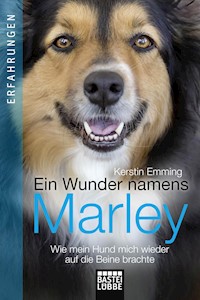
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kerstin ist eine Löwenmutter. Für ihre schwerbehinderte Tochter setzt sie Himmel und Hölle in Bewegung - bis sie selbst zusammenbricht. Gesundheitlich am Boden verliert sie fast die Hoffnung. Doch dann fällt ihr Blick auf eine Anzeige: "Australian-Shepherd-Mix abzugeben". Erst zögert Kerstin, die Verantwortung für einen Welpen auf sich zu nehmen, doch als sich das kleine Fellknäuel namens Marley gleich an sie schmiegt, weiß sie, dass sie zusammengehören. Dank seiner treuen Begleitung schöpft sie neue Kraft und Lebensfreude - und sie findet tatsächlich Heilung. Ein Wunder, sagen die Ärzte. Doch Kerstin weiß: Ihr Wunder heißt Marley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungVorwortKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Über dieses Buch
Nach einem Schlaganfall hat Kerstin alles verloren: den Job, ihre Ehe und ihre Gesundheit. An einen Rollstuhl gefesselt zieht sich von allem zurück – bis sie Marley trifft. Ein Bauer will den Welpen ertränken, doch Kerstin hat Mitleid und nimmt ihn zu sich. Für Marley wagt sie sich wieder ins Leben. Mit großer Geduld und seiner treuen Begleitung trainiert sie, bis sie wieder laufen kann und ihre Lebensfreude wiederfindet. Ein Wunder, sagen die Ärzte. Doch Kerstin weiß: Mein Wunder heißt Marley.
Über die Autorin
Kerstin Emming, 1965 in Recklinghausen geboren, ist gelernte Friseurin. Ihre mittlerweile erwachsene Tochter Angelina kommt mehrfach schwerstbehindert zur Welt. Die Ehe zerbricht an den Belastungen. Jahrelang kümmert sich Kerstin allein aufopferungsvoll um das Mädchen, bis sie zwei Schlaganfälle und ein Autounfall in den Rollstuhl zwingen. Kerstin droht sich aufzugeben, bis ihr ein kleiner Mischlingshund begegnet … Heute lebt Kerstin in der Nähe von Münster.
Kerstin Emming
mit Andrea Micus
Ein Wunder namens
Marley
Wie mein Hund mich wiederauf die Beine brachte
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Dr. Matthias Auer
Titelillustration: © Judy Davidson/Arcangel
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-8004-0
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Marley
Vorwort
»Sie sind austherapiert«, sagt mir der Arzt. Es ist der sechste in der vierten Klinik, und damit ist es endgültig: Man kann mir nicht mehr helfen!
Ich bin zweiundvierzig Jahre alt, seit drei Jahren auf den Rollstuhl angewiesen und weiß jetzt, dass es auch immer so bleiben wird. Ich werde nie mehr laufen, tanzen, joggen können. Meine ganzen Hoffnungen auf Normalität und ein endlich wieder schmerzfreies Leben zerplatzen mit diesem einen Satz. Es ist vorbei!
Als ich aus dem Sprechzimmer rolle, habe ich nicht mal mehr Tränen.
Hinter mir liegt so viel schicksalhaftes Leben, dass ich gelernt habe, damit zumindest äußerlich diszipliniert umzugehen. Vielleicht liegt es aber auch an dem gewaltigen Medikamentencocktail im Blut, der mich längst stumpf und teilnahmslos macht.
Ganz ohne Hoffnung erwarte ich nichts mehr vom Leben. Vor mir liegt ein Alltagstrauerspiel zwischen Klinik und Einsamkeit, Verzicht und Qual.
Zumindest denke ich das damals.
Doch das Schicksal lässt sich nicht festzurren. Es hält immer Überraschungen parat.
»Im Leben begegnen einem Wunder«, sagt mir wenig später mein Therapeut.
Anfangs ist das für mich nur eine Floskel. Doch dann tapst das Wunder direkt vor meine Füße.
Es hat Fell, vier Beine und dunkelbraune Kulleraugen, und es zeigt mir, dass im Leben auch das scheinbar Unmögliche möglich ist …
Kapitel 1
»In wenigen Minuten haben wir die endgültige Flughöhe erreicht. Wir servieren Ihnen dann warme und kalte Getränke und ein wohlschmeckendes Menü!«
Ich lehne mich entspannt in meinem Sitz zurück und schließe zufrieden die Augen. In zwei Stunden werden wir in der Türkei landen, und ich habe endlich Urlaub. Ich kann gar nicht aussprechen, wie sehr ich mich nach diesen Tagen des Nichtstuns sehne. Am Pool die Zeit vertrödeln, jeden Tag an einem elegant gedeckten Tisch sitzen, lecker zubereitete Köstlichkeiten genießen und einfach mal ohne Verpflichtungen leben. Ich habe das so bitter nötig!
Leise nimmt die Maschine Kurs Richtung Auszeit. Ich sehe aus dem Fenster und blinzle genüsslich in die Sonnenstrahlen. Unter mir liegt ein dichter Wolkenteppich. Ich werde in jeder Hinsicht die trüben Tage in Deutschland zurücklassen.
Mit der rechten Hand streichle ich meiner achtjährigen Tochter Angelina über die Wange.
Sie sitzt neben mir am Fensterplatz und fixiert die ganze Zeit über schon starr die Tragfläche des Flugzeuges. Auch meine Berührungen holen sie nicht aus ihren Gedanken. Was wohl in ihrem Kopf vor sich geht? Ich habe ihr erzählt, dass wir in die Ferien fliegen und bald am Meer sein werden. Aber richtig verstanden hat sie das nicht.
In der Reihe vor mir sitzt Rainer, mein Lebensgefährte, neben ihm Julian, mein vierzehnjähriger Sohn. Die beiden lösen gerade gemeinsam ein Kreuzworträtsel und sind in jede Menge Fragen vertieft. »Wie nennt man eine Frau, die bei einem Mann zu Gast ist?« Lösung mit elf Buchstaben. Damenbesuch. »Wie nennt man eine von der Kirche verehrte Frau?« Lösung mit sieben Buchstaben. Eine Heilige.
Ich höre den beiden gern zu. Sie verstehen sich blendend. Es ist also alles gut. Endlich. Ich kann mich in diese Stimmung fallen lassen und einfach wegnicken und träumen; von plätscherwarmem Meerwasser, raschelnden Palmwedeln und einer Sommerluft, die sanft meine Haut streichelt.
Rainer tätschelt durch zwei Rückenlehnen hindurch meinen Arm und holt mich aus meinen wunderschönen Gedanken.
»Hey, Schatz«, meint er lächelnd. Er hat sich im Sitz aufgerichtet und blinzelt mir über die Rücklehne hinweg zu. »Hier wird aber nicht eingeschlafen. Sonst verpasst du ja das leckere Essen!«
»Nein, nein«, ich schüttle den Kopf. »Das lasse ich mir nicht entgehen.«
Übermütig stupse ich ihm mit dem Zeigefinger an die Nase.
»Aber weißt du was, Liebling? Heute Abend sitzen wir schon auf der Hotelterrasse und lassen es uns richtig gut gehen. Ich sehe schon alles ganz genau vor mir. Das Meer rauscht, und wir genießen ein tolles Menü. Ich nehme Fisch und Salat, dazu einen trockenen Weißwein, als Dessert frische Früchte. Weißt du, ich liebe diese entspannten Abendessen. Darauf freue ich mich schon seit Wochen!«
»Und ich erst. Es ist unsere erste gemeinsame Reise«, meint Rainer leise, und seine Stimme klingt richtig liebevoll. »Ich bin so froh, dass wir das alles erleben, und gleich als richtige Familie.«
»Was möchten Sie trinken?« Die Stewardess steht neben mir, lächelt mich auffordernd an.
»Ich nehme zwei Wasser, für mich und meine Tochter!«
»Bitte, verzeihen Sie, ich verstehe Sie nicht! Was möchten Sie?«
»Wasser bitte!«, wiederhole ich und bin ganz irritiert, dass sie nachfragt.
»Du lallst ja«, meint Rainer, reckt seinen Kopf noch höher als bisher und sieht mich fragend an.
»Ich lalle?«, wiederhole ich genervt und sage jetzt schon zum dritten Mal, dass ich ein Wasser möchte.
»Bitte ein stilles, ja, ohne Kohlensäure. Und dazu gern ein paar Nüsse.«
»Kerstin!« Rainer steht plötzlich von seinem Sitz auf und macht einen großen Schritt über Julian hinweg auf den Gang.
»Kerstin!« Er ruft laut meinen Namen.
Warum schreit er denn bloß? Was ist los? Verdammt, jetzt schmerzt auch mein linker Arm auf einmal. Da ist so ein Ziehen. Was ist das denn? Das hatte ich noch nie. Mir wird schwiemelig im Kopf, und alles dreht sich. Das Wasser! Ich greife danach. Aber meine Güte, es fällt mir aus der Hand. Mir ist übel. Aus.
*
»Bleib ganz ruhig liegen. Wir sind bald wieder in Deutschland. Der Krankenwagen ist schon bestellt und wartet am Flughafen auf uns.«
Rainer küsst mich sanft auf die Stirn, streichelt mir liebevoll über den Arm.
»Es ist alles gut, meine Liebe. Mach dir bitte keine Sorgen!«
»Wo bin ich? Wieso … Deutschland?«, murmle ich leise und sehe mich irritiert um.
Ich liege mit angewinkelten Beinen auf drei Plätzen in der letzten Sitzreihe. Rainer hockt neben mir im Gang.
»Was ist passiert? … Wann sind wir da?«, frage ich jetzt.
»Wir landen gleich, aber wir dürfen nicht aussteigen!«
»Wie? Wir dürfen nicht aussteigen? Wir fliegen direkt zurück nach Deutschland? Wieso? Wir wollen doch in die Türkei!« Ich habe große Mühe zu sprechen und nuschle furchtbar.
»Ein zufällig anwesender Arzt hat dir etwas gespritzt. Er meint, es sei nötig, dass du zurück nach Deutschland fliegst.«
»Aber was ist denn … mit mir?«
»Der Arzt tippt auf einen Schlaganfall und meint, du würdest eine intensive Betreuung brauchen. Aber es wird alles gut. Ganz sicher!«
»Die Kinder? Wo sind sie?« Ich versuche, den Kopf nach oben zu recken, um die beiden sehen zu können. »Wie geht es Angelina?«
»Es ist alles gut, Liebling. Komm, leg dich wieder hin. Hier, ich schiebe dir das Kissen unter den Kopf. Das ist bequemer.«
Ich lasse meinen Kopf zurück auf das Kissen sinken, versuche, tief durchzuatmen. Es ist alles so seltsam unwirklich. Ich komme mir vor wie eine Zuschauerin, die einen Film sieht und die Handlung nicht versteht. Mein Körper, mein Kopf, nichts geht mehr richtig, und der Arm schmerzt mittlerweile fürchterlich.
»Einen Schlaganfall? Wieso habe ich einen Schlaganfall? Rainer? Das kann doch … nicht sein. Vielleicht täuscht sich der Arzt …«
Rainer lächelt.
»Ja klar, das kann auch so sein. Wir warten jetzt erst einmal ab, was die Ärzte in der Klinik sagen. Schlaf ein bisschen. Du brauchst Ruhe.«
»Nimmst du … die Kinder mit nach Hause? Wenn ich … in der Klinik bleiben muss?«
»Ja klar, ich habe doch Urlaub. Mach dir nicht so viele Gedanken. Glaube mir, wir bekommen das alles hin. Du denkst jetzt erst einmal nur an dich, und ich kümmere mich um den Rest.«
Ich lächle. Ich bin so froh, dass er da ist. Aber die Enttäuschung bohrt tief in mein Herz. Ich soll einen Schlaganfall gehabt haben. Das glaube ich nicht.
Ich bin neununddreißig Jahre alt und kerngesund. Das wird sich alles als riesengroßer Irrtum entpuppen. Da bin ich mir sicher. Der Arzt an Bord wird sich getäuscht haben. Na bravo, mit dieser Fehldiagnose hat er mir, ach was, uns allen die wunderbare Reise verdorben.
Vor meinen Augen tauchen wieder die herrlichen Strandbilder auf. Ich habe mich so sehr auf meinen Urlaub gefreut, und jetzt ist alles vorbei. Wer weiß, wann ich jemals wieder in den Süden fliegen kann.
Hoffentlich springt wenigstens die Reiserücktrittsversicherung ein, damit nicht auch noch das ganze Geld futsch ist.
»In wenigen Minuten beginnen wir mit dem Landeanflug auf Antalya …« Na super, für mich ist es nur ein Zwischenstopp.
Ich bin so tief enttäuscht und spüre, dass mir Tränen über die Wangen kullern. Klinik statt Strand. Das ist richtig bitter. Aber ich fühle mich so schwach …
*
»Frau Emming, der Verdacht hat sich bestätigt: Sie haben einen linksseitigen Schlaganfall gehabt. Wie es sich darstellt, verdanken Sie dem Mediziner an Bord wohl Ihr Leben. Er hat Sie in der Situation bestens versorgt.«
Ich liege im Klinikbett und höre die Sätze wie durch einen Wattebausch. Da bin ich nun gelandet. Kerstin Emming, klein, superschlank, mit kurzen blonden Haaren, aber durchtrainiert mit jeder Muskelfaser.
Ich trage gern Jeans und Sweatshirt, aber auch Pumps und Minirock. Ich schminke mich immer und liebe lackierte Fingernägel. Ich fühle mich zwar oft überanstrengt, ausgepowert und müde, aber trotzdem noch fröhlich und lebendig.
Schlaganfall! Leben gerettet. Glück gehabt. Die Worte schwirren in meinem Kopf herum. Ich bin doch noch zu jung dafür. Geht es jetzt schon um Leben und Tod?
»Sie werden eine Zeit lang bei uns bleiben. Im Anschluss besorgen wir Ihnen einen Platz für entsprechende Rehamaßnahmen.«
Jetzt bin ich plötzlich hellwach.
»Rehamaßnahmen? Nein, das geht nicht«, entfährt es mir sofort. »Ich habe … zwei Kinder, die versorgt werden müssen. Eines davon ist … krank. Ich muss so schnell wie möglich nach Hause.«
Jeder meiner Sätze kommt undeutlich und stammelnd heraus.
Der Mediziner, ein älterer, grauhaariger Mann mit einer dunklen, kreisrunden Hornbrille und einem bei jedem Satz lustig wippenden Schnurrbart, sieht mich skeptisch an.
»Ich glaube, Sie müssen erst einmal gesund werden. Und das braucht seine Zeit. Also, entspannen Sie sich. Alles andere machen wir.«
»Herr Doktor, Sie verstehen nicht!«, versuche ich es weiter und gebe mir wirklich große Mühe, verständliche Sätze zu formulieren.
»Das geht nicht mit der Reha … und ich kann auch nicht hierbleiben. Ich habe eine kranke Tochter, die mich … wirklich braucht.«
Der Arzt legt mir beruhigend die Hand auf den Arm. Aber ich nehme das kaum wahr.
»Was glauben Sie denn, wann ich entlassen werde?«, hasple ich weiter.
»Frau Emming, ruhen Sie sich aus, bitte. Glauben Sie mir, es ist das Beste, was Sie jetzt für Ihre Tochter tun können.«
Ausruhen! Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal konnte. Die Menschen sagen das immer so leicht dahin. Aber es gibt Lebenszuschnitte, in denen für dieses Wort gar kein Platz ist.
»Sie sind bei uns in den allerbesten Händen«, höre ich den Mediziner weitersprechen. »Denken Sie jetzt einfach mal an sich. Lassen Sie sich verwöhnen.«
Er zwinkert mir aufmunternd zu, lächelt.
Ich soll an mich denken? Wie denn? Ich habe Verantwortung. Es geht schon lange nicht mehr um mich. Vielleicht war das ein Fehler, und ich hätte früher auf Signale hören müssen. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt liege ich im Klinikbett und kann mich kaum mehr rühren.
Als der Arzt das Zimmer verlässt, versuche ich, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Ich greife vorsichtig mit der rechten Hand nach einer Tasse Kamillentee, nippe behutsam daran, und in meinem Kopf läuft mein Leben wie im Zeitraffer ab.
Eigentlich fing es richtig schön an. Ich bin auf einem Bauernhof im Ruhrgebiet aufgewachsen, zusammen mit meiner ein Jahr jüngeren Schwester Silvia. Wir besaßen jede Menge Tiere. Aber mein absoluter Liebling war Schäferhündin Dora, mit der ich stundenlang herumtollen konnte. Ich habe sie von ganzem Herzen geliebt, sie gefüttert und gekämmt und sie so oft wie möglich um mich gehabt.
Damals habe ich jedem gesagt: »Ich werde Tierärztin, dann habe ich ganz viele Tiere, um die ich mich kümmern kann!« Mein Papa hat dann oft geschmunzelt, »das kannst du auch jetzt schon machen« gesagt und mir gleich die Harke in die Hand gedrückt, damit ich die Ställe ausmiste. Vielleicht wollte er mir damit die Flausen vertreiben. Aber das hat nicht geklappt, denn auch das habe ich eigentlich gern gemacht.
Ich war einfach glücklich, wenn ich bei meinen Tieren sein konnte. Sie waren mein Leben.
Doch es wurde trotzdem nichts mit meinem Traumberuf. Nach der Mittleren Reife meinten meine Eltern, ich solle etwas Praktisches lernen. Also wurde ich Friseurin, hatte auch Spaß an meinem Beruf und arbeitete mich schließlich bis zur Leiterin in einem Salon in Gelsenkirchen hoch.
»Niemand schneidet die Haare so klasse wie Sie«, sagte eines Tages ein junger Bergmann zu mir. Ich war total stolz, und als er mich mit frisch geschnittenen Haaren zum Pizzaessen einlud, habe ich auch sofort »Ja« gesagt. Nach diesem Kompliment fühlte ich mich nahezu verpflichtet, sein Angebot anzunehmen.
Es blieb dann nicht bei der Pizza. Ich habe mich in Andreas sofort verliebt. Sechs Monate später stand ich schon mit ihm im Standesamt.
»Das geht nicht gut«, raunzte mir meine Mutter noch drei Minuten vor der feierlichen Zeremonie leise ins Ohr. Sie war unsere Trauzeugin und fand ihn »nicht passend«. Doch ich wollte davon nichts wissen. Wie alle Töchter mochte ich nicht auf meine Mutter hören.
Ich war einundzwanzig Jahre alt, fand mich ungeheuer erwachsen und wollte partout selbstständig sein – und was meine Mutter meinte, ja, das war mir schlichtweg »egal«, nein, mehr noch, es durfte auf keinen Fall stimmen.
Vier Jahre später kam unser Sohn Julian auf die Welt. Damals hatte ich schon eine Ahnung, dass meine Mutter mit ihrer Einschätzung nicht wirklich danebenlag. Denn Andreas trank gern. Wie viel genau, bekam ich nicht mit. Ich glaube, er trank heimlich. Auf jeden Fall war es genug, damit unsere Ehe ins Aus trudelte. Denn mit jedem Schnaps, den er intus hatte, wurde er aggressiver.
Zwei Jahre nach Julians Geburt hatte ich keine Lust mehr auf einen betrunkenen und unkontrollierten Mann. Ich zog die Notbremse! Nach einer handfesten Auseinandersetzung suchte ich mit Julian das Weite.
Jetzt war ich eine alleinerziehende Mama und zwar erleichtert, dass ich den Stress mit Andreas los war, aber auch überrascht, dass mein neues Leben zwischen Kind und Job so anstrengend wurde …
Ich hatte damals keine Ahnung, dass es noch viel anstrengender weitergehen würde.
»Hallo, Frau Emming, ich muss Sie kurz wecken. Aber es ist Zeit für Ihre Tabletten.«
Schwester Inge steht vor meinem Bett und holt mich lächelnd ganz sanft zurück in die Gegenwart.
»Sie haben mich nicht geweckt«, entgegne ich ihr. »Ich lasse nur … meine Gedanken schweifen. Wenn man viel Zeit hat, schwirren einem viele Dinge … kunterbunt durch den Kopf. Hier komme ich mal dazu, sie zu ordnen.«
Schwester Inge lacht.
»Das stimmt. Das erzählen mir viele Patienten.«
Während sie mein Tablettenschächtelchen auf dem Nachtschrank mit neuen bunten Pillen auffüllt, plaudert sie offen weiter.
»Das würde mir auch mal ganz guttun, einfach mal über alles nachzudenken und Dinge neu zu ordnen. Aber in meinem Alltag bleibt dazu keine Zeit. Doch Sie dürfen das jetzt. Sie haben zwar keinen schönen Anlass, machen aber wenigstens das Beste daraus.«
Sie streichelt mir aufmunternd über den Arm.
»So, ich bin weg, Sie können weiter träumen und sortieren. Viel Erfolg!«
»Ach, wissen Sie, es sind nicht nur gute Gedanken, die einen einholen. Meistens sind es die … beklemmenden.«
»Das stimmt«, sagt Schwester Inge im Hinausgehen und dreht sich an der Tür noch einmal zu mir um. »Aber wissen Sie, die Krisen sind ja bewältigt. Sie haben es doch bis hierher geschafft.«
»Hoffentlich war es das jetzt«, seufze ich. »Denn so richtig erfolgreich ist mein Leben bislang nicht gelaufen. Immerhin habe ich mit knapp vierzig Jahren … einen Schlaganfall bekommen.«
Schwester Inge lächelt milde und macht wieder zwei Schritte zurück in mein Zimmer.
»Ja, oft geht dem aber etwas voraus. Mögen Sie darüber sprechen?«
Ich schüttle den Kopf. »Schon gut, Sie haben viel zu tun. Ich tauche mal wieder ab. Mal sehen, ob ich noch Antworten finde.«
Sie zwinkert mir aufmunternd zu und winkt mir, in der Tür stehend, noch einmal zu. Sie ist eine tolle Schwester!
Und ich surfe gedanklich weiter durch mein Leben, mache dort weiter, wo meine Ehe aufgehört hat. Ja, knapp sechs Jahre nach meiner Hochzeit war bereits alles erledigt. Ich lebte mit Julian in einer kleinen Wohnung in Gladbeck, hielt mich mit einem Halbtagsjob über Wasser und war insgesamt ziemlich enttäuscht vom Leben.
Ich dachte damals oft an den Satz meiner Mutter: »Das geht nicht gut.« Ich hätte auf sie hören sollen!
Doch das Zurückblicken half damals auch nichts mehr. Ich musste mich in meinem neuen Leben einrichten, und dabei unterstützte mich ausgerechnet meine Mutter, die mir zum Glück meinen ehelichen Fehltritt niemals vorhielt.
Allerdings wollte sie, dass ich nach einer recht quälenden Trennungszeit wieder mehr unter die Leute gehe. »Komm heute mal mit zum Kegeln«, hat sie mich gedrängt. Und welche Überraschung: An diesem Abend war auch der Sohn ihrer Freunde dabei. Er hieß Bernd, arbeitete erfolgreich als Industriemeister in einem großen Chemiekonzern und war, richtig, auf Partnersuche! Meine Mutter hatte ihn ganz offenbar für mich im Auge und mit seinen Eltern ein Komplott geschmiedet. Aber davon hatte ich keinen blassen Schimmer. Ich wollte eigentlich nur kegeln und tappte voll in Mamas sehr gut vorbereitete Falle.
Doch es fügte sich, denn Bernd gefiel mir ausnehmend gut. Er war fünf Jahre älter als ich und machte genau das, was ich mir bei Andreas immer gewünscht hatte. Er trank nicht, blieb abends immer zu Hause und arbeitete ansonsten fleißig in seinem Betrieb. Dazu war er liebevoll, geduldig, besonnen und sehr verantwortungsbewusst und trug mich auf Händen. Ein Traummann für jede Schwiegermutter und jetzt auch für mich.
Bernd und ich wurden schnell ein Paar, und als ich wieder rasch heiraten wollte, hatten meine Eltern dieses Mal keinerlei Bedenken. »Der passt klasse zu dir. Das ist jetzt für immer«, jubelte meine Mutter. Und mein Vater meinte: »Jetzt fährst du in den sicheren Hafen.«
Was dann kam, entspricht dem Bilderbuch. Wir heirateten im Mai und kauften sofort einen Bungalow. Damit wir das alles finanziell stemmen konnten, nahmen wir Bernds Eltern mit ins Boot. Wir beide zogen ins Erdgeschoss, die Eltern ins Souterrain.
»Dann haben wir auch jemanden für Julian, und du kannst weiter arbeiten«, sagte Bernd zufrieden und strahlte mich an. Es passte alles, und darüber hinaus setzte ich prompt die Pille ab und freute mich auf das Familienleben. Idylle pur!
Aber dieses Bilderbuchleben führten wir nicht lange. Denn es gab die berühmten Wermutstropfen. Zum einen klappte es nicht mit der ersehnten Schwangerschaft. Ich hatte eine Fehlgeburt im dritten Monat. Eines Morgens bekam ich Blutungen und schlimme Krämpfe. Später erklärte mir der Frauenarzt, dass ich mein Baby verloren hätte. Ich litt unendlich darunter und wurde danach nicht wieder schwanger, was uns beiden zusetzte.
Dazu kamen Probleme mit meiner Schwiegermutter, die zwar vom ersten Tag an liebevoll mit mir und Julian umging, sich aber in alles einmischte und mir ständig zu verstehen gab, dass ich ihren Sohn nicht so behandelte, wie es ihm guttäte.
Berni, so nannte sie ihn, konnte eigentlich nichts allein und brauchte für alles Mamas Hilfe. Und da es jetzt mich gab, hatte ich in ihre Fußstapfen zu treten. Ich sollte »Berni« morgens in der Frühe seine Kleidung herauslegen, ihm zu bestimmten Tageszeiten bestimmte Dinge servieren und durfte ihn auf keinen Fall mit irgendwelchen Aufgaben im Haushalt belästigen. Nicht mal mit der Gartenarbeit durfte er behelligt werden. »Berni muss ja so viel arbeiten«, war ihr Lieblingssatz, mit dem sie mich zu jeder Tageszeit aufforderte, alles allein zu machen und ihn auf keinen Fall für irgendetwas einzuspannen.
Ich betreute also Julian, machte den Haushalt, den Garten, kochte, kaufte ein und war, natürlich, immer bestens gelaunt. Denn auch das brauchte Berni.
»Er mag fröhliche Menschen«, sagte meine Schwiegermutter immer, und ich bemühte mich, auch das richtig zu machen und immer zu lächeln, damit Berni sich wohlfühlte.
Als ich nach einem Jahr endlich hörte: »Gratuliere, Sie sind schwanger«, hoffte ich, dass wir damit ein anderes Thema hätten und sich nicht mehr alles nur um Bernis Wohlbefinden drehte.
Das war auch so. Die ganze Familie freute sich riesig, und Bernd war noch zauberhafter zu mir. Er war super lieb, ließ mich nur noch widerwillig zur Arbeit gehen, damit mir ja nichts passierte, und freute sich auf nichts in dieser Welt mehr als auf unser Baby.
Doch die Schwangerschaft verlief nicht komplikationslos. Ich bekam plötzlich, ähnlich wie beim ersten Mal, erneut starke Schmerzen. Zum Glück dieses Mal aber erst in der 21. Schwangerschaftswoche. Ich reagierte total aufgelöst, und man schickte mich vorsichtshalber sofort ins Krankenhaus und verordnete mir Bettruhe. Ich hatte furchtbare Angst, noch einmal ein Kind zu verlieren, und war froh, unter medizinischer Aufsicht zu stehen.
Bernd kam jeden Tag nach der Arbeit zu mir und versuchte, mir die Zeit zu vertreiben.
»Dieses Mal geht nichts schief. Das spüre ich«, sagte er mir immer wieder und machte mir damit Mut. »Wir werden ein wunderschönes Kind bekommen. Halte nur noch etwas durch.«
Ich hielt durch, bis ich eines Morgens einen ziehenden Schmerz verspürte und danach mein Bett komplett nass war. Ich wusste, was das bedeutete: Die Fruchtblase war geplatzt, vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin.
Panisch drückte ich den Alarmknopf. Innerhalb weniger Momente standen zwei Schwestern im Zimmer. Danach ging alles ganz schnell. Eine Ärztin kam angerannt. Man schob mich in den Kreißsaal. Ich weinte und hatte furchtbare Angst, wieder eine Katastrophe zu erleben und mein Baby zu verlieren. Ich kam sofort an den Wehentropf, und wenig später kam auch Bernd angehetzt: Man hatte ihn aus der Firma geholt.
Die kommenden Stunden waren ein Desaster. Denn ich bekam partout keine Wehen.
»Sie müssen sich bewegen«, meinte die Ärztin und ließ mich an Bernds Arm die Kliniktreppen rauf- und runterlaufen. Aber trotz der Anstrengung passierte nichts.
Als ich danach an den Wehenschreiber angeschlossen wurde, bemerkte ich genau, dass Unruhe aufkam.
Im Kreißsaal überschlugen sich die Ereignisse. Ich bekam mit, dass alle heillos überfordert wirkten. Es war ein Sonntag, das medizinische Team reduziert, und mit mir mussten drei weitere Frauen entbinden.
»Das Baby hat schwache Herztöne«, informierte mich die Ärztin schließlich knapp.
»Machen Sie doch einen Kaiserschnitt«, flehte ich sie fast schon an. Doch sie schüttelte den Kopf. »Wir versuchen es erst auf dem natürlichen Weg!« Ein Satz, und schon war sie wieder weg. »Aber …«, wollte ich gerade noch herauspressen, als Bernd meine Hand drückte und leise »pssst« zischte. »Lass mal, die Ärzte wissen schon, was zu tun ist.«
Ich war mir da schon längst nicht mehr sicher, wollte aber auch kein Theater machen. Vermutlich brauchte sie eine der anderen Frauen einfach dringender. Doch ich fühlte mich alleingelassen mit meiner riesengroßen Angst, und in meinem Kopf spann ich mir voller Misstrauen alles Mögliche zusammen.
Aber Bernd beruhigte mich. »Es sind genug Fachleute hier«, meinte er. »Du bist in besten Händen. Du musst auch Vertrauen haben.«
Vertrauen, genau das wollte ich so gern, aber das ganze Durcheinander machte es mir nicht leicht.
Der Schmerz, der mich wenig später fast zu zerreißen drohte, schnürte mir die Luft ab. Einen Moment lang dachte ich, ich würde sterben.
Ich hatte bereits ein Kind. Auch Julian war auf natürliche Weise auf die Welt gekommen, und auch bei ihm hatte ich Schmerzen gehabt. Aber das hier war etwas anderes. Es war einfach nur brutal.
»Was ist bloß los mit meinem Baby«, jammerte ich kläglich, weil ich nicht mehr wusste, wie ich die Quälerei aushalten sollte.
Bernd hielt mich fest und hatte die ganze Zeit Tränen in den Augen. Er fühlte so sehr mit mir.
Als der Schmerz endlich nachließ, hatte ich aber auch Hoffnung, dass sich mein Kind jetzt endlich auf den Weg machte.
Ich freute mich zu früh. Bis mein Baby auf die Welt kam, verging noch viel Zeit. Zeit voller Schmerzen, ausgefüllt mit meinen Schreien und meiner Stöhnerei und mit Bernds zärtlichen und beruhigenden Sätzen. Er streichelte mich unentwegt, schob mir das Haar aus der schweißnassen Stirn und sagte mir immer wieder, wie sehr er mich und das Baby liebe.
Die ganze Zeit wuselte das Klinikpersonal hektisch um mich herum. Aber ich war viel zu erschöpft, um irgendetwas zu beobachten oder gar einschätzen zu können. Ich wollte nur, dass dieses ganze Drama ein Ende hatte.
Doch erst nach einem brutalen Schmerzkrampf, der alles bisher Dagewesene noch einmal toppte, war es so weit: Unser Baby kam auf die Welt.
Augenblicke später legte man mir endlich mein Kind in den Arm. Sechsunddreißig Stunden nachdem ich von meinem Bett aus den Alarmknopf gedrückt hatte.
Ich war maßlos erschöpft und wollte am liebsten nur noch wegnicken. Aber ich hielt mein kleines Mädchen im Arm, wollte das winzige Wesen an mich drücken, streicheln und küssen. Sie war ganz klein und süß, mit zartem, weißen Flaum.
Aber was war mit dem Gesicht? Trotz meiner tiefen Erschöpfung war ich plötzlich wieder alarmiert. Der Kopf sah merkwürdig blau aus.
Der Arzt, der gerade nach mir sah, schien meine Gedanken zu lesen.
»Das kommt bei so einer langen Geburt schon mal vor«, beruhigte er mich und nahm mir mein kleines Mädchen gleich wieder ab. Sie war so zart, dass sie dringend noch einige Zeit in den Brutkasten musste. Die blaue Gesichtsfarbe, die vergaß ich sofort wieder. Sie hatte ja anscheinend keine Bedeutung.
Lächelnd sah ich dem Arzt nach, der mit meinem Kind im Arm verschwand. Ich war wieder sorglos.
»Ich bin dir so dankbar. Du hast das toll gemacht«, hauchte mir Bernd ins Ohr. Er küsste mich auf die Stirn.
Ich war glücklich und schlief selig ein. Mein Leben, jetzt war es wirklich ein Traum.
*
Angelina, so tauften wir unsere Kleine, war das liebste Kind der Welt. Sie schrie nie, schlief viel, und wenn sie ihre kleinen Äuglein aufschlug, sah sie mich immer nur ganz still an.
Julian war völlig anders gewesen. Er war ein unruhiges und lautes Kind und hatte mich anfangs mächtig auf Trab gehalten. Angelina dagegen bemerkte man kaum. Sie war so verschlafen, dass ich morgens ganz in Ruhe Julian fertig machen konnte und erst danach die Kleine aus dem Bett holen musste.
»Euer Kind meint es gut mit euch«, meinte Bernds Mutter schon nach wenigen Tagen. »Man merkt die Kleine ja kaum. So ein ruhiges Kind habe ich noch nie erlebt.«
»Ja, aber warte mal ab. Das wird sich noch ändern«, entgegnete ich damals.
Doch es änderte sich nicht. Angelina blieb ungewöhnlich ruhig, viel zu ruhig. Besonders fiel mir das auf, als sie ihre Impfungen bekam.
Als ich mit ihr im Arm auf den Arzt wartete, hörte ich das jammervolle Schreien eines anderen Babys, das vor uns an der Reihe war, und bereitete mich innerlich schon auf einen mächtigen Schreianfall vor. Aber Angelina bekam die Spritze und machte keinen Mucks dabei.
»Das ist aber ein geduldiges, liebes kleines Mädchen. Ich wünschte, es gäbe mehr solche Patienten«, meinte der Kinderarzt, und meine winzige Prinzessin lag da, so leise und ruhig, dass es fast schon unwirklich war.
Mir ging damals in dieser Situation zum ersten Mal die Fantasie durch: Hatte sie nur ein besonders stilles und ruhiges Naturell? Oder fehlte ihr etwas?
»Von mir hat sie das nicht, Herr Doktor«, sagte ich leise und wollte mich mit dem albernen Satz selbst von meinen ernsten Gedanken ablenken.
Der Kinderarzt ahnte, was in mir vorging.
»Machen Sie sich mal keine Sorgen, Frau Emming. Sie werden sich später noch manches Mal gern an diese ruhigen Zeiten erinnern. Ihre Tochter wird Ihnen schon bald richtig Dampf machen. Genießen Sie noch die Zeit, in der sie so ausgeglichen und zufrieden ist wie jetzt.«
Ich lächelte, streichelte meinem kleinen Mädchen über die Wangen und freute mich riesig über diese Einschätzung.
Und der Arzt machte gleich weiter.
»Wissen Sie, Kinder entwickeln sich nicht alle gleich schnell. Angelina ist eine Frühgeburt und ein bisschen entwicklungsverzögert. Aber das gibt sich. Bleiben Sie einfach geduldig. Sie holt das noch auf.«
»Ich möchte das gern glauben, Herr Doktor«, entgegnete ich dankbar. Und doch grummelte die Unsicherheit weiter in mir, und ich ließ deshalb auch nicht locker.
»Aber sehen Sie mal, die Hände. Die bewegt sie kaum. Das macht mich manchmal unruhig.«
Der Arzt ergriff jetzt vorsichtig ihre kleinen Fingerchen, drehte langsam das Handgelenk hin und her. »Ich sehe nichts Auffälliges. Aber kommen Sie auf jeden Fall zur nächsten Untersuchung. Ich möchte mir das dann noch einmal ansehen.«
»Sie krabbelt auch nicht«, hakte ich weiter nach. »Herr Doktor, das ist doch nicht normal.«
»Doch, doch«, versuchte mich der Mediziner erneut zu beruhigen. »Kinder entwickeln sich ganz unterschiedlich, oft auch in Schüben. Seien Sie unbesorgt.«
Als ich Angelina wenig später anzog, ging es mir trotzdem nicht gut. Ich hatte Zweifel, ob mein Kind gesund war. Aber ich hatte auch Zweifel an meiner Einschätzung.
»Du witterst überall Katastrophen«, hatte mir mein Vater früher öfter gesagt. Vermutlich war das immer noch so. Ich musste mir das endlich abgewöhnen …
»Hör auf, dir immer so viel Gedanken zu machen«, meinte auch Bernd später zu. »Mit Kindern muss man positiv denken!«, war sein Rat. Es stimmte ja. Ich musste aufhören, mich in schlimme Stimmungen hineinzusteigern, stattdessen positiv denken und zuversichtlich sein.
Liebevoll summte ich Angelina in den nächsten Wochen viele Male am Tag ihr Lieblingslied vor: »Alle Vögel sind schon da.« Das mochte sie immer ganz besonders gern.
Zumindest glaubte ich das, obwohl sie sich nie dabei rührte. Sie war eben noch zu klein. Aber irgendwann würde sich das ändern, und sie würde mitsingen, ganz bestimmt.
Kapitel 2
Ihr ganzer kleiner Körper war tomatenrot, die Ärmchen und Beinchen zuckten beängstigend heftig, und ihre Augen waren so weit aufgerissen, dass es gespenstisch aussah. Der Blick war starr und leer, und mein kleines Mädchen röchelte und japste verzweifelt nach Luft. So laut, dass ich davon wach geworden war. Jetzt stand ich am Kinderbettchen und wusste, es ging um alles. Angsterfüllt nahm ich mein Kind hoch und rannte ins Schlafzimmer zurück.
»Bernd, Bernd, wach auf! Schnell, ruf den Krankenwagen, wir brauchen Hilfe.«
Bernd war sofort hellwach. Als er Angelina sah, war ihm klar, dass wir keine Zeit verlieren durften.
Er zog sich in Windeseile die nächstbesten Kleidungsstücke an, griff nach den Autoschlüsseln und nahm mir das Kind aus dem Arm. »Schnell«, rief er mir zu. »Mach dich fertig und komm.«
Wenige Minuten später rasten wir schon mit dem Auto zur Klinik. Ich hatte bereits die Notaufnahme verständigt. Als wir vorfuhren, war alles vorbereitet.
Zwei Ärzte nahmen uns Angelina sogleich ab und brachten sie in den Behandlungsraum. Bernd und ich saßen starr vor Schreck und Angst, eng aneinandergeschmiegt, auf zwei Stühlen vor der Eingangstür und hielten uns stumm an den Händen.





























