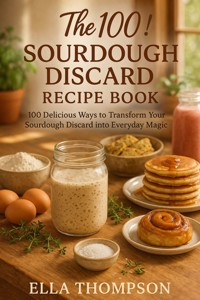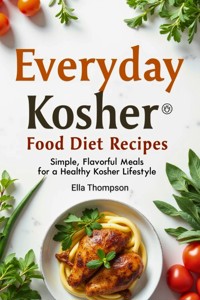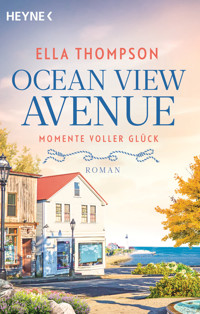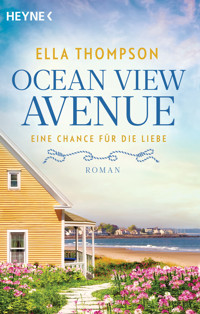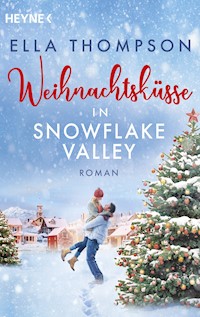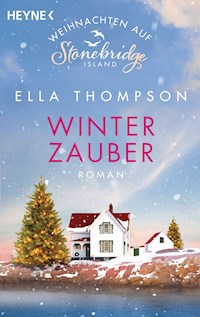9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Stonebridge-Saga
- Sprache: Deutsch
Aufwühlende Ereignisse und große Gefühle - der Auftakt der Stonebridge-Island-Reihe!
Abigail Cooper verabscheut Cameron Montgomery vom ersten Augenblick an, als er das Gestüt ihrer Familie betritt. Der reiche Erbe einer Hoteldynastie soll in den Silver Brook Stables auf Stonebridge Island Sozialstunden ableisten. Abigail, die zusammen mit ihren beiden Schwestern das Gestüt leitet und sich als Therapeutin für traumatisierte Kinder engagiert, hat weder Zeit noch Lust, sich um den neuen Mitarbeiter zu kümmern. Doch zu ihrer Überraschung ist Cameron nicht nur entsetzlich attraktiv, sondern auch noch ungemein charmant. Wenn da nur die Vorgeschichte nicht wäre, die ihn auf das Gestüt geführt hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Abbys Blick glitt an Camerons Halsmuskeln entlang, über seine breiten Schultern und blieb am Namen seiner Alma Mater auf dem Kapuzenpulli hängen. »Das ist das Problem mit euch Harvard-Absolventen. Ihr kennt harte, ehrliche Arbeit nur auf dem Papier.«
»Sagt die Möchtegernpferdeflüsterin.« Cameron beugte sich noch ein wenig weiter vor, und Abby musste sich zusammenreißen, um nicht einen einzigen Millimeter zurückzuweichen. »Diene ich deiner Belustigung? Du lässt mich diesen kompletten, riesigen Stall mit der Hand ausmisten. Aber gerade habe ich in diesem Stall dort drüben gesehen, wie das ein Typ mit einem Traktor macht.« Er wies mit dem Finger in Richtung ihres Seniorenheims, den Stall, in dem die alten Pferde ihren Lebensabend verbrachten.
Nun war es an Abby, sich ebenfalls ein wenig vorzubeugen. »Ich habe keinen Schimmer, was du hier überhaupt verloren hast.«
Die Autorin
Ella Thompson, geboren 1976, verbringt nach Möglichkeit jeden Sommer an der Ostküste der USA. Ihre persönlichen Lieblingsorte sind die malerischen New-England-Küstenstädtchen. An den endlosen Stränden von Maine genießt sie die Sonnenuntergänge über dem Atlantik – am liebsten mit einer Hundenase an ihrer Seite, die sich in den Wind reckt.
ELLA THOMPSON
EIN WUNSCH
in den Wellen
Stonebridge Island 1
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 06/2021
Copyright © 2021 by Ella Thompson. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Diana Mantel
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München, unter Verwendung von © Bigstock (CasoAlfonso); Shutterstock.com (kesipun, jack photo); iStockphoto (lucky-photographer)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-24579-5V001
www.heyne.de
Prolog
Das Knacken eines Holzstücks übertönte das Prasseln des Feuers. Eine orangerote Funkenfontäne stob in den schwarzen Nachthimmel hinauf, wurde von einem Windstoß durcheinandergewirbelt und verglühte irgendwo zwischen den dunklen Schatten der Pinien und dem unendlichen Sternenmeer.
Abby Cooper war ihr mit den Blicken gefolgt. Sie atmete die eisige, klare Luft ein und schloss für einen Moment die Augen. Das hier war Zuhause. Familie. So begrüßten die Coopers das neue Jahr, solange sie denken konnte. Hinter ihnen, auf der anderen Seite der Insel, in Home Port, wurde wie in jedem Jahr ein großes Feuerwerk gezündet. Das dumpfe Knallen der Raketen war bis hierher zu hören. Aber sie hatte nicht das Bedürfnis gehabt, in die Stadt zu fahren und sich das Spektakel anzusehen. Sie wollte an dem Ring aus Steinen hinter dem Ranchhaus stehen, in dem in jeder Neujahrsnacht ein großes Feuer loderte. Mit ihrer Mutter Olivia. Ihren Schwestern Summer und Megan. Zum ersten Mal seit ihrer frühesten Kindheit standen sie ohne ihren Vater Jack hier. Bei der Erinnerung an sein fröhliches, wettergegerbtes Gesicht und seine Jackentaschen, in denen sich immer ein paar Pferdeleckerli befanden, zog sich ihr Herz zusammen. Abby ließ den Schmerz zu, weil sie wusste, er würde irgendwann schwächer werden.
»Ich möchte euch etwas sagen.« Die ruhige, feste Stimme ihrer Mutter ließ Abby die Augen wieder öffnen. Sie alle standen in ihre dicken Daunenjacken gehüllt am Feuer. Hinter ihnen das Haus, das seit drei Generationen das Herz der Silver Brook Stables bildete. Vor ihnen fiel die Wiese erst sanft und dann steil ab. Hinter den Klippen breitete sich der Atlantik aus. Zerteilt von kleinen Inseln lag er ruhig da und warf das Licht des Vollmondes in die Nacht zurück.
Abby sah zu ihrer Mutter, genau wie ihre Schwestern, die ihr ebenfalls neugierig die Köpfe zuwandten. Olivia hatte ihre Mütze tief ins Gesicht gezogen und drehte ihr Champagnerglas in den Händen, die in dicken Fäustlingen steckten. »Ich habe eine Entscheidung getroffen«, fuhr sie fort. Ihre Augen waren seit Jacks Tod im Herbst ein Spiegel ihrer Trauer gewesen, und Abby hätte schwören können, diese Gefühle noch vor zwei oder drei Stunden gesehen zu haben. Doch jetzt leuchteten sie, als wäre sie dabei, sich in ein Abenteuer zu stürzen, das ihr Leben aus den Angeln heben würde. Und das ihrer Töchter gleich mit. Abbys Herzschlag beschleunigte sich. Was hatte sie vor?
»Ich habe beschlossen, mit Beginn dieses neuen Jahres die Leitung des Gestüts abzugeben.«
»Was?« Abby und ihre Schwestern sprachen gleichzeitig. Sie war sich sicher, dass in ihrem Blick die gleiche Fassungslosigkeit stand, die sie auf Summers und Megans Gesichtern erkennen konnte. »Aber … das kannst du nicht«, widersprach Abby automatisch. »Die Silver Brook Stables sind dein Leben.« Kaum hatte sie den Satz ausgesprochen, hätte sie sich am liebsten selbst eine Ohrfeige verpasst.
»Gut gemacht, Frau Doktor Psycho«, zischte Summer ihr zu und verdrehte die Augen.
Ihre Mutter senkte für einen Augenblick die Lider, und ein trauriges Lächeln schlich sich in ihre Mundwinkel. Dann blickte sie wieder auf und sah ihre Töchter der Reihe nach an. Ihre Augen glänzten, aber Abby wusste: Sie würde nicht weinen. Das würde sie sich für später aufheben. Wenn sie allein war. »Es war mein Leben, Abby-Schatz«, sagte sie leise. »Solange Jack an meiner Seite war. Jetzt soll es euer Leben werden. Verwirklicht eure Träume, so wie Jack und ich es getan haben.«
»Ach Mom.« Megan, die ihrer Mutter am nächsten stand, zog sie in eine lange, feste Umarmung.
»Hey.« Olivia lachte leise und löste sich schließlich aus der Umklammerung ihrer Tochter. »Ich bin trotzdem noch hier. Keine Angst, ich werde alles, was ihr tut, mit Argusaugen beobachten. Und euch jede Menge Ratschläge geben, auf die ihr keinen Wert legt.«
»Danke für das Vertrauen und die Chance«, sagte Summer schlicht und hob ihr Glas. »Wir können es kaum erwarten, uns deine unerwünschten Tipps anzuhören.«
»Eine Sache wäre da noch.« Olivia blickte in die Bucht hinunter, die aussah wie ein zwei Meilen langer, perfekt geformter Halbmond. »Ich habe Benedict Morgan die Halfmoon Bay abgekauft. Sie gehört jetzt euch. Frohes neues Jahr. Möge es besser werden als das, das wir hinter uns zurücklassen.« Sie hob ihr Champagnerglas und stieß der Reihe nach mit ihnen an. Zwischen den Lichtreflexen und Schatten, die das Neujahrsfeuer auf das Gesicht ihrer Mutter malte, konnte Abby die Zuversicht sehen. Die Gewissheit, die richtige Entscheidung für die Zukunft – und ihre Mädchen – getroffen zu haben. Auch wenn die Ankündigung mehr als überraschend gekommen war. Ihre Mutter war sonst nicht der Typ, der spontane Entschlüsse fasste und ihre Töchter vor vollendete Tatsachen stellte.
Aus Abbys Sicht warfen diese Entscheidungen Fragen auf. Fragen, die sie auch in den Augen ihrer Schwestern sah. Jede Menge Fragen. Denn die Morgans hatten die Halfmoon Bay seit Jahrzehnten wie einen Schatz gehütet. Hatten damit vor ihrer Nase herumgewedelt. Was brachte den Clan, mit dem ihre Familie seit einer Ewigkeit verfeindet war, dazu, ihnen plötzlich dieses wunderschöne Stück Land zu verkaufen? Ihre Schwestern kommentierten diesen merkwürdigen Verkauf und Olivias Entscheidung allerdings nicht weiter – sie waren wie üblich mit ganz anderem beschäftigt.
Summer beugte sich hinunter, um die beiden Hofhunde Henry und Nugget zu streicheln, die sich zu ihren Füßen niedergelassen hatten. Sie verstand die Tiere. Besonders Pferde und Hunde. Also war es kein Wunder, dass sich immer irgendein Vierbeiner in ihrer Nähe aufhielt.
Megan vollführte ein kleines Tänzchen. Zu einer Melodie, die nur in ihrem Kopf existierte. Abby wusste, was sie damit bezweckte. Es war ihre Art, jedem – und vor allem Olivia – zu zeigen, dass alles in Ordnung war. Abgesehen davon gehörte sie einfach nicht zu den Menschen, die stillhalten konnten. Oder schlechte Laune verbreiteten.
Abbys Schwestern hatten recht. Für all diese Fragen wäre auch später noch Zeit. Sie musste aufhören, ständig mental einen Schritt zurückzutreten und die Worte ihrer Mutter und Summers und Megans Reaktion darauf zu analysieren. »Frohes neues Jahr!«, stimmte sie in den Salut ihrer Familie ein. Die überraschenden Ankündigungen ihrer Mutter garantierten, dass es ein spannendes werden würde.
1
Abby atmete tief ein und schloss für einen Moment die Augen. Die Märzsonne schickte ihre ersten Strahlen vom blauen Himmel, ließ sie zart über ihr winterblasses Gesicht tasten. Der Wind hingegen, der ihr in die Wangen kniff, trug noch immer die Kälte des Winters in sich. Er riss an ihrer dicken Wollmütze und zerzauste die blonde Mähne ihrer Palomino-Stute Ebba. Das Pferd schnaubte leise, als sie an die Klippe traten. Unter ihnen brandete der Atlantik gegen die schwarzen Felsen, die den Naturgewalten seit Jahrtausenden trotzten. Weiter draußen durchschnitt das Boot eines Hummerfischers die glatte Oberfläche des Ozeans. Vielleicht Jacob Wilkinson und seine Crew auf dem Weg zu seinen Hummer-Fallen.
Abby zog ihren Schal ein Stück höher, um ihr Gesicht vor den eisigen Böen zu schützen, und blickte in die halbmondförmige Bucht hinunter, die jetzt ihrer Familie gehörte. Es juckte ihr in den Fingern, den schmalen Pfad hinunterzureiten und mit Ebba über den feinen, grauen Sand zu preschen. Aber dafür würde sie heute keine Zeit haben. Je länger sie hier draußen herumtrödelte, desto länger schob sie das Unvermeidliche auf. »Na komm, Süße«, sagte sie leise und wendete Ebba. Ein Stück trabten sie an der Klippe entlang, bevor sie auf den Pfad abbogen, der sie durch den Pinienhain führen würde. Abby hasste Abschiede, aber sie konnte sich nicht davor drücken, Gabriella Lebwohl zu sagen. Auch wenn sie schon jetzt einen Kloß im Hals hatte und ihre Assistentin – ehemalige Assistentin, verbesserte sie sich – heulen würde wie ein Schlosshund. Sie ließ Ebba in einen Galopp fallen und genoss die Geschwindigkeit, mit der die alten Bäume an ihr vorbeiglitten. An Stellen, die die Sonne noch nicht erreicht hatte, wurde das dunkle Moos von hartnäckigen Schneeresten bedeckt. Der Winter hatte den Nordosten Maines noch nicht aus seinen Klauen entlassen. Laut Wetterbericht würde er in den nächsten Tagen noch einmal zuschlagen – nichts Ungewöhnliches im März. Doch im Moment war der Waldboden weich, und das Trommeln von Ebbas Hufen klang leise. Abby mochte den Rhythmus, die Einheit, zu der ihr Pferd und sie verschmolzen. Sie liebte den Geruch nach feuchter Erde, Wald und Meer, der sie hier draußen im Frühling begleitete. Und den immer präsenten warmen Pferdeduft.
Abby musste nicht auf die Uhr sehen, um zu wissen, dass ihr die Zeit langsam davonlief. Sie musste zurückkehren. Gabriella wartete mit Sicherheit längst auf sie. Statt ihren Ausritt in Richtung Seal Rock Hall auszudehnen, entschied sie sich für den Weg an der Fohlenkoppel der Silver Brook Stables entlang und kehrte auf den Hof zurück. Sie ließ die knorrigen Nadelbäume hinter sich und Ebba wieder in Trab fallen. Eine Möwe schoss an ihr vorbei, segelte für einen Moment neben ihnen her und drehte dann wieder ab in Richtung Ozean. Als Abby den Hof erreichte, kam Josh Walsh aus dem Stutenstall. Er blieb stehen und sah ihr entgegen.
»Guten Morgen, Josh«, grüßte sie den Vorarbeiter, als sie Ebba neben ihm halten ließ.
»Morgen, Abby. Hallo, meine Schöne.« Er tätschelte Ebba zur Begrüßung den Hals und griff dann nach ihrem Zügel. »Du kannst sie mir überlassen«, bot er Abby an. »Gabriella wartet schon auf dich.«
Abby sah zu ihrer Praxis hinüber. Das kleine Holzhaus, das wie alle Ställe und Scheunen auf dem Hof dunkelrot gestrichen war, hatte früher als Wirtschaftsgebäude des Gestüts gedient. Beim Neubau des Hengststalles waren neue Wirtschaftsräume integriert worden. Ein paar Jahre hatte das Häuschen leer gestanden, ehe Abby ihrem Leben in Portland den Rücken gekehrt und hier einen Neustart gewagt hatte. Einen Neustart, bei dem Gabriella vom ersten Moment an dabei gewesen war.
Sie saß ab und strich Ebba über die Nase. »Danke«, sagte sie zu Josh und straffte die Schultern. Es machte keinen Sinn, das Unvermeidliche noch weiter hinauszuzögern. Die Tür der Praxis stand offen. Als Abby die beiden Stufen zu der kleinen Veranda hinaufstieg, drehte sich Gabriella zu ihr um und schniefte. Sie war dabei, ihre letzten Habseligkeiten in einen Karton zu packen, der auf dem kleinen Schreibtisch stand.
»Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich gehe«, sagte Gabriella mit zittriger Stimme. Die Freundin verzog den Mund und fuhr mit dem Handrücken über ihre Augen. Abbys dunkelbrauner Labrador Charlie trabte zu ihr hinüber und setzte sich neben sie, damit sie ihn streicheln konnte. Seine persönliche Version von ›den Abschiedsschmerz verringern‹. »Ich habe mir nie vorstellen können, jemals etwas anderes zu machen. Oder woanders zu leben.« Gabriella schluchzte laut, und Charlie rückte noch ein wenig näher an sie heran.
»Komm schon.« Abby bemühte sich um eine fröhliche Stimme, obwohl ihr der Abschied nicht weniger schwerfiel. Sie umarmte Gabriella, soweit das der dicke Bauch ihrer Freundin zuließ. »Jetzt beginnt ein neuer, wundervoller Lebensabschnitt. Aufregend und spannend.«
»Aber Boothbay ist so weit weg«, widersprach Gabriella. »Ich werde dich so vermissen. Ich werde alles hier vermissen. Dich auch, Charlie.« Sie beugte sich zu dem geduldigen Hund hinunter und kraulte ihn ausgiebig hinter den Ohren, wie er es liebte.
Abby legte ein rosa eingewickeltes Päckchen in den Karton. »Nicht aufmachen«, warnte sie, als ihre Freundin danach greifen wollte. »Das ist für Gabby Junior.« Sie hatte das süße Babyjäckchen im Gift Store in Home Port entdeckt. Es war von einer der Handarbeiterinnen aus Sandy Beach genäht worden. »Und für dich ist das.« Sie reichte Gabriella ein gerahmtes Foto, das sie beide zeigte. Zwischen ihnen stand Acapulco, das Therapiepferd, das Gabriella ausgebildet hatte. »Wenn die kleine Lady alt genug ist, kommt ihr uns besuchen. Dann bekommt sie ihre erste Reitstunde von mir.«
Bis zu diesem Moment hatte Gabriella sich noch irgendwie zusammengerissen, doch nun ließen sich die Tränen nicht mehr stoppen. Sie lachte und weinte gleichzeitig. Genau wie Abby war sie auf der Insel aufgewachsen. Nach ihrem Highschool-Abschluss hatte sie begonnen, für die Silver Brook Stables zu arbeiten. Sie liebte Pferde. Und sie hatte ein gutes Händchen im Umgang mit Menschen. Als Abby ihre Praxis vor zwei Jahren nach Stonebridge Island verlegt hatte, hatte Gabriella sich als Betreuerin für das therapeutische Reiten weitergebildet und war zu ihrer rechten Hand geworden. Sie waren ein tolles Team gewesen. Doch nun, im achten Monat schwanger, zog sie in die Nähe ihrer Schwiegereltern, ein paar Stunden die Küste hinunter. Ihr Mann hatte in seinem Heimatort als Hummerfischer Arbeit gefunden, und sie würde dessen Familie um sich haben. »Ich komme dich besuchen«, versprach Gabriella. Sie umarmte Abby noch einmal fest. »Ich hoffe, du findest einen guten Nachfolger für mich.«
»Wer soll dich schon würdig ersetzen?«, fragte Abby lächelnd.
»Niemand. Das ist doch klar.« Gabriella wischte sich mit einer entschlossenen Bewegung die Tränen von den Wangen und warf einen Blick auf ihre Uhr. »Ich gehe jetzt, bevor mich meine Hormone in einen echten Heulkrampf ausbrechen lassen.«
Sie griff nach dem Karton mit ihren Habseligkeiten, doch Abby schob ihre Hände sanft zur Seite. »Den nehme ich.« Sie trug ihn zum offen stehenden Kofferraum von Gabriellas kleinem SUV und stellte ihn neben die anderen Sachen, die dort bereits gestapelt waren. Ihre Reitstiefel. Ihr Sattel. Und ein paar Klamotten, die sich mit der Zeit in der Praxis und den Ställen angesammelt hatten.
Gabriella zog eine Dose Pferdeleckerli unter der Daunenweste mit dem Logo des Gestüts hervor, die sie im Winter oft getragen hatte. »Die sind für Acapulco. Der verfressene Kerl liebt die Dinger.« Sie umarmte Abby ein letztes Mal und kraulte Charlie unter dem Kinn, ehe sie sich mit ihrem Babybauch ungelenk hinter das Steuer klemmte und die Tür zuzog.
Abby winkte ihr nach, als sie langsam davontuckerte. Dann legte sie Charlie die Hand zwischen die Ohren. Der Hund sah voller Liebe zu ihr auf. »Dann sind wir nur noch zu zweit«, murmelte sie und blinzelte gegen das Brennen in ihren Augen an. Gabriella war ein Glücksgriff gewesen. Und eine große Stütze, als Abby ihre Arbeit in Portland aufgegeben hatte und auf die Insel zurückgekehrt war, auf der sie aufgewachsen war.
Abby hatte als Psychologin in einer Praxis gearbeitet, die sich auf Traumabewältigung und posttraumatische Belastungsstörungen spezialisiert hatte. Vor zwei Jahren hatte ein schrecklicher Moment ihre Welt aus den Angeln gehebelt und alles infrage gestellt, was sie die Lehrbücher und Vorlesungen gelehrt hatten. Ein Moment, der dazu geführt hatte, dass Abby ihren Job an den Nagel gehängt und beschlossen hatte, zu therapeutischem Reiten zu wechseln. Sie hatte eine Praxis auf dem Gestüt ihrer Familie eröffnet, und Gabriella hatte ihr von Anfang an viel Arbeit abgenommen. Sie musste wirklich schnell jemanden finden, der ihre Freundin wenigstens zum Teil ersetzen konnte. Auch wenn allein der Gedanke an die Veränderungen, die vor ihr lagen, ihren Puls beschleunigte. Sie mochte es nicht, die ausgetretenen Wege zu verlassen, die sie kannte. Denen sie mit geschlossenen Augen folgen konnte. Sich durch neues, unbekanntes Territorium zu tasten machte ihr mehr Angst, als sie irgendjemandem gegenüber zugeben würde. Ihre Schwestern und ihre Mutter waren nach Gabriellas Weggang für sie da. Sie würden ihr eine Zeit lang unter die Arme greifen. Aber in den nächsten Wochen begannen die Stuten zu fohlen, und auf dem Hof wurde jede Hand gebraucht.
Abby stellte ihren Fuß auf den untersten Querriegel des weißen Zauns der Stiefmütterchen-Koppel, die ihren Namen den kleinen lilafarbenen Blüten verdankte, die zu den ersten gehörten, die im Frühjahr ihre Köpfchen mutig durch die eisige Schneedecke steckten. Gabriella hielt vor dem Ranchhaus auf der anderen Seite des Hofes und rutschte aus dem Wagen, um sich auch vom Rest der Coopers zu verabschieden. Abbys Mutter, ihre Schwestern Summer und Megan traten aus dem Haus, begleitet von Rose Walsh, ihrer Haushälterin. Gabriella wurde umarmt und geherzt. Rose überreichte ihr einen abgedeckten Teller, auf dem sich garantiert der Lieblingskuchen ihrer Freundin befand. Abby war sich sicher, dass der Pecannut-Pie einen neuen Gefühlsausbruch herbeiführen und noch mehr Tränen fließen lassen würde. Sie stieß sich vom Zaun ab und drehte sich zu dem Stutenstall um, der schon immer so hieß, obwohl hier auch die Wallache untergebracht waren. »Komm, Charlie«, rief sie ihren Hund. In einer Viertelstunde kam ihr nächster Patient, für den sie Foxy satteln musste. Außerdem würde Acapulco sicher um eines der Leckerchen betteln, die Gabriella für ihn dagelassen hatte.
*
Das Licht pulsierte in einem nervtötenden Rhythmus um Cameron Montgomery herum. Es passte zum Dröhnen des Deep House Sounds, der auf seiner Haut vibrierte. Er konnte das Black Dreams eigentlich nicht ausstehen, egal wie angesagt der Club in Boston zurzeit war. Aber er hatte einen fantastisch gesicherten VIP-Bereich und war damit der perfekte Ort, um sich gepflegt zu betrinken. Denn genau das war sein Ziel für heute Nacht: Den Frust und die Enttäuschung runterzuspülen, die die Zugehörigkeit zum Montgomery-Clan mit sich brachte. Zu vergessen, wie sehr er sich die Anerkennung seines Vaters gewünscht hatte. Wie sauer ihn das geringschätzige Grinsen seines Bruders Jason gemacht hatte.
Cameron gehörte nicht zu den Menschen, die sich mit einer Flasche Scotch in ihr Schlafzimmer zurückzogen und dort in ihr Glas weinten. Sich zu betrinken war seiner Meinung nach nur halb so schlimm, wenn man es in Gesellschaft tat. Und Gesellschaft hatte er hier mehr als genug. Er hatte zwei der Promi-Jägerinnen, die es regelmäßig auf mysteriöse Weise in den abgesperrten Bereich schafften, eine Flasche Champagner ausgegeben. Eigentlich wollte er nichts von ihnen, aber so lief das im VIP-Bereich nun mal. Als drei Spieler der Patriots aufgetaucht waren, hatten ihn die Groupies auf der Stelle vergessen, was ihm mehr als recht war. Cameron leerte sein Glas und schenkte sich aus der geöffneten Whiskeyflasche auf seinem Tisch nach. Er versuchte, sich zu entspannen, lehnte sich in das kühle Leder der Couch zurück und nippte an dem Drink. Schon jetzt spürte er die leichte Taubheit, die sich von seinen Füßen aus über seinen Körper zog und den Grund für das Besäufnis und die Demütigung durch seine Familie langsam verblassen ließ. Zwei seiner Kumpels hatten ihm eine Zeit lang Gesellschaft geleistet, waren aber inzwischen in einen anderen Club weitergezogen. Vielleicht würde er das auch tun, wenn er mit diesem Glas Scotch fertig war.
Vielleicht auch nicht. »Scheiße!«, entfuhr es ihm, als sein Blick auf den Eingangsbereich der VIP-Lounge fiel. Das Glas auf halben Weg zum Mund starrte er Elayne Knox entgegen, die ihn offenbar längst entdeckt hatte und geradewegs auf ihn zusteuerte. Ihrem Gang nach zu urteilen hatte sie schon deutlich mehr Alkohol intus als er. Ihre Miene wirkte allerdings zutiefst entschlossen. Cameron kippte seinen Drink hinunter und stand auf. Höchste Zeit, die Flucht zu ergreifen.
»Cam, Schätzchen«, flötete Elayne, bevor er sich aus ihrer Reichweite retten konnte. »Was für ein Zufall, dich hier zu treffen.«
Zufall? Eher unwahrscheinlich. Die Verlobte seines Bruders Jason hatte früher nie etwas ohne Berechnung getan. Und das war mit Sicherheit auch zehn Jahre später nicht anders. Seit er ihr beim Montgomery-Familiendinner am vergangenen Sonntag zum ersten Mal seit einer Ewigkeit wieder über den Weg gelaufen war und sie sofort erkannt hatte, waren sie unausweichlich auf diesen Moment zugesteuert.
Er schaffte es nicht, ihr zu entkommen, weil sich ihre blutrot lackierten Fingernägel bereits in seinen Unterarm bohrten. »Elayne.« Pflichtschuldig küsste er sie auf die dargebotene Wange. »Schön, dich zu sehen«, log er und atmete ihren schweren, teuren Duft ein.
»Ist das so?« Elayne schenkte ihm ein strahlendes Lächeln. Sie war leicht genug zu durchschauen, um die Verärgerung hinter der schönen Fassade zu erkennen. Mit einer gekonnten Bewegung schwang sie ihr langes, blondes Haar über die Schulter und nahm auf der Couch Platz, von der Cameron sich gerade erhoben hatte. Die Hand immer noch um seinen Arm gekrallt zog sie ihn mit sich hinunter. »Ich freue mich auch, dich zu sehen. Wir sollten auf die alten Zeiten anstoßen. Champagner für mich«, wandte sie sich an den Kellner, der wie aus dem Nichts neben ihnen auftauchte. »Eine Flasche. Auf die Rechnung dieses Gentlemans.«
Cameron nickte ergeben, als der Kellner ihn fragend ansah. Schließlich hatte er den anderen beiden Frauen vorhin auch eine Flasche ausgegeben.
»Also«, forderte Elayne seine Aufmerksamkeit zurück. »Jason hat mir von den unschönen Geschichten erzählt, die du über mich verbreitest. Wobei ich es sehr beruhigend finde, dass er dir nicht glaubt. Wir lieben uns schließlich und vertrauen uns voll und ganz.« Sie rückte näher und legte ihre Hand vertraulich auf seinen Oberschenkel. »Menschen ändern sich, Cam. Ich bin nicht mehr die Zwanzigjährige, an die du dich erinnerst. Ich bin eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die sich in einen wundervollen Mann verliebt hat.« Sie senkte unschuldig die Wimpern und hob sie wieder, um ihn mit einem Blick anzusehen, der fast offen und ehrlich wirkte. Fast.
Cameron zog ihre Hand von seinem Bein und drückte sie auf die Sitzfläche der Couch. »Schlimm genug, wenn mein Bruder dir deine Tour abkauft. Ich werde das mit Sicherheit nicht tun.« Er ließ sich zu einem ironischen Lächeln herab. »Ich bin noch verabredet. Genieß deinen Champagner.« Dann wollte er aufstehen, doch sie lehnte ihren Oberkörper schwer gegen seinen. Ihre sanften Rundungen steckten in einem kurzen, mit Sicherheit sündhaft teuren Designerkleid mit ziemlich wenigen Stoffbahnen und jeder Menge schwarzer Spitze. Das selbstverständlich perfekt zu ihren meterhohen High Heels passte. Sie widerte ihn an. Und er war gerade nicht in der Stimmung, Small Talk mit ihr zu halten. Er war hier, um seinen Frust zu betäuben. Elaynes Auftauchen half nicht gerade, die in ihm brodelnde Wut zu dämpfen. Cameron sah sich vorsichtig um. Er wollte nicht mit der Verlobten seines Bruders gesehen werden. Zumindest nicht, solange sie sich so eng an ihn schmiegte.
»Ich will nicht, dass du gehst«, nuschelte Elayne, und erst jetzt wurde ihm bewusst, dass sie nicht nur ein bisschen betrunken war. Sie war sternhagelvoll.
Scheiße, ging es ihm zum zweiten Mal durch den Kopf, seit sie aufgetaucht war. Er konnte sie kaum so zugedröhnt hier zurücklassen. Resigniert stieß er einen schweren Seufzer aus und reichte dem Kellner, der den Champagner brachte, seine Kreditkarte. »Ich hätte gern die Rechnung«, sagte er. »Und du«, er schob Elayne ein Stück von sich, bis sie sich gegen die Couch lehnen konnte und ihre Körper sich nicht mehr berührten, »du bist völlig hinüber. Ich rufe dir ein Taxi, und wir sprechen miteinander, wenn du wieder nüchtern bist.«
Elayne grinste breit und griff in den tief sitzenden Ausschnitt ihres Kleides. »Ich bin in null Komma nichts wieder fit.« Sie zog ein kleines Papierbriefchen aus ihrem BH und wedelte damit vor Camerons Nase. »Willst du auch was?«
Geistesgegenwärtig griff er danach, riss es ihr aus der Hand und schob es in seine Hosentasche. Abermals sah er sich wachsam um. Niemand schien sich für sie zu interessieren. »Ehrlich, Elayne? Koks? Spinnst du jetzt völlig?«
»Hey!« Sie versuchte ihre Hand in seine Hosentasche zu schieben. »Seit wann bist du so unentspannt? Gib es mir zurück. Wenn du nichts davon willst, auch gut. Muss ich wenigstens nicht teilen.«
Cameron hielt sie mit der Linken davon ab, die Drogen wieder an sich zu nehmen, und unterschrieb mit der Rechten den Kreditkartenbeleg, den der Kellner ihm hinhielt. »Komm schon, wir gehen.« Er packte Elayne am Oberarm und zog sie hoch.
»Lassen Sie meinen Wagen kommen«, rief sie dem Kellner hinterher.
»Du brauchst deinen Wagen heute nicht. Ich rufe dir ein Taxi«, sagte Cameron.
Sie zog einen Schmollmund. »Du bist noch genauso ein Spielverderber, wie du es schon immer gewesen bist.«
»Halt die Klappe, Elayne«, fuhr Cameron sie an. Er hatte wirklich vorgehabt, sich ordentlich die Kante zu geben, und jetzt war er bereits wieder halb nüchtern, weil diese Frau ihn den letzten Nerv kostete. Cameron bugsierte sie durch den Club und die Treppe hinauf, in die kalte Frühlingsnacht.
*
Die kalte Bostoner Nacht traf sie wie eine Faust, als Elayne an Camerons Seite aus dem Club trat. Ihrer heimlichen Freude konnte der eisige Wind allerdings nichts anhaben. Sie musste sich regelrecht auf die Zunge beißen, um nicht laut zu lachen. Der ach so kluge Cameron Montgomery war ihr in die Falle gegangen, während er dachte, er hätte alles im Griff. Aber genau das war schon immer sein Problem gewesen. Gemeinsam mit der Arroganz, mit der er seine Defizite kompensierte. Das Schicksal des unbegabten Zweitgeborenen. Als Elayne vor ein paar Monaten seinen Bruder Jason kennengelernt hatte, war ihr klar gewesen, dass sie Cameron irgendwann über den Weg laufen würde. Sie hatte gehofft, dass bis dahin noch viel Zeit vergehen würde. Zum Beispiel bis kurz vor der Hochzeit, wenn niemand mehr bereit war, dieses riesige Event abzublasen. Bestenfalls, nachdem sie Jasons Frau geworden war.
Doch dann hatten Robert und Kathreen, die Eltern ihres Verlobten, Cameron von seinem Job in North Carolina abgezogen, und sie hatte ihn beim Familiendinner am vergangenen Sonntag zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wiedergetroffen. Für einen Moment hatte sie gehofft, er würde sie nicht erkennen. Sie hatte sich verändert. Hatte dazugelernt. Ein Blick in Camerons Gesicht hatte allerdings genügt, um zu wissen, dass er ganz genau wusste, wer sie war. Und natürlich hatte er noch am gleichen Tag versucht, Jason davon zu überzeugen, sie vor die Tür zu setzen.
Elayne hatte wirklich gehofft, dass es nicht notwendig werden würde, Cameron auszubremsen, aber sie war darauf vorbereitet gewesen. Sie würde sich von ihm nicht die Chance ihres Lebens vermasseln lassen. Viel zu viel Energie und Arbeit steckten inzwischen in diesem Projekt. Sie würde die Frau von Jason Montgomery werden. Dem Mann, der seinen Vater über kurz oder lang an der Spitze der Suites by Montgomery – einer der luxuriösesten Hotelketten der Welt – ablösen würde. Sicher, die meisten Frauen waren hinter Cameron her, der zu den heißesten Junggesellen der Bostoner High Society zählte. Aber zum einen kannte Cameron ihre Vergangenheit und würde sich allein deshalb nie auf sie einlassen. Zum anderen war Jason vielleicht nicht so attraktiv wie sein jüngerer Bruder, sein Portfolio machte das allerdings mehr als wett.
Elayne lehnte sich schwer gegen Cameron und ließ sich von ihm durch die kalte Nacht führen. Er war ein Gewohnheitstier, und darum war er natürlich sauer gewesen, weil sein Vater und sein Bruder sein Hotelprojekt abgelehnt hatten. Und wenn Cameron sauer war, ertränkte er seinen Ärger in einer Flasche Scotch. Natürlich nicht in der Kneipe nebenan – ein bisschen exklusiver musste es schon sein. Es war also nicht schwer für sie gewesen, ihn im Black Dreams ausfindig zu machen und ihren Plan ins Rollen zu bringen. Cameron hielt sie entweder für volltrunken oder zugedröhnt. Dabei hatte sie das Kokain nur in den Club gebracht, weil sie wusste, dass er es ihr sofort abnehmen würde, wenn sie damit herumwedelte. Wenn es etwas gab, das die Montgomerys verachteten, dann in den Klatschspalten der Regenbogenpresse aufzutauchen. Cameron war derjenige, der es regelmäßig in die Hochglanzmagazine und auf die Online-Plattformen schaffte. Natürlich wollte er nicht mit der Verlobten seines Bruders und einer Line Koks erwischt werden.
Elayne täuschte ein betrunkenes Straucheln vor und krallte ihre Finger noch fester in Camerons Arm. Sie hatte sich vom Alkohol ferngehalten. Und sie nahm selbstverständlich auch keine Drogen. Denn nichts war so schlimm, wie die Kontrolle über das eigene Handeln zu verlieren. Ihre Mutter war dieser Schwäche wieder und wieder erlegen. Etwas, das ihr nicht passieren würde. Wichtig war nur, dass Cameron das glaubte. Unauffällig blickte sie zu den Büschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es war nichts zu sehen, aber der Mann, den sie für diese Nacht bezahlt hatte, lag mit seinem Teleobjektiv auf der Lauer. Genau wie Andy, der im gleichen heruntergekommenen Trailer-Park wie sie aufgewachsen war und inzwischen die Uniform der Bostoner Polizei trug. Er verabscheute reiche Idioten, wie Cameron einer war. Während Elayne sich entschieden hatte, ihren sozialen Aufstieg zu forcieren und eine von ihnen zu werden, zog Andy seine größte Befriedigung daraus, diejenigen zu schikanieren, die mehr hatten als er.
Für die Inszenierung, die Elayne für diese Nacht geplant hatte, waren die beiden die perfekte Besetzung. Sie würden mitspielen. Und ihr helfen, Cameron lange genug aus dem Weg zu schaffen – oder ihn wenigstens mundtot zu machen –, bis die Hochzeit mit seinem Bruder unter Dach und Fach war. Adrenalin rauschte in einer erregenden Welle durch ihren Körper, als sie noch ein Straucheln vortäuschte und ein kicherndes »Huch« von sich gab.
2
Abby bog von der Landstraße ab, die die Küste mit Machias verband, und fuhr auf die schmale, nostalgische Steinbrücke, der die Insel Stonebridge Island ihren Namen verdankte. Ihre Schwester Megan hatte es sich auf dem Beifahrersitz bequem gemacht. Obwohl es draußen kalt war, hatte sie das Seitenfenster heruntergelassen und streckte genüsslich den Kopf hinaus. Sie lachte fröhlich, als die Hunde vom Rücksitz des Jeeps aus versuchten, ihre Köpfe neben Megan aus dem Fenster zu hängen und die Schnauzen in den Fahrtwind zu strecken.
»Ich liebe den Frühling«, ließ Megan sich vernehmen. Was kein Wunder war: Das Gleiche sagte sie schließlich auch über den Sommer, den Herbst und den Winter.
Abby blickte zu ihr hinüber und lächelte. Megan hatte ihre Stiefel ausgezogen und stemmte ihre Füße, die in knallbunten, handgestrickten Socken steckten, gegen das Armaturenbrett. Zu ihren Jeans trug sie einen pink und orange gestreiften, eng anliegenden Rollkragenpullover und darüber einen alten, abgewetzten Armeeparka. Was bei Abby wie ein modischer Unfall wirken würde, sah an ihrer Schwester so aus, als hätte es ein Designer nur für sie entworfen.
Abby hatte sich für den Besuch beim Tierarzt für die farblich schlichtere Variante entschieden. Jeans, Stiefel und eine Fleecejacke mit dem Logo der Ranch über einem Longsleeve. Die Hunde, ihr Labrador Charlie, und Henry und Nugget, die beiden Hofhunde (bei denen niemand so sicher war, welche Rassen in ihrem bunten Genmix verbunden waren), hatten ihren jährlichen Check klaglos über sich ergehen lassen. Jetzt schienen sie es jedoch gar nicht mehr erwarten zu können, auf die Insel zurückzukommen. Genau wie Megan, die ihre Hand aus dem Fenster hielt und den Fischern auf zwei Hummerbooten zuwinkte, die mit ihrem Fang in den Hafen zurückkehrten. Als Abby an der Ocean Street abbremste, trat eine der Freundinnen ihrer Mutter aus ihrer Galerie auf der anderen Straßenseite und winkte ihnen zu. Abgesehen von einem Tierarzt und einem Sheriff hatten sie wirklich alles, was sie brauchten auf der kleinen Insel, die gerade einmal fünfzehn Quadratmeilen groß war. Abby überlegte, ob sie noch genug Zeit hatten, in Marsha’s Bakery auf eine Tasse Kaffee und einen Blaubeermuffin vorbeizuschauen. Noch blieben ihnen fast eineinhalb Monate, bis die Touristen über die kleinen Städte Home Port und Sandy Beach und die unzähligen, auf der Insel verstreuten Feriencottages herfielen. Bis dahin konnte man sichergehen, bei einem Besuch in der Bäckerei oder Jills kleinem Eisladen an der Ecke nicht anstehen zu müssen und mit dem neuesten Tratsch und Klatsch versorgt nach Hause gehen zu können. Sie warf einen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett. Die Zeit bis zu ihrem nächsten Therapietermin war zu knapp bemessen, als dass sie sich noch auf ein Plauderstündchen einlassen konnten. Mit einem bedauernden Blick in Richtung Bäckerei bog Abby auf die Old Country Road ab. Sobald sie die Stadt hinter sich ließen, gesellte sich der Duft nach feuchter Erde und dem Harz der Pinien zum rauen Geruch des Ozeans.
»Stimmt es, dass Becky zurückkommt?«, fragte Megan. Sie schob die Hundenasen mit einer sanften Bewegung nach hinten und ließ das Fenster wieder hochfahren.
»Ja.« Abby musste bei dem Gedanken automatisch lächeln. Eine ihrer besten Freundinnen, die bei der Küstenwache arbeitete, war in ihre Heimat zurückversetzt worden und würde wieder hier leben. »Sie fängt nächste Woche ihren Dienst an.« Zwar würde sie auf dem Festland arbeiten, aber wieder nach Home Port ziehen. Sie hatte sich bereits ein kleines Häuschen gemietet.
»Dann ist das Kleeblatt wieder vereint.« Megan lehnte sich im Sitz zurück und schloss für einen Moment die Augen. »Das fühlt sich sicher toll an.«
»Ja, stimmt.« Es war wundervoll, wieder alle ihre Schulfreundinnen um sich zu haben. Das tröstete zwar nicht über den Verlust von Gabriella hinweg, aber es tat trotzdem gut. Sie warf Megan einen Seitenblick zu. »Du vermisst Kelly und Mel«, stellte sie fest. Eine der beiden Freundinnen ihrer kleinen Schwester lebte in Portland, die andere hatte es bis nach Kalifornien verschlagen.
»Hmm.« Megan lächelte ein wenig traurig. »Manchmal vermisse ich sie wie verrückt. Aber jetzt, wenn der Frühling anbricht, haben wir auf dem Gestüt so viel zu tun, dass ich aufhören werde, darüber nachzudenken. Im Sommer wollen wir uns treffen und für ein paar Tage zusammen wegfahren.«
»Das klingt gut«, sagte Abby und blickte wieder nach vorn. Der Jeep rollte über die Kuppe des Hügels, und sie trat erschrocken auf die Bremse, als sie das Auto direkt vor sich erblickte.
»Verdammter Blödmann«, murmelte Megan neben ihr und starrte den Mann an, dessen Kopf hinter der geöffneten Motorhaube auftauchte. Als Abby den Jeep langsam neben den Wagen am Straßenrand rollen ließ, fuhr Megan ihr Seitenfenster wieder herunter und lehnte sich heraus. Sie betrachteten den Mann, der ziemlich hilflos durch seine völlig verwuschelte Lockenmähne strich. Auf der Rücksitzbank des Wagens stapelten sich Kisten über Kisten, auf denen unübersehbar das Logo des Meeresbiologischen Instituts in Portland prangte.
»Können wir Ihnen helfen, Sir?«, fragte Megan.
»Nein. Vielen Dank. Ich habe schon jemanden angerufen.« Er kratzte sich am Kopf. »Mr. Baring von der Tankstelle.«
Megan nickte. »Bei Wally Baring sind Sie und Ihr Wagen in guten Händen. Aber stellen Sie Ihr Warnlicht an der Kuppe auf, sonst fährt Sie der nächste Hummerfischer, der hier langkommt, über den Haufen.« Sie hatte sich schon wieder in ihrem Sitz zurückgelehnt, als sie es sich anders überlegte und ihren Kopf noch einmal aus dem Fenster streckte. »Ich bin Megan«, sagte sie und schenkte dem Mann ein breites Grinsen.
»Zac. Ähm … Zac Bridges«, stellte der Typ sich vor und bekam tatsächlich rote Ohrenspitzen, so offen flirtete Abbys Schwester ihn an.
»Schön, dich kennenzulernen, Zac. Probier unbedingt den Pub in Home Port aus, solange du hier bist. Das Bier ist fantastisch. Und vielleicht laufe ich dir dort mal über den Weg.« Sie zwinkerte ihm zu. »Touristen«, murmelte sie, sobald sie das Fenster wieder hochgelassen und Abby Gas gegeben hatte, schaffte es aber nicht, ihr Grinsen abzustellen. »Auch wenn der gerade ziemlich süß war. Und so viel Zeug dabeihat, dass er vermutlich eine Weile bleiben wird.«
»Die Vorhut der Invasion«, stimmte Abby ihr zu. Die Sommergäste konnten einen hin und wieder an den Rand des Wahnsinns treiben. Aber die Inselbewohner waren von ihnen abhängig, und davon, dass sie zuverlässig jedes Jahr wiederkehrten. Vor ein paar Jahren war Stonebridge Island zu einem der zehn Geheimtipps an der Ostküste der Vereinigten Staaten gekürt worden. Das hatte ihnen als Urlaubsziel gehörigen Auftrieb gegeben, ließ den Insulanern aber trotz allem noch die Chance, ihr ruhiges Inseldasein zu leben.
Megan und Abby plauderten gut gelaunt über den bevorstehenden Sommer, und Megan dachte laut darüber nach, ob dieser süße Typ ihren Hinweis wohl verstanden hatte und seine Abende im Pub in Home Port verbringen und sie auf ein Pint Island Brew einladen würde. Sie bogen nach einer weiteren Meile nach rechts auf die Schotterstraße ab, die unter einem hohen Torbogen hindurchführte, an dem ein großes, altes Metallschild hing, das die Besucher in den Silver Brook Stables willkommen hieß. Links und rechts fassten weiße Koppelzäune die Straße ein. Der Horizont wurde von dunklen Pinien begrenzt, und rechts von ihnen tollten ein paar übermütige Jährlinge über die Weide. Sie schienen die Sonne genauso zu genießen wie Megan und sie. Der Jeep rumpelte über die Holzbrücke, die den Silver Brook überspannte, ehe Abby ihn auf dem Hof des Gestüts ausrollen ließ.
Ihre Mutter trat im gleichen Moment aus dem Haus, in dem Megan die Hunde aus dem Wagen ließ. Aufgeregt und glücklich bellend sprangen sie auf Olivia zu und ließen sich ausgiebig kraulen. »Na, ihr drei, habt ihr den Besuch beim Tierarzt gut überstanden?«
»Sie waren sehr brav.« Megan beugte sich ebenfalls hinunter, um den Hunden über den Rücken zu streichen.
Olivia küsste sie auf die Wange, als sie sich wieder aufrichtete, und begrüßte Abby auf die gleiche Weise, als sie sich zu ihnen gesellte. Ihre Augen glänzten, was in der letzten Zeit selten der Fall gewesen war, und eine Welle der Erleichterung rauschte durch Abbys Körper. Sie hatte sich Sorgen gemacht. In den vergangenen Monaten hatten sich immer mehr Anzeichen für eine nahende Depression bei ihrer Mutter gezeigt. Es wäre wundervoll, wenn es ihr jetzt, mit dem anbrechenden Frühling und dem zunehmenden Licht, wieder besser ginge.
»Gut, dass ihr wieder da seid. Ich muss euch was erzählen.« Olivia sah sie abwechselnd an. »Ich habe gerade einen Anruf von Richter Graw aus Boston erhalten.« Erwartungsvoll blickte sie von Abby zu Megan. »Ihr wisst doch noch, wer das ist?«
»Nein. Kann ich nicht von mir behaupten.« Megan zuckte mit den Schultern. »Du?«, fragte sie Abby.
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Ich bin mir sicher, dass ich euch schon von ihm erzählt habe. Er hat als Kind seine Ferien hier verbracht. Und später hat er sogar ein Pferd bei uns gekauft. Für seine Tochter«, begann sie abzuschweifen.
»Ich kenne ihn trotzdem nicht«, beharrte Megan und holte ihre Mutter damit wieder in die Gegenwart.
»Jedenfalls hat er mich angerufen und um einen Gefallen gebeten«, fuhr Olivia fort.
Abby schob die Hände in die Gesäßtaschen ihrer Jeans und wippte auf ihren Fußballen. »Was hat das mit uns zu tun?«, wollte sie wissen.
»O mein Gott!« Megan hüpfte aufgeregt, was die Hunde dazu brachte, ebenfalls aufgeregt – und fröhlich bellend – um sie herumzuspringen. »Es gibt da einen geheimnisvollen Typen, der im Zeugenschutz ist und ein Versteck braucht.«
Abby verdrehte die Augen. »Du musst echt aufhören, diese kitschigen Liebesromane zu lesen.«
Olivia lächelte, verzog dann aber das Gesicht zu einer entschuldigenden Miene. »Die Geschichte gestaltet sich tatsächlich ein wenig anders«, sagte sie.
»Ein wenig?« Auch ohne einen Doktortitel in Psychologie hätte Abby gewusst, dass ihre Mutter gleich mit etwas herausrücken würde, was ihr nicht gefallen würde.
»Na ja, es ist eher das Gegenteil«, gab Olivia zu. Sie wich Megans und Abbys Blicken aus und sah zum Roundpen hinüber, wo Summer gerade ein Pferd trainierte. Eine ihrer Rancharbeiterinnen, Zara Sanders, lehnte an einem Zaunpfosten und sah ihr dabei zu. »Er ist eher eine Art Straftäter, der für vier Wochen gemeinnützige Arbeit leisten soll. Der Richter hat mich gebeten, ihn hier arbeiten zu lassen.«
»Eine Art Straftäter? Oder ein richtiger Straftäter?« Abby zog die Augenbrauen hoch.
»Weißt du, was er angestellt hat?«, wollte Megan im gleichen Moment neugierig wissen.
»Ein … richtiger Straftäter«, konkretisierte Olivia. »Was er ausgefressen hat, weiß ich auch nicht.« Sie runzelte die Stirn. »Das habe ich glatt vergessen zu fragen.«
»Und warum sollte jemand aus Boston bei uns Sozialstunden ableisten?«, bohrte Abby nach.
Olivia zuckte mit den Schultern. »Das kann ich dir auch nicht sagen, aber ich habe zugestimmt.« Das Lächeln kehrte in das Gesicht ihrer Mutter zurück, als stehe ihnen allen ein großes Abenteuer bevor.
»Und was soll er bei uns machen?«, fragte Megan. »Ställe ausmisten?« Sie fasste ihre Haare, die der Wind um ihr Gesicht wehte, zusammen und band sie mit einem Gummi zurück, den sie von ihrem Handgelenk zog.
»Ich dachte eigentlich eher an Abby«, ließ ihre Mutter die Bombe platzen.
»Was?« Abby sah ihre Mutter an.
»Jetzt, wenn Gabriella weg ist, brauchst du dringend Unterstützung«, erklärte Olivia.
»Aber doch nicht von einem Straftäter«, widersprach Abby. »Wenn du schon einem alten Freund einen Gefallen tun willst, lass ihn doch für Megan arbeiten. Ich brauche zuverlässige Mitarbeiter, die wissen, was sie tun.«
»Hey.« Megan stieß ihr mit einem Grinsen den Ellenbogen in die Rippen. »Meine Mitarbeiter müssen auch verantwortungsbewusst sein.«
»Natürlich. Entschuldige. Ihr wisst, wie ich das meine. Meine Patienten …«, versuchte Abby ihren Standpunkt zu erklären.
»Ach was«, unterbrach ihre Mutter sie. »Du brauchst im Moment am dringendsten Hilfe. Zumindest, bis du jemanden gefunden hast, der Gabby ersetzen kann.«
»Genau, der Straftäter«, betonte Megan das letzte Wort genüsslich, »eignet sich doch hervorragend, einen weiteren Monat zu überbrücken und in Ruhe nach einem Nachfolger für Gabriella zu suchen. Und einen eigenen Stallburschen zu haben, kann nie schaden, oder?« Megan zwinkerte ihr zu. »Wahrscheinlich hat er am ganzen Körper fiese Tattoos, läuft herum wie ein Biker und hat einen total finsteren Blick. Ich wette, dass er einen langen Pferdeschwanz und einen genauso langen Bart hat. Oder vielleicht eine Glatze, auf die ein Spinnennetz tätowiert ist.« Sie erschauderte genüsslich.
»Genau das, was ich brauche«, murmelte Abby. Sie empfand nicht einmal im Ansatz so viel Aufregung wie ihre Schwester. Die Gesundheit ihrer Patienten hing von ihr ab. Wenn dieser tätowierte Rocker keine Ahnung davon hatte, wie man mit Menschen in Ausnahmesituationen umging … Wahrscheinlich machte er ihnen Angst mit seinem Auftreten. »Wie wäre es mit Summer? Sie kann doch immer Hilfe brauchen«, schlug sie vor. »Vielleicht eignet sich der Knastbruder perfekt, um Stalltüren aufzubrechen, wenn sie sich mal wieder auf den Weg macht, um ein Pferd zu retten.«
»Dann kann sie ihn ja bei dir ausleihen.« Olivia schob Abby den Arm um die Taille und strahlte sie an.
Abbys Herz zog sich zusammen. So aufgedreht und fröhlich hatte sie ihre Mutter schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Sie wollte nicht diejenige sein, die dafür verantwortlich war, dass das Leuchten wieder aus ihren Augen verschwand. Ergeben seufzte sie. »Gib mir die Telefonnummer des Richters. Ich will wenigstens die Akte dieses Gangsters lesen, bevor ich ihn mit meinen Patienten in Kontakt bringe.«
Olivia lächelte und zog einen Notizzettel aus ihrer Hosentasche. »Er wartet auf deinen Anruf.«
*
Camerons Laune sank mit jeder Meile, die er weiter nach Norden fuhr. Hinter Portland waren die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gesunken, und ein eiskalter Wind hatte begonnen, Schneeflocken quer über die Straße zu treiben. Was seinen Porsche regelmäßig ins Schlittern geraten ließ. Verdammt noch mal! Es war März! Eine Jahreszeit, in der in Boston der Frühling ausbrach. Er hingegen schien sich auf direktem Weg in Richtung Nordpol zu befinden.
Aus dem Rückspiegel blickte ihm die finstere Version seines Gesichts entgegen. Er hatte schon wieder an die Gerichtsverhandlung denken müssen. Was für eine Farce. Er konnte noch immer das Krachen des Richterhammers auf das dunkel glänzende Holzpult hören. Spürte die raue Textur seines Stuhlpolsters unter den Händen. Sein Anwalt hatte ihm verboten, die Fragen des Vorsitzenden zu beantworten. Er hatte behauptet, alles im Griff zu haben. Die Worte des Richters hatten allerdings den Eindruck erweckt, dass überhaupt nichts mehr unter Kontrolle war. Er hatte nicht auf seinen Anwalt gehört und versucht, seine Unschuld zu beweisen.
»Wollen Sie es vielleicht so weit treiben, dass ich eine Blutprobe von Ihnen untersuchen lasse? Oder möchten Sie lieber eine Haarprobe abgeben, Mr. Montgomery?«, hatte der Richter über den Rand seiner Lesebrille hinweg gefragt.
Cameron hatte sich erhoben. »Ja, das möchte ich, Euer Ehren.«
»Wissen Sie, was die Konsequenzen davon sind? Wenn wir Ihnen den Konsum von Kokain nachweisen, haben Sie größere Probleme, als Sie sich im Moment vorstellen können. Denn dann werde ich Sie in eine Zelle stecken lassen – oder in eine Entzugseinrichtung schicken.«
»Ja, Sir, ich weiß, was die Konsequenzen sind. Ich will trotzdem …«
Sein Anwalt packte Cameron am Ärmel seiner Anzugjacke und zog ihn auf den Stuhl zurück. »Mein Mandant wird keinen Drogentest machen, Euer Ehren«, sagte er entschieden.
Cameron beugte sich zu ihm hinüber. »Ich nehme keine Drogen. Elayne hat mich reingelegt. Das habe ich Ihnen doch erklärt«, zischte er. »Warum lassen Sie mich das nicht beweisen?«
»Herr Anwalt, mäßigen Sie Ihren Mandanten«, rief der Richter die beiden zur Ordnung. »Sie sollten dankbar sein, dass der Übergriff auf Miss Knox vom Tisch ist.«
In den nächsten Minuten hatte Cameron das Gefühl gehabt, als verhandelten der Anwalt und der Richter über seinen Kopf hinweg.
»Ihr Aufenthalt in den Silver Brook Stables auf Stonebridge Island wird Ihnen hoffentlich dabei helfen, Ihre Einstellung zum Thema Drogen zu überdenken«, sagte der Richter schließlich und schlug mit seinem Hammer auf das Pult. Dann verschwand er in seinem Zimmer.
Cameron hatte sich zu seinem Anwalt umgedreht, der mit zufriedener Miene seine Unterlagen zusammenschob, während drei Fragen durch Camerons Gedanken rotierten. Was – zur Hölle – waren die Silver Brook Stables? Wo – zum Henker – lag Stonebridge Island? Und wieso hatte sein Anwalt nicht versucht, ihm den Arsch zu retten und ihn stattdessen unschuldig verurteilen lassen?
Seine Schwester Valerie hatte noch im Gerichtssaal gegoogelt, was die Silver Brook Stables waren, und mit Informationen aufgewartet, sobald die Verhandlung beendet worden war. Ein Gestüt. Pferde.
Fassungslos hatte er den Kopf geschüttelt. Was hatte das mit vermeintlichen Drogenkonsumenten zu tun? Dieser Richter verbannte ihn allen Ernstes für vier Wochen in ein Nirgendwo kurz vor Kanada, vielleicht lag dieser Reiterhof sogar hinter der Grenze. Wer wusste das schon? Mit Pferden hatte Cameron nur zweimal in seinem Leben näheren Kontakt gehabt. Als er bei einem Besuch der Rennbahn mit einem einzigen – selbstverständlich narrensicheren – Tipp eine vierstellige Summe verzockt hatte. Und bei einem Polospiel, zu dem ihn ein Studienkollege geschleppt hatte. Diesen Nachmittag hatte er gar nicht so schlecht gefunden. Zumindest den Teil zwischen den Spielen, als die Frauen ihre High Heels aus- und ihre Röcke nach oben gezogen hatten, um den von den Schlägern und Pferdehufen aufgewühlten Rasen wieder festzutreten. Diesen Anblick hätte er durchaus noch ein wenig länger genießen können. Trotzdem war er zu keinem weiteren Spiel gegangen. Er hatte auch jetzt nicht die Absicht, Pferde näher kennenzulernen. Schließlich mochte er keine Tiere. Weder Katzen noch Zierhamster oder Zwerghasen. Und schon gar nichts, was größer war als ein Hund.
Der letzte Radiosender, der zivilisierte Musik gespielt hatte, schickte bereits seit fünf Meilen nichts als statisches Rauschen durch den Äther. Genervt drückte Cameron den Sendersuchlauf. Er hatte die Wahl zwischen drei Programmen: ein christlicher Sender, auf dem gerade eine feurige Predigt gehalten wurde, obwohl noch lange nicht Sonntag war. Dann grauenvolle Countrymusik. Und schließlich eine Sendung, in der auf Französisch diskutiert wurde. Wieder überlegte er, ob er, aus Versehen und ohne es zu merken, die kanadische Grenze überquert hatte. Er bemühte sich, nicht in Selbstmitleid zu versinken, aber das fiel ihm wirklich nicht leicht. Cameron hatte versucht, seinen Anwalt dazu zu bringen, diese aberwitzige Auflage in irgendetwas zu ändern, das näher an Boston lag. Irgendetwas, das ihm die Möglichkeit gab, in seinem eigenen Bett zu schlafen. Als Lancaster kategorisch abgelehnt hatte, sein Glück noch einmal bei Richter Graw zu versuchen, war Cameron noch skeptischer geworden. Wenn der Anwalt nichts unternahm, um seinem Mandanten zu helfen, konnte es dafür nur einen Grund geben.
Valerie hatte versucht, ihn davon abzuhalten, aber Cameron war nach der Gerichtsverhandlung auf direktem Weg in das Büro seines Vaters gestürmt und hatte ihn mit seinem Verdacht konfrontiert. Sein alter Herr hatte sich entspannt in seinem Chefsessel zurückgelehnt und sich nicht einmal die Mühe gemacht, sein kleines Komplott abzustreiten. Ihm und Camerons Mutter waren alle Mittel recht, um ihn aus Elaynes und Jasons Leben fernzuhalten. Kathreen plante eine Hochzeit. Nicht irgendeine Hochzeit. Das Event des Jahrhunderts, von dem die Bostoner High Society noch in zehn Jahren sprechen würde. Sie würde sich von nichts und niemandem aufhalten lassen. Auch nicht von ihrem mittleren Sohn. Und was seinen Bruder anging? Mit Jason zu reden war hoffnungslos. Er wollte einfach nicht sehen, was für eine Frau seine Verlobte in Wirklichkeit war. Cameron schüttelte den Kopf und versuchte noch einmal, einen anständigen Sender hereinzubekommen. Nachdem er zum zweiten Mal hintereinander bei der kanadischen Talkrunde landete, ertastete er sein Handy auf dem Beifahrersitz und versuchte, über Bluetooth eine seiner Playlists über das Soundsystem des Wagens abzuspielen. Als er von seinem Handydisplay aufsah, wurden ihm im Bruchteil einer Sekunde zwei Dinge bewusst. Zum einen war er auf die linke Fahrspur geraten. Zum anderen kam ihm genau dort in diesem Moment ein Traktor entgegen. »Scheiße«, fluchte er und zog das Lenkrad im letzten Moment nach rechts, um dem hupenden und wild gestikulierenden Farmer auszuweichen. Das rechte Vorderrad seines Porsche geriet in ein Schlagloch, das groß genug war, um als Mondkrater durchzugehen, und die Karosserie setzte mit einem unschönen Kratzen auf dem Asphalt auf. Cameron verzog schmerzlich das Gesicht. Er saß nicht zum ersten Mal auf, seit er auf diesem gottverlassenen Highway unterwegs war. Und es würde wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Er fuhr an den Straßenrand und wartete, bis sich sein rasender Puls wieder etwas beruhigte, ehe er weiter in Richtung Norden fuhr.
Je näher er seinem Ziel kam, desto einsamer wurde die Gegend. Er durchquerte endlose Wälder. Wenn er überhaupt auf Ansammlungen von Häusern traf, waren die meist so heruntergekommen und verfallen, dass sie eine perfekte Kulisse für jeden Stephen-King-Roman geboten hätten. Als er auf die Brücke fuhr, an deren Ende sein Zuhause für die nächsten Wochen – Stonebridge Island – lag, wurde das trübe Tageslicht bereits von der Dämmerung geschluckt. Ein Willkommensschild in fröhlichem Hellblau wies darauf hin, dass auf der Insel ganze eineinhalbtausend Menschen lebten. Cameron seufzte. Diese Zahl bestätigte, wie er sich diesen Ort vorgestellt hatte. Wenn auf der Welt eine Zombieapokalypse losbrach, wie lange würde es wohl dauern, bis die Untoten diese Insel überhaupt finden würden?
Das Kaff, in dem er sich ein Motelzimmer gebucht hatte, hieß Home Port. Offenbar hatte man hier beschlossen, bei Einbruch der Dunkelheit die Bürgersteige hochzuklappen. Er sah nicht wirklich viele Menschen, und die Geschäfte entlang der Straße hatten bereits geschlossen. Im Internet hatte er neben dem Jasper Point Motel zwei Inns gefunden, die klein und gemütlich wirkten – und ihm damit eine Spur zu persönlich waren. Für jemanden mit seinem Hintergrund kamen sie nicht infrage. Cameron war froh, keine Meute von Paparazzi an den Fersen kleben zu haben, die ihm von Boston aus in den Norden gefolgt war. Aber auch neugieriges Hotelpersonal, das herumschnüffelte und dann irgendwelche Lügengeschichten von ihm an die Boulevardpresse verkaufte, konnte er nicht gebrauchen. Das Motel war diesbezüglich allerdings keine viel bessere Wahl, wie er feststellte, als er auf den Parkplatz fuhr und in das kleine, völlig überheizte Managerbüro trat. Die Frau, die aus dem Hinterzimmer kam, hatte ein solches Leuchten in den Augen, dass Cameron sofort klar war: Sie wusste genau, wer er war.
»Ich bin Lucille Carlson«, stellte sie sich vor und kam um den Tresen herum, um ihm die Hand zu schütteln. »Mr. Montgomery, es ist meinem Mann und mir eine Ehre, Sie in unserem Haus begrüßen zu dürfen.«
»Danke.« Cameron versuchte, seine Hand zurückzuziehen, doch Mrs. Carlson schien noch nicht bereit, ihn loszulassen.
»Wirklich«, betonte sie noch mal. »Eine Ehre.« Endlich gab sie ihn frei. »Haben Sie gut hergefunden?« Sie schien auf ein wenig Small Talk aus zu sein und natürlich darauf, ihn auszuhorchen.
»Ja, vielen Dank«, entgegnete er. »Allerdings war die Fahrt ziemlich lang und bei diesem Wetter anstrengend.« Zumindest, wenn man einen Porsche fuhr. »Wenn ich einchecken könnte?« Je eher er diesem sensationslüsternen Blick entkam, desto besser.
»Sicher.« Mrs. Carlson kehrte auf ihre Seite des Tresens zurück. Sie nahm seine Kreditkarte entgegen und zog sie ehrfurchtsvoll durch den Scanner. Eine schwarze AMEX bekam man auf Stonebridge Island wahrscheinlich nicht oft zu sehen.
Eingeklemmt zwischen zwei Postkartenständern mit Karten der Insel und einer kleinen Kaffeebar wartete er, bis die Managerin seine Rechnung ausdruckte. »Morgens von sieben bis zehn gibt es frische Muffins hier an der Rezeption. Kaffee und Tee haben wir den ganzen Tag.« Abermals kam sie um den Tresen herum. »Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer«, sagte sie dienstbeflissen.
Das ist nicht nötig, hätte Cameron am liebsten gesagt. Schließlich war es nicht besonders schwierig, an einer Reihe rot lackierter Türen vorbeizugehen, bis er vor der mit seiner Zimmernummer stand. Aber er verkniff sich seinen Widerspruch. Mrs. Carlson würde nichts davon abhalten, ihn über den Hof zu begleiten und persönlich dafür zu sorgen, dass er sein Zuhause für die nächsten Wochen auch wirklich fand. Plappernd lief sie neben ihm her und schwärmte vom Frühling, der auf Stonebridge Island angeblich besonders toll war. Es schien, als nehme sie das Schneegestöber um sie herum überhaupt nicht wahr. Vor Zimmer Nr. 8 blieb sie stehen. »Hier sind wir«, begann sie erneut. »Die Zimmer haben …«
»Vielen Dank«, sagte er fest. »Ich komme klar.« Er nahm ihr den Schlüssel aus der Hand. »Ich will Sie wirklich nicht länger aufhalten. Einen schönen Abend.«
»Aber … ich … ja.« Sie nickte. »Das wünsche ich Ihnen auch.« Einen Moment blieb sie unschlüssig stehen, dann drehte sie sich um und kehrte in die Rezeption zurück.
Cameron war sich sicher, dass binnen Sekunden die Telefonleitungen der Insel heiß laufen würden, weil sie es gar nicht erwarten konnte, die Neuigkeit zu verbreiten, dass Cameron Montgomery höchstpersönlich im Jasper Point Motel abgestiegen war. Dann wartete er einen Moment, bis die Tür zur Rezeption hinter ihr ins Schloss fiel, und holte seine Reisetasche und den Koffer aus dem Porsche. Er ließ noch eine Frau vorbei, die ein Kind im Rollstuhl vor sich herschob. Sie nickte ihm müde zu und schob ihren Schlüssel mit dem roten Plastikanhänger in Tür Nr. 5. Cameron tat es ihr gleich und betrat sein Zimmer. Ohne das Licht einzuschalten, lehnte er sich von innen gegen das kühle Holz und starrte in die Dunkelheit. Er war in perfekter Stimmung für eine Selbstmitleidsparty.
*
Abby lehnte sich in ihrem Schreibtischstuhl zurück und starrte Cameron Montgomerys Konterfei an, das ihm vom Bildschirm ihres Laptops entgegengrinste.
Cameron Montgomery. Das mittlere Kind eines der reichsten Clans Bostons. Suites by Montgomery – die Hotelkette der Familie hatte ihre Luxushotels über die gesamten Vereinigten Staaten und die halbe Karibik verteilt. Wenn man den Klatschportalen Glauben schenkte, war Cameron der Bad Boy der Familie. Sein älterer Bruder Jason war derjenige, der in das Familienunternehmen eingestiegen war und gemeinsam mit seinem Vater die Geschicke der Firma lenkte. Die jüngere Schwester, Valerie, hatte sich offenbar noch nicht entschieden, was sie mit ihrem Leben anfangen wollte.
Abby klickte ein anderes Bild des Hotelerben an. Cameron war ein gut gekleideter, stilsicherer Charmeur, der genau wusste, wie er bekam, was er wollte. Sein Lächeln war jungenhaft, und seine Augen graublau. Das kurze, blonde Haar war in einem Crew Cut geschnitten. Was Abby nicht wusste, weil sie sich mit diesem Frisurentyp auskannte, sondern weil er Thema eines Internetblogs war, der sich mit den angesagtesten Junggesellen Bostons beschäftigte, diese Männer kategorisierte und katalogisierte, und den sie bei ihrer Suche zufälligerweise angeklickt hatte.
Mit einem müden Seufzen drückte sie die Fotos weg, die die Suchmaschine ihr angezeigt hatte. Die Bilderflut war geradezu überwältigend. Cameron Montgomery schien ein Liebling der Paparazzi zu sein. Was auch die Probleme erklärte, mit denen er sich im Moment auseinanderzusetzen hatte. Probleme, die er nach Stonebridge Island schleppen würde. Auf das Gestüt – und in ihre Praxis.
Sie kannte den Typ Mann, den er verkörperte. Nicht nur, weil sie als Psychologin die Gerichtsunterlagen studiert hatte, die Richter Graw ihr gemailt hatte. Sie wusste, wie er tickte, weil er genau wie ihr Ex-Mann Jace war.
Abby hatte früh gelernt, dass es ein Fehler war, ihrer Impulsivität nachzugeben. Diese Spontaneität und Wildheit hatte sie von ihrem Vater geerbt. Ihrem leiblichen Vater Scott. Nicht von Jack, der sie aufgezogen hatte, als wäre sie seine eigene Tochter. Sie hatte ihre Emotionen allerdings immer gut im Griff gehabt. Nur einmal, kurz nach ihrem Studium, hatte sie der unkontrollierten Seite in sich nachgegeben und in einer Kurzschlussreaktion in Las Vegas den Sunnyboy Jace Downey geheiratet. Sie hatte bereits am nächsten Morgen gewusst, dass sie einen großen Fehler gemacht hatte. Trotzdem hatte sie es noch ganze zwei Monate durchgezogen, ehe sie sich scheiden ließ – Jace hatte ihr nicht gutgetan. Er hatte aus gut situiertem Haus gestammt, hatte ein bisschen vor sich hin studiert, aber sein Leben hauptsächlich damit verbracht, Partys zu feiern. Ansonsten hatte er perspektivlos in den Tag hineingelebt und sich wenig Gedanken um andere gemacht. Er war rücksichtslos gewesen, egozentrisch. Jaces Leben hatte sich um Alkohol und Drogen gedreht, um den Rausch, den er Leben nannte. Sie hatte ihm nicht helfen können. Hatte es nicht geschafft, ihn aus seiner Sucht herauszuholen. Eine Trennung und die Rückkehr zu ihrem kontrollierten, vorhersehbaren Leben waren ihre einzigen Chancen gewesen, wenigstens sich selbst zu retten.
Sie hatte Jace hinter sich gelassen. Nur um mit einem noch schlimmeren Exemplar der gleichen Spezies konfrontiert zu werden. Jordan, der dafür gesorgt hatte, dass ihre siebzehnjährige Patientin Kelsey von einer Brücke gesprungen war. Seitdem war alles anders.
Und nun trat Cameron Montgomery in ihr Leben. Sie kannte ihn nur aus den Klatschspalten der Zeitschriften. Persönlich begegnet war sie ihm noch nie. Doch die Parallelen zwischen ihm, ihrem Exmann und Jordan waren unverkennbar. Der Alkohol. Drogen. Ein Übergriff auf die Verlobte seines Bruders. Abby praktizierte vielleicht nicht mehr als Psychotherapeutin, aber sie erkannte ein Muster, wenn sie es sah. Einen so wenig kontrollierbaren Mann wollte sie nicht auf dem Gestüt haben. Nicht auf ihre Patienten loslassen. Und sie wollte sich nicht daran erinnern, dass sie sich von genau dieser Art von Unberechenbarkeit einmal angezogen gefühlt hatte wie die Motten vom Licht.
»Abby?« Megan riss sie mit ihrem Klopfen an die Bürotür aus ihren Gedanken.
»Ja?« Sie klappte den Laptop zu und erhob sich.
Ihre jüngste Schwester schob die Tür auf und schwenkte grinsend eine Weinflasche. »Ich wurde geschickt, dich aus deiner Einsiedlerhöhle zu befreien. Summer ist vom Cross-Country-Training zurück. Sie hat hinter dem Haus ein Feuer gemacht, und ich habe den Alkohol. Wir haben beschlossen, ein paar Marshmallows zu rösten, in die Sterne zu kucken und dich dazu zu bringen, uns alles über deinen neuen Stallburschen zu erzählen. Cameron Montgomery.« Sie schüttelte sich wohlig. »Das ist noch tausendmal besser als ein Biker mit Vollbart und Pferdeschwanz.«
»Oder Spinnentattoo auf der Glatze«, ergänzte Abby. Sie legte Megan den Arm um die Taille. »Wein, Marshmallows und Feuer klingen fantastisch. Der Rest fällt unter die Schweigepflicht.«
3
Cameron hatte schlecht geschlafen und war dementsprechend erschöpft, als er am nächsten Morgen sein unrasiertes Gesicht im Spiegel betrachtete. Unter seinen Augen lagen dunkle Ringe. Er verzog den Mund und warf sich selbst einen genervten Blick zu. Das Schlimmste an der Nacht war gar nicht die Schlaflosigkeit gewesen, sondern die Gründe dafür. Jeder Erholungssuchende würde den Kopf schütteln, wenn er hörte, was Cameron wach gehalten hatte: Es war der fehlende Lärm der Großstadt. In Boston war er immer von Geräuschen umgeben. Menschen. Autos. Den Sirenen der Polizei, die einem ins Bewusstsein riefen, dass man nicht allein auf der Welt war. Aber auf Stonebridge Island? Nichts. Nur Stille und ab und zu das leise Pfeifen des Windes. Wie, um Himmels willen, sollte man da schlafen?
Zumindest konnte er sich nicht über sein Zimmer beschweren. Als er sich am Vorabend dazu aufgerafft hatte, seinen Rücken endlich von der Tür zu lösen und das Licht einzuschalten, war er von dem, was er erblickt hatte, positiv überrascht gewesen. Von außen hatte Jasper Point