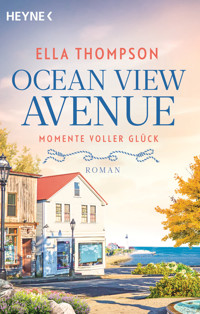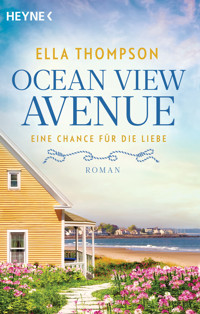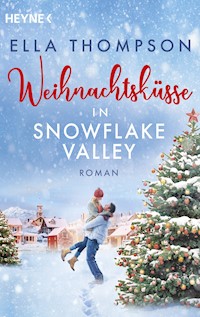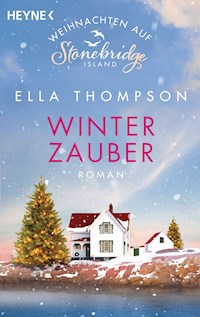9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lighthouse-Saga
- Sprache: Deutsch
Wenn die Begegnung mit deiner ehemals großen Liebe dein Herz zum Überlaufen bringt, dann bist du zu Hause
Elf Jahre ist es her, dass ein verhängnisvolles Ereignis auf Cape Cod Andrew Hunters Familie entzweite. Damals kehrte er dem Familiensitz Sunset Cove den Rücken, doch nun zwingen berufliche Probleme und der Gesundheitszustand seines Vaters ihn heimzukehren. Auf der Halbinsel erwarten ihn nicht nur die Erinnerungen an Sommer voller Lebensfreude, abenteuerliche Segeltörns und Freundschaft. Hier lauern auch die Schatten seiner ersten Liebe, Holly Clark. Sie lebt noch immer auf Cape Cod. Als Andrew ihr zufällig begegnet, ist die alte Vertrautheit sofort wieder da. Ihre Blicke brennen wie Feuer auf seiner Haut. Doch Andrew ist vorsichtig, schließlich hat Holly ihm schon einmal das Herz gebrochen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Elf Jahre ist es her, dass ein verhängnisvolles Ereignis auf Cape Cod Andrew Hunters Familie entzweite. Damals kehrte er dem Familiensitz Sunset Cove den Rücken, doch nun zwingen berufliche Probleme und der Gesundheitszustand seines Vaters ihn heimzukehren. Auf der Halbinsel erwarten ihn nicht nur die Erinnerungen an Sommer voller Lebensfreude, abenteuerliche Segeltörns und Freundschaft. Hier lauern auch die Schatten seiner ersten Liebe, Holly Clark. Sie lebt noch immer auf Cape Cod. Als Andrew ihr zufällig begegnet, ist die alte Vertrautheit sofort wieder da. Ihre Blicke brennen wie Feuer auf seiner Haut. Doch Andrew ist vorsichtig, schließlich hat Holly ihm schon einmal das Herz gebrochen …
Die Autorin
Ella Thompson, geboren 1976, verbringt nach Möglichkeit jeden Sommer an der Ostküste der USA. Ihre persönlichen Lieblingsorte sind die malerischen New England-Küstenstädtchen. An den endlosen Stränden von Cape Cod genießt sie die Sonnenuntergänge über dem Atlantik – am liebsten mit einer Hundenase an ihrer Seite, die sich in den Wind reckt.
ELLA THOMPSON
SOMMERTRÄUME AUF
Cape Cod
ROMAN
Teil 2
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 05/2019
Copyright © 2019 by Ella Thompson
Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Friederike Arnold
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München. Bigstock (belander, CaptureLight, SvetlanaR, bioraven, Artenex, Anna Om), Shutterstock (Naomi Creek, Allan Wood Photography, Nisachon Poompuang)
Kartenillustration »Cape Cod«: Andreas Hancock
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-23408-9V004
www.heyne.de
Inhalt
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Epilog
Lesen Sie die gesamte Lighthouse-Saga:
Newsletter-Anmeldung
Durch einen einzigen Augenblick kann dein ganzes Leben aus den Fugen geraten.
Prolog
Boston schlief nie. Auch um vier Uhr morgens sah die Stadt aus wie das Spiegelbild des Sternenhimmels. Wenn man sie von oben betrachtete. Zum Beispiel aus einem der Flugzeuge, die den Logan Airport ansteuerten. Oder vom Dach des Boston General Hospitals, vierzehn Stockwerke über den glitzernden Lichtern.
Der kalte Wind, der bereits einen Hauch von Frühling durch die Dunkelheit wirbelte, trug nur gedämpfte Fetzen der Melodie, die Boston ausmachte, hier herauf. Ein bisschen wirkte das Dach wie eine Oase im Chaos des Lebens. Dr. Andrew Hunter hatte das zumindest immer so empfunden. Er sah an seinen frei in der Nacht baumelnden Beinen vorbei nach unten. Ein Rettungswagen preschte mit blau, weiß und rot rotierenden Lichtern in die Auffahrt der Notaufnahme. Er müsste jetzt eigentlich dort unten stehen und einen Patienten in Empfang nehmen, schoss es Andrew durch den Kopf. Eigentlich.
Seine Hände umfassten die Kante der breiten Brüstung fester, auf der er saß und ins Ungewisse starrte. Er spürte die raue Oberfläche unter seinen Fingern. Als die stählerne Feuerschutztür hinter ihm mit einem Quietschen aufgeschoben wurde und mit einem dumpfen Knall wieder ins Schloss fiel, überlegte Andrew, ob es sich lohnte, den Kopf zu drehen und herauszufinden, wer ihm Gesellschaft leisten wollte. Er entschied, sich nicht die Mühe zu machen, und starrte weiter auf die Stadt und den Inner Harbour hinaus. Wer ihn stören wollte, tat das so oder so.
»Hey, Drew«, erklang Schwester Jessica Philipps’ sanfte Stimme. Sie lehnte sich neben ihm an die Brüstung.
»Jess.« Er sah sie nicht an. Das Letzte, was er im Moment brauchen konnte, waren besorgte Menschen mit noch besorgteren Gesichtern, die glaubten zu wissen, was mit ihm los war.
Jessica legte ihre warme Hand in einer freundschaftlichen Geste auf seinen ausgekühlten Unterarm und schuf damit eine Nähe, die Andrew nur von sehr wenigen Mitmenschen duldete. Jessica gehörte dazu. Vor zwei oder drei Jahren waren sie ein paar Mal miteinander ausgegangen, ohne dass der Funke zwischen ihnen übergesprungen war. Wahrscheinlich weckten ihre fröhlich wippenden, blonden Locken und die Sommersprossen auf ihrer Nase in ihm eine lang vergangene, romantische Erinnerung, mit der sie schlussendlich nicht hatte konkurrieren können. Seit dieser Zeit waren sie irgendwie – Freunde. »Es tut mir leid, was passiert ist«, sagte sie leise. »Ich kann dich verstehen.« Einen Moment zögerte sie, nicht sicher, ob sie die imaginäre Bombe, die Andrew in seinen Händen hielt, mit ihrem nächsten Satz zündete. »Sie hätten dich nicht suspendieren sollen«, fuhr sie schließlich fort. »Wenn du möchtest, trinken wir nach dem Dienst eine Tasse Kaffee und reden darüber.«
Das brachte Andrew endlich dazu, den Kopf in ihre Richtung zu drehen und ihn leicht zu schütteln. Soweit er sich erinnern konnte, war Jessica seit einem halben Jahr mit einem netten, unaufgeregten Banker verlobt. Er wollte nicht, dass sie in Erklärungsnöte geriet. Im Moment gab es schon genug Gerede um seine Person, weil er mitten in der Notaufnahme, in der er seit sechs Jahren arbeitete, ausgerastet war. »Das ist lieb von dir.« Seine Stimme klang so rau, dass er sie fast selbst nicht wiedererkannt hätte. »Ich gehe einfach nach Hause und schlafe mich ordentlich aus. Wenn ich wieder einen klaren Kopf habe, überlege ich mir, wie es weitergeht.«
Jessica strich mit ihrer warmen Hand über seine Schulter, und Andrew wurde bewusst, dass er noch immer seine Krankenhauskluft trug. Wie lange saß er jetzt schon hier oben?
Jessica nickte. Sie verstand, dass er seine Ruhe wollte. »Wenn ich etwas für dich tun kann, ruf mich einfach an, okay?«
»Sicher«, log er.
Die Schwester verschwand durch die Feuertür, die kurz darauf abermals aufgestoßen wurde. Andrew seufzte innerlich. Früher hatte man hier oben seine Ruhe gehabt. Er drehte sich nach dem Störenfried um.
»Sie wollen doch nicht springen, Doc?«, fragte ein junger Pfleger, den er flüchtig aus der Inneren kannte, und lehnte sich gegen die Wand des Treppenhauses. Er riss eine Red-Bull-Dose auf und leerte sie gierig mindestens bis zur Hälfte. »Soll ich einen der Psychologen anpiepsen?« Die Hilfsbereitschaft konnte den Sensationshunger in seiner Stimme kaum überdecken.
Andrew wandte den Blick wieder der Stadt zu und verdrehte die Augen. Ein Klugscheißer, dem zu viel Koffein-Taurin-Gemisch durch die Blutbahnen schoss, hatte ihm gerade noch gefehlt. Den Blödmann zu ignorieren war vermutlich am besten.
Als sein Handy klingelte, zog er es aus der Hosentasche und warf einen Blick auf das Display. Eine Handbewegung, die sich bei einem Arzt in der Notaufnahme längst in einen Reflex verwandelt hatte. Der Name, der weiß auf dem schwarzen Hintergrund leuchtete, ließ ihn für einen Augenblick das Atmen vergessen. Er wischte über die grüne Taste. »Dad? Ist alles in Ordnung?« Theodor Hunter rief Andrew nie an. Nie. Was brachte ihn dazu, um vier Uhr morgens …? Sein Puls beschleunigte sich, und sein Brustkorb zog sich zusammen, während er darauf wartete, dass sein alter Herr etwas sagte. Irgendetwas. Als es in der Leitung still blieb, fragte er noch einmal: »Dad? Bist du das?«
»Mr. … Dr. Hunter?«, verbesserte sich eine leise Frauenstimme. Sie klang jung und schien vor Angst zu zittern.
»Ja. Wer sind Sie? Und warum benutzen Sie das Telefon meines Vaters?« Noch ehe er zu Ende gesprochen hatte, kannte er die Antwort. Plötzlich fröstelte er, und ein Schauer lief ihm über den Rücken. Die Kälte setzte sich in seinem Herzen fest.
»Ich … bin … ich bin Alessia Michalson, die … ähm … Assistentin Ihres Vaters.«
Was bedeutete, sie war seine aktuelle, vermutlich zweiundzwanzigjährige Geliebte.
»Wir sind auf Cape Cod«, fuhr sie fort, und Andrew war sich sicher, sie stand kurz davor, vor Panik zu hyperventilieren. »In diesem Strandhaus … Sunset Cove? … Theodor hat … ich weiß auch nicht. Er ist … irgendwie zusammengebrochen. Aber er weigert sich, einen Arzt zu konsultieren.«
»Wie sind seine Vitalwerte?«
»Ich … ich weiß nicht.« Sie klang immer elender und schien mit der Situation völlig überfordert.
»Ist er bei Bewusstsein?«
»Ja!« Sie schrie fast, so froh schien sie darüber zu sein, endlich eine Frage beantworten zu können.
»Achten Sie darauf, dass das so bleibt. Sobald er ohnmächtig wird, rufen Sie einen Rettungswagen. Haben Sie mich verstanden?« Er wartete ihre Erwiderung nicht ab. »Ich bin unterwegs.« Ungeachtet dessen, dass sein Leben gerade um ihn herum implodierte und er der Letzte war, den sein Vater am Krankenbett sehen wollte, schwang er die Beine über die Brüstung, hastete mit ein paar schnellen Schritten an dem neugierigen Pfleger vorbei und raste die Treppe zum obersten Stockwerk hinunter. Ungeduldig hämmerte er auf den Knopf des Fahrstuhls, der ihn zu seinem Wagen in die Tiefgarage bringen würde. Um diese Tageszeit konnte er es in unter zwei Stunden auf die Halbinsel schaffen.
1
Solange Andrew ein Kind gewesen war, hatte das Überqueren der Sagamore Bridge etwas Magisches an sich gehabt. Es war der Auftakt der Ferien gewesen. Der Beginn der Freiheit, die aus Strand, Sonne und Meer bestand. Wenn er auf den Cape-Cod-Canal hinunterblickte, hatte er sich bereits den Wind vorstellen können, der an seinen Haaren riss. Er hatte die Augen geschlossen und den Geruch nach Kiefernwäldern, Seegras und gegrillten Hotdogs heraufbeschworen. Schmeckte die Mischung aus Vanille- und Erdbeereis auf der Zunge, die den Sommer ausmachte.
In dem Jahr, in dem er siebzehn wurde, verlor die Halbinsel ihren Zauber, weil ihm das Mädchen, das so lange Zeit seine Gedanken beherrscht hatte, das Herz brach. Ein paar Jahre später beschloss Andrews Mutter Georgina ausgerechnet in ihrem Strandhaus Sunset Cove, den Demütigungen seines Vaters zu entkommen, indem sie versuchte, sich das Leben zu nehmen. Sie wurde im letzten Augenblick gerettet, aber Cape Cod hatte in diesem Moment jede gute Erinnerung, mochte sie auch noch so flüchtig sein, eingebüßt und sich in einen Albtraum verwandelt. Andrew hatte nie wieder einen Fuß auf die Halbinsel gesetzt.
Im vergangenen Dezember war er zum ersten Mal zurückgekehrt. Wenn auch nur für wenige Stunden, in denen er das Leben seines jüngeren Bruders Niclas in den Händen gehalten hatte. Die Zeit hatte gereicht, zu dem Schluss zu kommen, dass auf den Hunters und ihrem Sommerhaus ganz offensichtlich noch immer ein Fluch lag. Auch wenn Niclas ihm vehement widersprach, schließlich hatte er in Sunset Cove seine große Liebe, Marie, gefunden.
Beim letzten Mal war Andrew im gleichen Tempo auf die Halbinsel gerast wie jetzt. Er nahm den Fuß nicht vom Gas, als er das Ortsschild von Eastham erreichte. Er wurde nicht langsamer, als er die Interstate 6 verließ, um hinter dem Städtchen in die von Pinien gesäumte Schotterstraße einzubiegen, die zum National Seashore führte. Bei Tageslicht hätte er im Rückspiegel die Staubwolke sehen können, die er aufwirbelte. Bis zum Sonnenaufgang war es nicht mehr lange. Aber wie sagte man so schön? Die Stunde vor Tagesanbruch war die dunkelste. So schwarz wie die Nacht fühlte sich Andrew im Inneren. Sein Wagen kam schlitternd neben der Garage zum Stehen. Er schnappte seine Arzttasche vom Beifahrersitz, sprang aus dem Auto und eilte auf die Haustür zu, die ihm von einer sehr attraktiven, fast etwas unschuldig wirkenden, jungen Frau geöffnet wurde. Andrew wusste, dass sie nicht so unverdorben war, wie sie schien. Sie war opportunistisch und geldgierig genug, sich an Theodor Hunter zu binden. Immerhin dürfte ihr diese Nacht die Augen geöffnet haben, dass sie sich auf einen verdammt alten, verdammt kranken Mann eingelassen hatte. Diese Beziehung würde sicher nicht mehr lange halten. »Sind Sie Alessia?«, fragte er.
»Ja. Danke, dass Sie gekommen sind, Dr. Hunter.« Sie rang nervös die Hände.
»Andrew«, bat er sie automatisch, ihn beim Vornamen zu nennen. »Wie ist sein Zustand?«
»Etwas besser. Er hat Tabletten genommen. Ich weiß nicht, was es war. Aber jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm.«
»Gut.« Andrew nickte. »Wo ist er?«
»In dem schönen Zimmer.« Alessia wies zum Turm, der die linke Seite des Hauses begrenzte.
Andrew stoppte abrupt. Er spürte, wie seine Gesichtszüge zu Stein wurden. Dieser verdammte Mistkerl. Im Turm befanden sich nur eine kleine Bibliothek und das Atelier seiner Mutter. Darüber lag das Schlafzimmer, das tatsächlich das schönste des Hauses war. Und in dem Georgina versucht hatte zu sterben. Wie brachte sein Vater es fertig, seine Flittchen ausgerechnet in diesem Bett …? Er schüttelte den Kopf. Diese Gedanken musste er auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Zweimal innerhalb von vierundzwanzig Stunden auszurasten war keine Option. Theodor zu treffen würde auch so schon zu einer Herausforderung werden. Er blendete die Vergangenheit aus und stürmte die Treppe zum Turmzimmer hinauf. Ohne anzuklopfen, riss er die Tür auf, durchquerte den Raum und ließ sich auf die Bettkante fallen. »Dad.«
»Was …?«
Ehe Theodor reagieren konnte, hatte Andrew bereits die Finger um sein Handgelenk geschlossen und prüfte seinen Puls. Die Hautfarbe seines Vaters schwankte zwischen Grau und Gelb, seine Augen glänzten, und kalter Schweiß stand auf seiner Stirn. Aber er schien nicht in einem Delirium zu sein, was zumindest ein gutes Zeichen war.
»Was soll das?«, fragte Theodor. Unwirsch wand er seinen Arm aus Andrews Hand. Nach einem Nierenversagen im vergangenen Herbst hatte er sich gut erholt. Aber er war noch immer auf Medikamente angewiesen und musste auf eine gesunde Lebensweise achten. Mit beidem hatte er es offenbar in letzter Zeit nicht so genau genommen, stellte Andrew mit einem Blick auf das leere Scotchglas und die blauen Pillen auf dem Nachtschränkchen fest, die eindeutig nicht zu seiner Therapie gehörten.
»Alessia hat mich angerufen. Offenbar ging es dir nicht so gut. Und du weißt genau, was Alkohol und Viagra mit deinen Nieren anstellen.«
»Mir geht es nicht so schlecht, dass ich mich von dir untersuchen lassen muss.«
Es war die immer gleiche Leier. Andrew verachtete seinen Vater dafür, wie sehr er seiner Frau mit seinen Eskapaden das Leben zur Hölle machte. Und Theodor hielt ihn für einen Nichtsnutz, der sein Leben in einer Notaufnahme vergeudete, anstatt sich im familieneigenen Finanzimperium, der Hunter Boston Bank, einzubringen. Sein Platz befand sich dementsprechend weit unten auf der Stufe aller zu erduldenden Kreaturen. »Wenn du dich nicht an das hältst, was dir die Ärzte sagen, läufst du Gefahr, ein weiteres Nierenversagen zu erleiden«, versuchte er, an die Vernunft seines Vaters zu appellieren. »Beim zweiten Mal kann dein Körper wirklich nachhaltige Schäden davontragen.« Als ob das erste Nierenversagen nicht schon dramatisch genug gewesen wäre. »Du spielst mit deinem Leben!«
»Ganz genau. Mein Leben.« Zornige Röte breitete sich auf seinem unnatürlich blassen Gesicht aus. »Damit spiele nur ich. Dir steht das nicht zu. Und jetzt verschwinde.« Theodor schlug die Bettdecke zurück und setzte sich auf. Er trug noch seine Anzughosen und ein Hemd. Die Schuhe standen vor dem Bett, doch er ignorierte sie. Seinen Vater kostete es sicher einige Anstrengung, sich hinunterzubeugen und sie anzuziehen. Eine Blöße, die er sich vor seinem Sohn nicht geben würde. »Alessia, meine Jacke«, herrschte er seine Geliebte an. Sie zuckte zusammen und griff nach seinem Jackett, das über einer Stuhllehne hing. Etwas mühsam streifte er es über und setzte sich leicht schwankend in Bewegung. »Wenn ich zu dem Schluss komme, einen Arzt zu brauchen, werde ich einen Spezialisten konsultieren«, sagte er über die Schulter, ehe er durch die Tür hinaustrat.
Andrew rieb sich über das Gesicht. Warum nur war jedes Gespräch mit seinem Vater ein solcher Kampf? Erkannte er denn nicht, dass er seine Gesundheit aufs Spiel setzte? Er folgte seinem alten Herrn und Alessia. »Dad«, versuchte er es noch einmal und legte bewusst einen ruhigen Ton in seine Stimme. Auf der Treppe stützte sich sein Vater schwer auf die junge Frau, die flehend zu ihm aufblickte. »Lass mich dir doch wenigstens helfen.«
»Ich brauche deine Hilfe nicht.« Sie hatten das Erdgeschoss erreicht, und Theodor ging auf die Haustür zu. »Alessia, wir fahren.«
»Dad. Verdammt noch mal! Hier geht es doch nicht darum, dass du seit fünfzehn Jahren sauer auf mich bist, weil ich lieber Medizin studieren wollte, als in deiner Bank zu arbeiten. Hier geht es um dich! Wenn du so weitermachst, brauchst du eine Nierentransplantation.«
»Was dann ebenfalls mein Problem wäre«, gab Theodor über die Schulter zurück. Er öffnete die Tür, und ein Schwall kühle, salzige Seeluft drang ins Haus, bevor sie mit einem unschönen Knall ins Schloss fiel und Andrew in der Stille zurückließ. Erschöpft lehnte er sich gegen die Wand. Sein Vater konnte ihn mit seinen Worten noch genauso treffen wie als kleinen Jungen, wenn er seinen Ansprüchen nicht gerecht geworden war. Er legte den Kopf in den Nacken und atmete mit geschlossenen Augen tief durch. Warum machte es ihm noch immer so viel aus? Er gestand es sich selten ein, aber es ließ ihn nicht kalt, wenn sein Vater wie ein Hurrikan durch sein Leben fegte und eine Spur der seelischen Verwüstung hinterließ.
Wahrscheinlich lag es einfach an dieser verdammten Müdigkeit, die zentnerschwer auf ihm lastete. Sie raubte ihm die Rationalität. Sie ließ ihn so verdammt dünnhäutig werden. Andrew drehte sich um und schleppte sich zu der Couch, die vor der breiten Fensterfront stand. Dieser Platz war einer der schönsten im ganzen Haus. Von hier konnte man den Leuchtturm auf der linken Seite der Bucht sehen. Davor verlief der feine Sandstrand in einem halbmondförmigen Kreis bis zu der Klippe am rechten Rand dieses kleinen Paradieses. Es öffnete sich der Blick auf die unendliche Weite des Atlantiks, über dem die ersten fliederfarbenen Schlieren den nahenden Sonnenaufgang ankündigten. Andrews Augen brannten vor Müdigkeit. Er konnte sich nicht erinnern, wann er zum letzten Mal so erschöpft gewesen war. Er schloss die Lider, und das Brennen ließ ein wenig nach. Nur einen Moment ausruhen, dachte er. Einen Moment. Dann würde er überlegen, was er als Nächstes tun würde.
Andrew erwachte mit einem Ruck. Die Sonne, die hoch über dem weiten Meer stand, blendete ihn. Für einen Moment wusste er nicht, wo er sich befand. Dann erinnerte er sich wieder daran, dass er wegen seinem Vater nach Sunset Cove gerast war. Offenbar war er genau so eingeschlafen, wie er sich hingesetzt hatte. Den Kopf an die Sofalehne gelegt. Er rieb sich über die steifen Nackenmuskeln, stand auf und streckte seine schmerzenden Glieder. Dann zog er sein Handy aus der Hosentasche, um einen Blick auf die Uhrzeit zu werfen, und stellte fest, dass er jede Menge Nachrichten und Anrufe verpasst hatte. Er musste geschlafen haben wie ein Toter. Denn das Klingeln seines Handys überhörte er nie. Es war ein Reflex, jeden eingehenden Anruf anzunehmen.
Er scrollte durch die Nachrichten, während er sich eine Flasche Wasser aus der Küche holte. Gierig trank er. Wenn er es nicht besser gewusst hätte, hätte er glatt glauben können, in der vergangenen Nacht einen über den Durst getrunken zu haben. Seine Mutter wollte wissen, was passiert war. Das wunderte ihn nicht wirklich. Georgina verließ ihren goldenen Käfig in Beacon Hill meist nur, um an irgendwelchen vermeintlich wichtigen Teegesellschaften oder Dinnerpartys teilzunehmen. Und doch hatte sie ihre Ohren überall. Mit Sicherheit wusste sie längst von seinem Ausraster im Krankenhaus. Genauso wie sie – von der eigentlichen Assistentin seines Vaters – erfahren hatte, dass ihr Ehemann im Sommerhaus auf Cape Cod zusammengebrochen war.
Dr. Burnstine, die Vorsitzende der Ethikkommission des Boston General, hatte ihm eine Sprachnachricht hinterlassen und forderte ihn auf, um Punkt zwölf Uhr vor dem Gremium zu erscheinen, um Stellung zum Vorfall der letzten Nacht zu nehmen. Erst jetzt warf Andrew einen Blick auf die Uhr. Zwölf Uhr dreiunddreißig. Tja, diesen Termin hatte er verpasst. Scheißegal, war das einzige Wort, das ihm durch den Kopf schoss. Er war über sich selbst überrascht. Noch nie war es ihm passiert, dass die Arbeit in der Notaufnahme nicht an erster Stelle gestanden hatte. Eigentlich müsste er jetzt zum Telefon greifen, Dr. Burstines Nummer wählen und beten, dass die Kommission seinen Ausbruch auf vorübergehende Unzurechnungsfähigkeit, geistige Umnachtung oder Burn-out zurückführen würde. Er hoffte, dass er eine Chance bekam, sein Fehlverhalten wiedergutzumachen. Durch Zusatzdienste. Doppelschichten. Was auch immer. Aber im Grunde genommen tat es ihm nicht leid, auf Walsh losgegangen zu sein. Er öffnete und schloss seine rechte Faust. Wenn er etwas bereute, dann, dass seine Kollegen ihn davon abgehalten hatten, diesem Arschloch mitten ins Gesicht zu schlagen. Nur Millimeter hatten gefehlt, und er hätte zumindest etwas Genugtuung empfinden können.
Abgesehen von diesem Gefühl, hatte ihn die Erschöpfung noch immer fest im Griff, und alles um ihn herum schien in einem wattigen Nebel zu verschwinden. Bevor er mit irgendjemandem sprach, brauchte er einen klaren Kopf, und den würde er auf dieser Couch ganz sicher nicht bekommen. Mit der Wasserflasche in der einen und seinem Handy in der anderen Hand schleppte er sich die weiße Holztreppe, wo an der Wand stilvoll gerahmte Fotografien hingen, hinauf in das Zimmer, das er schon als Kind in den Ferien bewohnt hatte. Die zeitlosen, weißen Möbel waren noch die gleichen, stellte er fest. Die bodenlangen, luftigen Vorhänge waren offenbar zwischenzeitlich ausgetauscht worden. Genau wie die Dekoration, die aus weiteren Schwarz-Weiß-Fotos und Treibgutstücken bestand. Ohne die Laken aufzudecken, ließ Andrew sich auf das Bett fallen. Er hörte die Wellen des Atlantik, die träge, aber machtvoll gegen die Klippen prallten. Schon im nächsten Moment sank er abermals in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Erst siebzehn Stunden später kam er wieder zu sich. Ausgeruhter und erholter als seit Jahren.
Nach einer ausgiebigen Dusche zog er eine Jogginghose und einen Kapuzenpulli an, die sein Bruder offenbar bei seinem Auszug aus dem Strandhaus vergessen hatte, und ging ins Erdgeschoss hinunter. Er brühte sich einen Kaffee auf und stellte mit einem Blick in den Kühlschrank fest, dass Alessia offenbar gern kochte. Sein Vater hätte mit der Flut an Lebensmitteln, die hier lagerten, sicherlich nichts anfangen können. Die beiden waren verschwunden. Das war aber kein Grund, all diese Leckereien in der Küche vergammeln zu lassen. Andrew war kein so guter Koch wie sein Bruder Niclas, aber er kam zurecht. Er belegte zwei Bagel mit Frischkäse, Schinken, Cheddar und Salat und trug sie gemeinsam mit seinem Kaffee auf die Terrasse. Er setzte sich auf die oberste Stufe der Holztreppe zum Strand und verschlang sein Frühstück wie ein Wolf, während sich vor ihm die Sonne aus dem Ozean erhob. Sein zweiter Sonnenaufgang innerhalb von zwei Tagen. Andrew hatte das Gefühl, dass der riesige Feuerball genau wie das längst überfällige Essen seine leeren Energiereserven füllte, je weiter er sich in den Himmel erhob. Der Wind wehte ihm kalt ins Gesicht, aber der Frühling ließ sich bereits erahnen.
Er stellte den Teller zur Seite, holte sein Handy aus der Tasche und scrollte durch die Anrufe und Nachrichten. Dr. Burnstine hatte zum zweiten Mal auf seine Mailbox gesprochen. Die Ethikkommission hatte ihn in seiner Abwesenheit für vier Wochen vom Dienst im Krankenhaus suspendiert. Sie gab ihm mit ihrer schneidenden Stimme deutlich zu verstehen, dass sein Nichterscheinen vor dem Gremium als Affront betrachtet wurde, und Andrew war sehr wohl klar, dass sie ihm die in seiner Situation höchstmögliche Strafe aufgebrummt hatten. Wäre er demütig gewesen und hätte den Damen und Herren den notwendigen Respekt entgegengebracht, hätte sich der Ausschluss vielleicht auf zwei Wochen verringert. So aber …
Er scrollte weiter durch das Telefonbuch zur Nummer seines Bruders und wählte. Burnstine hatte ihm die Entscheidung leicht gemacht. Er hatte so gut geschlafen wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Er hatte Appetit gehabt, und das, was er gegessen hatte, hatte sogar nach etwas geschmeckt. So gut hatte er sich wirklich lange nicht mehr gefühlt. Es war, als tauchte er aus dem Wasser auf und sei zum ersten Mal wieder in der Lage, frei zu atmen. Andrew wartete, bis Niclas abhob.
»Hey Drew, was gibt’s Neues?«, fragte sein Bruder zur Begrüßung.
»Ich bin in Sunset Cove und brauche deine Hilfe«, erwiderte Andrew ohne Umschweife.
Das brachte seinen Bruder dazu, für einen Moment, der sich zog wie Kaugummi, zu schweigen. Er konnte sich Niclas’ überraschtes Gesicht bildlich vorstellen. »Tatsächlich?«, fragte sein Bruder lang gezogen. Sie wussten beide, dass er damit nicht die Tatsache meinte, dass Andrew Hilfe brauchte. »Ausgerechnet dich verschlägt es in das verfluchte Haus«, hielt Niclas ihm seine eigenen Worte vor.
»Es gibt offensichtlich Dinge, auf denen ein weit größerer Fluch lastet.« Meine Karriere zum Beispiel, fügte er in Gedanken hinzu und stand auf, um sich noch eine Tasse Kaffee zu holen. »Kannst du mir für ein paar Tage Klamotten leihen?«
»Will ich wissen, warum du ohne Gepäck auf Cape Cod herumhängst?« Die Neugier hinter den Worten seines Bruders war nicht zu überhören.
»Das willst du. Und ich werde es dir auch erzählen, sobald du hier bist«, versprach er.
»Ich habe noch einige Dinge zu erledigen. Reicht es heute Nachmittag?«
»Sicher. Ich löse mich ja nicht in Luft auf.« Andrew stellte seine Kaffeetasse unter die Maschine und wartete auf den Satz, der unweigerlich kommen würde.
»Auf diese Geschichte bin ich wirklich gespannt«, sagte sein Bruder prompt.
*
Holly Clarks Herz lief über vor Mitgefühl. Mitgefühl für ihren siebzehnjährigen Bruder Jackson, der, die Hände in seine rostroten Locken gekrallt, am Tresen ihrer Bar hockte. Er stöhnte, als ob er seelische Schmerzen litte, ehe er seinen Kopf theatralisch auf sein Algebraheft fallen ließ. »Ich hasse Mathe«, tat er zum gefühlt tausendsten Mal kund.
Holly öffnete ein Mountain Dew, füllte es in ein Glas voller Eiswürfel und schob es neben das mitgenommen aussehende Heft.
Ihre Freundin Marie McMillan, die es sich seit dem letzten Jahr zur Aufgabe gemacht hatte, Jackson den Umgang mit Zahlen näherzubringen, zwinkerte ihr zu. Ihr Labrador Sam lag gemeinsam mit Hollys Retriever Potter, der zwar körperlich ausgewachsen, im Kopf aber noch immer ein Kind war, unter dem Tresen.
Während Marie die Aufgabe noch einmal mit Engelsgeduld Schritt für Schritt mit Jackson durchging, ließ Holly den Blick durch ihre kleine Welt schweifen. Sonnenstrahlen fielen, gefiltert von den Sprossenfenstern, auf den dunklen Holztresen, über den seit Jahrzehnten regionale Biere und ausgesuchte Whiskeys den Besitzer wechselten. Rachel stand am Empfang und bedachte ein älteres Ehepaar mit ihrem einnehmenden Lächeln, ehe sie sie in den Restaurantbereich des Fairway führte. Seit Holly den Laden vor einem Jahr von ihrem Vater übernommen hatte, hatte sie viel Zeit und Kreativität in die Einrichtung, die Speisekarte und Getränkeauswahl gesteckt. Nur das Codfish-Rezept hatte sie auf der Karte gelassen. Schließlich war das Restaurant genau dafür bis weit über die Halbinsel hinaus bekannt. Die Geschäfte liefen gut, auch wenn sie während des Winters nach wie vor nicht ohne einen Nebenjob über die Runden kam. Aber das machte nichts. Holly konnte ihren Traum leben und schaffte es inzwischen sogar hin und wieder, einen freien Nachmittag oder Abend herauszuschinden, um ihn mit Freunden zu verbringen. Freunden wie Marie McMillan, auch wenn sie vor einem Dreivierteljahr nicht im Geringsten damit gerechnet hätte, dass dieses spröde Wesen überhaupt menschliche Bindungen eingehen konnte.
Marie legte Jackson die Hand auf die Schulter und lächelte Holly an. Ihr Bruder klappte das Heft zu und verschwand mit Lichtgeschwindigkeit aus der Bar. Nicht, ohne rot anzulaufen, als er an der lächelnden hübschen Rachel vorbeischlitterte. Holly seufzte innerlich. Ihr Bruder war ein süßer Kerl, aber eben auch ein typischer, siebzehnjähriger Trottel, der nicht begriff, dass er nur seinen Mut zusammennehmen müsste, um das Herz seiner schönen Mitschülerin zu gewinnen. Der sehnsüchtige Blick, den das Mädchen Jackson hinterherwarf, sprach Bände.
»Man würde ihm am liebsten einen Schubs in die richtige Richtung geben«, sagte Marie leise. Sie war Hollys Blick gefolgt.
»Aussichtslos«, beschied Holly. »Teenager wissen nämlich grundsätzlich alles besser als du oder ich.« Sie zwinkerte Marie zu und füllte Cola in ein Glas. Gemeinsam mit einer Schale Brezeln schob sie es über den Tresen und ergriff mit der anderen Hand das halb leere Mountain-Dew-Glas ihres Bruders, um es wegzuräumen. In der Bar war im Moment nicht viel los. Die Gäste waren mit Getränken versorgt. Wie es sich in den letzten Monaten zwischen ihnen eingespielt hatte, nutzten sie die Zeit, um ein wenig zu tratschen. Marie, die sich vor einem halben Jahr mit Sicherheit nicht hätte vorstellen können, jemals eine Freundin wie Holly zu finden, sich in einen Mann wie Niclas Hunter zu verlieben oder einfach nur – wie jeder normale Mensch zu leben, schien diese Momente sehr zu genießen.
Mit glitzernden Augen lehnte sich die Freundin vor. »Hast du es schon gehört? Andrew ist auf der Halbinsel.«
Der Name ließ die Welt um Holly herum gefrieren, als wäre sie in flüssigen Stickstoff getaucht worden. Sie hielt den Atem an. An dem Kloß, der in ihrem Hals saß, ließ sich kein Sauerstoff vorbeipressen.
»Holly? Hast du mich gehört?«
»Was?« Sie zwang sich in die Wirklichkeit zurück. Marie sah sie besorgt an, und Holly rang sich ein Lächeln ab. »Ja …« Sie rieb sich über die Stirn und holte zu einer diffusen Handbewegung aus. »Ich war in Gedanken noch bei meinem Lieferanten. Entschuldige. Du sagtest, Andrew …«, der Name brannte wie Säure auf ihrer Zunge, »… ist auf Cape Cod. Andrew Hunter?«
»Der einzige Andrew, den wir beide kennen.« Marie legte den Kopf schräg und betrachtete sie. Bestimmt hatte sie während der vier Jahre im Gefängnis gelernt, selbst die kleinste Regung im Gesicht eines anderen Menschen wahrzunehmen.
Holly wollte ihr keinen Einblick in ihre Gedanken geben. Sie musste erst einmal selbst verstehen, was es bedeutete, dass Andrew Hunter und sie sich auf denselben tausend Quadratkilometern aufhielten. Diese Fläche war eindeutig zu klein für sie beide. Sie drehte sich zu den Regalen hinter dem Tresen um und begann, die Gläser geradezurücken, bis die gleichmütige Maske, die sie über ihr Gesicht zog, fest genug saß. »Was ist los mit dieser verdammten Hunterbrut?«, fragte sie in ihrer gewohnt schnippischen Art, die sie nicht unterdrücken konnte, wenn es um die Bewohner von Sunset Cove ging. »Haben sie vor, die Halbinsel zu übernehmen?«, fragte sie und drehte sich wieder zu ihrer Freundin um.
Marie knabberte an einer Brezel, die sie aus dem Schälchen gefischt hatte. »Vielleicht. Wer kann das bei den Hunters schon wissen?« Sie lächelte und war in Gedanken offenbar bei Andrews Bruder Niclas, der zwar nicht die Halbinsel – dafür aber Marie erobert hatte. »Er ist wohl ziemlich spontan im Strandhaus aufgekreuzt. Nic fährt gerade zu ihm, um ihm ein paar Klamotten zu bringen.«
Holly zuckte die Schultern in einer gleichgültigen Geste, von der sie hoffte, dass Marie sie ihr abnahm. »Ich bin tatsächlich ein wenig erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass es ihn in diesem Leben noch einmal auf die Halbinsel verschlägt.« Sie warf Marie einen funkelnden Blick zu. »Eines ist jedenfalls so sicher wie das Amen in der Kirche. Andrew Hunter wird keinen Fuß über die Schwelle meines Restaurants setzen.«
Marie legte die Hand sanft über ihre, und Holly wurde bewusst, dass sie das Geschirrtuch, mit dem sie die Gläser polierte, zwischen ihren Fingern zerknüllte. »Du weißt, dass du mir jederzeit erzählen kannst, warum Drew auf deiner Abschussliste ganz oben steht.«
»Ja, das weiß ich.« Holly zog ihre Finger unter Maries Hand hervor und drückte sie kurz, bevor sie nach dem nächsten Glas griff, um es zu polieren. »Es ist so, wie ich es dir erzählt habe«, hangelte sie sich an dem Teil entlang, den sie nicht in ihrem Inneren verschloss und für sich behielt. »Reiche kleine Jungen, die Menschen nur in die Kategorien ›Kann segeln‹ und ›Kann es nicht‹ einteilten, entwickelten sich zu arroganten Teenagerarschlöchern, die diejenigen mobbten, die nicht zu ihrem elitären Kreis gehörten. Wie du dir denken kannst, gehörte ich nicht zu diesem Zirkel. Ende der Geschichte.«
Das war bei Weitem nicht die ganze Story. Marie lehnte sich zurück und nippte an ihrer Cola. Ihr Blick sagte deutlich, dass sie Holly diese Version nicht abnahm. Aber sie war ihre Freundin. Sie würde warten, bis Holly bereit war, ihr die ganze Geschichte zu erzählen. Was vermutlich nie der Fall sein würde.
2
Andrew wartete, bis die Rücklichter des Wagens seines Bruders aus seinem Blickfeld verschwanden. Dann zückte er sein Handy und wählte die Nummer seiner Mutter. Die Stunde, die Niclas hier gewesen war, hatte ihm gutgetan. Natürlich hatte sein Bruder wissen wollen, wieso er auf Cape Cod gestrandet war, nachdem er eine Sporttasche mit Klamotten auf die Couch geworfen hatte.
»Ich bin wegen Dad gekommen. Er hatte wieder Nierenprobleme, aber glaub nur nicht, dass er mich an sich herangelassen hätte. Eines seiner Flittchen hat mich angerufen, er ist total ausgeflippt, als ich aufgetaucht bin.« Andrew zuckte die Schultern, als würde es ihm nichts ausmachen. »Ich musste es doch zumindest probieren, oder? Er ist sofort abgereist, aber der Kühlschrank war voll. Also habe ich mir überlegt, eine Auszeit zu nehmen und eine Weile hierzubleiben. Zeit mit dir und Marie zu verbringen«, hatte Andrew versucht, die Situation zu erklären.
Und sich damit einen schiefen Blick seines Bruders eingefangen. Sie standen sich nahe, keine Frage. Aber sie hatten beide hart gearbeitet – sein Bruder als Staatsanwalt und er als Arzt –, was ihnen nicht viel Zeit für gemeinsame Treffen ließ. Oft hatten sie es nur ihrem Freund Jake zu verdanken, dass sie sich überhaupt sahen, weil er sie davon überzeugte, dass es neben der Arbeit auch hin und wieder Zeit für ein gemeinsames Bier geben musste.
»Wir beide wissen, dass du nicht besonders spontan bist«, bemerkte Niclas und nahm zwei Bier aus dem Kühlschrank. Er hatte Andrew eines gereicht und war auf die Terrasse vorausgegangen.
Andrew musste seinem Bruder recht geben. Er stellte normalerweise nichts über seine Arbeit in der Klinik. Nicht einmal seine Familie.
»Du willst also noch nicht darüber reden?«, fragte Niclas, als Andrew nicht auf seine Behauptung eingegangen war.
»Noch nicht«, antwortete er leise.
»Kein Problem.« Niclas schlug ihm auf die Schulter und setzte sich auf die oberste Stufe der Strandtreppe. Andrew hatte sich neben ihn gesetzt. Gemeinsam hatten sie auf die Ebbepfützen gestarrt und ihr Bier getrunken, ohne viel zu reden.
Als Niclas schließlich gegangen war, hatte er darauf bestanden, dass sie den morgigen Abend gemeinsam verbrachten. »Ich will nicht, dass du hier den Einsiedler spielst, so wie ich es im letzten Herbst getan habe«, hatte er ihm zugerufen, bevor er in seinen Wagen gesprungen war.
Seine Mutter ließ sich Zeit. Andrew ging in die Küche und holte sich ein weiteres Bier. Als er an seinen neuen Stammplatz auf der Strandtreppe zurückkehrte, nahm sie seinen Anruf endlich an.
»Drew, mein Schatz! Das wurde höchste Zeit. Was ist passiert? Wie geht es dir? Und vor allem: Wo bist du?« Ihre Stimme klang für die Tageszeit erstaunlich fest und klar. Sie hatte heute also noch nicht zu tief ins Glas geschaut, was Andrew beruhigte.
»In dieser Reihenfolge?«, fragte er mit einem Lächeln in der Stimme.
»Nimm mich nicht auf den Arm, mein Junge. Wie geht es dir?«, wiederholte sie. Diese Frage erschien ihr offenbar am wichtigsten.
Andrew trank einen Schluck Bier und folgte mit dem Blick den Möwen, die im Tiefflug über die Tidentümpel jagten. »Um ehrlich zu sein: Ich weiß es nicht«, gab er schließlich zu. »Die Dinge sind mir ein wenig entglitten, könnte man sagen. Du hast sicher von dem Vorfall in der Klinik gehört.«
Sie seufzte. »Vier Versionen insgesamt. Die zum Teil ziemlich voneinander abweichen. Dein Blickwinkel wäre also sehr willkommen.«
Er stellte das Bier neben sich und fegte mit der Handfläche ein paar der Sandkörner, die der Wind den Tag über vom Strand hier heraufgetragen hatte, vom zerklüfteten Holz der Stufe. »Im Moment möchte ich nicht darüber reden. Fakt ist, dass ich für ein paar Wochen beurlaubt bin. Ich bin auf Cape Cod«, gestand er ihr. Seine Entscheidung würde sie mit Sicherheit nicht verstehen.
»In Sunset Cove«, sagte sie, und ihre Stimme klang wie ein rostiges Türscharnier. »Um Himmels willen, Andrew! Was ist nur los mit dir? Ausgerechnet in dieses verdammte Haus musstest du dich verkriechen!«
»Ich will Zeit mit Nic und Marie verbringen«, versuchte er es mit der gleichen, fadenscheinigen Begründung, die er bereits seinem Bruder aufgetischt hatte.
Georgina quittierte dies lediglich mit einem wenig damenhaften Geräusch. »Ich weiß, dass dein Vater mit seinem Flittchen im Strandhaus war. Ich weiß auch, dass er seine Gesundheit vor die Hunde gehen lässt, um dieses junge Miststück zu beeindrucken. Aber er ist wieder in Boston. Und – unglaublich, aber wahr …«, konnte sie sich den Sarkasmus nicht verkneifen, »… er lebt doch tatsächlich noch. Was hält dich also noch auf der Halbinsel? Und erzähl mir nicht, dass es dein Bruder ist. Du hasst Cape Cod.«
Das stimmte nicht ganz, war ihm bewusst geworden. Andrew atmete die kalte, frische Luft tief ein. Er liebte das Meer, den Strand und den Wind. Der Leuchtturm war ebenso Teil dieser schönen Umgebung wie die Klippe und das Strandhaus. Was er hasste, waren die Dinge, die sich hier in der Vergangenheit ereignet hatten. Ob er sie mit der Zeit würde ausblenden und von der bezaubernden Seite dieses Ortes trennen können, würde sich zeigen. Seine Mutter jedenfalls war dazu nicht in der Lage.
»Hast du mit Dad gesprochen? Weißt du, ob er beim Arzt war?«, wechselte Andrew deshalb das Thema. Eine Möwe stürzte sich vor seinen Augen auf eine andere und rammte sie mit einem Bodycheck. Voller Mitgefühl für den ins Trudeln geratenen Vogel verzog Andrew das Gesicht.
»Soweit ich weiß, hat er morgen einen Termin bei dem Nephrologen, der ihn auch das letzte Mal behandelt hat. Dr. Leeberman«, sicherte Georgina sich wieder seine Aufmerksamkeit. »Er hat sich schon wieder in seinem Büro verschanzt, und ich habe es aufgegeben, ihn davon zu überzeugen, auf seine Gesundheit zu achten. Aber zumindest hat er diese Untersuchung vereinbart. Hoffen wir, dass er nicht wieder irgendein Firmenimperium übernehmen muss und den Doktor versetzt.«
Obwohl Andrew wusste, dass er auch beim nächsten Versuch keinen Erfolg haben würde, versprach er Georgina, es noch einmal zu versuchen. »Eine Bitte habe ich noch«, sagte er am Ende ihres Gesprächs. »Könntest du in mein Apartment gehen, einen Koffer Klamotten zusammenpacken und ihn mir schicken?«
»Ach, Drew.« Sie seufzte. »Natürlich schicke ich dir etwas zum Anziehen. Aber du musst mir versprechen, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen.« Ich habe doch sonst niemanden, hallten die unausgesprochenen Worte nach – und hinterließen einen bitteren Geschmack auf seiner Zunge. Er liebte seine Mutter. Es gehörte zu seinen Pflichten, für sie da zu sein. Aber sie stützte sich ausschließlich auf ihn. Mit einer Selbstverständlichkeit, die ihm die Luft zum Atmen nahm. Diese Gedanken brachten ihn dazu, eine leise Entschuldigung in den auffrischenden Wind zu murmeln. Vielleicht war es tatsächlich ganz gut, sich eine Zeit lang an einem Ort zu verstecken, den Georgina mied.
Nachdem Andrew das Gespräch mit seiner Mutter beendet hatte, versuchte er es bei seinem Vater, wurde aber direkt zu dessen Assistentin durchgestellt. Er konnte sich gut an die Zeit erinnern, als Theodor Hunters Vorzimmer noch von Jakes Großmutter Moira gemanagt wurde. Sie hatte sich nie von seinem Vater auf der Nase herumtanzen lassen. Die Frauen, die diesen Job nach ihrer Pensionierung übernommen hatten, brachten nicht einmal im Ansatz den Schneid der alten Dame auf. So auch die aktuelle Assistentin, die offenbar angewiesen worden war, Andrew abzuwimmeln und auf keinen Fall irgendwelche gesundheitlichen Informationen an ihn herauszugeben.
Andrew kniff frustriert die Augen zusammen. Das Spiel, das sein Vater spielte, wurde langsam ätzend. Begriff er denn nicht, dass die Machtdemonstrationen seiner Gesundheit nur schadeten? Er legte auf und probierte es bei dem Arzt, der Theodor wegen seines Nierenversagens behandelt hatte. Dr. Leeberman bestätigte ihm, was seine Mutter bereits gesagt hatte. Sein alter Herr hatte am nächsten Morgen einen Termin mit dem Spezialisten, der ihm zusagte, ihn auf dem Laufenden zu halten.
Andrew rieb sich seine Bartstoppeln, was ein kratzendes Geräusch verursachte. Seine Familie kostete ihn immer Kraft, laugte ihn aus bis zur Erschöpfung. Seinem Vater hatte Andrew es nicht recht machen können. Theodor hatte darauf bestanden, dass er als erstgeborener Sohn in seine Fußstapfen trat und der Hunter Boston Bank zu noch mehr Reichtum und Ruhm verhalf. Er hatte getobt, als Andrew ihm eröffnet hatte, dass er stattdessenMedizin studieren würde. Alle Hoffnungen des Alten hatten daraufhin auf Niclas gelegen, der sich ebenfalls gegen die Bank entschieden und Jura studiert hatte. Auch diese Absage traf ihren Vater hart. Aber aus irgendeinem Grund war das Verhältnis zwischen Niclas und Theodor von jeher besser gewesen als zwischen Andrew und seinem Vater. Er hatte die Weibergeschichten schon immer verabscheut, ganz besonders, nachdem seine Mutter am Verhalten ihres Mannes zerbrochen war und sich fast das Leben genommen hätte. Niclas hingegen war auch nicht unbedingt begeistert von Theodors Affären, das größere Problem aber hatte er mit der Schwäche ihrer Mutter, die sich in deutlich überhöhtem Alkohol- und Psychopharmakakonsum äußerte. Sie hatten beide nie verstanden, warum Georgina sich nicht einfach von Theodor trennte. Während Andrew ihre Entscheidung jedoch akzeptierte, verachtete Niclas sie dafür.
*
Theodor Hunter hatte sich in seinem bequemen Bürosessel zurückgelehnt und wartete darauf, dass das Hausmädchen Dr. Leeberman in sein Büro führte. Er hatte die notwendigen Untersuchungen in der Klinik des Spezialisten hinter sich gebracht, weil sich das nicht anders bewerkstelligen ließ. Er war allerdings nicht bereit, sich dort auf eine Stuhlkante zu hocken wie ein Bittsteller und darauf zu hoffen, dass der Herr Doktor gute Nachrichten überbrachte. Deshalb hatte er den Termin kurzerhand in seine Privaträume ins Hunter House verlegt. Hier war er derjenige, der hinter dem Schreibtisch saß. Hier hatte er die Macht. Ein Gefühl, das er dringend brauchte, nachdem ihm seine Sterblichkeit so ungeschönt vor Augen geführt worden war. Der Zusammenbruch im vergangenen Dezember hatte ihn tief in seinem Inneren erschüttert. Auch wenn das niemand, absolut niemand wusste. Zum ersten Mal in den einundsechzig Jahren seines Lebens war ihm die Endlichkeit seines Lebens bewusst geworden. Er hatte begriffen, dass es jederzeit vorbei sein konnte. Dass er sich womöglich abends ins Bett legte und die Augen schloss, nur um sie am nächsten Morgen nicht mehr zu öffnen. Die Ärzte hatten ihm erzählt, wie viel Glück er gehabt hatte. Wie knapp er dem Tod von der Schippe gesprungen war.
Anstatt vorsichtiger zu werden, hatte diese Erkenntnis ihn dazu gebracht, genau das Gegenteil zu tun. Theodor wollte leben, wollte spüren, dass es noch nicht vorbei war. Er wollte die besten Finanzdeals abschließen, die glatte Haut junger Frauen unter seinen Fingern spüren. Vielleicht hatte er es ein wenig übertrieben, nachdem es mit seiner Gesundheit wieder aufwärtsgegangen war.
Zudem hing das Schicksal der Bank und damit das seiner Familie von ihm ab. Keiner seiner beiden Söhne hatte es für notwendig erachtet, in die Firma einzusteigen. Andrew als sein Ältester hätte die Geschäfte übernehmen müssen, so wie er von seinem Vater. Das gehörte zu seinem Erbe, war Teil der Familiengeschichte. Statt seinen Pflichten nachzukommen, spielte er Doktor. Was sollte Theodor also tun, außer mit der gleichen Energie wie bisher weiterzumachen? Nur so ließ sich das Imperium der Hunters erhalten.
Das Hausmädchen klopfte und machte die Tür auf, die in die getäfelte Holzwand eingelassen war. Die Verkleidung der Wände sollte nicht nur männlich und erhaben wirken. Sie bot auch einen perfekten Schallschutz. Heikle Gespräche führte Theodor deshalb oftmals lieber hier als in seinem Büro im Hunter Building in der Stadt.
»Dr. Leeberman für Sie, Mr. Hunter«, kündigte das Mädchen seinen Gast an.
»Danke, Marisol.« Theodor stemmte sich aus seinem Sessel hoch und reichte dem hageren großen Mann, dessen Anzüge immer aussahen, als wären sie eine Nummer zu groß, die Hand, als der vor seinen Schreibtisch trat. »Dr. Leeberman.«
»Mr. Hunter.« Der Arzt nickte ihm zu und stellte seine abgenutzte braune Aktentasche neben einen der beiden Stühle, die vor dem Schreibtisch platziert waren, und schob abwesend seine Drahtbrille hoch.
»Nehmen Sie Platz«, sagte Theodor mit einer einladenden Geste und ließ sich dann auf seinen Stuhl zurücksinken. Natürlich hätten sie bequem in den Clubsesseln vor dem Kamin sitzen können. Unter dem überdimensionalen Elchgeweih, das er als Trophäe von einer seiner ersten Jagden als junger Mann mitgebracht hatte. Aber der riesige Mahagonischreibtisch, ein antikes Möbelstück, das Theodor sehr schätzte, stand in all seiner Wuchtigkeit zwischen Leeberman und ihm und wirkte wie ein Schutzwall – der ihn vor dem bewahren würde, was auch immer der Arzt ihm zu sagen hatte. »Kann ich Ihnen etwas anbieten, Doktor?«, fragte er.
»Danke. Nein.«
Leeberman setzte sich, und Theodor gab Marisol mit einem Zeichen zu verstehen, dass sie verschwinden sollte. Leise schloss sie die Tür hinter sich.
Theodor legte die flachen Hände auf das dunkle, polierte Holz des Schreibtischs. Wann hatte seine Haut begonnen, so fleckig und faltig zu werden? Er hob den Blick von seinen Fingern und sah den Arzt an. Mit Sicherheit hatte er keine guten Neuigkeiten. »Spucken Sie es aus, Doktor«, sagte er schlicht.
Leeberman bückte sich und zog eine Mappe aus seiner Aktentasche. Er schlug sie auf, überflog das oberste Blatt, so, als müsse er sich versichern, dass sich die Fakten nicht geändert hatten, seit er zum letzten Mal einen Blick darauf geworfen hatte. Dann hob er den Kopf und sah Theodor ernst an. »Es sieht nicht gut aus, Mr. Hunter«, sprach er die Wahrheit aus. Ohne um den heißen Brei herumzureden. So wie er es mochte.
Theodor lehnte sich in seinem Sessel zurück und ließ seinen Blick über die Ölporträts seiner Vorfahren gleiten. Hatte einer von ihnen einen so verdammt schwachen, verräterischen Körper gehabt? Dazu gab es keine Aufzeichnungen in der hunterschen Chronik. Alle Familienpatriarchen waren steinalt geworden, bis auf Corporal George Benedict Hunter, den es mit dreiundzwanzig im Unabhängigkeitskrieg erwischt hatte. Aber wenn er nicht auf dem Schlachtfeld ein Bein verloren und ein paar Tage später im Lazarett an Wundbrand gestorben wäre, hätte seine Lebenserwartung wahrscheinlich neunzig Jahre betragen. Da war sich Theodor sicher. »Spannen Sie mich nicht länger auf die Folter«, forderte Theodor den Arzt auf.
Leeberman schob die Mappe mit Theodors Testergebnissen und Untersuchungen über den Schreibtisch. »Ich habe Ihnen bereits im Dezember erklärt, wie wichtig es für Sie ist, dem Rat der Ärzte ohne Diskussion …« Er machte eine Kunstpause, um seine nächsten Worte zu betonen. »… geradezu sklavisch zu folgen. Ihr Leben hängt davon ab, Mr. Hunter. Ihre Testergebnisse zeigen, dass Sie sich in den ersten Monaten recht gut an ihren Medikamentenplan und die Diät gehalten haben. Aber in den letzten Wochen haben Sie alles schleifen lassen, vermutlich weil Sie sich gesund und fit gefühlt haben. Eine trügerische Sicherheit, für die wir nun die Quittung präsentiert bekommen haben. Ihre Kreatininwerte sind jenseits von Gut und Böse. Auch davor haben wir Sie gewarnt. Jetzt stehen wir nicht einmal mehr dort, wo wir waren, als Sie im letzten Jahr in die Notaufnahme eingeliefert wurden. Es hat uns sogar noch weiter zurückgeworfen. Mit einer medikamentösen Therapie kommen wir da nicht weiter. Ihre Nieren sind nicht mehr in der Lage, ihrer Entgiftungsfunktion nachzukommen. Sie werden künftig auf eine Nierenersatztherapie angewiesen sein.« Leeberman breitete ein paar farbenfrohe Informationsbroschüren auf dem dunklen Mahagoni aus, die Theodor bereits von seinem Krankenhausaufenthalt kannte.
»Wir haben zwei Möglichkeiten. Ihre Nieren werden von nun an alle drei Tage in der Klinik gespült. Das würde bedeuten, dass Sie ab jetzt jede dritte Nacht im Nierenzentrum verbringen. Alternativ bleibt Ihnen eine Heimdialyse, die Sie jeden Tag selbst durchführen können. Aber egal, wofür Sie sich entscheiden, es ist nicht verhandelbar. Sie müssen sich ohne Wenn und Aber an den Plan halten, den Sie von uns bekommen. Ich kann es nur noch einmal eindringlich wiederholen: Ihr Leben, das sich ab jetzt drastisch verändern wird, hängt davon ab. Es wird Sie einschränken. Reisen und Geschäftstermine werden künftig zu einer Herausforderung. Es kann zu Komplikationen mit dem Shunt kommen, den wir Ihnen setzen. Sie werden Einschränkungen beim Essen und Trinken hinnehmen müssen. Und ihre Nierenvergiftung ist chronisch. Sie wird trotz allem weiterbestehen.« Leeberman schob abermals seine Brille hoch. »Das alles verkompliziert den Alltag immens. Besonders für einen Geschäftsmann, wie Sie einer sind. Eine Alternative zu diesem Szenario gibt es allerdings noch.«
»Was meinen Sie damit?« Theodors Puls beschleunigte sich. Er war sich nicht sicher, ob er die Antwort auf diese Frage hören wollte. Diese Diagnose hatte er befürchtet, und er ahnte, was jetzt kommen würde.
»Die einzige Alternative ist eine Nierentransplantation. Wenn wir einen Spender finden und das Organ nicht abgestoßen wird, werden Sie zwar für den Rest Ihres Lebens auf immunsuppressive Medikamente angewiesen sein, aber Sie sind wieder mobil, können normal essen und trinken und alt werden wie Methusalem. Ich rate Ihnen, sich Gedanken über dieses Thema zu machen. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und bitten Sie sie darum, sich testen zu lassen. Möglicherweise kommt ja einer Ihrer Söhne als Spender infrage. Das würde viel Druck rausnehmen. Wenn niemand aus Ihrer Familie kompatibel ist, kann die Suche nach einer Niere für Sie zu einem Glücksspiel werden.«
Eine Nierentransplantation. Theodor richtete sich auf und stützte seine Ellenbogen auf den Schreibtisch. So weit musste es wahrscheinlich gar nicht kommen, beruhigte er sich selbst. Leeberman dramatisierte gern und malte den Teufel in allen erdenklichen Farben an die Wand, damit seine Patienten Angst bekamen und seiner hübschen Klinik das Geld in den Rachen warfen. Er kannte diese verdammten Ärzte. Und er würde es auch so schaffen. Beim letzten Mal hatte er es schließlich auch hinbekommen. Ein bisschen Dialyse. Tabletten. Und in ein paar Monaten wäre er wieder wie neu. Natürlich würde er diesmal Leebermans Vorgaben befolgen. »Erstellen Sie einen Therapieplan. Kümmern Sie sich um die Dialyse. Ich werde mich daran halten«, versprach er. »Eines sollten wir allerdings noch klären. Ich weiß, dass Sie mit Andrew in Kontakt stehen. Sie werden meine Krankengeschichte mit niemandem diskutieren. Weder mit meiner Frau noch mit meinen Söhnen, ganz besonders nicht mit Andrew. Haben wir uns verstanden?«
Leeberman zögerte keine Sekunde. »Sicher, Mr. Hunter.« Er hatte zwar mit Andrew gesprochen, würde es aber von nun an unterlassen.
»Sehr gut.« Theodor lehnte sich wieder zurück. Dieses Gespräch hatte ihn mehr erschöpft, als er zugeben wollte. Aber es hatte gutgetan. Nichts ließ so viel Energie durch seine Adern fließen, als wenn er ein Machtwort sprach.
*
Holly zog ihre Beanie tief in die Stirn, ehe sie ihr Gesicht in den Wind und die Sonne hielt und tief einatmete. Es war kalt auf dem Meer, aber die Dream Dancer schoss mit den Möwen um die Wette über die leichten Wellen dahin. Das Segel über ihrem Kopf knatterte fröhlich – und ihr Bruder grinste über das ganze Gesicht. Die Idee, zum ersten Mal in diesem Jahr hinauszufahren, war ihr spontan gekommen. Nach ihrem Gespräch mit Marie war sie rastlos gewesen. Ungeduldig und genervt. Andrew Hunter war auf der Halbinsel. Das sollte ihr egal sein. Zumindest sollten diese verdammten beiden Wörter – Andrew Hunter – nicht ständig wie ein Neonschild vor ihrem inneren Auge blinken. Ihre Mitarbeiter hatten es jedenfalls nicht verdient, dass sie ihre schlechte Laune an ihnen ausließ. Als dann auch noch die Schule angerufen hatte, um ihr mitzuteilen, dass ihr Bruder sich außer in Mathe auch in Englisch und Geschichte nicht gerade mit Ruhm bekleckerte, hatte sie beschlossen, die Dream Dancer zu Wasser zu lassen. So schwer es manchmal war, ein vernünftiges Gespräch mit Jackson zu führen, das Wort Segeltörn musste sie nur in den Mund nehmen, und er schoss zur Tür hinaus und lief zum Hafen.
Die Dream Dancer war eine schnittige Holzjacht, die fantastisch im Wasser lag, aber lange von ihren Besitzern vernachlässigt worden war. Holly hatte sie günstig gekauft. Ihr war klar gewesen, wie viel Arbeit in das Boot gesteckt werden musste. Aber Jackson und sie hatten es zu ihrem gemeinsamen Projekt gemacht. Auch wenn ihr kleiner Bruder und sie in vielen Dingen anders tickten, die Liebe zum Meer und zum Segeln teilten sie uneingeschränkt. Über zwei Jahre hatten sie an der Jacht gearbeitet, bevor sie zum ersten Mal in See gestochen waren. An diese Fahrt – und den wilden Begeisterungsschrei ihres Bruders – konnte sie sich erinnern, als wäre es gestern gewesen.
Inzwischen nahm Jackson immer mehr Züge eines Eigenbrötlers an. Sie sprachen im Alltag nicht mehr viel miteinander, und auch wenn Holly wusste, dass ihm viele Dinge durch den Kopf gingen, so war sie nicht mehr die Person, mit der er darüber sprach. Und leider auch mit niemand sonst. Sicher, er war ein Teenager und hatte schon aus Prinzip kein Bedürfnis, seiner erwachsenen Schwester das Herz auszuschütten. Am liebsten würde sie die Zeit zurückdrehen, wo er ihr noch bedingungslos und blind vertraut hatte, einfach nur, weil sie seine große Schwester war.
Schweigend steuerten sie die Dream Dancer auf das offene Meer hinaus. Sie beherrschten die Handgriffe im Schlaf. Jackson wusste jeden Törn mit einem Profi zu schätzen. Im Sommer würde er reichen, gelangweilten Jugendlichen Segelunterricht erteilen. So wie sie es früher getan hatte. Einer der lukrativsten Ferienjobs auf dem Cape. Aber mitunter auch eine sehr frustrierende Erfahrung, wenn man das Segeln liebte.
Holly stand am Steuer und lächelte ihrem Bruder zu. »Gott, habe ich das vermisst«, rief sie, wobei der Wind den Satz in Fetzen riss und über das Meer davontrug.
Jackson trat neben sie, legte seine Hand auf dem Steuer über ihre und lehnte sich an sie. Ein kurzer Moment geschwisterlicher Nähe. Genüsslich schloss Holly die Augen. Viel zu schnell ging der Augenblick vorüber, ihr Bruder legte den Kopf in den Nacken und heulte wie ein junger Wolf, bevor er ein atemloses Lachen ausstieß. »Manchmal hast du echt gute Ideen, Schwesterchen.«
»Vielen Dank.« Sie deutete einen Knicks an.
Als sie weit genug hinausgefahren waren, holte Holly eine Thermoskanne Kaffee aus ihrem Rucksack und goss ihnen beiden ein. Die dampfenden Becher in den Händen, standen sie nebeneinander und starrten in die Unendlichkeit. »Was gibt es Neues?«, durchbrach Holly das Schweigen zwischen ihnen schließlich.
»Nichts.« Auf die Sprachfähigkeit ihres Bruders schien der Törn offenbar keine positive Auswirkung zu haben.
Holly unterdrückte ein Seufzen. »Mr. Raider hat angerufen.«
»Alter! Was für ein Problem hat der denn jetzt schon wieder?« Jackson ging automatisch in die genervte Selbstverteidigungshaltung über, die sie in der letzten Zeit so oft an ihm bemerkte.
Sie sah ihn von der Seite an. »Außer Mathe? Englisch und Geschichte.«
Er zuckte die Schultern. »Komm schon, Holly, chill mal!«, bediente er sich des Satzes, auf den Holly mittlerweile allergisch reagierte. »Bis zum Jahresende habe ich das im Griff.«
Sie würde überhaupt nicht chillen, solange der Schulabschluss ihres kleinen Bruders auf der Kippe stand. »Du weißt, dass ich dir helfe. Du musst nur etwas sagen«, bot sie ihm zum gefühlt tausendsten Mal an.
»Echt jetzt, Holly.« Er stöhnte übertrieben und verdrehte die Augen. »Wenn du nicht aufhörst, spring ich ins Wasser und schwimme an Land.« Er zog die Schultern hoch – Jacksons typische Geste für: »Du gehst mir mit deinem Große-Schwester-Ding auf die Nerven.« Dann schenkte er sich Kaffee nach und verzog sich mit seinem Becher zum Bug des Bootes.
Holly ließ ihn ein paar Minuten schmollen, bevor sie ihm folgte.
Ehe sie etwas sagen konnte, warf er ihr aus zusammengekniffenen Augen einen Seitenblick zu. »Fang nicht wieder an«, warnte er sie. »Ich bin alt genug, okay? Ich krieg das schon hin.«
»Ich vertrau dir, Jacks.« Kein bisschen. Aber offenbar würden sie an dieser Baustelle heute nicht weiterkommen. Also versuchte sie, ihren Bruder wenigstens dazu zu bringen, mit ihr über Rachel zu sprechen. »Gehst du zum Frühlingsball?«, fragte sie und nippte an ihrem lauwarmen Kaffee.
»Sieht so aus«, gab er zurück. »Ein paar von den Jungs wollen hin. Aber erst gegen später.«
»Ich habe gehört, wie Rachel sich mit einer Freundin unterhalten hat. Sie würde gern hingehen, aber bis jetzt hat sie noch niemand gefragt.« Holly wusste zwar nicht, ob das wirklich stimmte. Aber das Mädchen war genauso in Jackson verschossen wie er in sie. Falls sie schon um ein Date gebeten worden war, würde sie es sofort absagen, wenn ihr Bruder endlich den Mut aufbrachte, sie zu fragen.
»Alter! Das ist oberpeinlich, merkst du das nicht?« Jackson ließ sich auf den Holzplanken nach hinten fallen und legte den Arm über seine Augen. Trotzdem war die feine Röte, die sein Gesicht überzog, nicht zu übersehen.
»Ich meine ja nur. Ich habe es gehört und dachte, das willst du vielleicht wissen.«
»Will ich nicht«, behauptete er, klang aber weit weniger kratzbürstig als bei dem Gespräch über seine schulischen Leistungen. »Das ist Privatsache. Ich hab keine Ahnung, wie ich dir zu verstehen gegeben haben könnte, dass es okay ist, sich da einzumischen.«
»Hey. Unterstell mir doch nicht …«
»Wir sollten zurücksegeln«, unterbrach Jackson sie und erhob sich. »Ich übernehme das Steuer.« Thema erledigt.
Holly blieb nichts anderes übrig, als leise zu seufzen. Am liebsten hätte sie selbst die Augen verdreht, aber damit wäre sie wahrscheinlich nicht das perfekte Vorbild für ihren Bruder. Bis jetzt hatte sie geglaubt, bei Jacksons Erziehung alles richtig gemacht zu haben. Ein bisschen Strenge und viel Liebe. Bis zu diesem Jahr hatte er sich allerdings auch noch nie so verhalten wie in der letzten Zeit. Sie kippte ihren kalten Kaffee ins Meer und lehnte sich gegen die Reling, während ihr Bruder die Jacht wendete. Sie glitten an der Küste entlang, vorbei am National Seashore und – an Sunset Cove. Ihr Bruder hatte es tatsächlich geschafft, sie für eine Weile die Neuigkeiten vergessen zu lassen, mit denen Marie aufgewartet hatte. Der alte Leuchtturm erhob sich majestätisch über der Klippe. In den Fenstern der Kanzel reflektierte das Licht der untergehenden Sonne.
Holly schluckte. Sie wollte es nicht, und doch wandte sie den Blick und sah zum Strandhaus hinüber. Einige Fenster waren hell erleuchtet. Licht und Wärme. Eine heimelige Barriere gegen die hereinbrechende Dämmerung. Holly erkannte das Zimmer wieder, das Andrew Hunter in seiner Kindheit bewohnt hatte, wenn die Familie auf Cape Cod gewesen war. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte sie Kiesel gegen das Fenster geworfen, um ihn zu nächtlichen Abenteuern aus dem Haus zu locken. An die Holzbrüstung der Terrasse gelehnt, stand eine große Gestalt und blickte regungslos auf das Meer hinaus. Die Dream Dancer war zu weit draußen, und sie konnte den Mann nicht genau erkennen. Und doch wusste Holly genau, wer es war. Sie wandte den Blick ab und blinzelte, weil ihre Augen brannten.
»Heulst du?«, fragte ihr Bruder und warf ihr einen panischen Blick zu, den viele männliche Wesen beim Anblick von Tränen bekamen.
Holly wischte sich über die Augenwinkel. »Dieser verdammte Wind«, log sie und lächelte Jackson an. »Was hältst du von Burgern zum Abendessen?«
»Mit Süßkartoffelpommes?«, fragte er hoffnungsvoll.
»Mit was sonst?« Sie blickte über die Schulter noch einmal nach Sunset Cove zurück. Die einsame Gestalt wurde kleiner und kleiner.
3
Am nächsten Abend parkte Andrew seinen Wagen auf dem kleinen Schotterplatz vor dem Cottage, das Niclas und Marie gemietet hatten. Er stieg aus und warf einen Blick zu Niclas glänzendem, teurem SUV und Maries altem, von Rost zerfressenem Pick-up hinüber. In gewisser Weise illustrierten die Autos die Beziehung, die die beiden führten. Man konnte schwerlich auf die Idee kommen, dass zwei so grundverschiedene Menschen zueinanderpassten, aber die beiden belehrten ihr Umfeld eines Besseren. Was, wie Andrew wusste, besonders Georgina ein Dorn im Auge war. Marie war so gar nicht die Schwiegertochter, die sich seine Mutter für ihren Sohn vorgestellt hatte.
Der Muschelkalk knirschte unter seinen Schuhen, als er auf die Haustür zuging. Das Cottage war klein und mit den typischen, von der Witterung grau gefärbten Zedernschindeln verkleidet. Unter den weißen Sprossenfenstern hingen bereits Blumenkästen mit bunt leuchtenden Frühjahrsblühern, deren Namen Andrew nicht kannte.
Sie haben sich ein Nest geschaffen, dachte Andrew, als sein Bruder, den Arm um die Schultern der strahlenden Marie gelegt, die Tür öffnete. Sie passten gut zusammen. Wie er selbst war Niclas groß, dunkelblond und hatte graue Augen, die kalt wie Stein wirken konnten. Oder an sanften Nebel über dem Strand erinnerten, wenn sie so voller Liebe waren wie jetzt. Marie war ebenfalls groß und schlank. Sie trug schlichte Jeans. Die einzigen Highlights, die ihr langes braunes Haar aufhellten, stammten von der Sonne, weil sie während der Arbeit viel Zeit im Freien verbrachte. Sie war nicht der Typ, der viel Geld für einen Friseur ausgab, genauso wie sie darauf verzichtete, sich zu schminken. Aber ihr schönes Gesicht mit den großen, bernsteinfarbenen Augen hatte das auch nicht nötig.
»Schön, dich zu sehen, Andrew.« Marie umarmte ihn freundschaftlich und küsste ihn auf die Wange. Vor noch nicht allzu langer Zeit hatte sie nur einen misstrauischen Blick für ihn übrig gehabt. Umso mehr wusste er die Geste zu schätzen.
Niclas schlug ihm brüderlich auf die Schulter. »Komm rein«, sagte er und trat zur Seite.