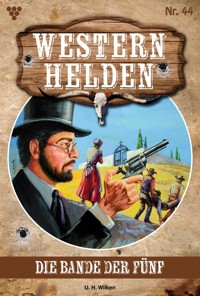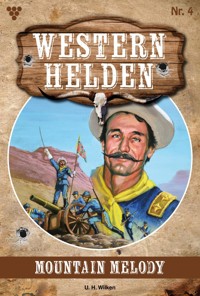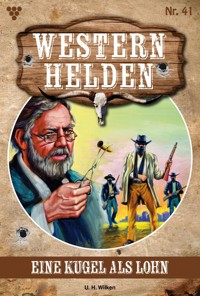
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Helden
- Sprache: Deutsch
Western Helden – Die neue Reihe für echte Western-Fans! Harte Männer, wilde Landschaften und erbarmungslose Duelle – hier entscheidet Mut über Leben und Tod. Ob Revolverhelden, Gesetzlose oder einsame Reiter auf der Suche nach Gerechtigkeit – jede Geschichte steckt voller Spannung, Abenteuer und wilder Freiheit. Erlebe die ungeschönte Wahrheit über den Wilden Westen Als es geschah, war es heller Tag. Es geschah aus Hass – und hinzu kam die grenzenlose Gier nach Geld. Sie kamen lautlos zwischen den dunklen Bäumen hervor und sahen den jungen Fremden dort am rauschenden Wasser stehen, nicht weit von der kleinen Brücke und dem Staudamm entfernt. Er hatte den Oberkörper entblößt und wusch sich mit dem klaren kalten Wasser aus den Bergen. Seine ebenholzschwarze Haut schimmerte weich und bläulich in der Sonne. Er kehrte ihnen den Rücken und sah sie nicht. Sein Army-Revolver hing mit dem Waffengurt am Sattel des abseits grasenden Pferdes. Sie gaben sich stumme Zeichen, kamen näher und standen vor der Jacke, die er auf einen flachen Stein gelegt hatte. Einer von ihnen ergriff die Jacke, um sie in den Fluss zu werfen. Da drehte sich der Mulatte um. Er hatte seltsam dunkelblaue Augen, die an einen Nachthimmel erinnerten. Er sah in ihre verschlagen grinsenden Gesichter, und er begriff sofort, dass sie ihn zusammenschlagen wollten. Sie hassten ihn und seine schwarze Haut, und sie übersahen dabei bewusst die Armeehose, die er noch vom Krieg her trug. Sie fielen über ihn her. Sie sprachen kein Wort. Es war ein stummer, wilder Hassausbruch. Er wehrte sich, denn er war zäh und flink. Aber sie stießen ihn in den Fluss. Er fiel unglücklich und schlug mit dem Kopf hart auf. Der Mann, der seine Jacke ergriffen hatte, wollte sie ihm nachwerfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Helden – 41 –Eine Kugel als Lohn
U.H. Wilken
Als es geschah, war es heller Tag. Es geschah aus Hass – und hinzu kam die grenzenlose Gier nach Geld.
Sie kamen lautlos zwischen den dunklen Bäumen hervor und sahen den jungen Fremden dort am rauschenden Wasser stehen, nicht weit von der kleinen Brücke und dem Staudamm entfernt. Er hatte den Oberkörper entblößt und wusch sich mit dem klaren kalten Wasser aus den Bergen. Seine ebenholzschwarze Haut schimmerte weich und bläulich in der Sonne.
Er kehrte ihnen den Rücken und sah sie nicht.
Sein Army-Revolver hing mit dem Waffengurt am Sattel des abseits grasenden Pferdes.
Sie gaben sich stumme Zeichen, kamen näher und standen vor der Jacke, die er auf einen flachen Stein gelegt hatte. Einer von ihnen ergriff die Jacke, um sie in den Fluss zu werfen.
Da drehte sich der Mulatte um. Er hatte seltsam dunkelblaue Augen, die an einen Nachthimmel erinnerten. Er sah in ihre verschlagen grinsenden Gesichter, und er begriff sofort, dass sie ihn zusammenschlagen wollten. Sie hassten ihn und seine schwarze Haut, und sie übersahen dabei bewusst die Armeehose, die er noch vom Krieg her trug.
Sie fielen über ihn her. Sie sprachen kein Wort. Es war ein stummer, wilder Hassausbruch. Er wehrte sich, denn er war zäh und flink. Aber sie stießen ihn in den Fluss.
Er fiel unglücklich und schlug mit dem Kopf hart auf.
Der Mann, der seine Jacke ergriffen hatte, wollte sie ihm nachwerfen.
Da fielen Dollarnoten hervor – viele Dollarnoten. Ein kleiner Reichtum an Geld.
Und die anderen sahen es. Wieder setzten sie nach, sprangen in den Fluss, warfen sich über ihn und drückten schwer, und nichts an ihnen war mehr menschlich.
Sie teilten das Geld untereinander auf und beseitigten die Spuren ihres Verbrechens. Sie vergruben alles und trieben das fremde Pferd ohne Sattel und Zaumzeug davon.
Nur etwas übersahen sie – ein kleines Stück Metall, vom Stiefel in den Boden gedrückt.
Ihre Hände zitterten noch nicht einmal.
Es wurde still am Fluss.
Die Wasser rauschten, und die Sonne ließ die sprühenden Tropfen funkeln. Der laue Wind bewegte schwach die schlanken hohen Baumkronen. Der Sommer war heiß, und die milden Tage des Indianersommers brachten leuchtende Farben in die Natur.
Jahre vergingen …
*
Wie Vorboten des nahenden Unwetters ziehen die tiefen Wolken über die mächtigen Berge hinweg, und aus den tiefen Wäldern von Wyoming steigen die feuchten grauen Nebelschwaden wie Rauch empor.
Durch das Zwielicht des scheidenden Tages reitet Moreno Black den weiten zerklüfteten Abhang hinunter und auf die noch fernen Lichtpunkte einer kleinen weltvergessenen Stadt zu.
Windböen treiben Staub und erste Regentropfen aus den Seitentälern hervor.
Im Schutz des Talhanges verhält der Reiter, löst den zusammengerollten Regenumhang hinterm Sattel und zieht ihn sich über.
Dann reitet er weiter, und die Nacht holt ihn mit Wind und Regen ein. Nur langsam rücken die Lichter der Ortschaft näher, und es währt noch gut eine Stunde, bis die schattenhaft verschwommenen Umrisse der Häuser aus der Unwetternacht auftauchen.
Wind und Regen haben zugenommen; hart prasselt er auf den Umhang. Regen klopft auf die Dächer und schlägt auf die Straße. Licht fällt schwach aus den Fenstern auf die Straße. Die Türen sind verschlossen. Keine Stimme übertönt das Rauschen des Regens und das Wimmern des Windes. Irgendwo an einem Haus klappert hart eine Luke.
Dort vor ihm befindet sich ein Saloon. Moreno Black blickt durch das Fenster in den Raum und sieht eine Frau hinter einem langen Tresen. Er kann ihr Gesicht nicht erkennen, weil die Fensterscheibe vom Regen beschlagen ist.
Das Licht fällt in sein nassglänzendes Gesicht; er lächelt schwach, zieht das Pferd sanft herum und reitet in die Hofeinfahrt hinein.
Moreno Black steigt vor dem Pferdestall aus dem Sattel, zieht das Tor auf und bringt sein Pferd hinein. Er holt die Winchester aus dem Gewehrschuh, streicht dem Tier den nassen Hals und geht hinaus, drückt das Stalltor zu und geht zurück zum Saloon.
Moreno Black drückt die Türflügel auf und tritt ein. Wasser tropft auf den Boden. Er bleibt stehen und nimmt den Stetson ab. Ein Lächeln huscht über sein dunkles Gesicht. Er kommt näher und sieht die junge Frau freundlich an.
»Guten Abend, Ma’am.«
Unwillkürlich greift die Frau zum Revolver unter dem Tresen, lässt aber die Hand unten.
Ihre blauen Augen blicken überrascht. Sie kann die Überraschung nicht verbergen. Doch auch Befremden ist in ihrem Blick.
»Guten Abend, Fremder«, erwidert sie und zieht die Hand zurück.
Ihm entgeht die Bewegung nicht. Er lächelt ein wenig stärker. Forschend blickt er umher. Er ist der einzige Gast in diesem Saloon.
»Die Männer sind draußen an der Flusssperre«, sagte sie erklärend. »Bei diesem Unwetter wird der Fluss über die Ufer treten. Noch ist die Ernte nicht eingebracht.«
Er nickt, als hätte er diese Antwort erwartet, und legt die Hände auf die Theke.
Ihr Blick hängt an diesen dunklen Händen. Gewaltsam reißt sie sich zusammen. In dieser Stadt ist es ungewöhnlich, dass ein Fremder kommt. Noch ungewöhnlicher ist es, wenn dieser Gast kein Weißer ist. Er muss zu einem Viertel oder Drittel Negerblut in den Adern haben. Man sieht es an seiner kaffeebraunen Haut.
»Ich möchte ein Zimmer, wenn es sich machen lässt«, sagt er. Seine Stimme klingt weich und ein wenig heiser.
Sie nickt.
»Zur Straße oder zum Hof?«
»Sagen wir – zum Hof, Ma’am. Mein Name ist Moreno Black.«
Sie atmet tief ein, hat sich gefasst.
»Wollen Sie länger bleiben, Mr. Black?«
»Vielleicht, Ma’am …«
Sie sieht ihn schnell an, geht hinter dem Tresen entlang und steigt die schmale hölzerne Treppe empor. Er folgt ihr und hinterlässt viele Wassertropfen. Sie öffnet eine Tür und lässt ihn eintreten.
»Danke, Ma’am.«
Sie geht wortlos zurück. Er öffnet das kleine Fenster, beugt sich hinaus und blickt auf den dunklen Hinterhof. Der Wind bläht die alte zerschlissene Gardine am Fenster. Er legt die Winchester aufs Schlaflager, entledigt sich des Umhanges und geht nach unten, holt die Satteltaschen und begibt sich wieder nach oben.
Draußen auf der Straße reiten mehrere Männer vorbei. Sie kommen heim. Und es spricht sich schnell herum, dass ein Halbblut in die Stadt gekommen ist …
Als Moreno Black eine knappe Stunde später in den Saloon kommt, sind etliche Tische besetzt und stehen mehrere Männer an der Theke. Sie alle starren ihn an. Er hat sich umgezogen, sein weißes Hemd lässt die braune Haut noch dunkler erscheinen. Zwischen den weißen Zähnen steckt eine lange schmale Zigarre. Er setzt sich an einen freien Tisch in der Nähe des Fensters und schlägt die Beine übereinander. Und er braucht nicht aufzusehen, um zu wissen, dass ihn alle beobachten.
Die junge Frau kommt zu ihm.
»Bitte, einen Whisky«, sagt er sanft und zieht den Rauch tief ein.
Sie beugt sich vor. Ihr Blick warnt ihn.
»Verlassen Sie die Stadt, schnell!«, flüstert sie fast klanglos, nickt dann und geht zum Tresen zurück. Dort holt sie mit fahriger Bewegung ein Glas vom Bord und füllt es. Er beobachtet sie, aber er sieht auch, was um ihn herum geschieht. Eisiges Schweigen herrscht, und versteckte Feindschaft lauert drohend im Saloon.
Sie wollen ihn nicht in der Stadt!
Denn er ist kein Weißer – und ein Fremder! Selbst hier im hohen Norden gibt es Rassenvorurteile. Aber warum nur – warum!
Die Frau nimmt das Glas, um es ihm zu bringen. Am Ende der Theke stehen zwei Männer. Sie sehen die Frau starr an, und ihre Blicke sind wie eine Wand, durch die sie nicht hindurchtreten kann.
»Er soll sich den Whisky selber holen!«, sagt einer der Männer hart. »Hier wird kein Nigger bedient! Hast du keine Ehre im Leib, Laureen?«
Sie steht da und kommt nicht weiter. Und der Mann hinter der Theke, dem der Saloon gehört, kommt heran und nimmt ihr das Glas ab.
»Hast du nicht gehört, Laureen?« Er stellt das Glas auf den Tresen.
Wieder schweifen die Blicke der anderen zu Moreno Black hinüber. Sie sehen ihn still und sanft lächeln. Er erhebt sich langsam und geht zur Theke.
»Lassen Sie nur, Ma’am«, sagt er ruhig. »Ich will keinen Streit.«
Er nimmt das Glas und führt es zum Mund. Doch da stößt ihn der Nebenmann an, und der Whisky schwappt aus dem Glas und auf das weiße Hemd.
»Verschwinde, Nigger!«, faucht der Mann.
»Meine Großmutter war eine Negerin«, sagt Moreno ruhig. »Mein Vater war ein Weißer wie ihr. Was habt ihr gegen mich? Ist es eine Schande, ein bisschen Negerblut zu haben?«
Er hebt erneut das noch halb volle Glas. Und wieder will der Mann ihn stoßen, will ihm mit Gewalt und Wucht den Ellbogen in die Seite rammen. Moreno weicht blitzschnell aus und kippt dem Mann den Whisky ins Gesicht. Der scharfe Alkohol brennt in den Augen. Der Mann reißt die Hände hoch und will sich auf Black stürzen. Da trifft ihn die harte Faust. Er stürzt schwer und bleibt bewusstlos liegen.
Moreno Black hat plötzlich den Revolver umfasst, lässt die Waffe jedoch noch in der Halfter.
»Wirklich«, sagt er leise, »ich möchte keinen Unfrieden … Geben Sie mir einen Whisky.« Mit der anderen Hand legt er einen Dollar auf den Tresen.
Zögernd schiebt der Salooner ihm den Whisky hin. Moreno trinkt und steigt dann über den Bewusstlosen hinweg, näherte sich der Treppe und lässt keinen einzigen der Anwesenden aus den Augen.
»Gute Nacht, Gentlemen«, sagt er sanft.
In seinem Zimmer steht er lange am Fenster und starrt in die Nacht. Fern über den Bergen flammt ein greller Blitz auf, zuckt durch die nächtliche Dunkelheit und erhellt Morenos steinernes Gesicht.
*
Er liegt noch lange wach, während draußen der Regen prasselt. Unten im Saloon ist es seit wenigen Minuten still geworden. Moreno Black hört, wie der Besitzer die Tür schließt. Dann ist es still.
Stunden vergehen.
Trotz des Unwetters ist es drückend und schwül im Zimmer. Moreno Black wälzt sich auf dem Lager hin und her, und als es wieder einmal draußen aufbrüllt und grollt, verlässt er das Lager und geht zum Fenster, drückt es halb auf und atmete tief ein. Regen trifft sein Gesicht.
Das Gewitter hängt vor den hohen Bergen. Wieder blitzt es. Moreno Black sieht in dieser Sekunde gerade auf den Hinterhof hinunter. Ihm entgeht die schnelle Bewegung dort unten nicht. Ein Schatten huscht um den Pferdestall und ist verschwunden.
Sofort holt er seine Winchester vom Schrank und stellt sich wieder ans Fenster.
Als es hell wird, steht das Stalltor halb offen …
Schlagartig ist es wieder dunkel.
Er schiebt sich hinaus, drückt sich ab und springt hinunter, landet federnd auf dem regennassen Boden und lehnt sich an die Hauswand. Regenwasser rieselt vom Dach. Es ist so dunkel, dass Moreno Black die Gestalt nicht sehen kann, die sich lautlos davonmacht.
Geduckt nähert er sich dem Stall, tastet sich an der Bretterwand entlang und erreicht die Tür, gleitet hinein und horcht. Das Pferd ist nicht zu hören. Er geht weiter hinein und fällt fast über den großen Pferdeleib.
Das Tier ist tot.
Der Wind fasst hinters Stalltor und knallt es hart zu.
Black wirbelt herum und reißt das Gewehr hoch.
Draußen wimmert der Wind und rauscht der Regen. Durch die Bretterfugen sticht das grelle Licht der Blitze herein. Er senkt den Lauf des Gewehres und atmet pfeifend aus. Wilder Zorn überkommt ihn, als er sich niederkniet und über das Pferd hinwegtastet. Eine Kugel hat das Tier getötet. Der Schuss muss in dem Moment abgegeben worden sein, als es draußen krachte und der Donner jedes andere Geräusch übertönte.
Eine hundsgemeine Tat.
Moreno Black ist kein Pferdenarr, und doch hat er sein Pferd geliebt, denn es hat ihn viele hundert Meilen weit durch ein wildes Land getragen.
Steif richtet er sich wieder auf. Langsam geht er zum Stalltor, drückt es gegen den Wind auf und gleitet hinaus. Im Licht der Blitze erkennt er die Eindrücke von Stiefeln im nassen Boden. Die Spur führt um den Stall herum und zum Nachbarhof.
Geduckt folgt er der Spur, und der Regen durchnässt in kurzer Zeit seine Kleidung. Wasser tropft vom Gewehrlauf. Düster stehen die Stallungen auf dem Hof. Die Spur führt zur Straße zurück. Sie verliert sich noch nicht einmal auf dem Gehsteig. Wasserlachen und Schmutzklumpen sind deutlich zu erkennen. Niemand ist auf der Straße. Das ungemütliche Wetter hat die Leute in die Häuser getrieben. Nur aus einem kleinen Haus fällt noch schwaches Licht.
Wenig später steht Moreno Black vor einem dunklen Haus. An der Tür dieses Hauses endet die Spur …
Er presste den Mund zusammen, blickt umher und geht dann weiter, steht schließlich am Ende der Straße vor dem kleinen Haus und blickt ins Fenster. Die Gardine ist nicht ganz zugezogen. Er sieht einen schmalen Ausschnitt des Zimmers. Eine alte Petroleumlampe mit einem Schirm aus Fransen steht auf einem Tisch. Im Stuhl daneben sitzt die junge Frau aus dem Saloon. Sie hat die Augen geschlossen, als schliefe sie, doch sie bewegt die Hände.
Leise klopft er ans Fenster.
Sie fährt erschrocken hoch.
Er bringt sein Gesicht in den Lichtschein und hebt die Hand.
Sie erkennt ihn, geht zur Tür, öffnet und sagt leise: »Kommen Sie schon herein! Schnell! Niemand darf Sie sehen!«
Er geht hinein, und sie schließt hinter ihm die Tür. Sie betreten das Zimmer. Sie zieht den Vorhang zu.
»Es ist schon spät«, sagt sie leise. »Warum sind Sie nicht auf Ihrem Zimmer?«
»Und warum schlafen Sie noch nicht?«, fragt er leise zurück.
»In dieser Stadt haben Sie Feinde, Mr. Black. Bevor Sie kamen, war diese Stadt ruhig. Jetzt ist es anders. Sie sollten schnellstens verschwinden!«
»Warum, Ma’am – warum ist das so?«, fragt er dunkel, stellt das Gewehr an den Stuhl und bleibt dahinter stehen.
»Sie fragen mich?« Sie zuckt die Achseln. »Ich bin erst seit zwei Jahren hier. Seitdem arbeite ich im Saloon.«
»Sie wissen mehr, als Sie mir sagen wollen, Ma’am …«
Sie legt die Hände auf die hohe Stuhllehne und blickt ihn seltsam an.
»Ja – Sie haben recht. Ich weiß mehr. In der Stadt gibt es einen Mann, der seinen Sohn vor vielen Jahren verloren hat. Neger haben seinen Sohn nach Kriegsende unten in Kansas gelyncht – damals, als die befreiten Neger plündernd durch das Land zogen …«
Er nickte.
»Sprechen Sie nur weiter, Ma’am. Ich weiß, dass solche Dinge geschehen sind. Ich war Soldat in der Union. Ich habe viel gesehen.«
Sie atmet tief ein, fährt fort: »Dieser Mann hasst alle Neger. Er saß heute auch im Saloon. Nein, er war es nicht, der Sie anstieß. Er saß ganz ruhig an einem Tisch, beobachtete Sie. Aber er hat die Leute aufgehetzt.«
»Wohnt er in dem Haus, wo das eine Fenster mit Brettern zugenagelt ist?«
»Wie kommen Sie darauf? – Nein, da wohnt er nicht. Ihm gehört der kleine Mietstall in der Stadt. Das Haus, das Sie meinen, ist nicht bewohnt.«
In seinen Augen flirrt es kalt auf. Er wendet sich ab, nimmt sein Gewehr mit zur Tür. Dort dreht er sich um und sagt dumpf: »Irgendwer hat mein Pferd erschossen – vor wenigen Minuten. Ich folgte der Spur bis zu dem Haus, wo das Fenster zugenagelt ist.«
»Mein Gott!«, flüstert sie erschrocken. »Der Hass auf Sie ist noch schlimmer, als ich annahm! Die Leute sind aufgehetzt. Sie sollen die Stadt nicht mehr zu Pferde verlassen können! Man will Sie zu Fuß aus der Stadt jagen!«
»Ma’am!«, sagt er bitte, »vor fünf Jahren ritt mein Bruder nach Norden, nach Wyoming – in diese Stadt. Haben Sie jemals davon gehört, Ma’am?«
»Nein«, erwidert sie sofort, »niemals. Kein einziges Wort darüber. Ihr Bruder wird nicht in diese Stadt gekommen sein. Ich hätte bestimmt davon gehört.«
»Er wollte zu Cameron Kane.«
»Zu dem Sohn vom alten Big Kane?«, fragt sie überrascht.
»Ja. Sie beide hatten im Krieg zusammen gekämpft. Sie waren Freunde. Sam wollte Cameron Kane nach Kriegsende besuchen – hier in Wyoming. Ich weiß, dass er losritt.«
»Und Sie – warum ritten Sie nicht mit Ihrem Bruder?«
»Ich blieb in der Armee. Nur in der Armee fand ich ein Zuhause – wenn Sie das verstehen, Ma’am.«
Ihre Hände umkrampften die Stuhllehne. Sie nickt und lauscht dem Regen, der gegen die Hauswand klatscht.
»Ich kann Ihnen nicht helfen, Mr. Black. Verlassen Sie noch heute Nacht die Stadt. Vielleicht erfahren Sie mehr auf der Kane-Ranch. Cameron Kane müsste Ihnen doch mehr sagen können! Vielleicht ist Ihr Bruder gleich zur Ranch geritten und dann wieder von dort zurück.«
»Nein, Ma’am«, widerspricht er ernst und überzeugt, »Sam wollte erst in die Stadt. Er ließ mir eine Nachricht zukommen. Er trank gern einen Whisky – nur einen am Tag. Vier Jahre lang wartete ich dann auf weitere Nachricht. Sie blieb aus. Sam schien verschollen zu sein. Vor drei Monaten war meine Dienstzeit abgelaufen. Da machte ich mich auf den Weg nach Wyoming.«
»Mein Gott! Was glauben Sie denn, Mr. Black? Glauben Sie etwa, dass Ihr Bruder …«
Er unterbricht sie schnell: »Ich glaube nichts, Ma’am. Ich will nur wissen, wo mein Bruder geblieben ist. Ich folgte seinem Weg. Er ist vor fünf Jahren in verschiedenen Städten aufgetaucht, die auf dem Weg nach Norden liegen. Es gab noch Leute, die sich an ihn erinnerten, weil er blaue Augen hat. Das ist sehr selten für ein Halbblut. Als unsere Mutter noch sehr jung war, sah sie sehr schön aus, und ein reicher weißer Mann am Missouri nahm sie in sein Haus. Sie bekam zwei Kinder – erst mich, dann Sam. Wir haben unseren Vater nie kennengelernt. Weiße hingen ihn auf, weil er eine Mulattin liebte … Ich habe Sam sehr gern, Ma’am. Ich muss wissen, wo er geblieben ist. In dieser Stadt wird irgendetwas geheimgehalten. Ich spüre es. Nein, Ma’am – ich reite nicht davon. Ich gehe auch nicht. Ich will wissen, was die Leute gegen mich haben.«
»Aber ich sagte es Ihnen doch schon.«