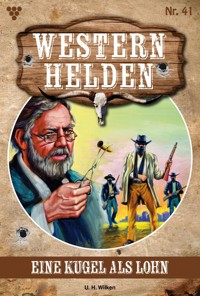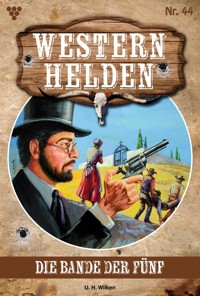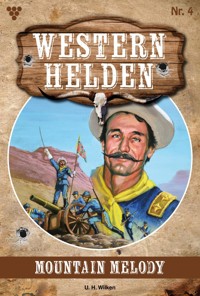Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western Classic
- Sprache: Deutsch
Nun gibt es eine exklusive Sonderausgabe – Die großen Western Classic Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Dieser Traditionstitel ist bis heute die "Heimat" erfolgreicher Westernautoren wie G.F. Barner, H.C. Nagel, U.H. Wilken, R.S. Stone und viele mehr. Sehnige dunkle Körper glitten durch das weite Tal und duckten sich wie wilde Tiere hinter den staubigen abgestorbenen Sträuchern. Aus der einsam gelegenen Adobehütte tönte das Klappern von Blechgeschirr. Gesättigt und zufrieden legte der Mann den Löffel in den blechernen Teller zurück und blickte durch die offene Tür hinaus. Staubwirbel tanzten im schreienden Wind vorbei. Sengende Hitze füllte das gewaltig große Tal. In rauchiger Ferne stießen die zerklüfteten Talränder in den blassblauen Himmel empor. Der Mann erhob sich, rülpste verhalten und bewegte sich auf die Tür zu. Langsam trat er auf die Türschwelle hinaus. Das grelle Sonnenlicht traf sein verkniffenes Gesicht und blendete ihn, er sah nicht, wie hinter der Strauchgruppe Metall aufblitzte und das Sonnenlicht reflektierte. Jäh peitschten die Schüsse durch das Tal. Heißes Blei klatschte gegen die Lehmwand der Hütte. Bösartig brüllte das Echo der Schüsse. Ächzend bäumte der Mann sich auf, fasste mit zuckenden Händen an die Brust und lief schwankend in die Hütte zurück. Stöhnend rollte er über den erdenen Boden, während der Schmerz seine Brust zerreißen wollte. Draußen gellten die Schreie der Apachen und überschlugen sich. Kugeln fauchten herein, durchschlugen den Topf auf dem kleinen Herd, rissen den Blechteller vom Tisch. Vor Schmerzen geschüttelt, kroch der Mann unter dem Tisch hindurch und zog sein Gewehr vom Hocker. Er hatte nicht viel Zeit. Er wusste, dass sein Leben jeden Moment zu Ende gehen konnte. Aber er wollte nicht kampflos sterben, er wollte zurückschießen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western Classic – 65 –Der Apachen-Scout
In schwarzen Augen glühte der Hass
U.H. Wilken
Sehnige dunkle Körper glitten durch das weite Tal und duckten sich wie wilde Tiere hinter den staubigen abgestorbenen Sträuchern. In schwarzen Augen glühte unsterblicher Hass …
Aus der einsam gelegenen Adobehütte tönte das Klappern von Blechgeschirr.
Gesättigt und zufrieden legte der Mann den Löffel in den blechernen Teller zurück und blickte durch die offene Tür hinaus. Staubwirbel tanzten im schreienden Wind vorbei. Sengende Hitze füllte das gewaltig große Tal. In rauchiger Ferne stießen die zerklüfteten Talränder in den blassblauen Himmel empor.
Der Mann erhob sich, rülpste verhalten und bewegte sich auf die Tür zu. Langsam trat er auf die Türschwelle hinaus. Das grelle Sonnenlicht traf sein verkniffenes Gesicht und blendete ihn, er sah nicht, wie hinter der Strauchgruppe Metall aufblitzte und das Sonnenlicht reflektierte.
Jäh peitschten die Schüsse durch das Tal. Heißes Blei klatschte gegen die Lehmwand der Hütte. Bösartig brüllte das Echo der Schüsse. Ächzend bäumte der Mann sich auf, fasste mit zuckenden Händen an die Brust und lief schwankend in die Hütte zurück.
Stöhnend rollte er über den erdenen Boden, während der Schmerz seine Brust zerreißen wollte.
Draußen gellten die Schreie der Apachen und überschlugen sich. Kugeln fauchten herein, durchschlugen den Topf auf dem kleinen Herd, rissen den Blechteller vom Tisch.
Vor Schmerzen geschüttelt, kroch der Mann unter dem Tisch hindurch und zog sein Gewehr vom Hocker.
Die Apachen kamen näher …
Er hatte nicht viel Zeit. Er wusste, dass sein Leben jeden Moment zu Ende gehen konnte. Aber er wollte nicht kampflos sterben, er wollte zurückschießen.
Langsam schob er sich über den Boden und stierte hinaus. Mühsam hob er die Waffe an.
Zwei Apachen zeigten sich zwischen den trockenen Sträuchern. In der hitzeflimmernden Luft verzerrten sich die Konturen.
»Ihr Hunde!«, flüsterte er, dann jagte er die Schüsse aus dem Lauf.
Die Apachen zuckten zusammen, drehten sich und sanken in den heißen Sand.
Andere tauchten auf.
Wieder schoss er und riss mit dem Blei drei Apachen von den Beinen. Die anderen schnellten in ihre Deckung zurück. Er kniff die Augen noch mehr zusammen. Tiefe Furchen durchzogen sein Gesicht, es war grau geworden. Die Hemdbrust rötete sich immer mehr. Er atmete schwer und starrte hinaus.
Hinter einem der Sträucher bewegte sich etwas. Er schickte das Blei in den Strauch hinein. Ein lebloser Körper rollte hervor. Schwarze lange Haare und die Fransen an den Beinkleidern flatterten im Wind.
Das Echo dröhnte und hallte. Immer wieder warfen die fernen hohen Talränder den Knall der Schüsse zurück.
Noch war Leben in ihm.
Er lud stöhnend nach, kroch zurück und warf den Tisch um, nahm dahinter Deckung und blickte aus der Hütte.
Tot lagen die Apachen vor der Hütte. Treibender Flugsand fiel auf sie. Vor seinen Augen verschwammen die Umrisse immer mehr. Dennoch bemerkte er die Bewegungen und die schattenhaft verwischten Gestalten. Verbissen feuerte er. Die Schatten schmolzen zusammen und lösten sich am Boden auf.
Wutgeheul folgte seinen Schüssen. Die Apachen hatten wohl geglaubt, den einsamen Mann schnell fertig machen zu können – doch er wehrte sich selbst in der Stunde des Sterbens noch wie ein Gigant. Er wollte einfach nicht aufgeben, wollte den Tod besiegen – und wenn es nur für Minuten wäre.
Sie kamen nicht in die Hütte hinein.
Draußen wurde es still.
Seine Hände wollten ihm nicht mehr so schnell gehorchen. Patronen entfielen ihm. Mit der Kraft der Verzweiflung schaffte er es schließlich, nachzuladen.
Trocken raschelte es draußen. Ein Apache näherte sich von der Seite her der Hütte. Weiche Mokassins tasteten durch den Sand. Sehnige Hände hielten eine Spencer.
Mordlust brannte in den Augen. Unbemerkt erreichte er die Hütte und verharrte an der Lehmwand. Scharf fiel sein Schatten gegen die Wand. Die anderen warteten. Lautlos bewegte er sich auf die Tür zu.
In der Hütte kauerte der Mann hinter dem umgestoßenen Tisch und hielt sein Gewehr bereit. Es lag auf der Tischkante, und der Lauf zeigte zur Tür, hinaus in das glühende Tal.
Schwer sank sein Kinn auf die Brust. Er hatte Mühe, zu atmen. Bleierne Schwere breitete sich in seinem Körper aus. Flatternd griff er an die Brust, stierte auf die Hand – sie war rot von seinem Blut. Urplötzlich erschien der Apache in der Tür. In der Hütte wurde es dunkler, der Indianer fing das Tageslicht auf, stand schwarz vor dem Weißen und schoss. Die Kugel blieb in der dicken Tischplatte stecken. Der Mann drückte ab. Feuer und Blei erreichten die Brust des Apachen. Die Kugel durchschlug ihn und schleuderte ihn zurück. Tot lag er auf der Türschwelle …
Das Gewehr rutschte dem Sterbenden aus den Händen. Er sackte zusammen und hörte das schrille Wutgeheul der Apachen wie aus weiter Ferne.
Im Tal bellte eine Winchester scharf und durchdringend.
Schritte hasteten um die Sträucher. Ein röchelnder Schrei tönte herüber und erstickte.
Der Mann wollte nicht liegend sterben. Aufrecht stehend und mit dem Colt in der Hand wollte er kämpfend untergehen.
Stöhnend schob er sich durch die Hütte, zog sich mit letzter Kraft hoch und fiel mit dem Rücken gegen die Wand, spreizte die Beine, stemmte sie gegen den Boden.
Langsam kam der große hagere Fremde herein, stieg über den toten Apachen hinweg und fing den Sterbenden auf. Vorsichtig legte er ihn zu Boden.
Im kantigen Gesicht des Fremden bewegte sich kein Muskel. Nur in den grauen Augen war Leben. Düster blickte er auf das eingefallene blasse Gesicht des Mannes am Boden.
»Ich habe einige von ihnen in die Hölle gejagt«, murmelte er düster. »Du hast dich tapfer gehalten. Vor der Hütte liegen etliche Indsmen herum.«
»Wer bist du?«
»Daniel Crook, Scout von Fort Bliss. Sprich jetzt nicht. Ich kümmere mich um dich …«
»Danke«, hauchte der Sterbende, »begrabe mich hier im Tal.«
»Ja, mach ich.«
Das Gesicht des Todgeweihten wurde erschreckend leer. Das Licht in seinen Augen erlosch.
»Ich geh jetzt. Ich …«
Sein Atem verwehte. Frieden war in seinem Gesicht. Er spürte nicht mehr die Schmerzen.
Daniel Crook schloss ihm die Augen und richtete sich hager auf. In seinen grauen Augen war ein kaltes Flirren. Er ging zur Tür, riss den leblosen Apachen weg und trat hinaus.
Niemand schoss zurück.
Die Apachen waren verschwunden, sie hatten ihre Toten zurückgelassen. Über dem bizarren fernen Talrand im Westen sank die Sonne. Weite Schattenfelder fielen in das Tal.
Neben der Hütte begrub er den Mann mitsamt seiner ganzen Habe.
Er hatte Ehrfurcht vor diesem Mann, der so tapfer ausgehalten hatte. Still stand er vor dem Grab und hörte die Sträucher im Wind trocken rascheln.
Dann ging er umher und betrachtete ausdruckslos die Apachen.
»Keine Mescalero-Apachen«, sagte er vor sich hin, »keine Tontos, Aravaipas und Chiricahuas.«
Er suchte nach Zeichen der Stammeszugehörigkeit, und als er nichts fand, wusste er, dass es Abtrünnige der Stämme waren – ausgestoßene Apachen, die mit den Weißen keinen Frieden machen wollten.
Diese Apachen waren Coyoteros!
Blutrünstige Apachen, die raubend und mordend das weite Land heimsuchten, die sich wie Ratten in ihren Schlupfwinkeln in den scheinbar unwegsamen Bergen und Wüstentälern verbargen und erst wieder hervorkamen, wenn der Gegner ihnen den Rücken kehrte …
Mit einem Ruck zog er sich in den Sattel und ritt durch das Tal. Hoch am Himmel kreisten die ersten Geier. Das heisere Geschrei der Totenvögel schallte hohl und unheimlich durch die Wildnis.
*
Anheimelnd gelber Lichtschein sickerte durch die verhangenen Fenster des Farmhauses. Hufschlag tönte durch die sternenklare Nacht. Am Rand der Felder tauchte ein Reiter auf, lenkte sein Pferd durch die Dunstschwaden, die vom Rio Grande herüberzogen, und näherte sich der Farm. Als er den Hof erreichte, knarrte die Tür des kleinen Schlafhauses neben dem Stall. Zwei Männer in derber Farmerkleidung traten hervor und richteten ihre Gewehre auf ihn.
»Bleiben Sie im Sattel, Mister!«, rief einer von ihnen scharf. »Was wollen Sie hier? Wir …« Er verstummte und sah Daniel Crook überrascht an. »Mann, Bing, das ist Dan!«, stieß er hervor und senkte das Gewehr.
»Ja, der alte Dan!«, antwortete Bing und lief heran. »Du bist es wirklich, Dan! Wir haben alle schon lange auf dich gewartet!«
Daniel Crook lächelte und rutschte vom Pferd. Staub wallte aus seiner Kleidung. Er drückte Bing und Hank, den beiden Farmhelfern, herzlich die Hand.
In diesem Moment kam sein Bruder aus dem Haus. Der Lichtschein fiel über die Türschwelle. Er hastete heran, und die Brüder umarmten sich.
»Teufel«, strahlte Johnny Crook, »komm rein ins Haus, Dan! Asa und die Kinder werden sich freuen! Großer Gott, das ist eine Freude, dich mal wiederzusehen, alter Junge!«
Er zog Daniel, seinen etwas jüngeren Bruder, zum Haus und ließ ihn erst kurz vor der Tür los.
»Asa, Tommy, Pennie – wir haben Besuch!«, rief er. »Fallt nicht vom Stuhl!«
Daniel Crook schluckte trocken. Monate waren vergangen, seitdem er das letzte Mal hier gewesen war. In all diesen Monaten war er als Scout für die Armee geritten. Zögernd betrat er das Haus, kam in den Lichtschein hinein und stand im Raum.
Und sie standen ihm gegenüber: Asa, die blonde Frau seines Bruders, Pennie, das erst vierzehn Jahre alte blonde Mädchen mit den schönen blauen Augen, und Tommy, der sechzehnjährige Sohn.
»Dan!«, flüsterte Asa weich.
»Onkel Dan!«, schrie Tommy Crook und sprang ihn an wie ein kleiner Junge. »Der große, berühmte Scout westlich des Rio Grande!«
»He, he«, schmunzelte Dan, »nicht so heftig, Tommy. Pennie ist auch noch da.«
Er schritt zu Pennie und betrachtete sie, und in seinen grauen Augen wurde es weich. Er legte die Hand unter ihr Kinn und sah in ihre blauen Augen.
»Warum kommst du nicht ganz zu uns, Onkel Dan?«, fragte Pennie leise. »Dad hat es dir doch schon ein paarmal angeboten. Gib doch diesen Scout auf.«
»Später, Pennie.« Er lächelte zuversichtlich. »Meine Zeit ist bald um. Dann komme ich hierher – aber ein richtiger Farmer werde ich wohl nie. Ich bin mit Pferden aufgewachsen, ich brauche einen Sattel unter dem Hintern.«
»Wenn ich groß bin, werde ich auch Scout!«
»Du bleibst schön hier, mein Junge«, sagte Tommys Vater. »Ich brauche dich hier. Und so schön ist das Leben eines Scouts nun auch wieder nicht. Frag deinen Onkel. He, Dan, sag’s ihm. Der Junge hat Flausen im Kopf!«
»Dein Vater hat recht, Tommy«, murmelte Dan und wurde auf einmal ernst. »Wir Scouts leben mit dem Tod. Die Indianer sind unberechenbar. Es sieht zwar danach aus, als wenn die Apachen Frieden schließen wollten – aber die Coyoteros morden weiter.«
»Coyoteros?« Tommys Wangen röteten sich, gespannt blickte er seinen Onkel an. »Ich kenne nur Kojoten!«
»Daher kommt der Name. Cochise selber hat die Abtrünnigen der Stämme so genannt. Er sagte, sie würden wie Kojoten durch die Nacht schleichen und töten, aber er könnte nicht überall sein, er wäre nicht verantwortlich für sie …«
Schweigen herrschte im Farmhaus. Auf dem Herd begann das Wasser zu kochen, und Asa Crook warf Kaffee hinein. Ein guter Duft breitete sich im Haus aus. Die Männer und die beiden Geschwister saßen am Tisch, Johnny Crook brach das Schweigen.
»Du hast diese Coyoteros gesehen, Dan?«
»Yeah, Johnny. Fünfzehn Meilen von hier haben sie einen Mann umgebracht, der allein in einem Tal gelebt hat. Ich habe ihn begraben.« Tiefer Ernst prägte seinen Gesichtsausdruck. Seine Stimme klang rau und rissig. »Ihr müsst wachsam sein, Johnny! Die Coyoteros sind überall! Sie morden, weil sie alle Weißen hassen und ihren höllischen Spaß daran haben. Diesen verdammten Bluthunden geht es nicht allein darum, Beute zu machen – sie wollen die Skalps der Weißen! Unterschätze niemals die Gefahr, Johnny! Sie waren nur fünfzehn Meilen von deiner Farm entfernt! Das ist für sie ein Ritt von einem halben Tag.«
Asa rief ihre Tochter zu sich. Beide füllten die Becher mit Kaffee. Tommy holte den Schinken heran. Als Asa die Becher auf den Tisch stellte, zitterten ihre Hände. Johnny Crook erhob sich und rief Hank und Bing herein. Dann saßen sie alle am Tisch und tranken.
Daniel Crook starrte wie geistesabwesend in den Kaffee. Alle bemerkten es und sahen zu ihm hin. Scharfe Falten durchzogen auf einmal sein Gesicht. Die gefährliche Zeit hatte ihre Spuren hinterlassen.
Jetzt blickte er auf, und das Gesicht entspannte sich, er lächelte wie gezwungen, als er die Blicke auf sich gerichtet sah.
»Der Kaffee schmeckt wieder großartig, Asa.«
»Das freut mich.« Sie lächelte seltsam verloren, griff zum Messer und schnitt eine große Scheibe vom Schinken ab, legte sie auf ein Stück selbstgebackenes Brot und reichte ihm beides auf einem hölzernen Tablett. »Hank hat den Schinken aus El Paso geholt. Iss so viel du willst.«
Er aß hungrig und tat auf einmal wieder so, als wäre es überall im Südwesten ruhig, als gäbe es keine Gefahr. Nach dem Essen plauderten sie, doch jeder konnte nicht vergessen, wie er soeben noch ausgesehen hatte.
Die Männer rauchten. Er hatte die langen Beine unter den Tisch geschoben und sprach über bewegte Zeiten. Immer wieder fragte Tommy ihn nach irgendwelchen Geschehnissen.
So verging die Zeit.
Auf einmal erhob Dan sich.
»Ich muss jetzt weiter. Passt alle gut auf euch auf.«
Er umarmte Asa und ihre Tochter Pennie, drückte Tommy und den Männern die Hände und verließ das Farmhaus.
Hoch stand der helle Mond über der Wüste im Westen, über den dunklen Bergzügen und bizarren Felsmonumenten, die wie riesige steinerne Särge aus dem gleißenden Sand emporragten. Kühl strich der Wind über den Hof. Bing holte ihm das abgeriebene und versorgte Pferd aus dem Stall, und er saß auf.
»Komm bald wieder, Dan!«, flüsterte Asa und presste die Hände zusammen. »Wir warten auf dich.«
Er nickte und lächelte rau.
»Mich kriegt keiner von den Füßen, Asa. Macht euch keine Sorgen um mich.«
Sein Bruder Johnny trat an das Pferd heran. Er wollte den Abschied leicht machen und sagte:
»Und bring das nächste Mal deine Freundin mit, Bruderherz! Sonst wirst du ein alter, knochiger Junggeselle. Los, hau schon ab, altes Haus!«
»Yeah!« Daniel Crook ritt an und hob die Hand. »Adios! Bis bald!«
Das Pferd trug ihn davon und am Rio Grande entlang. Sie sahen ihm nach. Wenig später war er hinter den Bäumen und Felsen am Fluss verschwunden.
»Hat er wirklich eine Freundin, Daddy?«, fragte Pennie.
»Bist du eifersüchtig, Pennie? He, Mädel, was ist los mit dir?«
Ernst lächelnd legte Asa den Arm um ihre Tochter. Pennie verehrte ihren Onkel Dan – und sie brachte ihm auch kindliche Liebe entgegen.
»Auch ich war mal ganz jung, Johnny«, sagte Ma, »und ich weiß noch, wie ich einen Mann verehrte und sogar liebte. Das ist nun mal so, Johnny …«
Daniel Crook hörte und sah die Menschen auf der Farm nicht mehr. Er ritt mit dem Wind nach Süden …
*
Wie ein Rudel Bluthunde kamen sie über die hohe Sanddüne hinweggeritten und griffen sofort mit mörderischer Gewalt die beiden Wagen an.
Schüsse krachten, und Männer kippten von den Wagen, fielen von den Pferden. Blei zerschlug die Wassertonne, zerfetzte die Planen. Brennende Pfeile bohrten sich in die Planen und setzten sie in Brand. In wilder Panik jagten die Wagenpferde los. Die Deichseln brachen, die Wagen knallten gegen Felsen, überschlugen sich und brachen auseinander.
Verzweifelt wehrten sich drei Männer gegen die heranstürmenden Apachen. Stöhnend lagen sie nebeneinander im Sand und schossen auf die Reiter. Mehrere Apachen flogen wie Bündel von den Pferden. Zwei Ponys brachen zusammen.
Gellendes Heulen schlug über den Männern zusammen. Sie schossen und kämpften um ihr Leben. Doch sie sahen nicht zurück. Hinter ihnen tauchten mehrere Apachen auf, schlichen zu Fuß heran und erschossen sie …
Schreiend stürzten die Apachen in die Wagen und rissen alles hervor, schleuderten es beiseite und wüteten wie Teufel. Mit gezogenen Messern rannten andere Apachen umher und skalpierten die Toten.
Nach wenigen Minuten war der grauenvolle Spuk zu Ende und waren die Apachen verschwunden …
Längst verweht waren die Spuren, als Daniel Crook die ausgebrannten Wagen und die leblosen Männer entdeckte. Nicht weit vom Rio Grande entfernt, lagen die Toten unter der heißen Sonne – und schon waren auch die Aasgeier in den Bäumen am Fluss und auf den Felsen.
»Diese verdammten Schweine!«, ächzte er. »Jeder redet vom Frieden, aber diese Hunde morden weiter!«
Er starrte über die Toten hinweg und nach den Wagen. Dort lag all das, was die Apachen als wertlos liegengelassen hatten – verbeulte Töpfe, Tuchfetzen, zersplitterte Wagenräder, Hocker, Gerümpel.
Sein Gesicht wurde steinern, als er näher ritt und die skalpierten Köpfe betrachtete. Würgend stieg es in seiner Kehle hoch. Er konnte die Toten nicht den Geiern überlassen. Steif saß er ab und arbeitete stundenlang, begrub die Toten.
Verstaubt und schweißnass hielt er schließlich inne. Neben ihm stand sein Pferd. Immer war die Winchester in seiner Nähe …
Grübelnd verharrte er unter der Sonne.
Er wollte nicht hassen. Doch tief in seinem Innern begann der Hass, ohne dass er es verspürte oder sich dessen bewusst wurde.
Langsam ritt er weiter.
Der Tag ging dahin.
Zwischen den Felsen am seichten Ufer des Rio Grande rastete er. Mit dem Stetson schöpfte er Wasser und kippte es sich ins Gesicht. Dann füllte er die Blechflasche und trank schließlich aus dem Fluss, lag auf dem Bauch und starrte nach drüben.