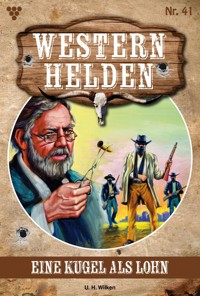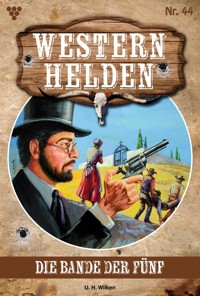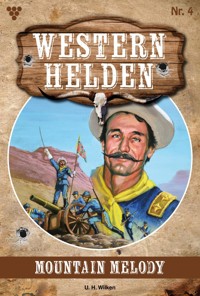Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). »Señor Day? Ich bin es – Rio!« Die weiche Stimme klang durch das Frühlicht. Ein junger schlanker Mexikaner stand vor der Hütte in den Bergen. Raunend trieb der Morgenwind die Dunstschwaden über den Hang und bewegte die verkrüppelten Baumkronen. Tiefe Stille herrschte. Langsam ließ der junge Mann die Zügel seines Maultieres los und ging auf die Hütte zu. Er beugte sich durch die offene Tür in die halbdunkle Hütte und rief wieder leise. Doch Lon Day antwortete nicht. Zögernd betrat der Mexikaner die Hütte, blickte umher und legte die Hand auf das Lager aus Fellen. Es war kalt. Lon Day mußte seine Hütte schon vor längerer Zeit verlassen haben. Seine Winchester fehlte. Im Anbau rumorte nicht das Pferd. Rio sah das Fleisch über dem Kamin aus Adobe hängen. Es war noch frisch, nicht gedörrt. In diesem Moment hörte er den Hufschlag mehrerer Pferde. Er warf sich herum und starrte mit dunklen Augen aus der Hütte. Schemenhaft verschwommen tauchten die Reiter am Berghang auf und trennten sich, kamen immer näher und verhielten schließlich auf dem Platz vor der Hütte. Dumpf schnaubten die Pferde. Eine heisere Stimme rief: »Day! Komm raus! Wir wissen, daß du ein Rind abgeknallt hast! Verkriech dich nicht in der Hütte!« Der Mexikaner wich unwillkürlich zurück. Mit flackernden Augen beobachtete er den blonden Ranchersohn Hunt Baxter und die anderen Reiter. Sie alle hockten wie die Geier auf den Pferden. Ihre Hände ruhten auf den Sattelhörnern. Kalt und feindselig starrten sie zur Hütte herüber. »Day, du hast doch wohl nicht Schiß vor uns?« rief Hunt Baxter höhnisch. »Komm
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 237 –Das Raubtier
U.H. Wilken
»Señor Day? Ich bin es – Rio!«
Die weiche Stimme klang durch das Frühlicht. Ein junger schlanker Mexikaner stand vor der Hütte in den Bergen. Raunend trieb der Morgenwind die Dunstschwaden über den Hang und bewegte die verkrüppelten Baumkronen. Tiefe Stille herrschte.
Langsam ließ der junge Mann die Zügel seines Maultieres los und ging auf die Hütte zu. Er beugte sich durch die offene Tür in die halbdunkle Hütte und rief wieder leise.
Doch Lon Day antwortete nicht.
Zögernd betrat der Mexikaner die Hütte, blickte umher und legte die Hand auf das Lager aus Fellen. Es war kalt. Lon Day mußte seine Hütte schon vor längerer Zeit verlassen haben. Seine Winchester fehlte. Im Anbau rumorte nicht das Pferd.
Rio sah das Fleisch über dem Kamin aus Adobe hängen. Es war noch frisch, nicht gedörrt.
In diesem Moment hörte er den Hufschlag mehrerer Pferde.
Er warf sich herum und starrte mit dunklen Augen aus der Hütte. Schemenhaft verschwommen tauchten die Reiter am Berghang auf und trennten sich, kamen immer näher und verhielten schließlich auf dem Platz vor der Hütte. Dumpf schnaubten die Pferde. Eine heisere Stimme rief: »Day! Komm raus! Wir wissen, daß du ein Rind abgeknallt hast! Verkriech dich nicht in der Hütte!«
Der Mexikaner wich unwillkürlich zurück. Mit flackernden Augen beobachtete er den blonden Ranchersohn Hunt Baxter und die anderen Reiter. Sie alle hockten wie die Geier auf den Pferden. Ihre Hände ruhten auf den Sattelhörnern. Kalt und feindselig starrten sie zur Hütte herüber.
»Day, du hast doch wohl nicht Schiß vor uns?« rief Hunt Baxter höhnisch. »Komm raus, du verdammter Rinderdieb!«
Schweißperlen erschienen auf dem braunen Gesicht des jungen Mexikaners. Furcht erfaßte ihn. Er preßte sich an die Hüttenwand und sah, wie einer der Reiter auf das Maultier zeigte.
»Du, Hunt – der Kerl hat Besuch.«
»Yeah«, grinste der junge Baxter und gab den Cowboys einen Wink. Daraufhin zogen die Reiter die Gewehre aus den Scabbards und luden durch. Hart klirrte es durch den Morgen. Die Pferde stampften auf der Stelle. Zaumzeug rasselte durchdringend. Hunt Baxter beugte sich vor und rief drohend: »Kommt raus, oder wir schießen die Hütte zusammen!«
Nebelfetzen wirbelten vorüber. Hinter den Bergzügen ging die Sonne auf und blendete die Reiter. Das blonde Haar des Ranchersohnes glänzte hell.
Der junge Mexikaner wußte, daß Hunt Baxter seine Drohung wahrmachen würde. Er hatte keine Chance. Steif und langsam trat er aus der Hütte hervor und bezwang mühsam seine Furcht.
»Er ist nicht da«, sagte er mit belegter Stimme, »nur ich bin hier…«
»Aah«, dehnte Hunt Baxter, »unser braunhäutiger Freund. Der Bastard hat seine Schwester alleingelassen. Ja, sie ist jetzt ganz allein in der Hütte.« Er drehte sich halb im Sattel um und deutete zum Bergzug hinüber, dessen Flanke felsgrau schimmerte. »Du läßt sie so allein, Bastard? Hast du keine Angst, daß ihr was zustoßen könnte?«
»Ich reite ja sofort zurück«, antwortete der junge Mexikaner mit dunkler, spröder Stimme.
»Nichts da!« Baxter schüttelte entschlossen den Kopf. »Erst will ich wissen, was du hier wolltest.«
»Ich wollte ihn besuchen – er ist doch unser Nachbar. Auch er lebt in so einer Hütte einsam in den Bergen.«
»Aber Muchacho! Glaubst du, mir was vormachen zu können? Du wolltest von ihm Fleisch holen. Er hat ein Rind von uns abgeschossen – und du wolltest etwas davon haben. So ist es doch.«
»Nein!« flüsterte Rio unruhig. »Ich wußte doch nichts davon.«
»Bastard, du lügst, du bist ein ganz gemeines Schwein, ein elender Lügner und Feigling. Seht doch mal nach, Jungs!«
Zwei Cowboys rutschten von den Pferden und stapften auf die Hütte zu. Rio wich ihnen aus. Sie betraten die Hütte. Der Mexikaner hörte sie in der Hütte poltern und fluchen. Er starrte zu den Reitern hinüber und sah nicht, wie einer der Cowboys lautlos aus der Hütte kam. Jäh traf ihn der Gewehrlauf im Nacken. Er stürzte nach vorn und fiel stöhnend zu Boden. Bevor er reagieren konnte, hatten sie ihn an den Armen gepackt und zerrten ihn auf den Platz hinaus.
Vom Schmerz geschüttelt hob er den Kopf an. Er blickte auf Hunt Baxters staubige Stiefel und drehte sich halb herum, sah in das grinsende Gesicht des Ranchersohnes und bemerkte zu spät die Faust. Hart traf sie sein Gesicht. Röchelnd sackte er zurück und lag auf dem Rücken. Breitbeinig stellte Hunt Baxter sich über ihn.
»Soll ich dich fertigmachen, Bastard? Du sehnst dich wohl nach Prügel, wie?«
»Bestimmt wollte er Fleisch abholen«, sagte ein Cowboy hetzend. »In der Hütte hängt frisches Fleisch.«
Gehässig starrte Hunt Baxter den jungen Mexikaner an.
»Du bist doch kein vollblütiger Greaser, nicht wahr? Du hast auch Blut von einem Weißen! Ja, du bist ein Bastard, eine kleine Drecksau…«
Die Gewalt war auf den Berg gekommen. Wenn ein Mensch nicht so aussah wie die anderen, dann war er ein Außenstehender, dann glaubte jeder, das Recht zu haben, über den Außenseiter herfallen zu können und in der Masse war der Mensch grausam.
Rio, der sich nicht selber gezeugt und geboren hatte, konnte sich kein anderes Äußeres geben. Er war ein ehrlicher und guter Kerl, den ein launisches und unbarmherziges Schicksal in diese Welt der Gewalt hineingestellt hatte – und dabei war er weich und friedlich.
»Bitte«, flüsterte er, »tut es nicht.«
Hunt Baxter verzog das männliche Gesicht zu einem zynischem Lächeln. »Was denn? Angst, du Ratte?«
Er trat zu und traf den Bauch. Rio krümmte sich stöhnend. Der Schmerz trieb ihm die Tränen aus den Augen. Zitternd lag er am Boden, während die Sonne die Winde erwärmte und die Cowboys sich um ihn herum aufstellten.
»Nein, wir tun dir gar nichts, Bastard«, meinte Hunt Baxter, der sich immer so unglaublich männlich fühlte und zeigte, »wir wollen dir nur zeigen, daß es ein Verbrechen in diesem Land ist, gestohlenes Fleisch zu nehmen.«
Er drehte sich um, trat dabei wie versehentlich auf Rios Bein und nickte den Cowboys zu.
»Gebt es ihm!«
Sie schoben sich heran. Rio kroch über den Boden, wollte weg – doch sie packten ihn und schlugen brutal zu, warfen ihn hin und her und schleuderten ihn dann in die Hütte hinein.
Unter brüllendem Gelächter rissen sie das Fleisch über dem Kamin herunter und drückten es ihm ins Gesicht. Er erstickte fast, röchelte, hörte ihr Lachen wie aus weiter Ferne, zog das Fleisch weg und kam mit blutverschmiertem Gesicht hoch.
Sie ritten über den Platz, johlten und verschwanden hinter den Bäumen und Felsklippen.
»O Gott!« stöhnte er und wälzte sich herum, zog sich am Tisch hoch und starrte mit geschwollenen Augen ins Freie. Staub wallte den Hang empor. Heiß kam der Wind herein. Überall am Boden lag das Fleisch, überall war Blut.
Das Maultier röhrte hohl. Zitternd schwankte er aus der Hütte und zu seinem Reittier, fiel dagegen und hielt sich fest. Weinend legte er das Gesicht an den warmen Körper des Maultieres.
Ein armer Kerl, der nicht ahnen konnte, wie grausam und schlimm noch alles werden sollte.
Plötzlich hob er das Gesicht an. Angst brachte in die dunklen Augen einen irren Ausdruck. Er zerrte sich mühsam auf das Maultier und ritt an.
Harte Schläge hatten seinen schlanken Körper gemartert. Fußtritte hatten ihn gequält und geschunden. Aber aller Schmerz war längst nicht so schlimm wie die Angst um seine Schwester Lupe.
Hunt Baxter und die Cowboys waren schon weit weg. Er sah die Staubwolke auf der öden Ebene, die von den Pferden hochgeschleudert wurde – und er erkannte, daß die Männer nach der Hütte ritten, wo seine Schwester zurückgeblieben war. Er schrie auf und trieb das Maultier voran, doch er konnte die Cowboys nicht einholen.
Auf Lon Days Berg war es wieder still. Leise knarrte die Tür der Hütte.
Der rauhe große Lon Day war irgendwo unterwegs, dieser gutmütige Mann, der seinen Frieden in der abgeschiedenen Welt der Wildnis suchte.
*
Das Klappern von Geschirr tönte aus der erbärmlich einfachen Behausung. Der Geruch von geschmorten Zwiebeln drang ins Freie. Schwacher grauer Rauch stieg über der einsamen Hütte empor.
Ein schönes junges Mädchen hantierte in der Hütte und summte dabei ein Mexikanisches Lied.
Guadalupe träumte in der Stille. Wie oft sehnte sich das Mädchen nach der Stadt, doch es durfte nicht in die Stadt. Eines Tages sollte es dorthin ziehen dürfen – aber wie fern war dieser Tag noch!
Draußen klapperten Hufe.
»Rio!« rief die junge Mexikanerin erfreut, hastete zur Tür und erstarrte. Ihre Freude erlosch, ihr Lächeln gefror. Wie angewurzelt verharrte sie auf der Türschwelle.
Fremde waren gekommen.
Fünf Fremde.
Männer, die Lupe noch niemals zuvor gesehen hatte.
Sie trugen den Staub eines langen Rittes auf den Gesichtern und Schultern. Sie waren verdreckt, ihre derbe Kleidung war durchgeschwitzt. Mit lauernden Blicken starrten sie umher und musterten das Mädchen. Reglos standen sie nebeneinander.
Die Pferde standen abseits zwischen den Felsen.
Der Herdrauch mußte die Männer angelockt haben.
Auf einmal grinsten sie so seltsam, so versteckt. Dabei warfen sie sich schnelle Blicke zu.
»Ein Mädchen!« flüsterte einer von ihnen staunend.
»Ja«, krächzte ein anderer und machte ein gequältes Gesicht, »ich bin ganz verrückt danach.«
»Sie ist eine Mexikanerin.«
»Das macht doch nichts!«
Sie kamen näher. Nach ein paar Schritten blieben sie wieder stehen, und ein Mann mit einer verkrüppelten Hand fragte heiser: »Bist du allein, Muchacha?«
Angst kroch in Guadalupe hoch. Sie brauchte nur in die Augen der Fremden zu sehen, um zu wissen, wie groß und wild und hemmungslos deren Begierde war.
»Nein!« schrie sie gellend auf und sprang zurück, erfaßte die Tür und riß sie zu, warf den Querbalken in die Halterung und horchte voller Entsetzen. Der Atem floh über ihre Lippen. Ihr Blick hetzte hin und her. Sie hörte das Rasseln von Sporen und heisere Stimmen und rannte zum kleinen Fenster. In fieberhafter Eile versuchte sie, die Fensterluke zu schließen. Sie riß das Fenster auf und faßte nach der Luke.
Da wurde ihre Hand von außen gepackt. Gewaltsam wurde sie ins Freie gezogen und von zwei Männern festgehalten. Ein dritter kroch durch das Fenster und öffnete von innen die Tür.
Für sie alle war das Mexikanermädchen nichts anderes als Freiwild. Denn sie waren weiß, waren Amerikaner, und das Mädchen war dunkelhäutig und ein Bastard.
Sie rissen Guadalupe in die Hütte hinein.
Guadalupe schrie entsetzt.
Hände krallten sich in ihre Kleidung und zerfetzten sie. Hände packten sie und stießen sie grausam auf das Lager. Hände hielten sie fest, fuhren über ihren Körper hinweg. Sie konnte sich nicht wehren, sie war hilflos und verloren. Für sie ging eine Welt unter, die doch manchmal schön gewesen war. Niemand dort draußen in der weiten Bergwildnis hörte ihre Schreie, ihr Flehen. Männer fielen über sie her. Jemand setzte sein Messer an ihre Brust. Hecheln und Keuchen drang aus der Hütte. Der Schrei eines jungen Menschen erstarb.
*
Mit grauen, fleckigen Gesichtern standen sie vor der Hütte. Sie bewegten sich nicht, als Rio auf dem Maultier herankam.
Keuchend trug das Tier den jungen Mexikaner auf den Berg. Rio hörte das Schnauben der Pferde und erblickte die Cowboys. Sie starrten ihm entgegen. Die Hüttentür stand weit offen. Er krümmte sich, sah in ihre Augen, rutschte vom Maultier.
»Lupe!« schrie er auf.
Er rannte los – doch zwischen den Cowboys und der Hütte blieb er stehen. Ganz langsam drehte er sich um und starrte die Cowboys an.
»Was – was ist denn?« flüsterte er.
Sie schwiegen. Der Wind bewegte die Halstücher und Pferdemähnen. Hunt Baxters Augen flackerten. Seine Lippen waren ganz spröde und aufgesprungen von der Hitze der Sonne. Schwach schüttelte er den Kopf. Kein Wort kam über die Lippen. Das blonde Haar haftete feucht am Kopf.
»Sagt doch was!« stöhnte Rio.
Doch die Männer, die ihn mißhandelt und zusammengeschlagen hatten, die alle so männlich hatten sein wollen, schwiegen bedrückt.
Da schrie er auf und rannte weiter.
»Geh nicht rein!« brüllte Hunt Baxter mit zerrissener Stimme. »Bleib draußen!«
Rio erstarrte auf der Türschwelle. Halbdunkel gähnte das Innere der Hütte vor ihm. Er hörte Sporengerassel und davonrasende Pferde. Staub wehte heran. Dann war es still.
»Lupe?« hauchte er. »Antworte doch!«
Ganz langsam trat er über die Türschwelle hinweg und schwankte.
»Nein!« flüsterte er. »Nein, das darf nicht…«
Sie lag auf dem Lager. Der Oberkörper war blutrot. Das lange schwarze Haar war zerwühlt und zerrissen, das Gesicht zerkratzt. An ihren Fingernägeln hingen Büschel von Haaren – schwarze und rötliche Haare. Ein Messerstich hatte sie getötet.
Der junge Mexikaner konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Aufschreiend brach er zusammen, fiel auf die Türschwelle zurück und krümmte sich wimmernd. Das Gesicht zerriß, die Hände fuhren zuckend durch den heißen Sand. Das Blut aus dem Rindfleisch bedeckte das Gesicht wie eine dünne Kruste.
Er konnte das Ungeheuerliche nicht begreifen. Alles in ihm wehrte sich dagegen. Er konnte nicht an den Tod der Schwester glauben, doch sie war tot, es war unabänderlich und endgültig.
Schluchzend lag er in der Tür.
»Ihr Mörder!« röchelte er und stierte über den Platz hinweg. »Ihr habt sie umgebracht! O mein Gott, wie konntet ihr das nur tun! Meine Schwester…«
Längst waren die Reiter verschwunden. Er war allein. Und er weinte und schrie.
Nach einer Ewigkeit des stumpfen Dahinbrütens und der völligen Leere bewegte er sich, kroch in den Sand und richtete sich schwankend auf.
Er wollte in die Hütte gehen, doch er hatte nicht die Kraft, seine Zwillingsschwester noch einmal zu sehen.
Er taumelte zum Maultier.
Ein achtzehnjähriger junger Mexikaner ritt vom Berg des Todes. Weinend hockte er auf dem Maultier. Er folgte nicht Hunt Baxter und den Cowboys. Er brauchte einen Menschen, bei dem er Liebe finden konnte.
Es trieb ihn nach Laguna.
Irgendwo in dieser Stadt lebte seine Mutter zurückgezogen und allein, eine ergraute Mexikanerin, die manchmal zum Berg gekommen war, um ihre Kinder zu besuchen.
Er wußte nicht, in welchem Haus sie wohnte. Niemals hatten er und seine Schwester sie aufsuchen dürfen – niemals.
Trostlos weit war das Land und voller Kakteen, Comas, Felsen und Sand, von Schluchten zerklüftet, von Tälern durchzogen. Doch so trostlos es auch war – er hatte dieses Land geliebt.
Das Maultier trottete dahin. Nach Meilen überquerte es die Spur mehrerer Pferde.
Rio sah die Spuren nicht. Er folgte dem Weg nach Laguna. Und er sah auch nicht die Männer, die ihn beobachteten.
Immer näher kam er heran.
Sie erkannten in ihm den Mexikaner. Einer von ihnen zog das Gewehr und legte es an. Der Lauf reflektierte das grelle Sonnenlicht. Unruhig tänzelte das Pferd unter dem Schützen. Jäh peitschte der Schuß durch die lastende Stille und weckte ein grollendes Echo in den Tälern.
Der junge Mann zuckte zusammen. Die rechte Hand fuhr noch halb hoch, als wollte er an den Kopf greifen. Schlaff fiel er vom Maultier und klatschte auf den felsigen Boden. Das Maultier blieb sofort stehen.
»Der steht nicht wieder auf.«
»Du schießt noch immer höllisch gut. Reiten wir weiter. Irgendwo können wir uns ausruhen.«
Hufschlag entfernte sich. Die Sonne brannte auf den Weg hernieder und in Rios Gesicht. Harte Grasbüschel raschelten am Wegrand. Die Schatten der Kakteen wanderten weiter.
*
»Dad, kann ich mit dir reden?« Verstaubt stand Hunt Baxter in der Wohnhalle des Ranchgebäudes und drehte den Stetson unruhig zwischen den Händen. Immer wieder schluckte er trocken und würgend. »Es ist sehr wichtig, Dad.«
»Sind uns wieder einmal Rinder entlaufen?« Der Rancher stellte die Flasche Whisky in den Schrank zurück und trank das volle Glas leer. Langsam drehte er sich um und wandte das verwitterte Gesicht dem Sohn zu.
»Nein, Dad – das heißt, ein Rind hat sich davongemacht, und dieser Lon Day hat es abgeschossen.«
Ford Baxter kniff die Augen zusammen und verzog das Gesicht.
»Der alte Lon Day«, knurrte er verächtlich, »dieser alte gutmütige Esel… Ich könnte ihn hinwegfegen, wenn ich es wollte.«
Er nahm das Glas und füllte es erneut. Im Hintergrund erhob sich eine blonde Frau, die einst sehr schön gewesen sein mußte.
»Trink nicht soviel, Ford«, sagte sie, »damit kannst du nichts ungeschehen machen oder irgendetwas vergessen.«
»Laß mich nur«, brummte er und nahm einen kleinen Schluck. »Ist das alles, Hunt?«
»Nein, Dad.« Der Sohn machte ein Gesicht, als müßte er sich übergeben. Mit stockender Stimme sagte er: »Als wir das Rind fanden, dachte ich sofort an Lon Day. Wir ritten hin. Das Fleisch hing in der Hütte, aber Day war nicht da. Wir sahen den Mexikaner vor der Hütte.«
»Diesen jungen Burschen?« Ford Baxter krampfte die Hand um das Glas. »Was dann? Rede!«
»Du weißt, daß ich die Mexikaner nicht ausstehen kann, Dad.«
»Ja, du haßt sie alle, du Narr!« grollte Baxter. »Aber es sind auch Menschen.«
Die blonde Frau kam heran und griff nach seiner freien Hand.
»Ford!« hauchte sie.
»Beruhige dich, Maureen. Weiter, Hunt!«
»Ja – weiter«, sagte Hunt dumpf. »Wir schlugen ihn zusammen, weil er sich Fleisch von Day holen wollte, und dann…«
»Ich habe dir verboten, den Mexikaner und seine Schwester zu belästigen!« schrie Ford Baxter mit brüchiger Stimme. »Hast du taube Ohren? Du sollst ihn nicht anrühren.«
»Er ist ein Bastard, Dad! Immer wieder verschwinden Rinder. Bestimmt fressen diese Bastarde sie auf! Sie haben doch sonst nichts!«
Baxter schloß die Augen und sank in den Sessel. Seine Frau hielt noch immer die Hand.
»Wir ritten weg, Dad. Zu seiner Schwester. Sie lag tot in der Hütte, mit einem Messer umgebracht, Dad. Dann kam er und sah uns. Ich wollte nicht, daß er in die Hütte läuft, aber er tat es doch. Da sind wir weggeritten. Die Mexikanerin sah furchtbar aus, Dad!« stöhnte Hunt Baxter.
Die Hand des Ranchers schloß sich, das Glas zersprang, Splitter zerschnitten die Hand, Scherben fielen zu Boden, Whisky tropfte mit Blut von der Hand.
»Das Mädchen ist tot?«
Leer war seine Stimme, klanglos. Das Kinn sackte auf die Brust. Der Atem kam schwer und pfeifend. Graue Flecken waren im Gesicht.