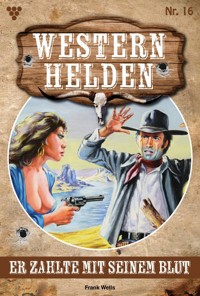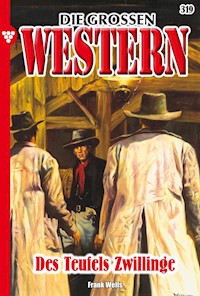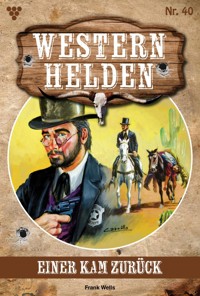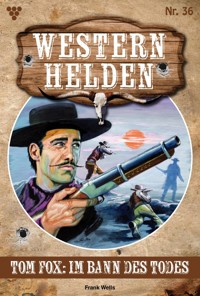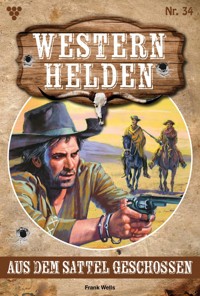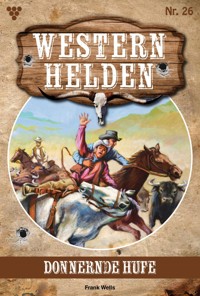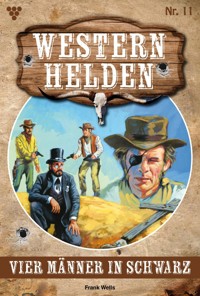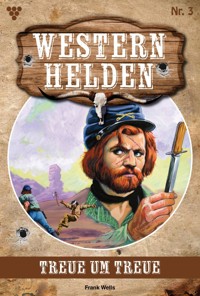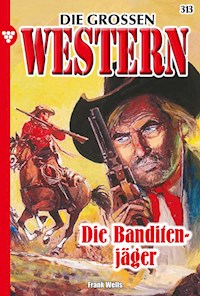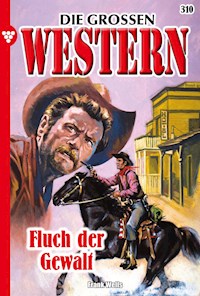Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Er hatte alles einkalkuliert, als er fliehen wollte: den Wächter, die Zeit seines Rundganges, die vielen Stahltore und die Gefängnismauer. Matt Brandon hatte gehofft, bis zum Morgen einen guten Vorsprung herausholen zu können. Aber nun war seine Flucht schon entdeckt. Ein Kanonenschuss aus dem alten Vorderlader, der auf dem Wachtturm des Zuchthauses stand, meldete es ihm. Erst der Schuss und nun das durchdringende Winseln der Glocke. Matt Brandon blieb stehen und starrte zurück. Seine Lungen pumpten – alles vergeblich. »Lebendig kriegen sie mich nicht!«, flüsterte er. Er begann zu laufen. Aber selbst in diesen Minuten der Panik vergaß er nicht seinen Plan, den er in langen Nächten ausgebrütet hatte. Er verfluchte den Tag, an dem er in dieses Land gekommen war. Fremont, berühmt durch sein Zuchthaus, die gnadenlose Endstation für manchen gnadenlosen Mörder. Er war in die Stadt geritten, um einen Mann zur Rechenschaft zu ziehen. Er hatte seinen Mann gefunden, den Kerl, der ihn um Hab und Gut betrogen hatte. Der Gent lachte ihn aus. Er konnte das, denn er war einer der Mächtigen in Fremont und nicht ein Satteltramp wie Matt Brandon. Der feine Gent hetzte zwei seiner Leute auf Matt. Am Ende lagen sie alle drei tot auf den Dielen. Dann kam der Town-Marshal mit gezücktem Revolver und rasselnden Handschellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 432 –Todesfaust
Frank Wells
Er hatte alles einkalkuliert, als er fliehen wollte: den Wächter, die Zeit seines Rundganges, die vielen Stahltore und die Gefängnismauer. Aber eines hatte er nicht berechnet: dass man den gefesselten Wärter schon nach sehr kurzer Zeit finden würde …
Matt Brandon hatte gehofft, bis zum Morgen einen guten Vorsprung herausholen zu können. Aber nun war seine Flucht schon entdeckt. Ein Kanonenschuss aus dem alten Vorderlader, der auf dem Wachtturm des Zuchthauses stand, meldete es ihm.
Erst der Schuss und nun das durchdringende Winseln der Glocke. Matt Brandon blieb stehen und starrte zurück. Seine Lungen pumpten – alles vergeblich. »Lebendig kriegen sie mich nicht!«, flüsterte er.
Er begann zu laufen. Aber selbst in diesen Minuten der Panik vergaß er nicht seinen Plan, den er in langen Nächten ausgebrütet hatte. Er verfluchte den Tag, an dem er in dieses Land gekommen war. Fremont, berühmt durch sein Zuchthaus, die gnadenlose Endstation für manchen gnadenlosen Mörder. Auch für Matt Brandon …
Er war in die Stadt geritten, um einen Mann zur Rechenschaft zu ziehen. Er hatte seinen Mann gefunden, den Kerl, der ihn um Hab und Gut betrogen hatte.
Der Gent lachte ihn aus. Er konnte das, denn er war einer der Mächtigen in Fremont und nicht ein Satteltramp wie Matt Brandon. Der feine Gent hetzte zwei seiner Leute auf Matt. Am Ende lagen sie alle drei tot auf den Dielen.
Dann kam der Town-Marshal mit gezücktem Revolver und rasselnden Handschellen. Später Jury und Richter, die in feierlicher Gerichtssitzung den Mörder Matt Brandon zu ›lebenslänglich‹ verdammten.
Matt Brandon blieb stehen. Wie weit noch zum Fluss? Der Missouri blieb die letzte Hoffnung …
Und dann hörte er es. Ein schwacher Laut nur wehte mit dem Orgeln des Windes heran: das kurze Blaffen eines Hundes.
Er wusste, was in der Finsternis hinter ihm vorging. Da waren Reiter unterwegs mit Gewehren in den Fäusten und Revolvern. Aber schlimmer als jede Waffe und jeder noch so gefährliche Mann waren die Hunde. Bluthunde, auf den Mann dressiert.
Matt Brandon zwang seine Beine zum Trab, stolperte durch die Hügel mit hämmernden Pulsen und keuchenden Lungen. Der Fluss! Der Missouri!
Und er lief, lief, lief, bis er klebrigen Sand und saugenden Schlamm unter den Stiefeln spürte, bis das Rauschen und Gurgeln der Fluten bösartig laut wurde … Bis er sich kopfüber hineinstürzte in das eisige Wasser, das der alte Missouri von den Bergen heruntertrug.
Schon nach einer Minute wusste Matt Brandon, dass er keine Chance hatte zu überleben. Die Kälte drang im Nu durch bis aufs Mark und ließ sein Blut gefrieren.
Ein Strudel griff nach Matt und zerrte ihn hinab, spie ihn wieder aus. Er wehrte sich mit der Verzweiflung eines Mannes, der leben will.
Ans Ufer zurück! Aber wo war das Ufer? Irgendwo im Nichts … Matt Brandon wusste nicht, wie lange er ein Spielball der Wellen war. Er verlor jeden Zeitbegriff.
Plötzlich hörte er eine Stimme. Sie war ganz nah. Sie sagte: »Die Flut treibt uns mehr ab, als ich dachte. Aber der Wind ist stark genug. Pass auf, ich …«
Und dann sah Matt Brandon aus halb blinden Augen das schemenhafte Etwas, das mit hoher Bugwelle an ihm vorbeizischte. Ein Boot unter vollen Segeln. Ein Segelboot. Wenn er diese allerletzte Chance verpasste …
Und Matt Brandon spannte alle Kräfte zu einer verzweifelten Anstrengung. Die Bordseite glitt rasend schnell vorüber, die Bugwelle warf sich gegen sein Gesicht, er kämpfte sich hindurch, warf beide Arme keuchend nach vorn, spürte irgendetwas an den Händen, griff nach und klammerte sich fest.
Dann sagte eine andere Stimme über ihm: »Es ist kalt, Spencer. Willst du nicht aufs Land zuhalten?«
Und die Männerstimme antwortete: »Geh in die Kajüte, und wärme dich durch, Isabella. Du weißt, ich liebe solche Fahrten auf wildem Wasser über alles. Oder zieh dir mein Schaffell über.«
»Ja«, sagte die melodische Stimme des Mädchens, das Isabella hieß, »das werde ich tun.«
Langsam kam Matt Brandon wieder halbwegs zur Besinnung. Er spürte seine Finger nicht mehr. Lange konnte er es nicht mehr aushalten.
Er hörte, wie die Frau zurückkam.
»Jetzt ist mir wohler«, sagte sie. »Sag mal, Spencer, was haben die vielen Lichter auf dem Fluss zu bedeuten? Mindestens zehn Boote sind mit Lampen und Fackeln unterwegs.«
»Es wird mit dem Kanonenschuss zusammenhängen, den wir vorhin gehört haben.«
»Oh, vom Zuchthaus? Glaubst du wirklich, dass ein Sträfling ausgebrochen ist?«
»Ja. Oder es ist eine Meuterei im Zuchthaus. Das kommt öfter vor.«
»Schrecklich. Wenn diese vertierten Menschen losbrechen, möchte ich nicht in der Nähe sein!«
»Hm«, brummte der Mann. »Ich kanns ihnen beinahe nachfühlen, wenn sie meutern. Man geht nicht besonders gut mit ihnen um. Und selbst Verbrecher sind Menschen. Aber diesmal scheint es sich wirklich um einen Flüchtling zu handeln, sonst wären die Boote nicht unterwegs. Ich halte mal drauf zu. Kannst du die Lampe am Bug befestigen?«
»Natürlich.«
Matt Brandon lauschte dem Zwiegespräch mit wachsender Besorgnis. Er spürte, wie das Ruder, an dem er hing, ein wenig herumgelegt wurde.
Nach endlos langer Zeit kam die Frau zurück. »Willst du beidrehen, Spencer?«, fragte sie.
»Nein. Ich nehme nur etwas Fahrt weg.«
Das Segel knatterte leise um den Mast – dann sah Matt Branden in geringer Entfernung Lampen auf einem Boot. Hörte eine raue Stimme: »Hallo! Wieso treiben Sie sich jetzt noch auf dem Fluss herum? Wer sind Sie?«
»Boot ahoi!«, rief der Mann in Matts Boot. »Ich bin Spencer Marlowe. Suchen Sie etwas?«
»Ein Sträfling ist ausgerissen, ein Lebenslänglicher. Wir müssen den Fluss absuchen.«
»Der Missouri gibt bei Hochwasser keinen raus. Wie heißt der Mann?«
»Ein dreifacher Mörder – Matt Brandon. Vielleicht entsinnen Sie sich an …« »O ja – Danke. Ahoi!«
Die Lampen und Fackeln glitten achteraus weg, auf neuem Kurs schnitt das Boot durch die Wellen. Und wieder fluchte der Mann – Spencer Marlowe.
»Ich glaube, das Ruder klemmt«, hörte Matt die Stimme.
Sein Herz klopfte oben im Halse.
»Also doch ein Sträfling«, sagte Isabella. »Ein Mörder. Wehe, wer dem in die Finger fällt!«
»Hm«, brummte Spencer. »Ich habe den Prozess verfolgt. Matt Brandon. Er hat Stewart erschossen. Erinnerst du dich? Stewart, diesen schleimigen Strolch – und zwei von seiner Leibwache.«
»Und wenn schon! Mord bleibt Mord. Selbst wenn Brandon von Stewart betrogen worden war, wie er behauptete, hätte er nicht schießen dürfen. Schließlich leben wir in einem geordneten Staatswesen und …«
»Na, ich sehe ja schwarz, wenn du mit mir in den Westen ziehen willst! Es soll dort nämlich Gegenden geben, in denen die Leute sich ihre Gesetze selbst zimmern.«
»Ach, das sind doch Fantastereien. Glaubst du im Ernst, dort drüben in Wyoming gäbe es noch so vorsintflutliche Anschauungen? Ich kann das nicht glauben.«
»Du brauchst gar nicht bis Wyoming zu gehen. Der Fall Matt Brandon ist ein Musterbeispiel – und hat sich direkt vor unserer Haustür abgespielt. Mach dich auf einiges gefasst, Schwesterherz.«
»Mir kannst du die Freude nicht versalzen. Ich freue mich mächtig darauf, wieder einmal im Sattel sitzen zu können wie damals, als wir noch Kinder waren und Dads Ranch noch bestand. Wir werden doch dort reiten können?«
»Wir werden sogar müssen. Nach allem, was Dorado mir geschrieben hat, herrschen im Miramar-County ziemlich hinterwäldlerische Zustände. Wir werden ihnen mit dem Staudamm eine neue Zeit bringen.«
»Fürchtest du tatsächlich, auf Widerstand zu stoßen? Ich kanns mir nicht vorstellen, Spencer.«
»Ich fürchte es nicht, sondern ich rechne damit. Jede Neuerung findet Freunde und Feinde, vielleicht sogar Hass. Wir werden es sehen, wenn wir in Miramar ankommen. Dorado ist zuversichtlich, warum also sollte ich es nicht sein?«
»Spencer Marlowe, der geniale, große Ingenieur! Ich bin stolz auf dich!«
»Na, so genial ist es wahrhaftig nicht, einen Staudamm zu bauen, um unfruchtbares Land zu bewässern …«
Soweit hörte Matt Brandon jedes Wort. Und von Sekunde zu Sekunde steigerte sich seine Qual. Er konnte nicht mehr. Sollten sie mit ihm machen, was sie wollten, wenn er nur hier herauskam, aus dem nassen Grab.
»Hallo«, krächzte er und wunderte sich über seine eigene Stimme. »Hallo – helfen Sie mir, bitte …«
Spencer Marlowe reagierte überraschend schnell. Er ließ die Segelleine fallen. Das Boot schwankte, neigte sich von Bord zu Bord und legte sich fast gerade.
»Was ist los?«, fragte Isabella.
»Übernimm bitte das Ruder«, sagte Spencer und beugte sich über Bord. Er sah, während seine Schwester heranhuschte, das blasse Oval eines Kopfes und fasste zu. Eine Hand, kälter als Eis, berührte die seine – und schnell packte er sie und hielt sie fest. Er brauchte fast eine Minute zu dem Rettungswerk, denn der Mann, den er aus dem Wasser zog, war hart an der Grenze zum Nichts.
»Matt Brandon!«, murmelte Spencer Marlowe überrascht.
Isabella unterdrückte einen Aufschrei und fasste ihres Bruders Arm. »Schnell«, stieß sie hervor, »die Boote sind noch auf dem Wasser. Sie suchen ihn doch. In wenigen Minuten sind wir ihn los – den Verbrecher.«
»Moment, Isabella. Zunächst einmal ist er ein Mensch, der um Haaresbreite am Tode vorbeigeschlüpft ist. Hol bitte die Whiskyflasche – oder nein. Ich bringe ihn in die Kajüte. Dort kannst du ihn versorgen.«
»Ich? Einen Mörder? Nie! Wir müssen ihn ausliefern!«
»Das findet sich. Lass ihn erst mal zu Verstand kommen. Ein Bad in diesem Eiswasser – brrr.«
Spencer schleppte Matt Brandon in die Kajüte, öffnete eine Whiskyflasche und träufelte etwas Alkohol zwischen die rissigen Lippen des Halbertrunkenen, der mit geschlossenen Augen dalag.
Isabella stand an der Tür und starrte in das leblose Gesicht des Geretteten.
Eine dunkelblonde Haarsträhne klebte klatschnass über der gebräunten Stirn, über einer breiten wuchtigen Stirn. Sie sah, wie die blaue Schlagader tickte. Sie bemerkte den strengen Gesichtsschnitt, die engen Lippen, das harte Kinn und die Adlernase. Selbst in dieser Totenstarre strömte das Gesicht Energie aus.
»Geh bitte ans Ruder, und halt aufs Ufer zu«, sagte Spencer. »Wir müssen sehen, dass wir an Land kommen. Zu der kleinen Hütte …«
*
Spencer Marlowe drehte eine Zigarette und schaute Matt fragend an. Der nickte, und Spencer warf ihm die Zigarette zu. Er drehte sich selbst eine zweite, reichte Matt und sich selbst Feuer und sagte über die verglimmende Flamme hinweg: »Fühlen Sie sich gesund, oder hat das Bad ihnen etwas getan?«
»Ich glaube nicht. Wenn die verdammte Kälte erst aus meinen Gliedern gewichen ist …«
»Gut. Ich will einmal auf meine schwache Menschenkenntnis bauen, Brandon. Meine Schwester und ich bleiben bis morgen abend hier in der Fischerhütte. Ich gebe Ihnen Kleidung. Sie dürfte ungefähr passen. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Sie wissen nicht, wer ich bin. Sie versprechen mir nur eins: dieses Land auf geradem Wege zu verlassen.«
»Und … und das Zuchthaus?«
»Ich bin nicht Ihr Richter, Brandon. Wenn ich Ihr Richter gewesen wäre, hätte das Urteil anders ausgesehen. Für mich war es Notwehr. Glauben Sie, sonst würde ich Ihnen die Chance geben?«
Am Abend des nächsten Tages schauten Isabella und Spencer Marlowe dem Mann nach, der mit schnellen Schritten in der Dämmerung verschwand.
*
An einem sonnigen Tag im Frühherbst kam Isabella Marlowe im Miramar-County an.
Gut, dass die Bahn direkt bis Miramar führte. Besonders gut für Spencer, der auf diese Weise alle Baumaterialien schnell an Ort und Stelle bringen konnte. Isabella hat mit Befriedigung die Aufschriften auf den fünf Güterwagen gelesen, die hinter den Personenwagen des Zuges angekoppelt waren: »An die Heimstättengenossenschaft E.P. Dorado, Miramar. Baugut«.
Der Mann, der Isabella gegenübersaß, hatte geschlafen. Jetzt gähnte er, betrachtete Isabella unter buschigen Brauen hinweg, stopfte eine Pfeife, zündete sie an und sagte: »Sie sind neu in dieser Gegend, Schwester? Man sieht’s.«
Isabella lächelte. Jede Abwechslung war ihr recht. Und der Graukopf gefiel ihr. »Ja, allerdings. Ein schönes Land, ich bin begeistert. Kennen Sie Miramar?«
»Seit ich denken kann – und das ist schon eine Weile her, Schwester. Solls ein Besuch sein? Ich wüsste nicht, welcher Rancher so was Hübsches wie Sie erwarten könnte …«
»Kein Rancher. Ich will zu meinem Bruder. Vielleicht kennen Sie ihn, obwohl er noch nicht lange dort ist.«
»Hm. Ich kenne jeden in Miramar. Nelson mein Name, Couch Nelson. Die Doppelkreuz-Ranch gehört mir. Aber von Rindern verstehen Sie wohl nichts?«
»Ein bisschen. Mein Vater hatte früher auch eine kleine Ranch. Vier Dürrejahre haben ihn um den Besitz gebracht.«
»Ja, so ist das. Mal gehts rauf, und mal gehts runter. Miramar gefällt mir nicht mehr. Zuviel Betrieb, seit dieser verdammte Staudamm gebaut wird.«
»Um den Staudamm? Aber warum denn? Es ist doch eine Arbeit, die dem ganzen Land Segen bringen wird …«
»Glauben Sie? Nein, Schwester, das ist ein Windei. Na ja, noch ist der Staudamm nicht fertig – und wahrscheinlich wird er es nie.«
»Was haben Sie denn nur gegen das Werk?«, fragte sie beklommen.
»Eine ganze Masse. Zum Beispiel werden unsere Weiden noch weniger Wasser bekommen als bisher, weil der Crystal-River praktisch umgelegt wird. Haben Sie nicht selbst gesagt, dass Ihr Vater seinen Besitz durch Dürrejahre verloren hat? Sehen Sie, bei uns braucht nicht mal ein Dürrejahr zu kommen. Uns wollen sie das Wasser einfach ganz abschneiden. «
»Unmöglich! Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.«
»Tatsache, Madam. Sehen Sie, bisher war die Hälfte unserer Weide Regierungsland. Jeder durfte sein Vieh draufschicken und grasen lassen. Nun hat die Regierung das Land plötzlich zum Verkauf freigegeben. Jeder von uns Ranchern wollte es haben – und keiner hats bekommen. Stattdessen kam so ein hergelaufener Fremder und steckte es in die Tasche. Und wofür? Für eine Siedlungsgesellschaft. Die Sunset-Weide soll in einzelne Parzellen zerlegt und an Siedler verteilt werden. Und weil es den ganzen Sommer über an Wasser fehlt, bauen die Halunken einen Staudamm, um das Siedlungsgelände zu berieseln – und wir Rancher können uns die Nase wischen.«
»Sie glauben tatsächlich, dass ihre Weiden trocken liegen werden?«
»Wir wissen es. Der einzige Fluss in unserem County ist der Crystal-River, verstehen Sie? Er bewässert alle Weiden, wenn es im Sommer auch nur ein paar Tropfen sind. Aber die Schneeschmelze im Frühling, die machts. Und gerade das Frühlingshochwasser wollen sie uns ja wegschnappen! Ich …«
Die Lok ließ mal wieder einen asthmatischen Pfiff hören und hielt an. Couch Nelson beugte sich hastig zum Fenster, riss es herunter, schrie: »Hallo, Boys!«, wandte sich grinsend Isabella zu und sagte: »Moment, Schwester, wir haben eine kleine Arbeit zu erledigen.«
Er stülpte sich den Stetson auf den Schädel und stürmte hinaus. Ein paar Cowboys spuckten ihre Glimmstängel aus und folgten ihm auf dem Fuße – und nun war auch Isabellas Interesse geweckt. Sie schaute aus dem offenen Fenster und erstarrte vor Schreck.
Jenseits des Baches hielt ein ganzer Trupp Reiter. In diesem Augenblick verließen alle bis auf einen die Sättel und sprangen mit Äxten und anderen Werkzeugen in der Faust über den Bach. Ein Überfall, durchschoss es Isabella. Banditen!
Doch dann erkannte sie Couch Nelson und die Cowboys aus dem Abteil mitten im Haufen der anderen Männer. Und als die ersten Axtschläge in das Holz der Güterwagen splitterten, wusste sie, was die Glocke geschlagen hatte.
Isabella Marlowe warf nur einen Blick auf die Szene, dann eilte sie durch das Abteil und sprang hinaus.
»Stop!«, schrie sie. »Halt! Zurück! Sind Sie wahnsinnig geworden? Mister Nelson!«
Die Tür des ersten Güterwagens wurde von starken Fäusten aufgeschoben – und dann peitschte ein Schuss. Er kam aus dem Wagen.
»Die nächste Kugel sitzt«, brüllte eine Männerstimme. »Ich werde euch Halunken …«
Weiter kam der Mann im Güterwagen nicht. Zwei oder drei Schüsse fielen fast gleichzeitig. Dann ein furchtbares Stöhnen und Röcheln … ein dumpfer Fall.
Isabella fühlte Schwäche in den Knien.
Mord! Sekundenlang kreiste alles vor ihren Augen – dann hörte sie Couch Nelsons heisere Stimme.
»Verdammt, wer hat geschossen? Habe ich nicht gesagt, dass kein Blut vergossen werden soll?«
Isabella raffte sich auf, drängte sich durch den Kreis und sah den zusammengesunkenen Mann in der Tür des Güterwagens.
»Heben Sie ihn heraus, schnell!«, befahl sie. »Wer hat Verbandzeug? Oder ist er …«
Der alte Nelson war als erster im Wagen.
Zwei Cowboys folgten ihm.
»Er lebt noch«, brummte Nelson und schoss einen schnellen Blick auf Isabella. »Fasst an, Jungs!«
Die leblose Gestalt wurde behutsam herausgehoben und neben dem Personenwagen ins Gras gebettet. Irgendjemand reichte Isabella Verbandzeug. Sie knöpfte mit zitternden Händen das Hemd des Bewusstlosen auf, der einfache Arbeitskleidung trug. Sicher ein Mann Spencers.
»Sparen Sie sich die Mühe«, sagte eine spöttische Stimme des Mannes hinter ihr. »Der ist geliefert.«
Wie sie diese Stimme hasste! Aber wenn sie keine Hilfe bekam …
»Mister Nelson!«, rief sie. »So helfen Sie doch!«
Der Graukopf hörte sofort. Er biss die Zähne aufeinander, als er sich neben Isabella niederbeugte. »Das habe ich nicht gewollt«, murmelte er. »Kein Blut. Verdammt …«
»Stellen Sie sich nicht so an, Nelson«, sagte die arrogante Stimme. »Wir müssen alle sterben. Und er hat zuerst geschossen.«
»Zur Hölle, Keene, sparen Sie sich Ihre verdammten Bemerkungen! Der hier hat seine Pflicht getan und sonst nichts. Außerdem hat er nur einen Warnschuss abgegeben.«
»Und wenn seine nächste Kugel in Ihren schönen Kopf gegangen wäre, was dann?«
»Keene, Ihr Ton gefällt mir nicht. Warum fassen Sie denn nicht mit an, wenn Ihnen soviel daran liegt, dass wir schnell fertig werden?«
Keene lachte nur spöttisch und trieb sein Pferd über den Bach zurück. Während Isabella alles tat, um die Blutungen der Wunde zu stillen, hörte sie mit schmerzender Eindringlichkeit das Poltern, mit dem die Wagen geleert wurden, hörte, wie die Zementsäcke in den Bach klatschten und das Holz krachend auf einen Haufen geworfen wurde.
Endlich saß der letzte Verband. Sie strich mit zitternder Hand eine verschwitzte Haarsträhne aus dem Gesicht.
Sie spürte Couch Nelsons Blicke und schaute ihn an.
»Ich glaube«, sagte er schwerfällig, »dass er es schaffen kann. Tut mir leid, Schwester …«
Da konnte Isabella sich nicht mehr halten. »Tut mir leid, tut mir leid!«, rief sie zornig. »Was glauben Sie denn, was jetzt geschieht? Wissen Sie, was das ist, was Sie und diese Leute dort angezettelt haben? Raub ist das! Und dazu versuchter Mord – wenn dieser Mann wirklich mit dem Leben davonkommt. Was hat Ihnen denn dieser unschuldige Mann getan, dass er vielleicht sterben muss?«
Wieder platschte das Wasser des Baches, als Keene sein Pferd hindurchtrieb. Isabella betrachtete ihn mit zornverdunkelten Blicken.
»Sie reden ziemlich laut, Kindchen«, sagte er, während er eine Zigarette zwischen die Lippen steckte und anzündete. »In diesem Lande gelten unsere Gesetze. Es wäre besser, wenn Sie Ihre schönen Augen schlössen und so täten, als hätten Sie nichts gesehen.«
»Erstens bin ich nicht Ihr Kindchen, Mister Keene«, sagte Isabella kalt. »Zweitens interessieren mich Ihre Gesetze herzlich wenig – wenn sie mit Raub und Mord geschrieben werden. Und drittens weiß ich sehr gut einen Traum von der Wirklichkeit zu unterscheiden. Ich werde dafür sorgen, dass Sie vor dem Richter erscheinen, Mister Keene. Selbst in Miramar dürfte Mord nicht gerade vom Gesetz belohnt werden.«
Sie sah, wie seine bernsteinfarbenen Augen sich jäh verdunkelten. Er warf die kaum angerauchte Zigarette weg, legte beide Hände auf den Sattelknopf und beugte sich langsam vor. »Was ich sage, meine ich auch, Mylady!« Das war blutiger Hohn. »Und wenn Sie von einem Richter träumen, könnte es für Sie ein schlimmes Erwachen geben!«