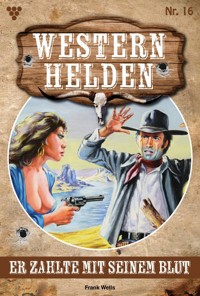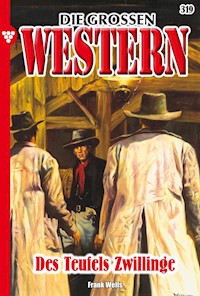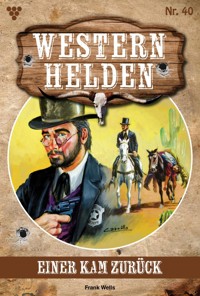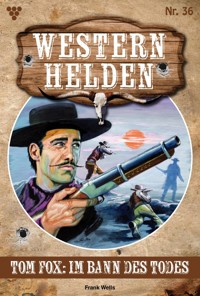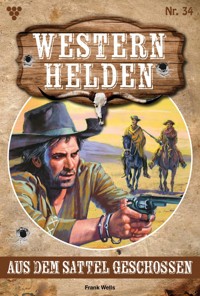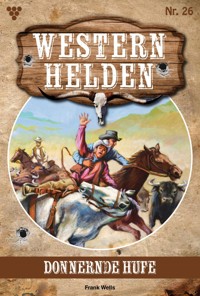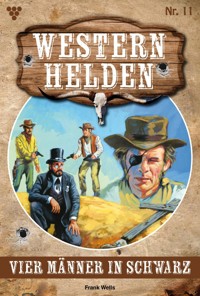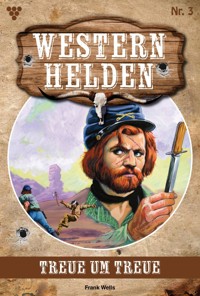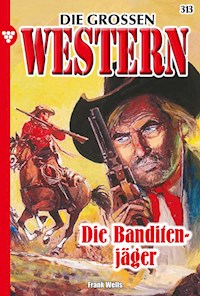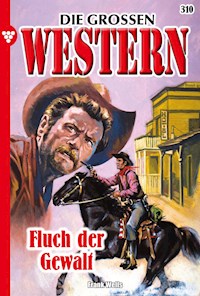Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Als die Sonne sank, waren zwanzig Männer gestorben: acht auf der Seite des Rindermanns Graham, zwölf aufseiten des Schafzüchters Blount. Die Esperanza-Valley-Fehde würde in die Annalen der blutigen Geschichte des Westens eingehen. An dem Sieg Grahams gab es nichts zu drehen und zu deuteln. Die schwerwiegendste Nachricht traf ein, als Grahams Mannschaft sich sammelte und die abgetriebenen Pferde absattelte. »Blount hats erwischt«, verkündete Slim Hay. »Sie bringen ihn in die Stadt, aber ich schätze, er sieht die Sonne nicht mehr aufgehen.« »Das ist der Sieg!«, brüllte Bruce Graham. »Wir haben sie alle in der Tasche, Jungs. – Diese Weiden und das ganze Land … es gehört uns!« »Uns?«, dachte Cliff Brand bitter. Dir gehört es … und morgen schon wirst du vergessen haben, wer es für dich erobert hat. Die anderen Männer stimmten großenteils in das Gebrüll des Sieges ein. Vormann Larry Born wandte sich, unberührt von dem Trubel, an den Kundschafter Slim Hay. »Was hast du gesehen – und wo hast du es gesehen?« Slim hielt eine Zigarette schief zwischen den Lippen und stieß den Rauch durch Mund und Nase aus. Sein verwegenes Raubvogelgesicht glühte noch vom Kampf her. »Ich habe einen Halbkreis unter den White-Cliffs entlanggeschlagen«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 435 –Nur einer blieb treu
Frank Wells
Als die Sonne sank, waren zwanzig Männer gestorben: acht auf der Seite des Rindermanns Graham, zwölf aufseiten des Schafzüchters Blount.
Die Esperanza-Valley-Fehde würde in die Annalen der blutigen Geschichte des Westens eingehen. An dem Sieg Grahams gab es nichts zu drehen und zu deuteln.
Die schwerwiegendste Nachricht traf ein, als Grahams Mannschaft sich sammelte und die abgetriebenen Pferde absattelte.
»Blount hats erwischt«, verkündete Slim Hay. »Sie bringen ihn in die Stadt, aber ich schätze, er sieht die Sonne nicht mehr aufgehen.«
»Das ist der Sieg!«, brüllte Bruce Graham. »Wir haben sie alle in der Tasche, Jungs. – Diese Weiden und das ganze Land … es gehört uns!«
»Uns?«, dachte Cliff Brand bitter. Dir gehört es … und morgen schon wirst du vergessen haben, wer es für dich erobert hat.
Die anderen Männer stimmten großenteils in das Gebrüll des Sieges ein.
Vormann Larry Born wandte sich, unberührt von dem Trubel, an den Kundschafter Slim Hay. »Was hast du gesehen – und wo hast du es gesehen?«
Slim hielt eine Zigarette schief zwischen den Lippen und stieß den Rauch durch Mund und Nase aus. Sein verwegenes Raubvogelgesicht glühte noch vom Kampf her.
»Ich habe einen Halbkreis unter den White-Cliffs entlanggeschlagen«, entgegnete Slim Hay. »Bis auf zwei Meilen bin ich an die Stadt rangeritten. Ich habe gesehen, wie sie aus dem Canyon herausgeritten kamen – Ringo Natter vornweg. Blount lag auf einer Schleppbahre, und sein Gesicht sah aus, als wäre er völlig am Ende. Yeah, so wars.«
»Gut. Wie viele sind mit Ringo Natter geritten?«
»Ein rundes Dutzend, und davon war bestimmt die Hälfte verletzt.«
Bruce Grahams Augen leuchteten auf. Schon hatte er seinen Entschluss gefasst – und jetzt fragte er nicht wie bisher bei seinem Vormann an, ob der die Entscheidung für richtig hielt. Der Sieg war dem bulligen Rindermann wie Sekt in den Schädel gestiegen. Er kannte jetzt weder Maß noch Ziel.
»Sattelt frische Pferde, Boys!«, schrie er heiser. »Wir setzen heute Abend den Schlusspunkt. Wir haben sie von dieser Weide gejagt, jetzt jagen wir sie in einem Schwung aus der Stadt und aus dem Land!«
Cuck Malone, Bud Maker und Slim Hay waren sofort dabei. Cliff Brand presste die Lippen fest aufeinander und starrte seinen Vormann und Freund Larry Born an. Er sagte sehr leise und gedehnt: »Ich mache nicht mehr mit, Larry. Bis hierher bin ich Bügel an Bügel mit dir geritten, weil ich es dir und unserer Freundschaft schuldig war. Was jetzt noch kommt, ist Mord!«
Larry Born nickte düster. Er wirbelte spielerisch das Gewehr um die Hand. Er schaute Bruce Graham an: »Ich halte das nicht für richtig, Boss. Wir haben unser Ziel erreicht – denn unser Ziel war es, Jesse Blount von seinem hohen Ross herunterzustoßen. Jetzt liegt er am Boden und wird froh sein, wenn er verhandeln kann – falls er noch so lange am Leben bleibt.«
»Verhandeln?«, lachte Graham. »Ja, zum Teufel, was ist denn plötzlich in dich gefahren, Larry? Seit wann verhandelt man mit einem Gegner, der am Boden liegt?«
»Ich halte das für ein Gebot der Fairness. Heute ist viel Blut geflossen, und wir wollen nicht fragen, auf wessen Seite die Schuld an dieser Entwicklung liegt …«
»He! Was sind das für Töne? Hast du vergessen, dass Jesse Blount zuerst die Killer ins Land geholt hat? Hast du vergessen, wie Ringo Natter meinen Bruder ermordet hat?«
»Ja. Gut. Blount ist einfach größenwahnsinnig geworden. Mach du jetzt nicht den gleichen Fehler, Bruce.«
»Ah, du kannst mich jetzt nicht zurückhalten, Larry. Keine Macht der Welt hält mich jetzt noch auf. Ich bin nicht mit Brotsamen zufrieden. Ich will alles! Alles will ich, verstehst du! Sattle dein Pferd, Larry, wenn wir gute Freunde bleiben wollen!«
Und nur Cliff Brand hörte, wie Larry murmelte: »Freunde? Heute habe ich dich ohne Maske gesehen, Bruce Graham …«
Widerspruchslos ging er zum Seilkorral und sattelte. Plötzlich erinnerte er sich an Cliff Brand, der immer noch reglos am gleichen Platz stand. Larry kam, das Pferd am Zügel, zurück.
»Cliff«, murmelte er, »bitte, komm mit. Dies eine letztes Mal noch. Du brauchst nicht zu schießen, zu töten – auch ich werde es nicht tun. Aber lass mich nicht im Stich. Ich brauche einen Menschen – einen Freund!«
Cliff Brand zögerte noch einen Augenblick. Dann sattelte auch er.
*
Die Stadt – Annuncio – gehörte zu diesem Weidekrieg wie der Deckel zum Topf. Hier in der Stadt hatte das Drama den Anfang genommen. Niemand würde je ergründen können, welcher Stein die Lawine ins Rollen gebracht hatte. Nur eins stand fest: der uralte Hass zwischen Rindermännern und Schafmännern. Dort lag die Wurzel des Übels – und in den unversöhnlichen Charakteren der beiden Herdenbosse. Bruce Graham hier, Jesse Blount da.
Slim Hays Bericht stimmte. Jesse Blount lag blass und stumm und fast ohne Atem auf dem Feldbett des Arztes, und blitzende Instrumente senkten sich in den ausgebluteten Körper. Es stimmte auch, dass Blounts Mannschaft sich die Wunden leckte, und am Ende war – aber gerade, weil sie am Ende war, fand sie die Kraft der Verzweiflung, als von ferne der trommelnde Hufschlag der Rindermannschaft herankam.
Ringo Natter organisierte den Widerstand. Ringo Natter, den sie auch den ›Totenkopf‹ nannten …
Ringo Natter verstand nichts von Schafen und nichts von Rindern. Sein Geschäft war der Tod, sein einziges Handwerkszeug der Colt. Er hatte für Jesse Blount gekämpft, weil der den höchsten Kampfeslohn geboten hatte – zu einer Zeit, als Bruce Graham noch nicht mit den Kriegsvorbereitungen fertig war. Ringo hatte für Blount den Bruder Grahams getötet … nach seiner Ansicht in fairem Zweikampf.
Natter rühmte sich, noch nie auf der Seite eines Verlierers gestanden zu haben. Heute sah das anders aus … bis zu diesem Augenblick, in dem die Kavalkade der Rinderleute herandonnerte.
»Führt die Pferde auf die Straße!«, befahl er in jähem Entschluss. »Wenn ich das Zeichen gebe, jagt ihr sie aus der Stadt!«
Während der Galopp der Pferde näher herandonnerte, verteilte Ringo Natter die Schützen zu beiden Seiten der Straße.
Aus der Schwärze der Nacht huschten die Schatten der Feinde heran.
»Jetzt!«, sagte Ringo Natter. Und zwei drei Männer peitschten auf die Pferde ein, die in wilder Stampede die Straße entlang preschten und den Staub aufwirbelten.
»Sie fliehen!«, schrie Bruce Graham an der Spitze seiner wilden Horde. »Sie reißen aus wie Schafsleder!«
Nein, er konnte nicht sehen, dass die Sättel der Tiere leer waren, er konnte auch die tödliche Falle nicht sehen, in die er, allen voran, hineingaloppierte. Der Sieg des Nachmittags hatte ihn trunken gemacht und blind.
Als die Schüsse losbrüllten, als die mörderischen Feuerzungen von allen Seiten nach den Rindermännern griffen, da gab es kein Zurück mehr. Wie von der Faust eines zornigen Riesen wurde Bruce Graham im Sattel durchgeschüttelt, ehe es ihn in den Staub warf. Über ihn hinweg donnerten die Hufe, über ihm, der sich in den letzten Zuckungen im Staub wand, schrillten Todesschreie, brüllte das Stakkato der Waffen, herrschte das Chaos.
Cliff Brand schoss nicht. Eine unnatürliche Ruhe hielt sein Wesen umfangen. Nach dem fürchterlichen Morden dieses Tages war er am Ende. Nichts in der Welt hätte ihm den Colt in die Hand drücken können – nicht einmal der Gedanke an seine eigene Haut. Er hatte nur Augen für den Freund an seiner Seite, für Larry Born.
Die anstürmende Rotte der Rindermänner wurde von dem eisernen Besen auseinandergefegt. Binnen zehn Sekunden war aus den siegestrunkenen Angreifern ein zersplitterter, zügelloser Haufen geworden. Ringo Natter feierte den größten Triumph seines Lebens.
Cliff Brand sah, wie die Kugeln in den starken Leib des Freundes schlugen. Er sah entsetzt, wie Larrys Pferd sich aufbäumte und den Freund im Sturz unter sich begrub.
Larrys rechtes Bein war unter dem zuckenden Pferdeleib eingeklemmt.
»Hau ab!«, flüsterte Larry mit verkniffenen Lippen. »Du bist verrückt, Cliff. Sieh zu, dass du durchkommst. Ich … ich schaff’s doch nicht mehr!«
Cliff hob den Leib des toten Pferdes an, stemmte ein Knie unter die mörderische Last und zog Larrys Bein darunter hervor. Er hob den Freund auf die Arme und legte ihn über den Sattel seines Pferdes. Er schwang sich dahinter auf den Rücken des Mustangs und trabte an.
Nur aus zwei harmlosen Streifwunden blutend verließ Cliff Brand die Stadt. Noch lebte der Freund …
*
So wurde das letzte Kapitel der Esperanza-Valley-Fehde geschrieben. Es gab keinen Sieger – nur Tote und Flüchtlinge. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass die Gräber der beiden Bosse – Bruce Graham und Jesse Blount – unmittelbar nebeneinander auf dem Friedhof Annuncios ausgehoben wurden.
Fern von der Stadt glimmte das Lagerfeuer bei der Rinderherde auf, die ihren Herrn verloren hatte. Neben dem Küchenwagen hielt Cliff Brand und hob den Freund behutsam aus dem Sattel. Im Schein der flackernden Flammen sah er deutlich, was er auf den Meilen hierher gefürchtet hatte. Es gab keine Hilfe mehr für Larry Born.
Bud Maker trat aus dem Schatten des Küchenwagens. Er starrte finster auf Larry hinab, zuckte die Achseln und knurrte: »Dir ist wohl nichts Besseres eingefallen, als ihn hierherzuschleifen, Brand?«
Cliff erhob sich, schaute Maker gleichgültig und unendlich müde an und murmelte: »Ich wollte, ich hätte mehr für ihn tun können, Bud. Er ist mein Freund – und er ist bis zu diesem Augenblick auch dein Sattelgefährte gewesen.«
»Nun werd bloß nicht sentimental!«, knurrte Maker.
Cliff knirschte mit den Zähnen. Vergeblich versuchte er, seinen Zorn zurückzudämmen. Er konnte es nicht – und wollte es auch nicht mehr. Mit fürchterlicher Wucht schlug er die Rechte an Makers Kinn, und der Schlag schleuderte den bulligen Mann bis unter die Räder des Küchenwagens. Dann wischte er sich die Hand ab, als habe er ein ekelhaftes Gewürm berührt, und schaute langsam in die Runde.
Chuck Malone verzog keine Miene. Larry Borns Augen schauten in eine Weite, die den anderen verborgen blieb, die nur einem Sterbenden offenstand. Er war von einer Bewusstlosigkeit in die andere getaumelt, und das Ende kam schnell. Er spürte es und wusste es. Er hatte das Ende des steinigen Erdenpflasters erreicht. Dann tastete sein Blick sich noch einmal ins Diesseits zurück. Er lächelte schwach.
Slim Hay murmelte: »Well, Larry, wir haben schöne Stunden zusammen gehabt – verdammt schöne Stunden. Ich … ach verdammt …« Er brach jäh ab, und nun glitt er in das Dunkel hinein. Larrys Stimme hielt ihn auf – eine Stimme, die ganz klar und gar nicht einmal leise in die Stille fiel.
»Slim – bleib noch!«
Hay machte kehrt.
Larry Born schaute sie alle der Reihe nach an. Noch einmal leuchteten die grauen Augen. Noch einmal gewann die Stimme etwas von ihrer alten Kraft.
»Jungs, ich hatte gehofft, wir würden noch manche Meile Bügel an Bügel reiten. Ich habe euch geführt, bis zu diesem Abend. Ich habe aus euch rauen Gesellen eine Mannschaft geformt, und darauf bin ich stolz. Aber jetzt, wo die letzte Tür hinter mir bald zuklappen wird – jetzt weiß, dass nicht alles richtig war. Wir haben für einen Mann gekämpft, den ich für einen guten Mann gehalten habe. Er war nicht gut. Heute Abend habe ich es erkennen müssen.«
Cliff Brand legte die Hand auf die fiebernde Stirn des Freundes. Er murmelte: »Streng dich nicht so an, Larry. Es hat keinen Sinn, über Fehler nachzugrübeln – jetzt nicht mehr.«
»Schon gut, Cliff. Du warst immer mein gutes Gewissen. Ich … ich habe eine Bitte an dich – an euch alle.«
»Ich erfülle sie – wenn es in meiner Macht steht!«
Larry Born schloss die Augen. Der Atem pfiff rasselnd durch die weit geöffneten Lippen. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit, und er wusste es.
»Ich … ich wollte euch alle anwerben, Freunde«, murmelte er leiser als vorher. »Ich hätte eine Kampfmannschaft nötig gehabt – diesmal nicht für einen anderen, sondern für mich und mein Elternhaus. Ich habe es vor Jahren verlassen – nun greifen die Geier danach und wollen es in die Krallen bekommen. Cliff – in meiner Brusttasche … der Brief … lies ihn!«
»Ja, Larry. Später. Was gibt es für uns zu tun?«
Larry Born sog die Luft heftiger ein.
»Mein Vater ist alt«, flüsterte er.
»Ranch, in … in Montana. Ich … ich muss hin – muss helfen. Er wartet auf mich. Cliff … Slim … Chuck, Bud – versprecht mir … versprecht mir …«
Plötzlich richtete der Mann sich halb auf. Sein Mund formte Worte, aber die drangen nicht mehr an das Ohr des Freundes. Cliff Brand fasste nach den zuckenden Schultern und stützte sie. Er sah, und das Herz drehte sich ihm im Leibe um, wie dieser starke Mann von der stärkeren Faust des allgewaltigen Todes durchgerüttelt wurde, bis er ganz still wurde.
»Danke, Cliff«, flüsterte Larry Born. Er lächelte, und aller Schmerz wurde aus seinem Antlitz gelöscht. Er lächelte noch, als längst der letzte Atemzug seiner Brust entwichen war. Es war, als hätte er in der Minute des Sterbens noch einmal in die Heimat geschaut …
*
Sie begruben ihn unter den himmelstürmenden weißen Klippen. Er legte Larrys Hut und seine Waffengurte über den düsteren Steinhaufen – und dann einen Strauß blühender Margeriten. Viel später als die anderen kam er zum Küchenwagen zurück, den knisternden Brief in der Tasche, den eine Frauenhand an Larry geschrieben hatte.
»Gut, dass du kommst«, empfing ihn Chuck Malone. »Wir beraten gerade, was mit diesen zweitausend Rindern geschehen soll. Schätze, wir stimmen ab. Ich bin dafür, wir verkaufen sie auf dem nächsten Markt und teilen den Gewinn. Okay?«
Natürlich waren alle dafür, nur Cliff Brand schwieg.
»Na, und du?«, rief Slim Hay. »Wie ist deine sehr geehrte Meinung zu diesem Fall?«
Cliff schüttelte den Kopf: »Ich habe keine Meinung, Slim. Es sind nicht meine Rinder. Der Mann, dem sie gehört haben, ist tot. Was damit geschieht, ist mir völlig gleich.«
»Wunderbar! Also bist du doch für unseren Plan. Wie sollen wir denn sonst unseren Kampfsold kriegen, he?«
»Ich verzichte darauf, Slim. Ich will kein Geld. Ich habe genau wie ihr meinen letzten Lohn pünktlich am Ersten bekommen. Mehr brauche ich nicht.«
Chuck Malone schüttelte irritiert den Kopf.
»Du verzichtest auf deinen Anteil, Cliff?«
»Ja – sofern von einem Anteil die Rede sein kann. Macht, was ihr wollt. Mir liegt etwas anderes am Herzen. Ihr habt Larrys letzte Worte gehört – und seine Bitte …«
»Richtig!«, nickte Slim Hay. »Er hat von einem Brief gesprochen und von Schwierigkeiten. Well, Schwierigkeiten sind für uns immer richtig – falls es dabei was zu holen gibt. Aber da Larry immer ’ne offene Hand hatte, wird auch sein alter Herr kein Knauser sein. Du hast den Brief?«
»Ja – aber ehe ich ihn verlese, will ich eure Entscheidung hören. Seid ihr bereit, mitzukommen und Larry den letzten Dienst zu erweisen – einerlei, was für euch dabei herausspringt?«
Bud Maker zeigte alle Zähne.
»Das ist nicht so einfach, meine ich«, brummte er heiser. »Könnte ja sein, dass Larrys Alter mittlerweile schon pleite ist und nicht zahlen kann …«
»Das ist richtig«, nickte Chuck Malone. »Wir sind es gewohnt, unsere Dienste an den Meistbietenden zu verkaufen. Schließlich ist es unsere Haut, die wir zu Markte tragen. Aber darüber reden kann man immerhin …«
Slim Hay, der dritte im Bunde, pfiff eine Melodie vor sich hin. Er entschied sich noch nicht, sondern meinte: »Lies erst mal den Brief vor, damit wir schlauer werden.«
Cliff Brand entfaltete das Schreiben. Plötzlich fiel etwas zwischen den Blättern heraus und zu Boden. Slim Hay bückte sich und rief: »Ein Bild! Hölle und Pest – das ist ’ne Frau! So was von Frau habe ich noch nie gesehen!«
Cliff biss die Zähne aufeinander. Er überflog die Zeilen – dann las er langsam vor:
»Lieber Larry! Ich hoffe, dass diese Zeilen Dich erreichen, dass Du noch dort unten in Arizona bist und auch die Post abholst. Dein letztes Schreiben war sehr kurz, aber wir freuen uns, dass Du gesund bist. Auch Dad. Er hat längst vergessen, was zwischen euch gewesen ist – und er wartet auf Dich. Wir alle warten auf Dich, denn nie haben wir unseren großen Bruder nötiger gehabt als jetzt. Weißt Du noch, wie Du damals mit Gordon Farrell aneinandergeraten bist? Wegen dieses Streites hat Dad Dich aus dem Hause gewiesen, denn Farrel und Dad waren immer Freunde. Sie waren es, Larry, denn seit einiger Zeit ist Farrell unausstehlich geworden. Ich kann das nicht alles schreiben, aber Tipp und ich glauben, dass Farrell uns von der Ranch verdrängen will. Den Anfang dazu hat er gemacht. Er hat einen Teil unserer Sommerweide einfach mit Beschlag belegt – und Dad hat es schweigend hingenommen. Du kennst ja Dad. Er will den Frieden um jeden Preis. Wir alle wollen den Frieden, aber nicht um jeden Preis! Ich glaube, alles wäre anders, wenn Du hier sein könntest. Bitte, komm zurück! Und komm bald, Larry – denn Dad ist zu alt und Tipp und ich sind zu jung.
Ich hoffe, dass Du auch wirklich gesund bleibst. Und ich werde jeden Tag nach dem Lawinen-Pass hinaufschauen, bis ich Dich heranreiten sehe!
Das kleine Bild soll Dir zeigen, was aus Tipp und mir geworden ist, seit du damals gegangen bist. Wir waren neulich in der Hauptstadt und haben die Fotografie machen lassen.
Bitte Larry – komm zu uns zurück! Bald!
Deine Dich liebende Schwester Sabrina und alle hier im Hause.«
Slim Hay betrachtete immer noch verzückt das Bild. »Sabrina heißt sie, was? Toller Name, tolles Mädchen. Yeah, Freunde, wenn ihr mich fragt, ich bin dabei!«
Chuck Malone schob eine Zigarette zwischen die Lippen. »Wir werden sehen, Cliff. Hört sich ganz interessant an. Weidekriege werden ja allmählich unsere Spezialität.«
Cliff Brand faltete den Brief zusammen und nahm Slim Hay das Bild aus der Hand. Ein lachendes Jungengesicht und daneben die herbe Schönheit eines Mädchenantlitzes schauten ihn an – so, als wären sie lebendig und ständen leibhaftig vor ihm. Er ließ den Blick davon los und schob Brief und Bild in die Tasche. Er sagte knapp: »Mein Entschluss steht fest. Ich reite.«
»Gut, gut«, nickt Bud Maker schnell. »Und wir kommen nach, sobald wir diese Rinder an den Mann gebracht haben. Ist das okay?«
Cliff antwortete nicht. Er trat zu seinem Wallach, prüfte den Sitz des Sattels und hob sich hinauf. Er wandte sich noch einmal zurück: »Ich hatte gehofft, wenigstens einmal in eurem Leben würde die Sucht nach dem Geld hinter dem zurücktreten, was man Treue nennt. Ich habe mich getäuscht. Es ist mir gleich, was ihr macht. Aber da ich immer ehrlich zu euch gewesen bin, sage ich dies in aller Offenheit: Ich möchte euch am liebsten nie wiedersehen!« Er gab dem Wallach die Zügel frei und galoppierte an der lagernden Herde vorbei nach Norden.
Vor ihm lag ein Ritt bis Montana, hoch im Norden, ein Ziel, über das er sich gar keine Vorstellung machen konnte. Er wusste rein gar nichts über dieses Land. Höchstens das eine, dass dort der Winter ein strenges Regiment bis tief in die Monate hinein führte, in denen tief im Süden, in Arizona, ewige Sonne lachte. Er ahnte nicht einmal, dass der Winter solche Ausmaße annehmen konnte, dass er jegliches Leben lahmlegte – auch einen geplanten Weidekrieg.
Er bekam es am eigenen Leibe zu spüren, dass der Mensch ohnmächtig ist gegen das Toben entfesselter Elemente. Wenige hundert Meilen vor dem Ziel, in einer kleinen Stadt in Wyoming, wurde er eingeschneit. Zehn Fuß hoch und mehr türmten sich die Schneemassen auf – unüberwindlich für Mann und Pferd. Unüberwindlich auch für die Eisenbahn. Jeglicher Verkehr erstarb. Cliff Brand musste sich, ob er wollte oder nicht, auf eine lange Zwangspause einrichten …
*