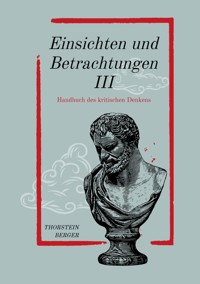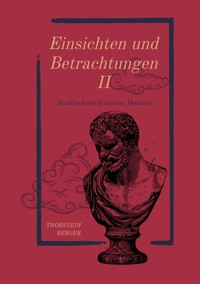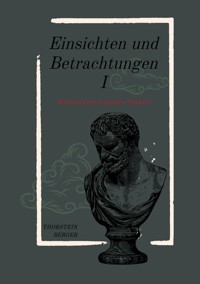
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Einsichten und Betrachtungen
- Sprache: Deutsch
Betrachtungen von der Welt und dem Menschen in ihr anzustellen, um dadurch Einsichten über den Zustand des Menschen in der Welt zu gewinnen - dies ist gerade die Aufgabe, die sich das vorliegende Buch stellt. Dabei behandelt es eine Vielzahl von philosophischen und nichtphilosophischen Themen, die aber stets aus dem Einheitspunkt des kritischen Denkens heraus betrachtet werden, wodurch ein in sich geschlossenes Gesamtbild entsteht. Das Buch ist zudem in der leicht fasslichen Kurzform des Aphorismus und der Sentenz abgefasst, um dem Leser sowohl eine wertvolle Orientierung für die Fragen des täglichen Lebens wie auch eine fortwährende Anregung zum eigenständigen Nachdenken an die Hand zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Thorstein Berger
Einsichten und Betrachtungen I
Ein Kompendium des kritischen Denkens in Aphorismen
© 2021 Thorstein Berger
Verlag und Druck:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-22073-7
Hardcover:
978-3-347-22074-4
e-Book:
978-3-347-22075-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Erstes Buch
Die Geduld des Papiers ererbt doch nicht der Leser, denn wird jene erst bemüht, so ist es um dessen schon geschehen.
Alle Selbstgerechtigkeit entspringt daraus, sich zuerst den äußeren Schein von überlegener Moralität zuzulegen, um dessen Täuschung dann selbst zu erliegen, an denselben also, als das innerste Wesen aller Moral, in eigener Person so andachtsvoll wie ehrfürchtig zu glauben.
Die in der Maske scheinheiliger Leutseligkeit auftretende Verstellung erklärt sich doch immer nur dem Schein nach für die objektive Wahrheit, nämlich allein dann, wenn ihr ein solches aus Gründen subjektiver Nützlichkeit gerade als das Gebotene erscheint.
Der Pfad zu aller Weisheit ist ein so schmaler und steiler, und der Aufstieg auf ihm darum ein so beschwerlicher, dass der Wanderer, der ihn beschreitet, alsbald alles ihm lästig fallende, dabei ganz überflüssige Gepäck freudig am Wegesrand zurücklassen wird, als für welches er Ruhmsucht und Selbstgefälligkeit, Geltungsbedürfnis und Sendungsbewusstsein erkennen muss.
Einen nicht unerheblichen Teil der Urteilskraft macht die Fähigkeit aus, zwischen der Form und dem Inhalt einer Aussage unterscheiden zu können. Denn wider den ersten Anschein ist es oftmals nicht der Inhalt, der falsch, sondern bloß die Form, die dem Inhalt unangemessen ist, unter welche er also gewaltsam gezwungen, und wodurch die Aussage zu einer falschen wurde.
Vom rationalen Prinzip zum dialektischen fortzuschreiten, bedeutet bloß, sich vom Falschen zum Widersinnigen zu versteigen, macht der Widerspruch, welcher in jenem auftreten muss, dasselbe doch zunichte, während er in diesem als endlich erlangte Erkenntnis begrüßt wird.
Im rationalen Prinzip wird die Vergottung des allzeit Seienden, im dialektischen die des ewig Werdenden betrieben.
Im Fortschreiten vom rationalen zum dialektischen Prinzip soll der Widerspruch, der sich in jenem notwendig zeigen muss, in diesem zu einer absoluten Erkenntnis geraten, und die Herrschaft der Vernunft somit zu einer unumstößlichen.
Die Ellipse (…) beschließt in allem Folgenden einen Gedankengang, den zu seinem offensichtlichen Ende zu führen dem Leser überlassen bleibt.
Die Ellipse (…) überlässt eine offensichtliche Schlussfolgerung zu ziehen im Folgenden dem Leser.
Das absolute Scheitern eines absoluten Prinzips wiederum als Beweis für die Existenz des Absoluten zu nehmen, da eben das Scheitern doch ein absolutes war…
Die eine Gesinnungslehre im Scheitern der anderen ihre Begründung und Rechtfertigung finden lassen zu wollen, heißt doch nur, auf ewig vom Regen in die Traufe, von der Traufe in den Regen zu kommen.
Anders als in der Geometrie ist in der Kultur der weiteste Abstand bereits da erreicht, wo kein gemeinsamer Berührungspunkt mehr besteht.
Wehe dem Zeitalter, in dem der Erhalt der ewigen Werke denjenigen zufällt, welche selbst ohne jedes Verständnis für dieselben sind, vielmehr ein solches nur vorgeben, um vom Glanz derselben für die eigene Person zu borgen.
Größer als jede astronomische Einheit ist der Abstand zwischen objektivem und subjektivem Intellekt, zwischen der Kultur und bloß einer Kultur.
Kultur und Kulturbetrieb sind Zwillingsplaneten zu vergleichen, die zwar auf derselben Bahn fahren, ohne einander aber doch jemals zu begegnen.
Zum bloßen Kulturbetrieb verhält sich die Kultur wie die Sonne zum Mond, erborgt dieser seinen Schein doch allein von jener, und das auch noch, wenn sie schon lange untergegangenen ist, und er nun als das hellste Gestirn am Himmel steht.
Den größten Unterschied bedeutet es, ob ich ein Denkprinzip seinem Grundsatz nach ablehne oder lediglich eine Ausprägung desselben, dafür aber eine andere solche befürworte. Und diesen Unterschied nur immer verschleiern und dadurch ableugnen zu wollen, ist eben dem Verfechter des Denkprinzips angelegentlich, um sich derart jeglicher ihm lästig fallender Kritik zu entledigen.
Den größten Unterschied bedeutet es, ob man ein Denkprinzip seinem Grundsatz nach verwirft, oder aber bloß eine besondere Ausprägung desselben, dabei einer anderen solchen allerdings zustimmt.
Den größten Unterschied bedeutet es, ob man eine Sache dem Prinzip nach ablehnt, oder aber bloß eine besondere Erscheinungsweise derselben, dem Prinzip der Sache selbst also dennoch zustimmt.
Den größten Unterschied bedeutet es, ob man einen Denkfehler seinem Grundsatz nach verwirft, oder aber bloß eine bestimmte Ausprägung desselben, um dabei einer anderen solchen allerdings zuzustimmen.
Und diesen Unterschied nur immer verschleiern zu wollen ist dem Verfechter des Denkfehlers angelegentlich, um so dem Gegner des Denkfehlers im Grundsatz unterstellen zu können, bloß ein Gegner des Denkfehlers in einer bestimmten Ausprägung zu sein, mithin einer anderen solchen selbst anzuhängen, wodurch der Grundsatz des Denkfehlers vom Gegner also als wahr zugegeben wäre, und damit auch zumindest eine Ausprägung desselben wahr sein müsse, und zwar doch wohl diejenige des ursprünglichen Verfechters des Denkfehlers, welche also zu Unrecht angegriffen wurde.
Der ewige Traum der Einäugigen, über diejenigen Blinden zu herrschen, die sie selbst zu diesem Zwecke erst geblendet haben…
Nur einen Teil der Wahrheit für die ganze Wahrheit auszugeben, ist - schon wieder eine Unwahrheit.
Eine halbe Wahrheit für die ganze Wahrheit auszugeben, macht selbst wieder eine Unwahrheit.
Für manchen Schreiberling ist das Schreiben ein ebenso natürlicher Vorgang wie das Verdauen - bei gleichem Ergebnis.
Aller Unverstand fragt nicht nach dem Denkfehler in einer Irrlehre, um denselben künftig vermeiden zu können, sondern bloß danach, wie allein der äußere Anschein zu vermeiden wäre, zu den Anhängern derselben zu gehören.
Anstatt zu sagen „Ich will!“ ist es doch ziemlicher zu sagen „Ich soll!“, drückt sich im ersteren doch das Selbstische, im letzteren aber das Selbstlose aus, und ewig glücklich, wer einer Lehre anhängen darf, in der das subjektiv Gewollte gerade gleich dem objektiv Gebotenen ist, das „Ich will!“ und das „Ich soll!“ also immer zusammenstimmen…
Wenn alle Freiheit allein darin gefunden werden kann, sich auf die Seite der Unterdrücker zu stellen, um nur nicht selbst zu den Unterdrückten zu gehören, so ist eben gar keine Freiheit.
Aus Gründen der Pietät alle Auseinandersetzung in der Sache untersagen zu wollen, heißt nur, für viele künftige Anlässe zur Pietät zu sorgen.
Die nackte und lautere Wahrheit hat immer den denkbar schlechtesten Stand und steht zudem noch im geringsten Ansehen, da sie so überaus frei von jeder Pietät und Ehrfurcht gegenüber dem ist, was in den Augen des großen Haufens als ebenso heilige wie unantastbare Wahrheit zu gelten habe.
Bei anderen den Trugschluss hervorrufen zu können, den äußeren Schein bereits für den Kern der Sache selbst zu nehmen, ist eine Kunstfertigkeit, die doch nie ihr Publikum verfehlt, ihrem Adepten also stets einen auskömmlichen Broterwerb zu sichern versteht.
Derjenige Lügner muss doch der erfolgreichste sein, der sich selbst nicht einmal bewusst ist, dass er überhaupt lügt.
Eine Frage derart zu beantworten, dass sich für die gegebene Antwort dieselbe Frage, nicht nur der Form, sondern gerade dem Inhalt nach, sogleich aufs Neue und in gleicher Weise stellt, heißt eben, sie gar nicht zu beantworten.
Die Frage nach der Herkunft des Lebens auf der Erde kann nicht in der Abkunft von einem fremden Planeten ihre letzte Antwort finden, die Frage nach der Legitimation des Staates nicht in einem übergeordneten Staatenbund, usw.
Das, wonach man sich nur immer sehnt, vermag man selbst doch schlechterdings nicht zu sein, erst recht nicht, um somit allem Sehnen selbst ein Ende zu machen und alles Wollen hierin endgültig zu befrieden.
Gibt es die Götter oder nur den Glauben an dieselben, ist das, was den Menschen als Religion mächtig bewegt, gerade unumstößlicher Beweis für ihr Dasein oder bloß sichtbares Unterpfand seines blinden Wähnens?
Nicht sind die Götter wirklich, sondern es ist vielmehr nur der Glaube an dieselben ein wirksames.
Sind die äußeren Wahrzeichen und sichtbaren Zeugnisse einer Religion, das sind die in ihrem Namen unternommenen Eroberungszüge, die ihr zu Ehren errichteten sakralen Prachtbauten sowie die geistige Vorherrschaft ihrer Glaubenslehre, schon hinreichender Beweis und Gewähr der überlegenen Macht und Wahrhaftigkeit der in ihr angebeteten Gottheit oder nur Ausdruck des planvollen, wie auf Verabredung geschehenden Vorgehens und Handelns ihrer Anhänger zur Erreichung der eben allein erst durch die Religion selbst aufgegebenen Absichten und Zwecke?
Erkennen wir in der Vorherrschaft einer Religion die überlegene Macht und Wirklichkeit der in ihr angebeteten Gottheit oder nur den Umstand, dass gerade eine auf solcher Annahme gegründete Glaubenslehre das Handeln und Denken ihrer Anhänger auf das Wirksamste und Tiefgreifendste zu bestimmen vermag?
Erkennen wir in der Vorherrschaft einer Religion die Wirklichkeit der in ihr angebeteten Gottheit als eines allmächtigen Prinzips, und darin bereits auch die Wahrheit ihrer Glaubenslehre, oder nur die Wirksamkeit ihrer Glaubensartikel als eines Beweggrundes für das ebenso übereinstimmende wie absichtsvolle Handeln ihrer Bekenner?
Die Wirklichkeit eines Prinzips soll bedeuten, dass es sowohl Dasein habe als auch Wirksamkeit zeitige. Wiederum aus der Wirksamkeit allein kann aber eben nicht bereits auch auf das Dasein und damit die Wirklichkeit des Prinzips geschlossen werden, vermag sich dieselbe Wirksamkeit doch auch aus dem bloßen Glauben an die Wirklichkeit des Prinzips, als eines Beweggrundes für das menschliche Handeln, einzustellen.
In der Wirksamkeit des Glaubens an ein Prinzip, als eines Beweggrundes, soll der Anschein erweckt werden, als wäre dieselbe gleichbedeutend mit der Wirksamkeit des Prinzips selbst, als eines Erkenntnisgrundes und Realgrundes gleichermaßen, und somit durch die vermeintliche Wirksamkeit auch schon die Wirklichkeit des Prinzips bewiesen.
Ist die Wirksamkeit eines Prinzips von der Wirksamkeit des bloßen Glaubens an die Wirklichkeit des Prinzips nicht zu unterscheiden, so kann eben aus einer solchen Wirksamkeit die Wirklichkeit des Prinzips mitnichten geschlossen werden.
Mangelt einem Prinzip zwar auch die Wirklichkeit, so kann der Glaube an dieselbe aber doch schon hinreichend für dessen Wirksamkeit, als eines bloßen Glaubensartikels, sein.
Ein Prinzip muss, um nur immer wirksam, doch nicht wirklich sein, kann der bloße Gaube an die Wirklichkeit desselben für seine Wirksamkeit, als eines bloßen Glaubensartikels, doch schon ausreichen.
Es kann doch gerade die mangelnde Wirklichkeit eines Prinzips die größte Wirksamkeit desselben, als eines bloßen Glaubensartikels, bedeuten, als welche dann wiederum den überzeugendsten Schein herbeizuführen versteht, als käme dem Prinzip auch Wirklichkeit zu.
Es kann gerade die fehlende Wirklichkeit eines Prinzips die größte Wirksamkeit desselben, als eines bloßen Glaubensartikels, bedingen, welche dann wiederum den überzeugendsten Schein herbeizuführen versteht, als wäre das Prinzip auch ein wirkliches.
Es kann gerade die mangelnde Wirklichkeit eines Prinzips die größte Wirksamkeit, nicht des Prinzips selbst, als Realgrund, sondern bloß des Glaubens an dasselbe, als Beweggrund, bedingen, welche dann wiederum den überzeugendsten Schein herbeizuführen versteht, als wäre das Prinzip tatsächlich ein wirkliches.
Gerade die mangelnde Wirklichkeit eines Gegenstandes vermag doch Ursache für die äußerste Wirksamkeit des bloßen Glaubens an denselben zu sein.
Steht die Wirklichkeit eines Prinzips der menschlichen Willkür eben nicht als Hindernis entgegen, so kann gerade der bloße Glaube an die Wirklichkeit des Prinzips die größte Wirksamkeit zeitigen.
Für die Wirksamkeit des Glaubens an ein Prinzip, als Beweggrund, ist die Wirklichkeit des Prinzips, als Realgrund wie Erkenntnisgrund, nicht nur nicht notwendig, sondern derselben zumeist sogar geradezu abträglich.
Die Wirksamkeit des Glaubens an die Wirklichkeit eines Prinzips vermag sich eben gerade auch bei Abwesenheit der Wirklichkeit des Prinzips einzustellen.
Ist die Wirksamkeit des Glaubens an ein Prinzip nur augenscheinlich genug, so muss die Wirklichkeit des Prinzips hierdurch eine allemal ausgemachte und bewiesene Sache sein…
Kommt einem Prinzip Wirklichkeit zu, als Realgrund der Gegenstände, oder nur dem Glauben an ein solches Wirksamkeit, als Beweggrund des Handelns in Bezug auf die Gegenstände?
Die Überzeugung von der Wirklichkeit einer Sache kann wirksam sein, ohne dass dafür die Sache selbst überhaupt wirklich sein muss, vermag doch gerade die mangelnde Wirklichkeit einer Sache deren Wirksamkeit als eines bloßen Glaubensartikels aufs Äußerste zu steigern, welches dann wiederum den überzeugendsten Schein herbeizuführen versteht, als wäre damit auch die Sache eine wirkliche.
Die äußerste Wirksamkeit eines Prinzips kann doch gerade aus der mangelnden Wirklichkeit desselben herrühren, wenn dieselbe sich also nicht aus dem Prinzip selbst, als eines Realgrundes, sondern vielmehr bloß aus dem Glauben an die Wirklichkeit des Prinzips, als eines Beweggrundes, einstellt.
Der Wirksamkeit eines Prinzips, als eines bloßen Glaubensartikels, kann gerade die Wirklichkeit des Prinzips entgegenstehen, sodass es besser ist, es würde bloß geglaubt, denn dass es wahr wäre…
Ein Prinzip braucht, um nur immer wirksam, doch nicht wirklich zu sein, muss also mitnichten objektiv wahr, sondern nur subjektiv geglaubt sein.
Ein Prinzip braucht, um nur immer wirksam, doch nicht wirklich zu sein, muss also mitnichten objektiv wahr sein, sondern nur subjektiv für wahr gehalten werden.
Ein allwaltendes Prinzip, als Ursache und Erkenntnisgrund der Gegenstände gleichermaßen, kann doch niemals wirklich sein, wohl aber der Glaube an ein solches, als Beweggrund, ein äußerst Wirksames, und zwar genau aus dem Grund.
Alle Wirksamkeit des Glaubens an ein Prinzip, als Beweggrund des Handelns, kann doch niemals die Wirklichkeit desselben, als Realgrund und Erkenntnisgrund der Gegenstände des Handelns gleichermaßen, erweisen, ist jenes allein doch ein mögliches, dieses aber bereits ein unmögliches.
Für die Herrschaft der Einäugigen bedarf es einer blinden Welt.
Mit dem blindwütigsten Eifer wird noch immer dasjenige geglaubt, was sich jeder Erfahrung entzieht, mithin also bloß in der Einbildung sein Dasein hat.
Aller Relativismus löst sich in Nichts auf, sobald er nur auf sich selbst Anwendung findet.
Aller Relativismus kann, wenn auf sich selbst angewendet, sich eben auch nur selbst aufheben.
Aller Relativismus kann, ohne sich selbst zu widersprechen, eben auch keine allgemeine Gültigkeit für sich selbst beanspruchen.
So, wie man eben nichts zu wissen braucht, sondern nur alles besser. Und wer so alles besser weiß, der stellt dann auch unzweifelhaft etwas Besseres dar…
Dass eine Lüge eine Lüge sei, lässt sich - unglücklicherweise - auch immer aus einer anderen Lüge beweisen.
Man entledigt sich mitnichten des Dogmatismus selbst, indem man nur die dogmatische Forderung aufstellt, dass kein Dogmatismus sein solle.
Manch einer schreibt allein schon deshalb unmäßig viel, um sich nur selbst darüber zu vergewissern, dass er dabei doch wohl auch etwas gedacht haben müsse.
Der Erfolg des Egoisten beruht gerade darauf, dass die anderen eben keine solchen sind, mithin die Maxime seines Handelns nicht die allgemeine ist. Aus dem überlegenen Erfolg seines Handelns auch die Überlegenheit der demselben zugrundeliegenden Maxime folgern zu wollen, verkennt also gerade die Bedingtheit desselben.
Liegt die Bedingung für den Erfolg einer Handlungsmaxime gerade darin, dass sie weder die allgemeine ist noch überhaupt sein kann, so muss die ihr zugrunde liegende Auffassung notwendig falsch sein.
Der Erfolg einer Handlungsmaxime ist gerade der Erfolg des Handelns gemäß derselben Maxime.
Liegt die Bedingung für den Erfolg einer Handlungsmaxime gerade darin, dass sie weder die allgemeine ist noch überhaupt sein kann, so muss sie aber dennoch, um das ihr gemäße Handeln zu rechtfertigen, zur allgemeinen erklärt werden, zu der sie dann, eben durch den vorbildlichen Erfolg des ihr gemäßen Handelns, auch tatsächlich wird, wodurch die Bedingung für den Erfolg derselben allerdings aufgehoben ist.
Gegen die eine Lüge stehen doch immer eine andere Lüge und die Wahrheit zugleich, als wie im Verein auf, was die Verfechter jener dann zum Vorwand nehmen, dieser ihren schlechten Umgang vorzuwerfen.
Man braucht Kenntnisse der Geschichte wie man Kenntnisse der Religion braucht, nicht also, weil man selbst solche glaubt, sondern um solche nicht glauben zu müssen.
Was in der Geschichte am längsten fortwährt und am tiefsten nachwirkt, das macht entweder das Größte oder das Geringste am Menschen aus.
Es ist nur ein schmaler Grat zwischen Intelligenz und Impertinenz.
Positive Religion ist zumeist bloß gelebter Irrtum und anerzogener Charakterfehler, ihre jeweilige mythologische Einkleidung also immer mehr zufälliges Merkmal an derselben.
Lieber um tausend kleine Wahrheiten wissen, denn eine große Lüge glauben.
Der syllogistische Schluss lässt sich durch eine Kanone versinnbildlichen, die durch den Obersatz geladen und durch den Untersatz abgefeuert wird. Um nun aber nur immer das Abfeuern derselben zu verhindern, ist es ganz müßig, jedesmalig nur den Untersatz als nicht zum Obersatz passend nachzuweisen, wenn man stattdessen einfach zeigen kann, dass die Kanone gar nicht geladen, mithin also der Obersatz falsch ist.
Gemessen wird nicht die Zeit selbst, sondern nur die Dauer von Vorgängen in der Zeit, ist Zeit doch eben keine Eigenschaft von Gegenständen an sich. Und genauso ist der Maßstab, der hierzu herangezogen wird, nicht die Zeit selbst, sondern immer nur wiederum die Dauer eines anderen Vorgangs in der Zeit, gibt es doch eben keine absolute Zeit.
Das Merkmal eines Gegenstandes ist im Begriff abgesetzt, eine Eigenschaft desselben im Gesetz erklärt. Allerdings ist der Unterschied zwischen Merkmal und Eigenschaft kein absoluter, ist eine hinreichend beglaubigte Eigenschaft doch dann wiederum nichts anderes als ein Merkmal, und somit bereits im Begriff des Gegenstandes zu erfassen.
Das Merkmal ist das unproblematische am Gegenstand, die Eigenschaft das problematische. Und um eine Eigenschaft des Gegenstandes durch ein Naturgesetz erklären zu können, müssen die hierzu erheblichen Merkmale des Gegenstandes zuerst in einen Begriff, nämlich den des Gegenstandes selbst, abgesetzt werden.
Das Merkmal ist das unproblematische am Gegenstand, die Eigenschaft das problematische, und demgemäß wird jenes, als Tatsache, im Begriff festgestellt, diese wiederum, als Behauptung, im Gesetz aufgestellt.
Gegenstände durch einen gemeinsamen Begriff zu vergleichen heißt eben nicht, dass man sie damit auch im gemeinsamen Begriff gleichsetzt, sei es ihrem Wesen oder ihrem Wert nach.
Gegenstände durch einen gemeinsamen Begriff zu vergleichen heißt eben nicht, dass man sie damit auch im gemeinsamen Begriff gleichsetzt, sie also mithin für einerlei Gegenstand erklärt.
Gegenstände zu vergleichen bedeutet aber eben nicht, nur da man sie hierzu unter einen gemeinsamen Begriff gebracht hat, sie damit auch bereits für wesensgleich oder gleichwertig zu erklären.
Gegenstände zu vergleichen bedeutet aber eben nicht, nur weil man sie hierzu unter einen gemeinsamen Begriff gebracht hat, dass man sie damit auch bereits für wesensgleich oder gleichwertig erklärt.
Im gemeinsamen Begriff der Gegenstände ist weder ihre Wesensgleichheit noch ihre Gleichwertigkeit erkannt, und ihr Unterschied in Wert oder Wesen nicht dadurch, dass man sie bloß unter getrennte Begriffe gebracht hat.
Werden Gegenstände, um sie zu vergleichen, auch unter denselben Begriff gebracht, so ist hierdurch doch weder die Wesensgleichheit noch die Gleichwertigkeit der Gegenstände behauptet.
Gegenstände zu vergleichen heißt eben nicht, nur weil man sie hierzu unter den gleichen Begriff gebracht hat, dass damit bereits die wesentliche Gleichheit der Gegenstände festgestellt wäre, oder, nur weil man sie hierzu unter verschiedene Begriffe gebracht hat, dass damit bereits die wesentliche Verschiedenheit der Gegenstände festgestellt wäre.
Gegenstände zu vergleichen heißt eben nicht, dieselben bloß unter einen gemeinsamen Begriff zu bringen, um durch denselben dann ihre Wesensgleichheit oder Gleichwertigkeit festgestellt zu haben.
Gegenstände dadurch zu vergleichen, dass man sie unter denselben Begriff bringt, heißt eben nicht, dieselben hierdurch bereits als wesensgleich oder gleichwertig ausgemacht zu haben.
Gegenstände zu vergleichen heißt, sie sowohl unter einen gemeinsamen Begriff zu bringen, um Aussagen über Eigenschaften treffen zu können, die den Gegenständen gemeinsam zukommen, als auch unter verschiedene Begriffe, um Aussagen über Eigenschaften treffen zu können, die nur einem Teil der Gegenstände zukommen.
Gegenstände zu vergleichen bedeutet, dass man sie unter einen gemeinsamen Begriff bringt, um damit Eigenschaften derselben erklären zu können, die ihnen gemeinsam, und unter getrennte Begriffe, um damit Eigenschaften derselben erklären zu können, die ihnen gerade nicht gemeinsam zukommen.
Aller Vergleich von Gegenständen besteht darin, dieselben sowohl unter den gleichen Begriff zu bringen, um Aussagen über Eigenschaften treffen zu können, die den Gegenständen gemeinsam zukommen, als auch unter getrennte Begriffe, um wiederum Aussagen über Eigenschaften treffen zu können, die den Gegenständen bloß verschiedentlich zukommen.
Aller Vergleich von Gegenständen besteht darin, dieselben zum einen unter den gleichen Begriff zu bringen, um Aussagen über gemeinsame Eigenschaften, zum anderen unter verschiedene Begriffe, um Aussagen über unterschiedliche Eigenschaften an denselben treffen zu können.
Vergleichen lassen sich doch allemal ganz beliebige Gegenstände miteinander, sind dieselben hierzu doch bloß sowohl unter einen gemeinsamen Begriff wie auch unter getrennte Begriffe zu bringen, als welches dem Begriffsvermögen, unabhängig von den jeweiligen Gegenständen, schlechterdings immer möglich ist.
Vergleichen lässt sich doch allemal alles mit allem, da man beliebige Gegenstände immer sowohl unter einen gemeinsamen Begriff wie auch unter getrennte Begriffe bringen kann. Ob ein Vergleich allerdings auch sinnvoll ist, also einem Erkenntnisinteresse zu dienen vermag, ist hierdurch noch keineswegs ausgemacht.
Die sophistische Lüge besteht eben nicht im Verbreiten der reinen Unwahrheit und des schlechthin Falschen, sondern immer nur in der Verdrehung, Verfälschung oder Erschleichung der Wahrheit, und zwar gemäß derjenigen Absichten und Zwecke, welche die hierdurch zu befördernde Gesinnungslehre gerade vorgibt.
Es ist eben nichts irrationaler als der Rationalismus selbst, als welcher, das Begriffsvermögen für eine eigenständige Erkenntnisquelle missverstehend, hierdurch immer entweder in Tautologie oder in Paradoxie enden muss.
Der Rationalismus, in seinem Bestreben, alles im Allgemeinen erklären zu wollen, vermag am Ende doch rein gar nichts im Besonderen zu erklären, sondern gerät hierbei vielmehr beständig in Widerspruch mit der Erfahrungswelt.
Und wenn der Rationalismus nun alles in der Welt als für ihm gemäß erklärt, so ist eben alles, was nur immer ist, auch bereits derart, wie es sein soll, und jedes nur irgend durchführbare Handeln findet seine Rechtfertigung dadurch bereits in sich selbst…
Ein rationales Prinzip, das in seiner Anmaßung vermeint, alles im Allgemeinen erklären zu können, vermag am Ende aber doch gar nichts im Besonderen zu erklären.
Ein allwaltendes Vernunftprinzip vermeint zwar, für alles Geschehen den allgemeinen Erkenntnisgrund abzugeben, vermag dabei aber doch für kein einziges Ereignis seinen besonderen Realgrund anzugeben.
Das Faustrecht erfolgreich in das Reich des Geistes getragen zu haben, ist der ewige Triumph des subjektiven über den objektiven Intellekt.
Der Rationalismus kann es doch nicht vermeiden, im Moralischen auf eine Anerkennung des Faustrechts hinauszulaufen, mithin also alles Handeln darin, dass es sich nur als durchführbar erweist, bereits auch seine Rechtfertigung finden würde.
Ewig fühlt sich der forschende Menschengeist dazu verleitet, die Natur des Modells, das er sich von einem Gegenstande macht, bereits für das Wesen des Gegenstandes selbst zu nehmen, und so wird ihm die Natur des Modells zum Wesen der Natur. Ist also sein Modell vom Sonnensystem ein bloß mechanisches Räderwerk, so sieht er auch die Gestirne selbst überall, wie von unsichtbaren Zahnrädern und Federn bewegt, ihre Bahnen ziehen…
Das absichtsvolle Verwechseln von Ursache und Wirkung, Grund und Folge ist doch immer das geeignetste Mittel, um einem bloß subjektiven Wähnen den Anschein eines objektiven Wissens zu verleihen.
Im absichtsvollen Verwechseln von Ursache und Wirkung, Grund und Folge ist noch immer das geeignetste Mittel gegeben, um dem bloß subjektiv Gewollten den Anschein des objektiv Gebotenen zu verleihen.
Der nützlichste Irrtum besteht noch immer im absichtsvollen Verwechseln von Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck, Grund und Folge.
Um also in der Selbstsucht nicht den Beweggrund des Handelns, sondern im Erfolg des Handelns die Rechtfertigung der Selbstsucht erblicken zu können, muss der subjektive Intellekt nur immer Ursache und Wirkung, Grund und Folge, Mittel und Zweck nach seiner Absicht zu vertauschen wissen.
Ob nun der Mensch für ein Werk nach den Zwecken der Natur, oder die Natur als ein Werk zum Zwecke des Menschen anzusehen wäre…?
Es ist, als wollte der Nachtfalter der Lampe bedeuten, dass diese nur darum brennen würde, weil er um sie her flatterte. Und sein Hochmut hierüber hält solange an, bis er sich endlich die Flügel an ihr versengt hat.
Die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, dass er sein eigenständiges Wesen für den Urgrund und Ursprung aller seiner Handlungen annimmt, sondern vielmehr diese bloß für die Erscheinung von jenem erkennt.
Ewigkeit bedeutet eben nicht für alle Zeit, sondern vielmehr außerhalb aller Zeit.