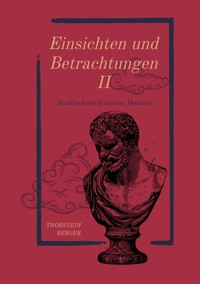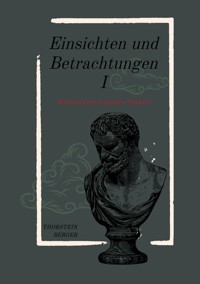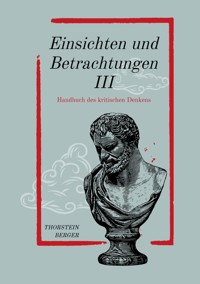
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Einsichten und Betrachtungen
- Sprache: Deutsch
Betrachtungen von der Welt und dem Menschen in ihr anzustellen, um dadurch Einsichten über den Zustand des Menschen in der Welt zu gewinnen - dies ist gerade die Aufgabe, die sich das vorliegende Buch stellt. Dabei behandelt es eine Vielzahl von philosophischen und nichtphilosophischen Themen, die aber stets aus dem Einheitspunkt des kritischen Denkens heraus betrachtet werden, wodurch ein in sich geschlossenes Gesamtbild entsteht. Das Buch ist zudem in der leicht fasslichen Kurzform des Aphorismus und der Sentenz abgefasst, um dem Leser sowohl eine wertvolle Orientierung für die Fragen des täglichen Lebens wie auch eine fortwährende Anregung zum eigenständigen Nachdenken an die Hand zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nil admirari.
[Horaz, Epistulae 1, 6]
Thorstein Berger
Einsichten und Betrachtungen III
Handbuch des kritischen Denkens
© 2024 Thorstein Berger
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland
ISBN
Paperback978-3-384-18473-3
Hardcover978-3-384-18474-0
e-Book978-3-384-18475-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Erstes Buch
Gestattet man dem Gesetz der Kausalität auch nur eine Ausnahme, so hat man es schon zur Gänze aufgehoben, da nur eine Ausnahme von demselben bereits alles zur Ausnahme erklärt.Gestattet man dem Satz vom Grunde auch nur eine Ausnahme, so hat man ihn schon zur Gänze aufgehoben und damit vernichtet.
Der Zirkel zwischen Materialismus und Spiritualismus lässt sich bereits dadurch auflösen, dass man sowohl die materiale als auch die spirituale Welt für ideal, und somit dem vorstellenden Subjekt zugehörig erkennt, mithin in dessen Vorstellung verlegt, wodurch beide dem Satz vom Grunde unterworfen sind, diese sich allerdings nur im inneren Sinne der Zeit, jene sich zusätzlich im äußeren Sinne des Raumes darstellend. Und eine gegenseitige Beeinflussung dieser derart zusammengeführten Welten am Bande der Kausalität bedeutet dann auch keine Schwierigkeit, vor allem aber keinen Zirkel oder Widerspruch mehr.
Der Widerspruch des klassischen Dualismus erlischt, wenn man Subjekt und Objekt als untrennbar in einer Sphäre, nämlich der des Idealen, liegend annimmt.
Dass wer nur immer herrscht, hierdurch bereits seine Vorzüglichkeit vor allen anderen bewiesen hätte, und durch diesen Umstand wiederum zur Herrschaft berechtigt wäre, ist allerdings ein Satz, der nirgends so falsch ist wie in der Welt des Geistes.Wer nur immer in der Welt des Geistes herrscht, hat dadurch bereits seine geistige Überlegenheit unter Beweis gestellt, als welche ihn eben wiederum zu selbiger Herrschaft berechtigt…
Die Despotie in der geistigen Welt nimmt sich immer als die unerträglichste Despotie aus.
Wollte man in allem Naturgeschehen ein allwaltendes rationales Prinzip erkennen, welches als ein solches das Naturgeschehen erst hervorrufen würde, so hat man in demselben Prinzip bereits auf unstatthafte Weise Erkenntnisgrund und Realgrund in eins gesetzt, wodurch das Prinzip durch noch so zahlreich vorgebrachte empirische Vorgänge, in denen sich dasselbe angeblich zeigen soll, nachweisen zu wollen zu einem ganz müßigen Unterfangen gerät.
In gewissen allgemein verneinenden Urteilen einen Widerspruch entdecken zu wollen, wie zum Beispiel, dass die Behauptung, es sei kein Dogmatismus möglich, selbst ein Dogma wäre, oder das Bekenntnis der eigenen Unwissenheit selbst ein Wissen darstellen würde, vermag nur, wer die Gegenstände, auf die das Urteil sich bezieht, als auch das Urteil selbst fälschlich in derselben Sphäre verortet, sodass jenes mit der Existenz dieser auch sich selbst verneinen würde.
Eine bloß formale Aussage über alle nur möglichen Inhalte ist selbst eben kein solcher Inhalt, und somit auch nicht in sich widersprüchlich.
Dass vom Absolutum keine Erkenntnis möglich wäre, ist eben selbst keine Behauptung einer solchen Erkenntnis, da die Behauptung derselben eine transzendente, die der Unmöglichkeit derselben allerdings eine transzendentale ist.Die Behauptung, dass keine Erkenntnis des Absolutums möglich wäre, setzt aber eben selbst keine solche Erkenntnis voraus, ist doch die Behauptung der Erkenntnis des Absolutums eine transzendente, die der Unmöglichkeit derselben allerdings eine transzendentale.
Die Behauptung, dass eine Erkenntnis des Absolutums unmöglich wäre, ist selbst eben keine solche absolute Erkenntnis, sondern bloß eine formale Aussage über die Möglichkeit inhaltlicher Erkenntnis.
Logik ist diejenige Instanz im Erkenntnisvermögen, welche die Begriffe in ihrer Verknüpfung zu Urteilen auf Widerspruchsfreiheit prüft, nicht aber ein eigenständiger Apparat zur Gewinnung positiver Erkenntnisse.
Dasjenige in der menschlichen Erkenntnis, hinter das nicht zurückgegangen werden kann, welches selbst also nicht weiter ableitbar ist und über das nichts hinausführt, ist gerade die Form des Erkenntnisvermögens selbst, nicht aber ein spezifischer Inhalt desselben. Einen besonders ausgezeichneten spezifischen Inhalt dennoch fälschlicherweise für ein solches zu nehmen, bedeutet gerade das Aufstellen eines dogmatischen Grundsatzes. Und aus diesem ließe sich dann tatsächlich dem bloßen Schein nach jeder nur mögliche Inhalt ableiten, was aus der bloßen Form desselben unmöglich wäre.
Ein Mehr an empirischer Erkenntnis vermag wohl den vielen Irrtümern abzuhelfen, aber doch nicht dem einen, den als Glaube an die Möglichkeit der wesentlichen Verbesserung des Menschen in seinem diesseitigen Zustande der Empirismus selbst darstellt.
Aller Fortschritt in der empirischen Erkenntnis von der Welt vermag zwar einzelne Übelstände aus derselben fortzuschaffen, nicht aber aus derselben etwas wesentlich Anderes oder gar Besseres zu machen als das, was sie eben ist und immer sein wird.
Die Kunst leerer Beredsamkeit ist noch immer der schlechteste Ersatz für eigenständiges Denkvermögen.
Ein rationales Weltprinzip selbst ist nicht zu fürchten, da es eben nicht existiert, wohl aber diejenigen, die ein solches entweder glauben oder bloß glauben machen wollen. Jene beabsichtigen, die Menschheit mit ihrer Kenntnis von selbigem zu beglücken, diese behaupten aus reinem Eigennutz eine solche, und das wider besseres Wissen. Jene ereifern sich in ihrem Auftreten, diese sind bloß berechnend, mit dem Unterschied, dass vom Wahn abzubringen leichter ist, denn von der Selbstsucht.
Wer Vieles besitzt, vermag noch ein Mehreres zu scheinen.
Dass das Gehirn als Träger der Vorstellungswelt selbst wiederum nur Vorstellung sei, wird gerne als Widerspruch angeführt, allerdings ist eben nicht das Gehirn selbst Träger der Vorstellungen, sondern nur das materiale Korrelat desselben, als für welchen das transzendentale Bewusstsein anzusehen ist.Das Gehirn ist nicht selbst Träger der Vorstellungswelt, sondern bloß das materiale Korrelat desselben.
Das Postulat, dass alles mit allem zusammenhängen würde, bezeichnet den Umstand, dass kein Zustand als Wirkung möglich ist, der nicht mit einem anderen Zustand, als seiner Ursache, in kausaler Beziehung stehen würde, leidlich schlecht.
Es ist doch immer die intuitive Anwendung der Kausalität, als einer apriorischen Verstandesfunktion, von der diskursiven Auffassung derselben, als dem Gesetz der Kausalität, welches das Aufstellen empirischer Naturgesetze ermöglicht, zu unterscheiden.
Alles mathematische Axiom ist ein Satz, der zwar als Grund für einen logischen Satz zu dienen vermag, selbst aber nicht durch einen solchen, sondern allein durch einen Seinsgrund in Raum und Zeit zu begründen ist. Und dass für beliebig gesetzte logische Prämissen von Schlussketten die Bezeichnung des Axioms in Anspruch genommen wird, soll einer solchen Prämisse nur das Ansehen der Unfehlbarkeit des Axioms verleihen, als würde es sich hierbei um Sätze von unumstößlicher, da selbstevidenter logischer Wahrheit handeln.
Ein Axiom ist eben kein selbstevidenter logischer Satz, der also seine Begründung in sich selbst finden würde, sondern ein Satz, der gar keiner logischen Begründung fähig ist, weil seine Gründe außerhalb der Logik liegen.
Ein Axiom ist eben kein selbstevidenter logischer Satz, der also seine Begründung in sich selbst finden würde, sondern ein Satz, der gar keiner logischen Begründung fähig ist, weil seine Begründung, als in einem Seinsgrund der Mathematik liegend, gerade außerhalb der Logik aufzusuchen ist.
Die Frage nach der Wahrheit eines mathematischen Axioms verlangt nicht nach einem logischen Grund, sondern nach einem Seinsgrund in Raum und Zeit, erwächst also nicht aus bloßer Logik, sondern aus reiner Anschauung.
Die Wahrheit eines mathematischen Axioms liegt nicht in einem logischen Grund.
Es gibt keine der Ratio entstammenden Axiome, sondern nur Dogmen.
Axiom ist eben nicht jede willkürlich getroffene Voraussetzung eines bloß rationalen Systems von Sätzen.Unter einem Axiom ist nicht jede willkürlich gesetzte rationale Annahme zu verstehen, entspringt alles Axiom doch vielmehr der reinen Anschauung.
Dass das Aufstellen eines Modells nicht der eigentliche Zweck der Wissenschaft ist, um in demselben eine genaue Abbildung der Realität zu erblicken, und die Anwendung desselben auf Erfahrung nicht in der bloß klassifikatorischen Einordnung des empirisch Gegebenen unter die verschiedenen Begriffe des Modells besteht, beruht darauf, dass die exakte Wissenschaft nicht bereits auch die empirische Wissenschaft ist, mithin nicht unmittelbar auf die Erfahrungswelt herabreicht.
Im vereinzelt auftretenden Naturgeschehen kann die Kausalität selbst nicht zu entdecken sein, ist vielmehr durch die Kausalität das Naturgeschehen doch erst gegeben, und zwar als ein am Bande der Kausalität verknüpftes. Rein empirische Induktion, verstanden als das Aufsteigen von vereinzelten Naturbegebenheiten zu allgemeinen Naturgesetzen, kann also überhaupt nicht stattfinden ohne die Voraussetzung der apriorischen Kausalität selbst.
Für die intuitive Erkenntnis des Verstandes besitzt die Wirkung, da reine Empfindung, nur intensiven Grad, die Ursache, als im Raum vorgestellte, da in den Raum projizierte Kausalität, nur extensive Größe. Die diskursive Erkenntnis der Vernunft zeigt sich dann im Aufstellen von empirischen Naturgesetzen, die das Kausalverhältnis zwischen verschiedenen Klassen von Zuständen erklären sollen. Hier aber kommen nun sowohl der Ursache als auch der Wirkung, jeweils aufgefasst als empirischer Zustand, sowohl intensiver Grad als auch extensive Größe zu.
So wie der Bezeichner ein sinnliches Abbild des Begriffes in der Welt der Erfahrung darstellt, so die Grammatik ein solches der Logik.
Nicht nach Originalität im Denken ist zu streben, sondern nach Wahrhaftigkeit, selbst wenn man dieselbe Wahrheit zum tausendsten Male vorzutragen hätte. Aber wie originell müsste uns doch heute die Wahrheit vorkommen.
Es ist die ewige Frage, ob man die Auffassung von Raum und Zeit den Begriffen der Mathematik oder vielmehr die Begriffe der Mathematik gerade der reinen Anschauung von Raum und Zeit zu entnehmen habe.
Ausgehend von der herkömmlichen Arithmetik kann man eben nicht durch eine bestimmte Normierung der arithmetischen Operationen zu einer neuen Arithmetik vorstoßen, die völlig unabhängig von der herkömmlichen wäre, in ihren Ergebnissen aber eine größere Gültigkeit als dieselbe besitzen soll.
Eine solche Unmenge von Lügen zu erzählen, dass man selbst sogar noch die größte derselben glaubt, dass nämlich alles Wahrheit sei, was man nur vortragen würde…
Sich frei von Weisheit zu finden, ist bloß bedenklich, aber die Weisheit nicht nur nicht zu suchen, sondern ihrer sogar absichtsvoll zu fliehen, vollends verderblich.
Wer nur mit Falschheit gewappnet durch die Welt geht, darf sich nicht wundern, wenn er beständig sowohl mit der Wahrheit als auch mit anderer Falschheit aneinandergerät. Daraufhin sich aber sowohl diese als auch jene verbitten zu wollen, da einem beide gleichermaßen unleidlich, da dem eigenen Nutzen unzuträglich sind, stellt dann allerdings den Höhepunkt an Falschheit dar.
Man mag in hohem Maße gelehrt und doch bar jeder Urteilskraft sein, und das gerade in Bezug auf diejenigen Dinge, von denen man zwar ein großes Wissen, um die man aber dennoch keine Wissenschaft besitzt.
Mögen die Grenzen der Erfahrungswissenschaft auch beständig erweitert werden, ihre Beschränktheit auf die bloße Erscheinung wird doch niemals überwunden werden.
Die Überzeugungskraft der meisten philosophischen Systeme beruht allein auf ihrer logischen Geschlossenheit, und damit Widerspruchsfreiheit, welche aber doch allemal nur notwendig für die Wahrheit eines solchen ist. Tatsächlich vermag uns von derselben Wahrheit nur die Urteilskraft zu überzeugen, indem sie die dem System zugrundeliegenden Begriffe und Urteile auf ihren materialen Gehalt hin untersucht.
Recht albern und läppisch nimmt sich der Mensch in seiner Hoffart und Geltungssucht aus, und dieses umso mehr, je stärker der Intellekt demselben Vorschub leistet, indem er gerade die Motive hierzu heranzuschaffen versteht, welche denselben dann hilfreich die Steigbügel halten.
Die bloß logische Verknüpfung von Urteilen bereits für eine wissenschaftliche Erkenntnis ansehen zu wollen, heißt aber zu verkennen, dass zwischen logischem Folgen und ätiologischem Erfolgen kein Parallelismus besteht.
Es gibt eben keinen Parallelismus zwischen Erkenntnisgrund und Realgrund, zwischen logischem Folgen und ätiologischem Erfolgen.Es gibt eben keine logische Naturerklärung derart, dass in ihr der logische Schluss der kausalen Wirkung parallel gehen würde.
Es ist ein Irrtum der empiristischen Auffassung von Naturwissenschaft, dass der Ursache eines Kausalgeschehens in der abstrakten Erklärung desselben ein logischer Grund entsprechen soll, aus dem die Erkenntnis des Kausalgeschehens, und damit der Wirkung, dann wiederum zu schließen wäre, ist ein solcher Parallelismus doch gänzlich unstatthaft, da weder Ursache und Erkenntnisgrund gleichzusetzen sind, um derart aneinander ihre Entsprechung zu finden, noch der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung, als ein Naturgesetz, analytisch zu erkennen, mithin aus bloßen Begriffen zu folgern ist.
Das Auftreten einer Wirkung kann nicht aus einem der Ursache als korrespondierend angenommenen Erkenntnisgrund logisch geschlossen werden, sondern es stellt die Kenntnis um eine Wirkung gerade erst den Erkenntnisgrund dar, aus dem auf die Notwendigkeit eines ihr vorhergehenden Zustands als ihrer Ursache geschlossen wird.
Die empirische Wissenschaft besteht eben nicht darin, eine der causa vermeintlich parallel gehende ratio zu bestimmen.
Bei jeder Lehre, die auf einem Widerspruch beruht, stellt sich nicht die Frage, wie sie zur Gänze aus der Welt zu schaffen, sondern vielmehr, in welche Richtung sie allein aufzulösen wäre. Und für nichts gilt dasselbe mehr als für die Lehren der überkommenen Offenbarungsreligion.
Ein Gegenstand der Erfahrung kann immer nur unter einen Begriff fallen, nicht aber einem Musterbild aus Begriffen entsprechen.
Die Wellen des Meeres, beständig einander brechend, sind zu vergleichen den flüchtigen Erscheinungen der Welt, welche in ihrer zeitlichen Begrenztheit nichts so wenig ausmachen wie das Wesen des ewig in sich ruhenden Ozeans.
Das abstrakte Denken und Urteilen ist eben nicht als eine Mechanik von Begriffen aufzufassen.
Wird eine idealistische Auffassung als Mittel zur Erreichung eines allemal realistischen Zweckes missbraucht, so lässt sich aus der moralischen Verwerflichkeit von diesem eben nicht auch bereits die von jener folgern. Vielmehr ist gerade das Zugeständnis an die Gültigkeit der idealistischen Auffassung in kritischer Weise gegen die argumentative Rechtfertigung des realistischen Zweckes zu gebrauchen.
Durch den verdeckten Übergang von Nominalismus zu Realismus, d.h. von nominalistischer zu realistischer Auffassung des Begriffes, lässt sich gerade erklären, dass, was nicht ist, auch niemals sein kann. Denn was einem empirischen Gegenstand als Merkmal nicht zukommt, das kommt ihm auch seinem Begriff nach nicht zu, macht mithin also nicht sein im Begriff erkanntes Wesen aus, und kann ihm somit niemals als Merkmal zukommen, da es ihm wesensfremd ist, wenn man hierbei bloß dem nominalistischen Begriff den realistischen Begriff von gleichem Bezeichner substituiert…
Durch den versteckten Übergang von Nominalismus zu Realismus lässt sich für jeden Gegenstand beweisen, dass, wenn ihm ein Merkmal nicht zukommt, er also nicht unter den Begriff des Merkmals fällt, folglich auch sein Wesen nicht durch den Begriff des Merkmals ausgemacht sein, und ihm das Merkmal somit niemals zukommen kann.
Wer noch nie ein Verbrechen begangen hat, fällt nicht unter den Begriff des Verbrechers, ist also auch seinem Wesen nach kein Verbrecher, und somit unfähig, jemals ein Verbrechen zu begehen…
Hat jemand noch niemals eine Bank ausgeraubt, so fällt er auch nicht unter den Begriff des Bankräubers, ist demnach seinem Wesen nach kein Bankräuber, und somit unfähig, jemals eine Bank auszurauben…
Unterwerfe ich schlechterdings alles dem Satz vom Grunde, also auch das Ding an sich und alles a priori Gegebene, als das Formale der Erkenntnis, so ist das Ergebnis allemal kein Kritizismus, sondern ein Skeptizismus, und zwar mit allen Schwächen, die einem solchen naturgemäß zukommen.
Wer den Satz vom Grunde auf schlechterdings alles Anwendung finden lassen möchte, mithin also auch auf sich selbst, und damit bereits die Möglichkeit aller Erkenntnis a priori bestreitet, indem er alles in die empirische Realität herüberzuziehen sucht, kann für seine Position aber nicht in Anspruch nehmen, Kritizismus zu sein, handelt es sich bei derselben doch bloß um Skeptizismus.
Auf einer weißen Leinwand, als der menschlichen Existenz bar jeder Eigenschaft, lässt sich mit weißem Kreidestift, als dem empirisch freien Willen, das bunte Bild des vielgestaltigen Lebens doch niemals zur Aufführung bringen.
Das Gesetz der Schwerkraft ist ein empirisches Naturgesetz, da es eben die Äußerung einer Kraft allgemein zu erklären unternimmt, damit streitet es aber nicht, dass die in ihm vorkommenden Verhältnisse extensiver Größen zwar a priori zu bestimmen sind, ihr behaupteter gesetzlicher Zusammenhang aber immer nur von hypothetischer Geltung sein kann.
Mag der mathematische Zusammenhang in einem Modell der exakten Wissenschaft auch von apodiktischer Gültigkeit sein, so ist das durch dasselbe Modell aufzustellende Gesetz der empirischen Wissenschaft dennoch bloß von hypothetischer Gültigkeit.
Dem universalen Dogmatismus lässt sich sowohl mit einem bloß partikularen Dogmatismus als auch mit einem universalen Kritizismus begegnen. Jener behält den dogmatischen Irrtum bei, erklärt ihn aber zu einer nur subjektiven Wahrheit, dieser verwirft ihn, indem er ihn als in Widerspruch mit der objektiven Wahrheit stehend nachweist.
Das Vorhergehen der Ursache ist zwar notwendig für das Auftreten der Wirkung, nicht aber ist damit bereits jede behauptete Bestimmung der Ursache als notwendig für die Vollständigkeit der Ursache in ihren Bestimmungen, und damit Wirksamkeit derselben ausgemacht.
Füge ich zu den Bestimmungen, die eine Ursache ausmachen, noch eine weitere hinzu, welche allerdings in keinerlei Kausalverhältnis zur Wirkung derselben Ursache steht, so erfolgt auch auf ihr vereintes Auftreten weiterhin die Wirkung, sodass selbiges Auftreten der Wirkung für den Schluss auf die Vollständigkeit wie auch Vollzähligkeit der Bestimmungen der Ursache also niemals hinreichend, sondern immer nur notwendig sein kann.
Auf das vollständige Beisammensein derjenigen Bestimmungen, welche in ihrer Gesamtheit die Ursache ausmachen, lässt sich aus dem anschließenden Auftreten der Wirkung zwar hinreichend schließen, nicht aber auf die Vollständigkeit der abstrakten Kenntnis um diese Bestimmungen durch ein empirisches Naturgesetz. Denn entweder kann in demselben eine Bestimmung fehlen, die der Ursache allerdings notwendig angehört, oder aber durch dasselbe der Ursache eine Bestimmung beigezählt werden, ohne die das Kausalgeschehen dennoch erfolgen würde.
Die konkrete Vollständigkeit der Bestimmungen einer Ursache lässt sich zwar logisch aus ihrer gegebenen Wirkung ableiten, nicht aber die Vollständigkeit der Bestimmungen in der abstrakten Kenntnis von der Ursache, sodass, welche Bestimmungen der Ursache also tatsächlich beizuzählen sind, gleichfalls als hypothetisch verbleiben muss.
In derselben Richtung, in der das Kausalgeschehen erfolgt, kann die Logik auf das allgemeine Gesetz dieses Erfolgens nicht hinreichend schließen, sondern immer nur aus dem Auftreten der Wirkung auf das Vorhergehen der Ursache und aus dem Ausbleiben der Wirkung auf die Abwesenheit der Ursache.
Objekt und Subjekt machen, in ihrer Beziehung zueinander, bereits die ganze Welt der Vorstellung aus. Und darum ist es mehr als ungereimt, in ihrem Verbund, der gerade darin besteht, dass das eine nicht ohne das andere vorgestellt, und damit der Begriff des einen nicht ohne den des anderen gedacht werden kann, da alles Vorgestellte immer auf ein Vorstellendes verweist und umgekehrt, einen Zirkelschluss ausmachen zu wollen. Ein solcher würde nur dann auftreten, wenn man Objekt und Subjekt, als Reales und Ideales, Materie und Geist, ausgedehnte und denkende Substanz missverstanden, widerrechtlich auseinanderreißen wollte, um sie hierdurch zwar für vollkommen wesensfremd, und darum getrennten Sphären angehörig zu erklären, im Anschluss aber doch jeweils das eine aus dem anderen abzuleiten.
Käme der Raum als Bestimmung einem Objekt an sich zu, und wäre zudem die Materie, aus welcher dasselbe bestehen soll, nicht ins Unendliche teilbar, existierten mithin also unteilbare Atome, so wäre der Raum selbst auch nicht ins Unendliche teilbar, damit aber gleichfalls kein Kontinuum…
Die Naturforschung ist um Bestätigung eines empirischen Naturgesetzes bemüht, eingedenk seiner grundsätzlichen Unbeweisbarkeit.Alle Naturforschung ist um Bestätigung des empirischen Naturgesetzes bemüht, wohl wissend um seine grundsätzliche Unbeweisbarkeit.
Dass sich ein empirisches Naturgesetz immer nur bestätigen, niemals aber beweisen lässt, ist ein unumstößliches Ergebnis der Einrichtung unseres Verstandesapparates.
Die Wahrheit empirischer Naturgesetze lässt sich schlechterdings nicht beweisen, weder aus Tatsache noch aus Begriff.
Noch so viele Tatsachen der Erfahrung reichen doch nicht zu einem allgemeinen Gesetz bezüglich derselben hin, sondern können für die Geltung eines solchen immer nur notwendig sein, und dieser Umstand liegt gerade in der synthetischen Natur jedes solchen Gesetzes begründet, indem es zur Verknüpfung der rein empirischen Tatsachen immer noch der jeder Erfahrung vorhergehenden Verstandesfunktion der Kausalität bedarf.
Der recht verstandene Atheismus besteht nicht in der Hinwendung zur materialistischen Seite des überkommenen Dualismus aus Materie und Geist, sondern gerade in dessen Auflösung.
Es ist doch das Unglück, dass der Kritizismus zwar im Theoretischen den Dogmatismus selbst aus dem Feld geschlagen, im Praktischen aber bloß Platz für unzählige neue dogmatische Lehren geschaffen hat.Es ist eben das Unglück, dass der Kritizismus zwar im Theoretischen den Dogmatismus selbst widerlegt, im Praktischen aber nur eine dogmatische Lehre verdrängt hat, an deren Stelle nun unzählige andere getreten sind.
Die Zahlbegriffe sind aus dem unmittelbar gegebenen Kontinuum der Zeit abstrahiert, und somit kann also, da die Welt der Begriffe kein Kontinuum darstellt, aus den Zahlbegriffen die Zeit nicht konstruiert werden.Die Zahlbegriffe sind aus dem uns unmittelbar gegebenen Kontinuum der Zeit abstrahiert, und da die Welt der Begriffe kein Kontinuum ist, kann aus den Zahlbegriffen die Zeit eben nicht erst konstruiert sein.
Die Logik, als Vermögen des Verstandes, angewandt auf diskrete Zahlbegriffe, schafft eben nicht erst das Kontinuum, sondern nähert sich dem Kontinuum, aus welchem dieselben allein abgezogen sind, allenfalls an.Die Logik, als Vermögen des Verstandes, angewandt auf diskrete Zahlbegriffe, schafft nicht erst das Kontinuum, sondern vielmehr stammt die Kenntnis des Kontinuums gerade aus der reinen Anschauung der Zeit.
Die Logik kann sich vermittelst der immer nur diskreten Begriffe der kontinuierlichen Anschauung zwar beliebig annähern, nicht aber diese selbst kongruent abbilden.
Jede inkommensurable Zahl setzt bereits ein Kontinuum voraus, die bloß kommensurable Zahl gerade nicht.
Unendlichkeit und Kontinuum, als etwas, das bis ins Unendliche teilbar ist, sind demnach Wechselbegriffe, und beide zudem bloß negative. Und somit gibt es auch nur jeweils eine Art der Unendlichkeit und des Kontinuums.
Jede inkommensurable Zahl setzt das Kontinuum schon voraus, und zwar in ihrer Dezimaldarstellung als Intervallschachtelung, und ist somit, gemäß ihrer Darstellung, selbst ein Kontinuum, die kommensurable Zahl jedoch nicht, da sie immer über eine nur endliche Verkleinerung eines diskreten Maßstabes erreichbar ist.
Jede inkommensurable Zahl setzt die Existenz eines arithmetischen Kontinuums voraus und ist hierzu vollkommen berechtigt, da es sich bei demselben um nichts anderes als die Zeit selbst handelt.
Aller Versuch, aus diskreten Zahlbegriffen ein Kontinuum erst konstruieren zu wollen, ist zur Gänze vergeblich, da dasselbe jedem Zahlbegriff bereits vorausgeht. Das Problem besteht eben darin, dass bei der Überführung eines Kontinuums in die Welt der Begriffe die Eigenschaft der Kontinuität gerade verloren gehen muss.
Alle Zahlbegriffe sind abstrahiert aus der Sukzession der reinen Zeit. Nun sind aber die grundlegenden, da ursprünglichen Zahlbegriffe notwendig diskret, da sich die Kontinuität der Zeit nicht in die Welt der Begriffe übertragen lässt. Und widersinnig ist damit alles Ansinnen, ein Kontinuum der Zahlenwelt mithilfe der diskreten Zahlbegriffe erst konstruieren zu wollen.
In der Auffassung, dass, wenn ein Axiom nicht zu beweisen ist, man ihm genausogut entraten und es durch einen anderen Satz ersetzen könne, solange das System der axiomatischen Sätze dabei nur widerspruchsfrei bleibt, drückt sich aber doch die naive Sichtweise aus, dass Axiome nicht nur logisch zu beweisen wären, sondern ihre bloße Widerspruchsfreiheit bereits hinreichend für die Realität des durch dieselben aufzustellenden Systems wäre.
Die Auffassung, dass man aus einer Menge von widerspruchsfreien Axiomen einzelne derselben entfernen könne, solange die verbleibende Menge dabei nur widerspruchsfrei bleibt, um so zu einer Erkenntnis von größerer Allgemeingültigkeit aufzusteigen, die dann die in der ursprünglichen Menge der Axiome niedergelegte Erkenntnis als bloßen Spezialfall enthalten soll, gerät genau dann zu einem Logizismus, wenn die Axiome, welche die Menge ausmachen, eben keine logischen Sätze sind, sondern auf reiner Anschauung beruhen, sodass für dieselben also gar kein logischer Grund, sondern allein ein Seinsgrund in Raum und Zeit angegeben werden kann.
Axiome sind zwar logisch nicht zu beweisen, wohl aber können sie zueinander logisch äquivalent sein, nämlich wenn sie auf reinen Anschauungen von gleicher Bedeutung beruhen.
Für ein Axiom eine logische Begründung zu finden, heißt eben nur zu zeigen, dass es keines ist.
Was der reinen Anschauung entstammt, kann sich untereinander weder widersprechen noch irgend widerstreiten, denn weder ist es durch einen Begriff gegeben, in welchem allein der Widerspruch, noch als eine Erfahrung, in welcher allein der Widerstreit möglich ist.
Der Nachweis ihrer Widerspruchsfreiheit ist doch niemals hinreichend für die Existenz mathematischer Objekte, welche allemal aus reiner Anschauung zu konstruieren sind.
Religionsfreiheit bedeutet Abwesenheit der absoluten Ansprüche von positiver Religion, nicht aber absolutes Anrecht auf eine solche in ihren Ansprüchen.
Der Wahn, da man um die Irrtümer eines großen Denkers weiß, sich über diesen schon erhaben zu glauben, ist so schwer heilbar als die Eigenliebe des Menschen.
Ist die Wahrnehmung abhängig vom sinnlichen Wahrnehmungsapparat, dieser aber wiederum von der äußeren Sinnenwelt, so kann der Wahrnehmung der äußeren Sinnenwelt doch niemals objektive Gültigkeit beigelegt werden, stehen Gegenstand und Wahrnehmung des Gegenstands doch in wechselseitiger Abhängigkeit zueinander, derart, dass die Wahrnehmung der äußeren Sinnenwelt immer bereits der Beschaffenheit derselben gemäß ausfallen muss.
Ein Modell der exakten Wissenschaft kann, gemessen an der empirischen Realität, eben nicht falsch, sondern bloß unzweckmäßig sein.
Ein Modell der exakten Wissenschaft kann eben nicht wahr sein, indem es die empirische Realität oder auch nur einen Ausschnitt derselben exakt abzubilden wüsste, sondern immer nur zweckmäßig, indem es das Aufstellen eines empirischen Naturgesetzes, und damit die Zurechnung der Wirkung zu ihrer Ursache gestattet.
Ein Modell der exakten Wissenschaft ist fehlerhaft, sofern es einen logischen oder mathematischen Fehler enthält, der seine Widerspruchsfreiheit aufhebt, nicht aber falsch, weil es verabsäumen würde, die empirische Realität zu beschreiben, wie sie an und für sich ist.
Ist der Gegenstand eines Modells ein abstrakter, so kann ein Irrtum oder Widerspruch im Gegenstand auch im Modell anzutreffen sein, ohne dass dieses hierdurch irrtümlich oder widersprüchlich geraten würde, da der Irrtum oder Widerspruch in diesem Fall nur seinen gedanklichen Inhalt ausmacht, ohne dass es hierdurch auch in seiner formalen Konstruktion fehlerhaft wäre.
Ist eine Auffassung auch falsch, so ist von dieser falschen Auffassung dennoch ein idealtypischer Begriff zu konstruieren möglich, der formal fehlerfrei ist, den Denkfehler der Auffassung allerdings als inhaltliche Bestimmung aufweist.
Ein wissenschaftliches Modell kann eben, gemessen an der Wirklichkeit, niemals wahr, sondern immer nur zweckmäßig sein, ist selbst also nicht Ziel und Zweck aller wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern bloß Mittel zu einer solchen. Und somit bildet das Modell auch nicht einen Teil der für sich bestehenden Welt ab, wie sie an sich bestehen würde, sodass man anstatt der ursächlichen Beziehungen in dieser bloß die denselben entsprechenden begrifflichen Beziehungen im jenem zu verfolgen hätte.
Ein wissenschaftliches Modell ist weder wahr noch falsch, kann es, in Bezug auf eine vermeintlich objektive, d.i. für sich bestehende Realität, die es angeblich zu beschreiben hätte, auch gar nicht sein, sondern immer nur zweckmäßig, und zwar dann, wenn mittelst desselben ein empirisches Naturgesetz aufzustellen ist, welches sich in der Folge an der Erfahrung bestätigen lässt.
Ein Modell der exakten Wissenschaft ist immer bestenfalls zweckmäßig, nicht aber an sich bereits wahr, in Bezug auf den Ausschnitt der Wirklichkeit, den es zu modellieren unternimmt, und somit nur technisches Mittel zur Erlangung von Wissen, nicht aber selbst schon ein Wissen von der empirischen Wirklichkeit, oder gar Abschluss der empirischen Wissenschaft.
Die exakte Wissenschaft ist nicht der logische Abschluss der empirischen Wissenschaft, sondern stellt derselben vielmehr erst die logischen Werkzeuge zu ihrem Verfahren bereit.
Die Absicht, alles Kausalgeschehen logisch erklären zu wollen, setzt doch voraus, dass der materialen Ursache im Realen auch stets ein logischer Grund im Idealen entsprechen würde, mithin also einen durchgängigen Parallelismus zwischen Realem und Idealem…
Eine bloß logische Erklärung des Kausalgeschehens kann nicht ohne Erschleichung vonstattengehen, da dasjenige, was eigentlich zu erklären ist, den Begriffen hierzu schon immer untergeschoben sein muss, nämlich der kausale Zusammenhang im fraglichen Geschehen.
Durch die Sinne allein kann ein Raum niemals erst gegeben sein, ist alles Sinnesorgan doch nirgendwo anders als bereits im Raume anzutreffen.
Kraftäußerung und Zustandsänderung sind durchaus Wechselbegriffe, da diese nicht ohne jene vonstattengehen kann und wiederum jene nicht ohne diese.
Kraftäußerung und Zustandsänderung sind durchaus Wechselbegriffe, da diese nicht ohne jene vonstattengehen kann und umgekehrt, nicht aber sind Ortsänderung und Zustandsänderung für ein und dasselbe zu halten. Ein Gegenstand mag in einem Zustand verharren, nämlich dem der Bewegung, solange keine Kraft auf ihn einwirkt, dieselbe zu hemmen oder zu befördern, verändert aber doch kontinuierlich seinen Ort. Umgekehrt bedeutet jede Zustandsänderung zumindest mittelbar eine Änderung des Ortes, sei derselbe in Raum oder Zeit, da ohne diese jene nicht festzustellen wäre. Eine Zustandsänderung bezüglich des Denkens oder Fühlens findet nur in der Zeit statt, bedeutet also Ortsänderung lediglich in der Zeit.
In der apodiktischen Gültigkeit der Mathematik ist bereits ein Kriterium zur Feststellung einer Zustandsänderung gegeben, derart dass, was derselben nicht gemäß ist, allein in einer Kraftäußerung seine Ursache haben kann, wie wenn die Bewegungsgröße eines Zustandes nicht linear zu zerlegen wäre, tatsächlich durch einen Beschleunigungsvorgang eine Zustandsänderung stattgefunden haben muss.Durch die apodiktische Gültigkeit der Mathematik ist bereits ein Kriterium zur Feststellung einer Zustandsänderung gegeben, derart dass, wenn ein Zustand derselben nicht gemäß wäre, sich seine Bewegungsgröße zum Beispiel nicht linear zerlegen ließe, tatsächlich eine Zustandsänderung stattgefunden haben muss.
Alles Entstehen und Vergehen der empirischen Zustände findet statt in der Zeit, sodass, in dieser Hinsicht, sie selbst nicht vergeht, sondern alles Vergehen in ihr stattfindet, gleichwohl aber, sollten auch alle empirischen Zustände beharren, die ideale Zeit dennoch verstreichen würde, und zwar als die sich stetig erneuernde Bedingung zur Möglichkeit der Zustandsänderung selbst.
Die Erfahrung ist ihrem mannigfachen Inhalte nach zwar unerschöpflich und unübersehbar, wohl aber lässt sich die Form, in welche gekleidet alle Erfahrung überhaupt nur auftreten kann, doch mit Gewissheit angeben.
Nicht Raum und Zeit selbst sind dem Satz vom Grunde unterworfen, sondern bloß aller Gegenstand in Raum und Zeit.
Erfährt ein Körper, der in einer Bewegung, als einer Ortsänderung, der aber keine Zustandsänderung entspricht, begriffen ist, zusätzlich eine Zustandsänderung, so kann die Ortsänderung, die durch diese bedingt ist, zusätzlich noch von jener abhängig sein, als einer Scheinkraft.
Wichtiger als alles Fortschreiten in einer besonderen Erfahrungswissenschaft ist immer noch das Verständnis des Verfahrens der Erfahrungswissenschaft selbst.
Der höchste erreichbare Gipfel aller Weisheit ist doch ein zu steil aufragender, als dass die vielen ihn zu erreichen, geschweige denn auf ihm sich zu halten vermöchten, schleppen sie doch zumeist noch einen Ballast aus eigentlich schon abgelegten Irrtümern mit sich, welcher ihnen das Erreichen des Gipfels verwehrt, indem er sie zu einem allzu zeitigen Abstieg zwingt.
Ein Rückfall in die Welt mittelalterlichen Denkens ist doch jederzeit möglich, sofern nur die allgemeine Urteilskraft durch den herrschenden Zeitgeist hinreichend getrübt ist.
Mathematische Konstruktion kann nie eine aus bloß logischen Begriffen, sondern muss eine aus reiner Anschauung sein.
An die Stelle der Erforschung der Wirklichkeit, als der empirischen Wissenschaft, tritt doch in immer größerem Maße die bloße Durchmusterung der Schriften derselben Wissenschaft, und damit ein bloßes Schriftgelehrtentum von den bislang in denselben niedergelegten Erkenntnissen.
Das Wissen um die empirische Wissenschaft ist selbst schon zu einer empirischen Wissenschaft geraten, mit allen Nachteilen einer solchen.
Man könnte doch sein Leben lang die Schriften, die nur zu einem Philosophem verfasst wurden, durchmustern, ohne dabei befürchten zu müssen, auch nur eine Minute lang mit Philosophie behelligt zu werden.
Mathematik ist zur Erkenntnis der Welt weder hinreichend noch überhaupt notwendig.
Raum und Zeit im Verbund machen sowohl die Ortsänderung als auch die Zustandsänderung überhaupt erst möglich, allein durch die Kausalität wird letztere aber in ihrem Eintreten dann auch notwendig.
Ein Begriff von etwas Angeborenem gibt noch keinen angeborenen Begriff. Angeboren, als untrennbar vom Subjekt, sind demnach die apriorischen Verstandesfunktionen, nicht aber die Begriffe, die man sich von denselben macht.
Gleichzeitigkeit ist nicht allein durch die Zeit, sondern zusätzlich durch den Raum erst möglich, nämlich als ein Nebeneinander der Gegenstände im Raum zum gleichen Zeitpunkt.
Wer die Vergottung einer auf Freiheit beruhenden Herrschaftsform zu betreiben unternimmt, wirkt doch insgeheim auf ihre Abschaffung hin. Und wer das Wesen der Freiheit zu bestimmen unternimmt, zielt doch unbewusst auf ihre Beseitigung ab.
Die Aussage, dass alle Erkenntnis nur subjektiv gültig wäre, widerspricht sich entweder durch ihren Anspruch auf objektive Gültigkeit selbst, oder muss sich, wenn sie einen solchen von sich weist, ins Nichts der Bedeutungslosigkeit verflüchtigen.
Das Aufsteigen zu allgemeinen Begriffen ist nicht gleichzusetzen mit dem Aufsteigen zu allgemeinen Gesetzen. Jenes ist Sache der Vernunft, dieses des Verstandes.
Raum und Zeit sind selbst unentstanden, findet alles Entstehen und Vergehen doch bloß statt in Raum und Zeit.
Das Trägheitsgesetz bezieht sich unmittelbar auf die a priori gegebene Kausalität, kann somit zwar auf empirischem Wege gefunden werden, ist darum aber mitnichten empirischen Ursprungs.
Raum und Zeit sind weder als unabhängig von allem Objekt und Subjekt, und damit als absolut, noch als Bestimmungen des Objekts an sich, und damit als real, sondern vielmehr als Erkenntnisformen des Subjekts, und damit als ideal zu betrachten.
Es gibt lediglich drei mögliche Verhältnisse, in denen Raum und Gegenstand der Erfahrung zueinander stehen können. Gegen die Auffassung, dass der Raum als Eigenschaft dem Gegenstande selbst zukäme, ließe sich das Argument der symmetrischen Inkongruenz anführen, gegen die eines absolut realen Raums, der auch nach Wegnahme allen Subjekts und Objekts fortbestünde, sich wiederum einwenden, woran oder durch wen derselbe dann überhaupt erkannt werden sollte. Und so verbleibt als letzte Möglichkeit die der Idealität des Raumes, dass derselbe also als Erkenntnisform dem erkennenden Subjekt anhängen müsse.
Raum und Zeit sind weder absolut, indem sie auch nach Wegfall von allem Objekt wie Subjekt bestehen bleiben würden, noch objektiv, indem sie bloß dem Gegenstand an sich anhaftende Bestimmungen oder eine Relation von Gegenständen an sich untereinander wären, sondern vielmehr subjektiv, indem sie gerade apriorische Erkenntnisformen des Verstandes ausmachen.
Mitnichten können Raum und Zeit sowohl Bestimmungen am Gegenstand an sich als auch abhängig vom jeweils wahrnehmenden Individuum sein.
Gleichzeitigkeit ist nicht durch oder in bestimmter empirischer Erfahrung gegeben, sondern durch die Form der Erfahrung selbst, in welcher dieselbe stets als Vorstellung auftritt und als solche beliebig viele Gegenstände, im Raum getrennt, zum jeweils gegenwärtigen Zeitpunkt unter sich befasst. Sind Auffassungen der Zeit, wie die einer absolut oder relativ, da den Gegenständen als Eigenschaft zukommenden, realen Zeit mit dieser Auffassung von Gleichzeitigkeit unvereinbar, so sind sie notwendig falsch.
Leugnet eine Auffassung der Zeit die Möglichkeit der Gleichzeitigkeit überhaupt, so ist sie notwendig falsch.
Was unmittelbar gegeben ist, sind die Gegenstände der Vorstellung in ihrer Gleichzeitigkeit, von deren Gleichzeitigkeit also in aller weiteren Betrachtung überhaupt auszugehen ist.Was unmittelbar gegeben ist, ist die Vorstellung, deren Elemente gleichzeitig sind und von deren Gleichzeitigkeit stets auszugehen ist.
Jede Bewegung oder Geschwindigkeit lässt sich beliebig linear zerlegen und wieder zusammensetzen, ohne dass sich dadurch an ihr oder ihrer Größe etwas ändern würde. Betrachten wir zwei Körper, die sich relativ zueinander bewegen, so kann also dem einen jeder beliebige Anteil an der Bewegung zugesprochen werden und dem anderen der entsprechende Rest, ohne dass sich hierdurch an der gesamten Bewegung oder Bewegungsgröße etwas zu ändern vermöchte. Dies ist eine synthetische Erkenntnis a priori. Wäre dem nicht so, so könnte es keine zusammengesetzte Bewegung, und damit überhaupt keine Bewegung geben.
Zu vermeinen, dass, wenn das Ideal für einen Gegenstand nicht zu begründen ist, damit auch die Existenz des Gegenstandes selbst ohne Grund wäre, vermag nur, wem der eigene Idealismus bereits zum Selbstzweck geraten ist.
Wenn das Ideal eines Gegenstandes nicht bestehen kann, dann soll auch der Gegenstand nicht von Bestand sein…
Wenn der ideale Staat nicht bestehen kann, so soll es gar keinen Staat geben. Die Geburt des Anarchismus aus kindlichem Trotz…
Die scholastische Anbetung von Naturkonstanten, die als schlechthin notwendig für das objektive Bestehen des Weltganzen aufgefasst werden, versucht darin allerdings dem naturwissenschaftlichen Weltbild dieselbe Grundlage zu geben wie dem religiösen.
Der Widerstreit zwischen den verschiedenen Dogmen lässt sich nicht dadurch überwinden, dass man sie alle gleichermaßen gelten lässt, also lediglich ihren jeweiligen Anspruch auf alleinige Gültigkeit verwirft, sondern vielmehr dadurch, dass man sie alle gleichermaßen der universalen Kritik unterwirft.
Würde das Unrecht allein im Zuwiderhandeln gegen das positive Recht bestehen, so wollte man zu erklären versucht sein, dass es mithin jenes ohne dieses gar nicht geben würde, und damit die gänzliche Abschaffung des positiven Rechts bereits den moralischen Idealzustand in der Gesellschaft herbeiführen müsste. Nun sind aber gerade das Unrecht und das Unrechttun das eigentlich Positive, und damit Hirngespinste dieser Art genauso gegenstandslos wie verderblich.
Der empirische Realismus behauptet, dass die Vorstellungen abhängig wären von der objektiven, d.i. an sich bestehenden, ausgedehnten Außenwelt. Dass diese Außenwelt aber gerade nur in unserer und für unsere Vorstellungswelt ihr Dasein hat, besagt wiederum der transzendentale Idealismus.
Die Bedingungen für das Dasein der Vorstellungswelt können nicht abhängig sein von den Vorstellungen in ihr.Die Bedingungen, unter denen eine Welt der Vorstellungen überhaupt gegeben sein kann, können eben nicht abhängig sein von den einzelnen Vorstellungen in ihr.
Extensive Größen sind nicht an sich messbar, sondern nur bestimmbar, und zwar durch Vergleich mit anderen extensiven Größen.
Es gibt zwar das wahrnehmende Individuum in Raum und Zeit, allerdings sind Raum und Zeit selbst erst für und durch das Bewusstsein des erkennenden Subjekts gegeben.Es gibt zwar das wahrnehmende Individuum in Raum und Zeit, dieses selbst aber ist, als Vorstellung, erst für und durch das Bewusstsein des erkennenden Subjekts gegeben.
Rotation ist Bewegung ohne relative Ortsänderung der in Rotation befindlichen Teile zueinander, nichtsdestominder aber als eine Kraftäußerung gegeben. Und festzustellen ist eine solche Bewegung somit allein durch den Effekt einer Scheinkraft.
Die analytische Erschleichung in der Erfahrungswissenschaft besteht darin, dass man das erst zu postulierende empirische Naturgesetz als schon bewiesen voraussetzt und dem Begriff des Gegenstandes, auf den und dessen Eigenschaften es sich bezieht, als zusätzliche Eigenschaft unterschiebt, sodass dann vermeintlich aus dem reinen Begriff des Gegenstandes nebst dem der auf ihn einwirkenden Ursache in logisch-analytischer Weise auf die Wirkung geschlossen werden könne.
Absolutismus ist, wenn unter Rückgriff auf eine dogmatische Lehre absolut zu herrschen gesucht wird, ungeachtet dessen, ob das der Lehre zugrundeliegende Prinzip als absolut gut oder als absolut böse anzusehen, und somit zu befürworten oder zu verwerfen ist.
Man befreit sich nicht dadurch von der Herrschaft einer dogmatischen Glaubenslehre, dass man zwar die aus derselben abgeleiteten Handlungsvorschriften verwirft, an ihrer statt aber nun den ihnen genau gegenteilig lautenden Handlungsvorschriften dieselbe Geltung einräumt wie vormals jenen.
Die Annahme einer absoluten Geschwindigkeit, die durchaus endlich sein soll, ist in sich widersprüchlich, denn um bestimmbar zu sein, müsste sie, wie jede Geschwindigkeit, relativ sein, also ist sie selbst unbestimmbar, soll aber nun, als absolut genommen, dazu herhalten, alle anderen Geschwindigkeiten zu bestimmen, mithin an ihr zu messen. Sie muss an etwas physischem wahrgenommen werden können, aber sich doch jeder weiteren physischen Beeinflussung durch den Kausalnexus entziehen, ja gänzlich ursachlos sein, um so eine unbedingte Größe bleiben zu können.
Das Endliche in seinen Verhältnissen kann nicht das Absolute sein.
So wie die Auffassung von relativer Bewegung und relativer Geschwindigkeit diejenige von absolutem Raum und absoluter Zeit abgelöst hat, so die der absoluten Geschwindigkeit wiederum die der relativen, da jene die naive arithmetische Zerlegung von dieser, und somit sie selbst unmöglich macht, dadurch aber wiederum, als absolutes Verhältnis von Raum und Zeit selbst, den absoluten Raum und die absolute Zeit impliziert. Sehen wird von all diesen Widersprüchen ab, so bleibt nur die tautologische Feststellung bestehen, dass die absolute Geschwindigkeit immer mit sich selbst übereinstimmen muss.
Mathematische Konstruktion bedeutet nicht Konstruktion aus bloßen Begriffen, sondern in reiner Anschauung.
Indem man den Teil der Wissenschaft, der überhaupt durch die Mathematik erreichbar ist, fälschlicherweise bereits für die ganze Wissenschaft genommen hat, wurde die wissenschaftliche Verfahrensweise darauf reduziert, den jeweils relevanten Ausschnitt der empirischen Realität in der Sprache der Mathematik zu beschreiben, und die empirische Wissenschaft damit auf eine mathematische Beschreibung der empirischen Realität.
Die Erkenntnis der allgemeinen Gesetzmäßigkeit des empirischen Geschehens liegt eben niemals abgeschlossen vor, sondern steht immer der weiteren, berichtigenden Abänderung offen.
Um den Anforderungen, dass die Wissenschaft nicht nur ein genaues Abbild der empirischen Realität hervorbringen, sondern auch der steten Abänderung offenstehen soll, gleichermaßen Rechnung zu tragen, ist man dazu übergegangen, die apodiktische, keinen Widerspruch duldende Gewissheit der Mathematik, in welcher die Sprache zur Formulierung eines solchen genauen Abbildes gefunden sein soll, aufzulösen, um so zu einer probabilistischen Scheinmathematik zu gelangen, durch welche nun beiden Anforderungen zu genügen wäre…
Um sowohl dem vermeintlichen Grundsatz der empirischen Wissenschaft, dass dieselbe ein genaues Abbild der empirischen Realität zu besorgen hätte, als auch der berechtigten Forderung, dass dieselbe in ihren allgemeinen Aussagen abänderbar sein solle, Genüge zu tun, hat man sich dazu verstiegen, die apodiktische, keinen Widerspruch duldende Gewissheit der Mathematik, in welcher ein solches Abbild allein aufzuführen wäre, aufzulösen, indem man sie zu einer probabilistischen Scheinmathematik umgestaltet hat.
Um sowohl der berechtigten Forderung nach Rektifizierbarkeit der allgemeinen Aussagen der empirischen Wissenschaft als auch der unberechtigten Forderung nach Exaktheit der Ergebnisse der empirischen Wissenschaft, als eines genauen Abbildes der empirischen Realität, Genüge zu tun, hat man sich dazu verstiegen, die apodiktische Gewissheit der Mathematik aufzulösen, um an ihrer statt eine bloß probabilistische Scheinmathematik zu verfolgen.
Vor jedem moralischen Urteil über eine Handlung anderer muss die redliche Selbstprüfung stehen, wie die eigene Handlung in derselben Situation ausgefallen wäre.Jedem moralischen Urteil über eine Handlung anderer muss die redliche Selbstprüfung vorausgehen, zu welcher Handlung die eigene Person in derselben Situation sich notwendig hätte bekennen müssen. Und wer sich im Anschluss hieran immer noch moralisch über andere erhaben glaubt, als ein Musterbild reinster Gesinnung, ist in Wahrheit bloß ein Ausbund heilloser, da unheilbarer Gesinnungsgewissheit.
Am abträglichsten sind der Erfahrungswissenschaft diejenigen Lehrbücher derselben, die, von ihrem vorläufigen Ende ausgehend, all ihre Ergebnisse bloß als analytisch gegebene Wahrheiten entwickeln.
Die didaktische Lehre der Wissenschaft setzt allzuoft mit dem vorläufigen Endergebnis der Forschung an, um aus diesem dann in analytischer Weise seine vermeintliche Bedeutung zu entwickeln, anstatt, ausgehend von der ursprünglichen wissenschaftlichen Fragestellung, den Weg zu ihrer vorläufigen Beantwortung nachzuzeichnen. Und so ist eine Wissenschaft am wenigsten aus einem Lehrbuch derselben zu erlernen.
Begriffe werden nicht erlernt und durch das Erlernen gleichermaßen von außen erworben, sondern, anhand der Erfahrung und der erfahrenen Sprache, vielmehr in der eigenen und durch die eigene Vernunft nachgebildet.
Begriffe und Urteile, und nicht die bloßen Bezeichner derselben, sind das eigentliche Material des logischen Denkens.
Es ist stets der empirische Irrtum vom methodischen Irrtum in der Erfahrungswissenschaft zu unterscheiden. Jener ist notwendig für das Fortschreiten in der Wissenschaft, indem er das fortwährende Rektifizieren ihrer vorläufigen Postulate ermöglicht, dieser gerade das größte Hemmnis in derselben, indem er ihre Postulate als letztgültig zu verabsolutieren sucht.
Es gibt Irrtümer, die der Wissenschaft notwendig sind, da sie allererst ihren Fortgang ermöglichen, wie auch solche in der Auffassung von Wissenschaft selbst, die den Fortgang derselben zu hemmen wissen und in dem Maße unverzeihlich sind, als sie zu den längst abgelegten Irrtümern der Menschheit gehören, welche bloß in neuem Putz einherschreitend Urstände feiern.
Wollte man unter Sprache lediglich die Menge der Bezeichner nebst der Grammatik als dem Regelwerk ihrer syntaktischen Anordnung verstehen, so steht doch außer Frage, dass die Bezeichner nicht den Inhalt des Denkens ausmachen und die Grammatik nicht die Form desselben bestimmt. Was das Denken aber sehr wohl zu bestimmen weiß und ihm dadurch abträglich wird, das sind die irrtumbehafteten Begriffe wie auch die irrtümliche Auffassung vom Begriff selbst. Diesem Übelstand kann nur die Kritik Abhilfe schaffen, nicht aber das Aussondern und Entfernen von vermeintlich schädlichen Bezeichnern aus dem Wortschatz der Sprache, unternommen in der unbegründeten Hoffnung, dadurch zugleich auch das diskursive Denken selbst zu läutern, da von Irrtümern zu befreien.
Verderblicher als jeder gegebene Irrtum ist allemal derselbe Irrtum, welcher sich nun allerdings als sein genaues Gegenteil ausgibt, dabei aber lediglich das bislang mit ihm einhergehende Werturteil in sein Gegenteil verkehrt, um ansonsten unverändert zu bleiben.
Sprache und Denken in Kategorien zwängen zu wollen, welche der Sprache und dem Denken gerade selbst entstammen und nur entstammen können, ist eben keine Wissenschaft, sondern bloß tautologisches Nichts.
Durch die Vernunft ist der Mensch nicht frei, sondern lediglich zurechnungsfähig, da er durch sie die Auswirkungen seines Tuns in abstracto zu überblicken im Stande ist.