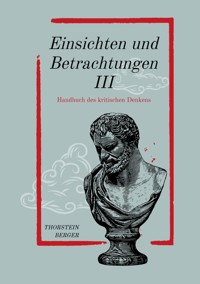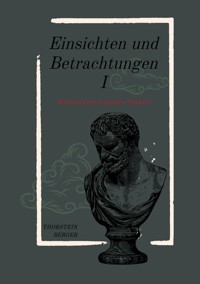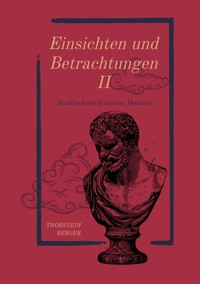
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Einsichten und Betrachtungen
- Sprache: Deutsch
Betrachtungen von der Welt und dem Menschen in ihr anzustellen, um dadurch Einsichten über den Zustand des Menschen in der Welt zu gewinnen - dies ist gerade die Aufgabe, die sich das vorliegende Buch stellt. Dabei behandelt es eine Vielzahl von philosophischen und nichtphilosophischen Themen, die aber stets aus dem Einheitspunkt des kritischen Denkens heraus betrachtet werden, wodurch ein in sich geschlossenes Gesamtbild entsteht. Das Buch ist zudem in der leicht fasslichen Kurzform des Aphorismus und der Sentenz abgefasst, um dem Leser sowohl eine wertvolle Orientierung für die Fragen des täglichen Lebens wie auch eine fortwährende Anregung zum eigenständigen Nachdenken an die Hand zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Thorstein Berger
Einsichten und Betrachtungen II
Ein Kompendium des kritischen Denkens in Aphorismen
© 2021 Thorstein Berger
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-34879-0
Hardcover:
978-3-347-34880-6
e-Book:
978-3-347-34881-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Erstes Buch
Geschwätz, selbst wenn in gelehrter Diktion vorgetragen, bleibt dessen ungeachtet doch immer noch Geschwätz.
Die Ellipse (…) beschließt im Folgenden ein bloß akademisches Argument, aus dessen Gedankengang die offensichtliche Schlussfolgerung zu ziehen somit dem Leser überlassen bleibt.
Das Zurechnungsurteil von einem Gegenstand rechnet einem Merkmal des Gegenstandes seine Ursache zu. Das essentiale Zurechnungsurteil findet dabei dieselbe Ursache im begrifflich zu erkennenden Wesen des Gegenstandes, das kausale in einem empirisch zu bestimmenden Zustand desselben.
Nur weil das essentiale Zurechnungsurteil falsch ist, kann man deshalb nicht jegliches Zurechnungsurteil verwerfen, mithin also essentiales wie kausales zugleich, und damit alle Gegenstände kurzerhand für kausal gleichartig erklären.
Nur weil das essentiale Zurechnungsurteil falsch ist, kann man deshalb nicht jegliches Zurechnungsurteil untersagen, mithin also essentiales wie kausales zugleich, würde man damit tatsächlich doch bloß alle Gegenstände für wesensgleich erklären.
Geht man von dem Denkfehler aus, dass jedes Zurechnungsurteil ein essentiales sein müsse, weil der Begriff des Urteils auf das Wesen seines Gegenstandes gehen würde, um dann wiederum dem nächsten Denkfehler, als der Forderung nach universaler Gleichheit aller Gegenstände, Rechnung tragen zu wollen, so kann man in den Widerspruch zu geraten nicht vermeiden, die Verschiedenheit der Gegenstände in ihren Merkmalen wiederum demselben unterschiedslosen Wesen der Gegenstände kausal zuzurechnen.
Man sieht jedes Zurechnungsurteil für ein essentiales an, in dem also der Begriff des Urteils auf das Wesen des Gegenstandes desselben gehen würde, um dann den moralischen Schwierigkeiten, die sich aus derselben Annahme ergeben müssen, dadurch entgehen zu wollen, dass man zwar vorgeblich alles Zurechnungsurteil als unmoralisch verwirft, in Wahrheit aber doch dasjenige essentiale Zurechnungsurteil, das auf ein universales Wesen der Gegenstände geht, beibehält, damit aber auf den Widerspruch gerät, die Verschiedenheit der Gegenstände in ihren Merkmalen dem unterschiedslosen Wesen derselben Gegenstände kausal zurechnen zu müssen.
Unterscheiden sich die Gegenstände allein in ihren Merkmalen, nicht aber in ihrem Wesen, so kann das Zurechnungsurteil von den verschiedenen Merkmalen eben nicht auf das gleiche Wesen gehen, mithin also kein essentiales sein.
Nur weil das essentiale Zurechnungsurteil falsch ist, kann man deshalb nicht jegliches Zurechnungsurteil untersagen, mithin also essentiales wie kausales zugleich, wird hierin doch tatsächlich ein durchgängig gleiches Wesen der Gegenstände als die Ursache der verschiedensten Merkmale derselben unterstellt.
Nur weil das objektive Werturteil falsch ist, kann man deshalb nicht jegliches Werturteil verwerfen, mithin also objektives wie subjektives zugleich, und damit alle Gegenstände kurzerhand für gleichwertig erklären.
Nur weil das objektive Werturteil falsch ist, kann man deshalb nicht jegliches Werturteil untersagen, mithin also objektives wie subjektives zugleich, werden hierdurch doch bloß alle Gegenstände für gleichwertig erklärt, was den ganzen Wertbegriff überflüssig, wie auch alle Technik, als wertende Erörterung von Mittel und Zweck in ihrem Zusammenhang, unmöglich machen würde.
Allein das Auftreten einer ideologischen Lehre wiederum durch einen neuerlichen Ideologismus erklären zu wollen, bedeutet aber bloß, eine Ausprägung des Ideologismus gegen eine andere anzuführen.
Das Scheitern einer Ideologie wiederum durch einen neuerlichen Ideologismus erklären zu wollen, kann doch nur auf eine Meta-Ideologie führen, und damit vom Regen in die Traufe.
Für eine falsche Auffassung ist nicht der Beweggrund, aus dem sie dennoch geglaubt wird, sondern der Beweisgrund, aus dem sie eben als falsch nachzuweisen ist, das Entscheidende, zumal, wenn der Beweggrund bloß in einem Ideologismus, und damit wiederum in einer falschen Auffassung gefunden sein soll.
Für ein falsche Auffassung ist nicht der Beweggrund, aus dem sie dennoch geglaubt wird, sondern der Beweisgrund, aus dem sie eben als falsch nachzuweisen ist, das Entscheidende, zumal wenn der Beweggrund bloß in einem Psychologismus gefunden sein soll, dem wiederum die falsche Auffassung vom Ideologismus zugrunde liegt.
Mögen zwei Werturteile inhaltlich auch identisch ausfallen, so muss der ihnen zugrunde liegende logische wie psychologische Prozess formal doch mitnichten derselbe sein, noch weniger, wenn das eine objektive, das andere bloß subjektive Gültigkeit behauptet.
Falsch an einem Werturteil kann nur die objektive Gültigkeit sein, die man für dasselbe behauptet, sodass in einem solchen Fall das vermeintlich richtige Werturteil nicht in dem ihm inhaltlich genau entgegengesetzten Werturteil gefunden ist, noch weniger, wenn dasselbe wiederum objektive Gültigkeit behauptet.
Ist das essentiale Zurechnungsurteil von einem Gegenstand auch falsch, so kann man damit aber nicht, bloß weil jenes in seinen weiteren Folgen moralisch verwerflich wäre, auch das kausale Zurechnungsurteil von demselben Gegenstand verbieten.
Ist die Behauptung der objektiven Gültigkeit eines Werturteils vom Gegenstand auch falsch, so kann man damit aber nicht, nur weil dieselbe in ihren Folgen moralisch verwerflich wäre, auch das subjektive Werturteil von demselben Gegenstand verbieten, mag dasselbe inhaltlich auch identisch ausfallen.
Ist das essentiale Zurechnungsurteil von einem Gegenstand auch falsch, so kann man damit aber nicht, bloß weil dasselbe in seinen Folgen moralisch verwerflich wäre, auch das kausale Zurechnungsurteil von demselben Gegenstand verbieten, noch weniger, wenn der Gegenstand des kausalen Zurechnungsurteils gerade derjenige Denkfehler ist, welcher der Auffassung vom essentialen Zurechnungsurteil zugrunde liegt.
Das unberechtigte Zurechnungsurteil zieht das ebenso unberechtigte Werturteil derart nach sich, dass jenes, als essentiales Zurechnungsurteil, vermeint, das den Eigenschaften eines Gegenstandes zugrundeliegende Wesen des Gegenstandes ausmachen zu können, worauf dieses, daran anschließend, als objektives Werturteil, vermeint, für das Wesen des Gegenstandes, als ein allgemeines und notwendiges, Geltung beanspruchen zu können. Und dieser Verkettung von Fehlurteilen entzieht man sich nicht dadurch, dass man jegliches Zurechnungsurteil verwirft, und als Werturteil allein das gesinnungsethisch genehme beibehält.
Es gibt doch ewig kein absolutes, mithin positives Recht, welches aller Staatlichkeit vorhergehen und dieselbe hierdurch erst rechtfertigen würde. Was es allerdings gibt, ist das Unrechttun des einen Menschen wider den anderen im Naturzustand, als welches eben den Anlass zur Schaffung von Rechtsvorschriften, dasselbe unter Strafe zu stellen, gibt, und somit bereits zur Schaffung von Staatlichkeit.
Es gibt doch ewig kein absolutes, mithin positives Recht, welches aller Staatlichkeit vorhergeht und dieselbe in der Folge erst rechtfertigt. Was es allerdings gibt, ist das Unrechttun der Menschen widereinander im Naturzustand, als welches den Anlass zur Schaffung von Rechtsvorschriften, dasselbe unter Strafe zu stellen, gibt, und somit bereits zur Schaffung von Staatlichkeit.
Es gibt kein vor allem Staate bestehendes, positives Recht, denselben in der Folge erst zu rechtfertigen, sondern allein darin, dem Unrechttun im vorstaatlichen Naturzustand abzuhelfen, indem ihm im Staate ein Recht entgegentritt, dasselbe unter Strafe zu stellen, kann er seine Rechtfertigung finden.
Es gibt eben kein Naturrecht, das, aller Staatlichkeit vorausgehend, dieselbe erst begründen würde, sondern im Aufstellen der ersten Rechtsvorschrift, ein Unrechttun unter Strafe zu stellen, wird die Staatlichkeit gerade erstmalig geschaffen.
Ein Übermaß an Geisteskraft muss nicht auch notwendig mit einem Übermaß an Urteilskraft einhergehen, ist ein solches derselben doch allzu oft sogar abträglich.
Nicht selber denken zu können, ist bloß bedenklich, es zwar zu vermögen, nicht aber zu wollen, allerdings vollends verwerflich.
Das Tun des Bösen wiederum aus dem erlittenen Bösen erklären zu wollen, heißt allerdings, es gar nicht zu erklären, tritt dieses doch stets als Widerpart zu jenem auf.
Das Tun des Bösen wiederum aus dem Erleiden des Bösen erklären zu wollen, heißt allerdings, es gar nicht zu erklären, tritt dieses doch stets als unmittelbares Gegenstück zu jenem auf.
In jedem Akt des Bösen treten Tun und Erleiden eben vereint auf, als zwei Seiten derselben Münze, sodass eine Erklärung für das Tun des Bösen eben nicht im erlittenen Bösen liegen kann, ohne es dadurch selbst bereits vorauszusetzen, allerdings in einer anderen Person.
Der Analogieschluss besagt Gleichheit der Verhältnisse zwischen den Gegenständen, nicht aber Gleichheit unter den Gegenständen, die in analogem Verhältnis stehen.
Der Analogieschluss besagt Gleichheit der Verhältnisse zwischen den Gegenständen, nicht aber Gleichheit derjenigen Gegenstände, die in den Verhältnissen einander entsprechen. Wenn sich also a zu b verhält, wie c zu d, so sagt diese Analogie weder Gleichheit von a und c, noch solche von b und d aus.
Der Analogieschluss besagt Gleichheit der Verhältnisse, nicht aber Gleichheit der in den Verhältnissen einander korrespondieren Gegenstände. Verhält sich also a zu b wie c zu d, so ist hierin eben weder die Gleichheit von a und c, noch die von b und d ausgesprochen.
Im Analogieschluss werden allein Verhältnisse zwischen Gegenständen gleichgesetzt, nicht aber die in den Verhältnissen einander entsprechenden Gegenstände selbst.
Alle symbolische Bedeutung wird einem Gegenstand immer bloß willkürlich beigelegt, nicht aber als in seinem Wesen liegend erkannt.
Alle symbolische Bedeutung wird einem Gegenstand immer bloß willkürlich beigelegt, nicht aber als eine ihm wesentliche oder aus einer ihm wesentlichen Eigenschaft erkannt.
Wollte man die Möglichkeit des Materialismus auch einräumen, dass also unter Absehung von allem wahrnehmendem Individuum die materiale, ausgedehnte Welt genauso fortbestehen würde, so kann diesem zum Trotz ein anthropologischer Materialismus, der also seine Materie aus bloß hypostasierten Begriffen von Gegenständen der Kultursphäre bestehen lässt, doch nimmer statthaben, denn was derselbe als das für sich bestehende, mithin materiale annimmt, muss eben zusammen mit allem wahrnehmendem Individuum, und damit dem Menschen, fortfallen.
Wollte man die Möglichkeit des Materialismus auch einräumen, als einer nach Abrechnung von allem wahrnehmendem Individuum für sich bestehenden, materialen Außenwelt, so kann dessen ungeachtet ein anthropologischer Materialismus, der also seine Materie in bloß hypostasierten Begriffen von Gegenständen der Kultursphäre findet, doch nimmer bestehen, denn was dieser als das für sich bestehende, mithin materiale annimmt, muss eben bereits mit allem wahrnehmendem Individuum, und damit dem Menschen, zugleich fortfallen.
Lehrt der Materialismus das Dasein einer für sich bestehenden, materialen Welt, die auch nach Abrechnung aller erkennenden Wesen fortbestünde, so ist hierdurch bereits jedweder anthropologische Materialismus, der also seine Materie in bloß hypostasierten Begriffen der Kultursphäre finden will, ausgeschlossen, da dasjenige, was nach ihm die Materie sein soll, gerade mit allem erkennenden Wesen wegfällt.
Lehrt der Materialismus das Dasein einer für sich bestehenden, materialen Welt, die auch unter Absehung von allem erkennenden Wesen fortbestünde, so ist hierdurch bereits jedweder anthropologische Materialismus, der also seine Materie in bloß hypostasierten Begriffen der Kultursphäre finden will, ausgeschlossen, da dasjenige, was nach ihm die Materie sein soll, gerade mit allem erkennenden Wesen wegfällt.
So wie der Materialismus in der Materie den Grundbaustein der natürlichen Welt gefunden haben möchte, so der anthropologische Materialismus in den materialen Besitzverhältnissen, da sich dieselben mit der Materie doch immerhin den Bezeichner teilen, den Grundbaustein für die kultürliche Welt, kommt hierbei aber doch über einen unstatthaften Wechsel der Gattung durch den gleichlautenden Begriff der Materie nicht hinaus.
Was nur alle Rechtschaffenheit ewig erbittert, ist die dreist auftretende und dabei noch erfolgreiche Lüge, welche zudem noch im allgemeinen Rang und Ansehen einer unumstößlichen Wahrheit steht.
Was nur alle Rechtschaffenheit ewig erbittert, ist die dreist auftretende und dabei noch erfolgreiche Lüge, welche sich dadurch zudem noch im allgemeinen Ansehen einer unumstößlichen Wahrheit hält.
Das grenzenlose Fortschreiten der empirischen Naturerkenntnis vermag aber doch nichts gegen ihre Beschränktheit auf die bloße Erscheinungswelt auszurichten, und damit aller Fortschrittsgläubigkeit zum Trotz also am Wesen der Welt auch nicht das Geringste zu ändern.
Das grenzenlose Fortschreiten der empirischen Naturerkenntnis vermag aber doch nichts dagegen auszurichten, dass sie ewig auf bloße Erscheinungen beschränkt bleiben muss, und damit für eine Erkenntnis vom Wesen der Welt nicht das Geringste zu leisten im Stande ist.
Die empirische Freiheit ist weder notwendig für diejenige des Willens, noch gleichbedeutend mit derselben. Denn die Freiheit des Willens, nebst der mit ihr einhergehenden Verantwortung, bedarf nicht nur keiner empirischen Freiheit, im Sinne von Kausalitätslosigkeit, als absolutem Zufall, sondern ist vielmehr mit einer solchen vollkommen unvereinbar.
Die bloßen Meinungen und falschen Auffassungen von einem Gegenstande machen doch allemal keine Eigenschaften desselben aus, die man nun, um sein Wesen zu ergründen, allein zu durchmustern und in ihrer Gesamtheit zu erfassen hätte.
Die bloßen Meinungen und falschen Auffassungen von einem Gegenstande machen doch allemal keine Eigenschaften an demselben aus, die man nun, zur Ergründung seines Wesens, nur immer zu durchmustern und in ihrer Gesamtheit zu erfassen hätte.
Wenn alles vom Rand aus einem gemeinsamen Mittelpunkt zustrebt, in welchem es also unweigerlich zusammenstoßen muss, so trägt hieran wohl letztlich dasjenige die Schuld, welches an diesem Streben keinen Anteil genommen, sondern sich wohlweislich abseits gehalten hat…
Sind zwei Lehren zwar miteinander unvereinbar, beruhen aber dennoch auf demselben Irrtum, so muss die objektive Widerlegung der einen unweigerlich auch die andere stürzen. Und somit kann alle Dialektik in ihrem Bestreben, nur die eine Lehre zu stürzen, die andere aber zu stützen, nur auf den subjektiven Anschein von Wahrheit abstellen, indem sie also bloß Einräumungen des Gegners zum Gegenstand wider denselben zu kehren sich bemüht oder schlussendlich in ihren Einwendungen rein gegen die Person des Gegners zu richten sich befleißigt. Andersherum ist jede Disputation, in der rein subjektiv verfahren wird und die objektive Wahrheit ganz beiseitegesetzt ist, das sicherste Zeichen dafür, dass die beiden Lehren, die sich in ihr befehden, eben auf einem gemeinsamen Irrtum beruhen, wovon hierdurch also nur immer abgelenkt werden soll.
Sind zwei Lehren zwar miteinander unvereinbar, beruhen aber dennoch auf demselben Irrtum, so muss die objektive Widerlegung der einen Lehre unweigerlich auch die andere stürzen. Und somit kann alle Dialektik in ihrem Bestreben, nur die eine Lehre umzuwerfen, die andere aber zu erhalten, lediglich auf den subjektiven Anschein von Wahrheit abzielen, indem sie also bloße Einräumungen des Gegners zum Gegenstand wieder denselben kehrt oder sich schlussendlich in ihren Einwendungen rein gegen die Person des Gegners richtet. Andersherum ist jede argumentative Auseinandersetzung, in der rein subjektiv verfahren wird und die objektive Wahrheit ganz beiseitegesetzt ist, bereits das sicherste Zeichen dafür, dass die beiden Lehren, die sich in ihr befehden, auf einem gemeinsamen Irrtum beruhen, wovon nur immer abzulenken also das unausgesprochene Ziel derselben ist.
Jeder absichtsvoll betriebene Eigennutz kann nur darin seine ethische Rechtfertigung finden, dass er es in der Folge nicht vermeiden kann, unbeabsichtigt auch anderen zum Vorteil zu gereichen. Und hierin liegt letztlich auch die einzig mögliche Apologie allen wirtschaftlichen Eigennutzes, wenn derselbe also nicht als bloßer Selbstzweck, sondern vorrangig als Mittel zum Wohle anderer aufgefasst wird.
Wer nur immer die Würde des heiligen Affen, dem ob seiner Heiligkeit alles erlaubt wäre, für sich beansprucht, will hierdurch aber doch vor allem auch nur eines sein, nämlich Affe.
Wer nur immer die Würde des heiligen Affen, der sich ob seiner Heiligkeit alles erlaubt halten kann, für sich in Anspruch nimmt, wird hierdurch allerdings auch niemals etwas anderes sein, denn eben Affe.
Dass diese Welt eine des ebenso trügerischen wie falschen Scheins ist, werden wir gerade an demjenigen gewahr, was in derselben nur immer herrschen will, weshalb man demselben auch nicht fluchen, sondern vielmehr dankbar sein soll, und zwar für den Aufschluss, den von der traurigen Beschaffenheit dieser Welt zu gewähren es derart nicht vermeiden kann.
Dass diese Welt eine des ebenso trügerischen wie falschen Scheins ist, werden wir gerade an demjenigen und durch dasjenige gewahr, was über dieselbe nur immer zur Herrschaft strebt, weshalb man demselben auch nicht fluchen, sondern vielmehr dankbar sein soll, und zwar für den Aufschluss, den von der traurigen Beschaffenheit dieser Welt zu gewähren es derart also nicht entraten kann.
Demjenigen zu fluchen, welches in dieser Welt nur immer zur Herrschaft strebt, ändert doch nichts an der unabwendbaren Notwendigkeit des Strebens selbst. Würde es hierum anders stehen, so auch um die Welt, allein, dem ist nicht so.
Das Sein in der Kopula ist selbst keine Eigenschaft, sondern gerade das Setzen einer Eigenschaft.
Der ewigen Inkongruenz zwischen Begriff und Anschauung lässt sich eben mitnichten durch Mittel der Logik abhelfen.
Der ewigen Inkongruenz zwischen Begriff und Anschauung lässt sich eben mitnichten durch Mittel der Logik abhelfen, lässt sich doch auf Seiten des Prädikats auch durch noch so viele diskrete Zwischenbegriffe mitnichten die Stetigkeit des Prädikats erreichen, während auf Seiten der Kopula die Einführung eines graduellen Seins aus diesem graduellen Sein wiederum eine Eigenschaft des Subjekts machen würde, was aber ewig unstatthaft ist.
Wird in der Logik auch die Zahl der Prädikate durch Zwischenbegriffe noch so sehr vermehrt, so vermag jedes Prädikat einem Subjekt doch trotzdem nur entweder beigelegt oder abgesprochen zu werden, und alles bloß graduelle Beilegen eines Prädikats würde aus dem graduellem Sein wiederum eine Eigenschaft des Subjekts machen, was aber niemals statthaben kann. Und somit ist also in beidem kein Mittel gefunden, der Inkongruenz zwischen Begriff und Anschauung, als der mangelnden Übereinstimmung zwischen beiden, nur irgend abzuhelfen.
Die Anzahl der in einer Logik für ein Subjekt zu setzenden Prädikate ist für dieselbe doch nicht das Entscheidende, kann ein jedes dieser Prädikate doch einem Subjekt immer nur entweder beigelegt oder abgesprochen werden, und jeder Versuch eines dem Grad nach abgestuften Beilegens desselben macht aus diesem graduellen Beilegen einer Eigenschaft selbst wiederum eine Eigenschaft des Subjekts, was aber niemals statthaben kann.
Es ist auch durch noch so viele Prädikat, als diskrete Zwischenbegriffe, keine Stetigkeit des Prädikats zu erreichen, als durch welche der mangelnden Kongruenz zwischen Begriff und Anschauung abzuhelfen wäre. Denn zum einen lässt sich auch von den vielen Prädikaten ein jedes dem Subjekt bloß entweder beilegen oder absprechen, zum anderen würde ein graduelles Beilegen des Prädikats dasselbe bereits zu einer Eigenschaft des Subjekts machen, was aber niemals statthaft sein kann.
Durch das bloße Aufweichen des Seins in der Logik, als der Kopula zwischen Subjekt und Prädikat, in ein solches von vermeintlich kontinuierlichen Abstufungen, lässt sich doch ewig nicht das Problem der mangelnden Kongruenz zwischen Begriff und Anschauung lösen.
Durch das bloße Auflösen der logischen Trennschärfe zwischen Begriffen lässt sich eben mitnichten das Problem der ewigen Inkongruenz zwischen Begriff und Anschauung lösen.
Alles Sein im Begriff kann aber doch immer nur das Setzten einer Eigenschaft für ein Subjekt bedeuten, nicht aber selbst eine Eigenschaft am Subjekt ausmachen, und somit kann das Sein im Begriff eben kein graduelles Sein einer Eigenschaft bedeuten, müsste alles graduelle Sein hierdurch doch bereits zu einer Eigenschaft des Subjekts werden.
Jeder Begriff lässt sich entweder in Hinsicht auf die ihm zugrundeliegenden anschaulichen Bestandteile oder die ihm zukommenden logischen Bestimmungen betrachten. Besteht aber nun das Problem für die menschliche Erkenntnis gerade im Verhältnis des Begriffes zur Anschauung, so lässt sich dasselbe eben nicht als ein logisches auffassen, und demnach auch nicht durch Mittel der Logik lösen.
Die Inkongruenz zwischen Begriff und Anschauung, dass also der ewig diskrete Begriff der stets kontinuierlichen Anschauung doch niemals zur Gänze zu entsprechen versteht, lässt sich eben nicht durch logische Mittel aus der Welt schaffen, da es sich gerade um kein logisches Problem handelt.
Die Inkongruenz zwischen Begriff und Anschauung, dass also der ewig diskrete Begriff der stets kontinuierlichen Anschauung doch niemals ganz zu entsprechen vermag, lässt sich eben nicht durch logische Winkelzüge aus der Welt schaffen.
Der Inkongruenz zwischen Begriff und Anschauung, dass also der ewig diskrete Begriff der stets kontinuierlichen Anschauung doch niemals ganz zu entsprechen versteht, kann eben nicht durch bloße Mittel der Logik abgeholfen werden, hat dieselbe an diesem Umstand doch überhaupt gar keinen Anteil.
Es vermag insbesondere die Einführung von noch so vielen Zwischenbegriffen in logischer Hinsicht nicht das Problem zu lösen, das sich beim Übergang von allemal stetigen Anschauungen zu immer nur gesonderten Begriffen ergibt, und damit auch keine Stetigkeit in der Begriffswelt herbeizuführen.
Es vermag insbesondere auch die Einführung von noch so vielen Zwischenbegriffen in logischer Weise nicht das Problem zu lösen, dass allemal kontinuierliche Anschauungen doch immer nur in diskrete Begriffe überführt werden können.
Die mangelnde Kongruenz zwischen allemal stetiger Anschauung und immer bloß gesondertem Begriff lässt sich weder einer bestimmten Sprache noch der Logik selbst anlasten, und derselben somit auch weder durch Einführung noch so vieler Zwischenbezeichner in eine Sprache noch der eines bloß graduellen Seins in die Logik abhelfen.
Die mangelnde Kongruenz zwischen allemal stetiger Anschauung und immer bloß gesondertem Begriff lässt sich weder einer bestimmten Sprache noch der Logik selbst anlasten, und derselben somit auch weder durch Einführung noch so vieler Zwischenbegriffe noch der einer bloß graduellen Kopula abhelfen.
In der mangelnden Kongruenz zwischen Begriff und Anschauung ist der Grund dafür gefunden, dass die Erfahrungswelt nicht in ein genaues begriffliches Abbild ihrer selbst abgesetzt werden, und dasselbe somit auch nicht Aufgabe der Erfahrungswissenschaft sein kann.
Nur die eigene Person für frei und selbstbestimmt, alle anderen aber bloß für willenlose, von außen bewegte Gliederpuppen anzusehen, zeugt doch nur von der durchgängigen Blindheit des Menschen in Betracht auf die Fäden, durch die er selbst erst in Bewegung gesetzt und derart über den Schauplatz gezogen wird.
Der empirischen Realität vermag doch ewig nichts Absolutes innezuwohnen, über das hinaus also kein mehreres gegeben sein kann, muss doch alles in der Erfahrungswelt Vorhandene noch einmal als gegeben vorgestellt werden können, diesmal allerdings als demselben entgegengesetzt, es damit also gerade aufhebend.
In der empirischen Welt kann doch ewig nicht Absolutes gefunden werden, über welches hinaus also nichts weiteres gegeben sein kann, muss doch alles in der Erfahrungswelt Vorhandene noch einmal als gegeben vorgestellt werden können, diesmal allerdings als demselben entgegengesetzt, es damit also gerade aufhebend.
Wäre ein Absolutes in der Erfahrungswelt möglich, so ließe es sich noch einmal als gegeben denken, nun aber als demselben entgegengesetzt, es somit also aufhebend, sodass der kleinste, darauf folgende Zuwachs in die eine oder andere Richtung nun bereits ein Hinausgehen über das vermeintlich Absolute bedeuten würde.
Das Absolute in der Erfahrungswelt müsste entweder als absolute Größe oder als absoluter Grad vorliegen. Nun ist aber alle Größe durch die Erkenntnisformen von Raum und Zeit gegeben, alle solche Größe also immer nur im Verhältnis zu einer anderen solchen zu bestimmen, und damit weder absolut noch überhaupt empirisch. Und ebenso ist aller Grad durch die Erkenntnisform der Kausalität miteinander verknüpft, aller absolute Grad wiederum nur an einem Gegenstand an sich wahrnehmbar, und damit niemals zugleich absolut und empirisch.
Die Natur kennt keinen Widerspruch, sondern bloß Widerstreit.
Die Natur kennt keinen Widerspruch, als zwischen den vermeintlich das Wesen der Natur ausmachenden Begriffen, sondern bloß Widerstreit, als unter den in der Natur sich äußernden Kräften.
Dass Unverstand und Widersinn zu akademischen Würden gelangen, gibt doch nur aus der sicheren Distanz der Geschichte ein belustigendes Schauspiel ab, mitnichten aber für die Mitwelt, die dasselbe vielmehr als ein Trauerspiel zu erdulden hat.
Dass Unverstand und Widersinn zu akademischen Würden gelangen, hebt jene eben nicht zu der Höhe von diesen herauf, sondern stößt diese vielmehr zu jenen in die Tiefe hinab.
Im Triumph des eigenen Intellekts über fremden Intellekt gibt sich dasjenige, was da triumphiert, aber doch immer bloß als der subjektive Intellekt zu erkennen, wodurch eben nicht nur die Vorherrschaft desselben über den fremden Intellekt, sondern vielmehr auch über den eigenen objektiven Intellekt ausgemacht ist.
Der sich überlegen dünkende Intellekt ist eben immer bloß der subjektive Intellekt.
Der sich als überlegen wähnende Intellekt ist doch immer nur der subjektive Intellekt.
Stimmen verschiedene Begriffe in all ihren logischen Bestimmungen überein, so auch ihre Begriffssphären, als die Menge aller in ihnen gedachten Gegenstände, nicht aber stimmen verschiedene Gegenstände, die bloß in demselben Begriff gedacht sind, auch schon notwendig in all ihren empirischen Bestimmungen überein, wären somit also ununterscheidbar und mithin als identisch, d.i. als einerlei Gegenstand anzusehen.
Logische Identität impliziert nicht bereits auch empirische Identität, denn zum einen kommt alle logische Bestimmung unmittelbar nicht dem Gegenstande, sondern allein dem Begriff zu, zum anderen ist immer eine zusätzliche logische Bestimmung denkbar, sodass zwar der eine Gegenstand in der Sphäre des durch dieselbe spezifizierten Begriffes weiterhin enthalten wäre, der andere aber gerade nicht mehr.
Sind zwei Begriffe logisch identisch, so sind auch ihre Begriffssphären gleich. Nicht aber sind zwei Gegenstände, wenn ihre Begriffe bloß logisch identisch sind, auch in allen empirischen Bestimmungen gleich, und somit als identisch, mithin also einerlei Gegenstand ausgemacht.
Den schwer definierbaren Begriff logisch auf den undefinierbaren zurückzuführen, ist eben nur ein Scheinerfolg des Logizismus.
Einem Begriff sind immer zwei Mengen unmittelbar koordiniert, zum einen die Menge seiner logischen Bestimmungen, zum anderen die Menge der in ihm gedachten Gegenstände.
Die Begriffe von Definition und Begriff sind selbst eben nicht ohne eine Petitio Principii zu definieren. Die Begriffe von Definition und Begriff sind eben nicht ohne einen Rückgriff auf sich selbst zu definieren. Die Begriffe von Definition und Begriff sind eben nicht ohne Voraussetzung ihrer selbst zu definieren.
Der Begriff der Menge ist genauso wenig definierbar wie der Begriff des Begriffes selbst.
Jeder Begriff lässt sich nach zwei Richtungen hin betrachten, zum einen in Richtung der Logik, als in welcher er durch die Menge der Bestimmungen, durch die er gedacht wird, und zum anderen in Richtung der Anschauung, als in welcher er durch die Menge der Gegenstände, welche in ihm gedacht sind, ausgemacht wird.
Die Frage nach dem, was einem Begriff nur immer zukommen mag, lässt sich sowohl in formaler, und damit logischer, als auch in inhaltlicher, und damit anschaulicher Weise auffassen. Das erstere führt auf eine Erklärung des Begriffes durch dessen logische Bestimmungen, das letztere zu einer Klärung der Zugehörigkeit eines Gegenstandes zur Sphäre eines Begriffs durch dessen empirische Bestimmungen.
Die negativen Zahlen als Begriffe finden ihre einzige gegenständliche Entsprechung in und an der Zeit. Der gegenwärtige Zeitpunkt wird in a Zeiteinheiten gerade vor a Zeiteinheiten gewesen sein, d.h. a+(−a)=0.
Die Logik kennt zwar die Negation, aber doch nur als Abwesenheit des positiv Gegebenen, nicht aber als proportionale Aufhebung des zwar gleich großen, aber einander Entgegengesetzten, und somit kann aus der Logik der negative Zahlbegriff nicht abgezogen sein.