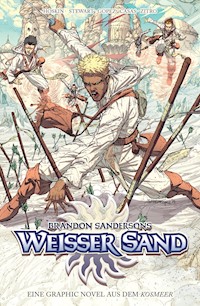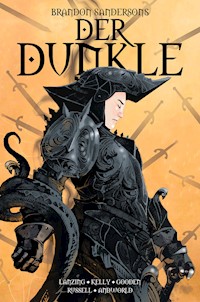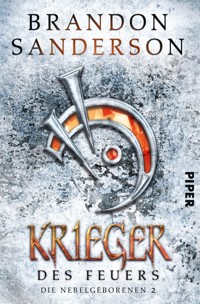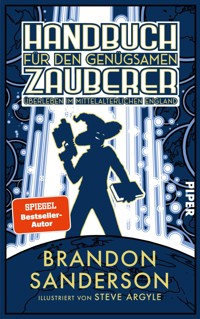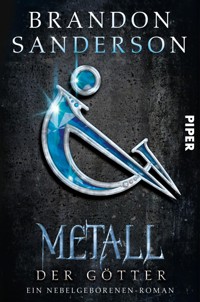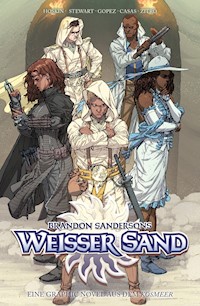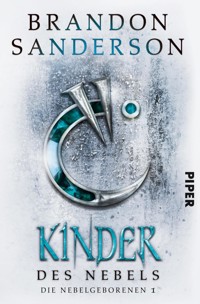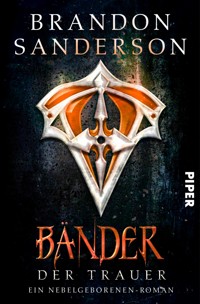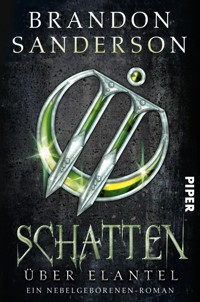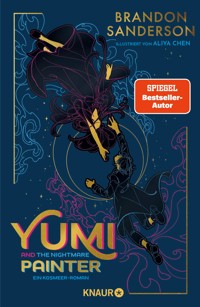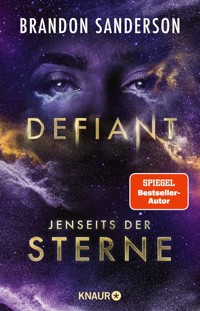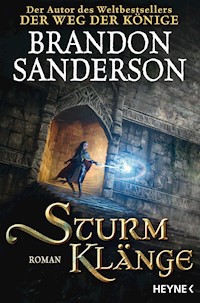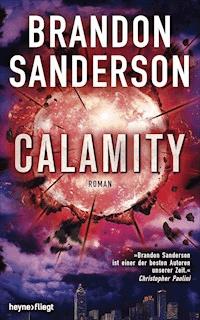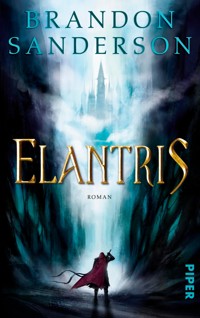
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mit seinem gefeierten Debüt »Elantris« setzt US-Superstar Brandon Sanderson noch heute Maßstäbe für groß angelegte, epische Fantasy. Nun liegt der Roman endlich in neuer Ausstattung vor: Einst war Elantris, die magische Stadt im Lande Arelon, ein Paradies, in dem die Götter wandelten. Aber dann wurde es von einem schrecklichen Fluch getroffen und die vormals blühende Stadt verwandelte sich in eine tödliche Falle für ihre Bewohner. Kronprinz Raoden, der in der gefallenen Stadt gefangen ist, muss gemeinsam mit der Königstochter Sarene das Geheimnis von Elantris ergründen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Elantris« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Der Roman »Elantris« wurde übersetzt von Ute Brammertz.
Die Erzählung »Hoffnung für Elantris« wurde übersetzt von Karen Gerwig.
ISBN 978-3-492-97884-2
© Dragonsteel, LLC 2005
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Elantris«, Tor Books, New York City 2005
Deutschsprachige Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Erstmals erschienen im Wilhelm Heyne Verlag, München 2007
Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Ute Brammertz liegen beim Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
© »The Hope of Elantris«, Dragonsteel, LLC 2000
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Karte
Prolog
Erster Teil – Elantris’ Schatten
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Zweiter Teil – Elantris’ Rufen
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Dritter Teil – Elantris’ Lebensgeist
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Epilog
Glossar
Danksagung
Hoffnung für Elantris – von Brandon Sanderson
Meiner Mutter gewidmet,
die einen Arzt haben wollte,
einen Schriftsteller bekommen hat,
ihn aber so sehr liebt,
dass sie sich nicht darüber beklagt
(oder jedenfalls nicht allzu sehr).
Prolog
Elantris war wunderschön. Früher einmal. Man nannte es die Stadt der Götter: ein Ort voll Macht, strahlendem Glanz und Magie. Besucher wissen zu berichten, dass selbst die Steine in einem inneren Licht erstrahlten und die Stadt eigentümliche rätselhafte Wunder beherbergte. Nachts leuchtete Elantris wie ein gewaltiges silbernes Feuer, das man sogar noch von weit her sehen konnte.
Doch so herrlich Elantris auch sein mochte, seine Bewohner übertrafen es noch: Mit ihrem glänzend weißen Haar und der beinahe metallisch silbernen Haut schienen die Elantrier genauso zu leuchten wie die Stadt selbst. In den Legenden heißt es, sie seien unsterblich gewesen, oder zumindest beinahe. Ihr Körper heilte schnell, und sie verfügten über ein großes Maß an Stärke, Klugheit und Schnelligkeit. Mit einem bloßen Wink konnten sie Zauber wirken. Die Menschen kamen aus ganz Opelon angereist, um von den Elantriern geheilt zu werden oder elantrische Speisen oder weisen Rat zu erhalten. Die Elantrier waren göttliche Wesen.
Und jeder Mensch konnte zu einem Elantrier werden.
Man nannte es die Shaod. Die Verwandlung. Sie ereilte die Menschen willkürlich – gewöhnlich des Nachts, während der geheimnisvollen Stunden, in denen das Leben langsam zur Ruhe kommt. Die Shaod konnte einen Bettler, einen Handwerker, einen Adeligen oder einen Krieger treffen. Wenn sie sich ereignete, endete das Leben des Glücklichen und ein neues begann; er streifte seine alte, profane Existenz ab und zog nach Elantris. Elantris, wo er in Glückseligkeit leben, voll Weisheit herrschen und in Ewigkeit verehrt werden konnte.
Diese Ewigkeit ging vor zehn Jahren zu Ende.
Erster Teil
Elantris’ Schatten
Kapitel 1
An jenem Morgen erwachte Prinz Raoden von Arelon früh, ohne sich auch nur im Geringsten bewusst zu sein, dass er bis in alle Ewigkeit verdammt war. Immer noch schlaftrunken setzte Raoden sich auf und blinzelte in das sanfte Morgenlicht. Durch die geöffneten Balkontüren konnte er in der Ferne die gewaltige Stadt Elantris sehen, deren kahle Mauern einen tiefen Schatten über die kleinere Stadt Kae warfen, in der Raoden lebte. Die Mauern von Elantris waren unglaublich hoch, doch Raoden konnte dennoch die Spitzen der schwarzen Türme erkennen, die sich dahinter erhoben und noch in ihrem Zustand der Zerstörung die niedergegangene Pracht erahnen ließen, die sich hinter den Mauern verbarg.
Die verlassene Stadt wirkte dunkler als sonst. Raoden starrte sie einen Moment lang an, dann wandte er den Blick ab. Es war unmöglich, den riesigen elantrischen Mauern keinerlei Beachtung zu schenken. Trotzdem gaben sich die Einwohner von Kae alle Mühe, eben dies zu tun. Es schmerzte, an die ehemalige Schönheit der Stadt zu denken und sich zu fragen, wie sich der Segen der Shaod vor zehn Jahren in einen Fluch hatte verwandeln können …
Raoden schüttelte den Kopf und kletterte aus dem Bett. Es war ungewöhnlich warm für die frühe Stunde. Ihm war überhaupt nicht kühl, als er sich sein Gewand überwarf und anschließend zum Zeichen, dass er zu frühstücken wünschte, an der Dienstbotenklingel neben dem Bett zog.
Auch das war eigenartig. Er war hungrig – sehr hungrig. Beinahe heißhungrig. Bisher hatte er nie gern ausgiebig gefrühstückt, doch an diesem Morgen wartete er ungeduldig auf sein Essen. Letzten Endes entschloss er sich, jemanden zu schicken, der nachsehen sollte, warum das Ganze so lange dauerte.
»Ien?«, rief er durch die unbeleuchteten Gemächer.
Keine Antwort. Die Abwesenheit des Seons veranlasste Raoden zu einem leichten Stirnrunzeln. Wo mochte Ien stecken?
Raoden entfernte sich vom Bett, wobei sein Blick erneut auf Elantris fiel. Im Schatten der gewaltigen Stadt wirkte Kae wie ein unbedeutendes Dorf. Elantris. Ein ungeheuerlicher Klotz wie aus Ebenholz; keine wirkliche Stadt mehr, sondern nur noch deren Leichnam. Ein leichter Schauder überlief Raoden.
Es klopfte an der Tür.
»Na endlich«, sagte Raoden und durchquerte das Zimmer, um die Tür zu öffnen. Draußen stand die alte Elao mit einem Tablett voll Obst und warmem Brot.
In dem Augenblick, als Raoden die Hände ausstreckte, um ihr das Tablett abzunehmen, entglitt es den Fingern des bestürzten Dienstmädchens und fiel polternd zu Boden. Raoden erstarrte, als das metallene Scheppern des Tabletts in dem morgendlich stillen Gang widerhallte.
»Gütiger Domi!«, flüsterte Elao, Entsetzen in den Augen, während ihre zitternde Hand den Korathianhänger an ihrem Hals suchte.
Raoden streckte die Hand aus, doch die Dienstbotin wich bebend vor ihm zurück, wobei sie in der Eile über eine kleine Melone stolperte.
»Was ist los?«, wollte Raoden wissen. Da sah er seine Hand. Was ihm im Schatten seines dunklen Zimmers verborgen geblieben war, wurde nun im flackernden Schein der Laterne im Gang sichtbar.
Raoden wandte sich um und riss auf dem Weg zu dem großen Spiegel an der Seitenwand seines Gemaches Möbelstücke um. Das morgendliche Dämmerlicht war mittlerweile so stark, dass er das Spiegelbild erkennen konnte, das ihm entgegenstarrte. Das Spiegelbild eines Fremden.
Seine blauen Augen waren immer noch dieselben, auch wenn sie vor Schreck weit aufgerissen waren. Doch sein Haar war nicht länger rötlich braun, sondern hing ihm schlaff und grau vom Kopf. Die Haut war das Schlimmste. Das Gesicht im Spiegel war von widerwärtigen schwarzen Flecken überzogen, die aussahen, als seien es dunkle Blutergüsse. Diese Flecken konnten nur eines bedeuten.
Die Shaod hatte ihn ereilt.
Das Stadttor von Elantris fiel dröhnend hinter ihm zu. Das Geräusch hatte etwas erschreckend Endgültiges. Raoden sackte gegen das Tor, immer noch ganz benommen von den Ereignissen des Tages.
Es war, als gehörten seine Erinnerungen einem anderen. Sein Vater, König Iadon, hatte Raodens Blick gemieden, als er den Priestern befohlen hatte, seinen Sohn vorzubereiten und in die Stadt Elantris zu werfen. Es war schnell und leise geschehen, denn Iadon konnte sich nicht leisten, dass bekannt wurde, der Kronprinz sei ein Elantrier. Vor zehn Jahren hätte die Shaod aus Raoden einen Gott gemacht. Doch anstatt die Menschen in silberhäutige Gottheiten zu verwandeln, machte die Shaod sie nun zu widerwärtigen Ungeheuern.
Ungläubig schüttelte Raoden den Kopf. Die Shaod war etwas, was anderen Leuten zustieß – Leuten, die weit weg waren. Leuten, die es verdient hatten, verflucht zu sein. Nicht dem Kronprinzen von Arelon. Nicht Raoden.
Vor ihm erstreckte sich die Stadt Elantris. Die hohen Mauern wurden von Wachhäusern und Soldaten gesäumt. Allerdings sollten diese Männer nicht dafür sorgen, dass keine Feinde in die Stadt eindrangen, sondern dass die Bewohner nicht nach draußen entkamen. Seit der Reod brachte man jeden Menschen, der von der Shaod ereilt wurde, nach Elantris, wo er verrotten sollte. Die gefallene Stadt war zu einer riesigen Gruft für diejenigen geworden, deren Körper vergessen hatte, wie man starb.
Raoden konnte sich noch entsinnen, wie er einst auf jenen Mauern gestanden und auf die grausigen Einwohner von Elantris hinabgeblickt hatte, so wie nun die Wächter auf ihn herabsahen. Damals hatte die Stadt weit weg gewirkt, obgleich er sich nur knapp außerhalb davon befunden hatte. Damals hatte er nachgegrübelt, wie es wohl sein mochte, durch jene geschwärzten Straßen zu wandern.
Jetzt würde er es herausfinden.
Raoden drückte kurz gegen das Tor, als wolle er seinen Körper hindurchzwängen und sein Fleisch von dem Makel reinigen. Er senkte den Kopf und gab ein leises Stöhnen von sich. Am liebsten hätte er sich auf den schmutzigen Steinen zu einem Knäuel zusammengerollt und darauf gewartet, aus diesem Traum zu erwachen. Doch ihm war klar, dass er niemals erwachen würde. Die Priester sagten, dass dieser Albtraum niemals ein Ende nahm.
Etwas tief in seinem Innern drängte ihn jedoch vorwärts. Er wusste, dass er sich bewegen musste; denn wenn er es nicht täte, so fürchtete er, würde er einfach aufgeben. Die Shaod hatte Besitz von seinem Körper ergriffen. Er konnte nicht zulassen, dass sie ihm auch noch den Verstand raubte.
Also benutzte Raoden seinen Stolz wie einen Schutzschild gegen Verzweiflung, Mutlosigkeit und – ganz besonders – gegen das Selbstmitleid und hob den Kopf, um der Verdammnis die Stirn zu bieten.
Als Raoden früher auf den Mauern von Elantris gestanden und – sowohl wörtlich wie auch im übertragenen Sinne – auf dessen Einwohner hinabgeblickt hatte, hatte er den Dreck gesehen, der die Stadt bedeckte. Jetzt stand er mitten darin.
Jede Oberfläche, von den Mauern der Gebäude bis hin zu den zahlreichen Spalten in den Pflastersteinen, war mit einer schleimigen Schmutzschicht bedeckt. Der rutschige, ölige Belag hatte eine nivellierende Wirkung auf die Farben von Elantris und ließ sie alle zu einem einzigen deprimierenden Farbton verschmelzen – einem Ton, in dem sich pessimistisches Schwarz mit schmutzigen Grüntönen und Abwasserbraun vermischte.
Früher war es Raoden gelungen, ein paar der Stadtbewohner zu erspähen. Jetzt konnte er sie zudem hören. Etwa ein Dutzend Elantrier lagen auf dem stinkenden Kopfsteinpflaster des Platzes verstreut. Ohne sich darum zu kümmern oder ohne es zu merken, saßen manche in tiefen dunklen Pfützen, die noch von den nächtlichen Regenfällen übrig geblieben waren. Und sie stöhnten. Die meisten taten dies auf eine leise Art, indem sie etwas vor sich hin murmelten oder vor Schmerz, der keine sichtbare Ursache zu haben schien, wimmerten. Eine Frau am anderen Ende des Platzes schrie jedoch und gab Laute von sich, die heftige Qualen erahnen ließen. Einen Augenblick später verstummte sie, da ihr entweder die Luft oder die Kraft ausgegangen war.
Die meisten trugen Lumpen – dunkle, locker sitzende Kleidungsstücke, die genauso schmutzig waren wie die Straßen. Als Raoden jedoch genauer hinsah, erkannte er, was es war. Er blickte an seinen eigenen weißen Totengewändern hinab. Die Sachen waren lang und wallend, wie Bänder, die man zu einem losen Gewand zusammengenäht hatte. Der Leinenstoff an seinen Armen und Beinen war bereits voller Dreck, weil er damit das Stadttor und die Steinpfeiler berührt hatte. Raoden beschlich der Verdacht, dass sich seine Kleidung schon bald nicht mehr von der Tracht der anderen Elantrier unterscheiden ließe.
Das hier wird aus mir werden, dachte Raoden. Es hat bereits angefangen. In ein paar Wochen werde ich nur noch eine mutlose Hülle sein, ein Leichnam, der in der Ecke vor sich hin winselt.
Etwas auf der anderen Seite des Platzes bewegte sich und riss Raoden aus seinem Selbstmitleid. Ein paar Elantrier kauerten ihm gegenüber in einem Torbogen, der im Schatten lag. Ihre Umrisse verrieten ihm nicht viel, doch die Leute schienen auf etwas zu warten. Er konnte spüren, wie ihre Blicke auf ihm ruhten.
Um seine Augen vor dem Sonnenlicht abzuschirmen, hob Raoden einen Arm, was ihm erst wieder den kleinen Strohkorb ins Gedächtnis rief, den er in der Hand hielt. Darin befand sich das rituelle Korathiopfer, das man den Toten ins nächste Leben mitgab – oder, in diesem Falle, nach Elantris. In dem Korb waren ein Brotlaib, ein wenig kümmerliches Gemüse, eine Handvoll Getreidekörner und ein kleiner Schlauch Wein. Gaben für tatsächlich Verstorbene waren viel opulenter, doch selbst einem Opfer der Shaod musste man zumindest etwas zugestehen.
Wieder sah Raoden zu den Gestalten in dem Torbogen, und ihm fielen Gerüchte ein, die er draußen aufgeschnappt hatte: Geschichten, in denen es um elantrische Gewalttaten ging. Noch hatten sich die dunklen Gestalten nicht von der Stelle gerührt, aber es machte ihn nervös, wie sie ihn musterten.
Raoden holte tief Luft und trat dann zur Seite. Er bewegte sich die Stadtmauer entlang auf die Ostseite des Platzes zu. Die Gestalten schienen ihn noch immer zu beobachten, doch sie verfolgten ihn nicht. Im nächsten Moment verschwand der Torbogen aus seinem Blickfeld, und nach einer weiteren Sekunde hatte er sicher eine der Seitenstraßen betreten.
Raoden atmete aus. Er hatte das Gefühl, entkommen zu sein, obgleich er nicht wusste, wem oder was. Kurze Zeit später war er sich sicher, dass ihn niemand verfolgte, und er kam sich töricht vor, derart beunruhigt gewesen zu sein. Bisher hatte er noch nichts gesehen, was die Gerüchte über Elantris bestätigt hätte. Kopfschüttelnd ging Raoden weiter.
Der Gestank war schier überwältigend. Der allgegenwärtige schleimige Dreck hatte einen fauligen Modergeruch an sich, wie Schimmelpilz. Der Geruch machte Raoden so sehr zu schaffen, dass er beinahe auf die knorrige Gestalt eines alten Mannes gestiegen wäre, der an einer Häuserwand kauerte. Der Mann ächzte erbärmlich, einen dünnen Arm in die Höhe gestreckt. Als Raoden hinabblickte, überlief ihn auf einmal ein eiskalter Schauder. Der »alte Mann« war höchstens sechzehn Jahre alt! Die mit Ruß bedeckte Haut des Wesens war dunkel und voller Flecken, doch das Gesicht war das eines Kindes, nicht eines Mannes. Unwillkürlich wich Raoden einen Schritt zurück.
Kraft der Verzweiflung streckte der Junge den Arm nach vorn, als sei ihm klar geworden, dass die Gelegenheit gleich vorüber wäre. »Essen?«, murmelte er. In seinem Mund waren nur noch die Hälfte seiner Zähne übrig. »Bitte?«
Dann fiel sein Arm wieder nach unten, völlig verausgabt, und sein Körper sank kraftlos gegen die kalte Steinmauer. Seine Augen beobachteten Raoden allerdings weiterhin. Kummervolle, gequälte Augen. Früher hatte Raoden schon Bettler in den Außenstädten gesehen, und wahrscheinlich war er etliche Male Betrügern auf den Leim gegangen. Dieser Junge spielte ihm jedoch kein Theater vor.
Raoden holte den Brotlaib aus dem Korb mit den Opfergaben und reichte ihn dem Jungen. Das ungläubige Staunen, das über das Gesicht des Jungen huschte, war auf gewisse Weise beunruhigender als die Verzweiflung, die es ablöste. Diese Kreatur hatte bereits vor langer Zeit jegliche Hoffnung aufgegeben. Wahrscheinlich bettelte er mehr aus Gewohnheit, als weil er tatsächlich etwas erwartete.
Raoden ließ den Jungen hinter sich, drehte sich um und folgte weiter dem schmalen Sträßchen. Er hatte gehofft, die Stadt würde jenseits des Platzes am Stadttor nicht mehr so schrecklich aussehen – vielleicht weil er geglaubt hatte, der ganze Schmutz rühre daher, dass der Platz relativ stark besucht war. Er hatte sich getäuscht: Die Straße war genauso dreckig wie der Platz, wenn nicht noch dreckiger.
Von hinten erklang ein dumpfer Schlag. Überrascht drehte Raoden sich um. Am Eingang der Gasse befand sich eine Gruppe dunkler Gestalten und kauerte um etwas auf dem Boden. Den Bettler. Bebend beobachtete Raoden, wie fünf Männer seinen Brotlaib hinunterschlangen, wobei sie untereinander kämpften und die verzweifelten Schreie des Jungen ignorierten. Schließlich ließ einer der Neuankömmlinge, der offensichtlich verärgert war, einen behelfsmäßigen Knüppel mit solcher Wucht auf den Kopf des Jungen niedersausen, dass das knirschende Geräusch in der ganzen Gasse widerhallte.
Nachdem die Männer das Brot aufgegessen hatten, wandten sie sich zu Raoden um. Ängstlich wich er einen Schritt zurück. Anscheinend war die Annahme, dass er nicht verfolgt wurde, voreilig gewesen. Die fünf Männer gingen steifbeinig vorwärts. Da wirbelte Raoden herum und rannte los.
Hinter sich konnte er seine Verfolger hören. Erschrocken hastete er davon – etwas, wozu er als Prinz noch nie zuvor gezwungen gewesen war. Er rannte wie ein Wahnsinniger und rechnete damit, außer Atem zu geraten und Seitenstechen zu bekommen, was ihm normalerweise passierte, wenn er sich überanstrengte. Nichts davon geschah. Stattdessen überkam ihn lediglich eine schreckliche Müdigkeit, und er fühlte sich so schwach, dass er gewiss bald zusammenbrechen würde. Es war ein qualvolles Gefühl, als versickere sein Leben nach und nach.
Verzweifelt schleuderte Raoden den Opferkorb über seinen Kopf. Die linkische Bewegung brachte ihn aus dem Gleichgewicht, und ein Spalt im Kopfsteinpflaster, den er nicht gesehen hatte, ließ ihn ungeschickt vorwärtsschlittern, bis er gegen einen Haufen morschen Holzes taumelte. Das Holz, bei dem es sich vielleicht einst um einen Kistenstapel gehandelt hatte, gab ein dumpfes Geräusch von sich und bremste seinen Sturz.
Raoden setzte sich rasch wieder auf, wobei die moderigen Holzsplitter von ihm abfielen. Seine Angreifer hatten jedoch längst das Interesse an ihm verloren. Die fünf Männer kauerten inmitten des Straßendrecks und pickten das verstreute Gemüse und die Getreidekörner von den Pflastersteinen und aus den dunklen Pfützen. Raodens Magen verkrampfte sich, als einer der Männer den Finger in eine Ritze steckte und eine Hand voll dunkler Masse hervorkratzte, die mehr aus Dreck als aus Getreide bestand. Dann stopfte er sich den Brei gierig in den Mund. Brackiger Speichel troff dem Mann vom Kinn. Sein Mund glich einem Topf voll Schlamm, der auf einem Herd kochte.
Ein Mann bemerkte, dass Raoden sie beobachtete. Der Kerl stieß ein Knurren aus und packte den Knüppel, der beinahe vergessen auf dem Boden neben ihm lag. Fieberhaft suchte Raoden nach einer Waffe und bekam ein Stück Holz zu greifen, das nicht ganz so morsch wie der Rest war. Er hielt seine Waffe unsicher in den Händen und versuchte, möglichst gefährlich zu wirken.
Der Schläger hielt inne. Eine Sekunde später erregte ein Freudenschrei hinter ihm seine Aufmerksamkeit: Einer der anderen hatte den winzigen Schlauch Wein gefunden. Bei dem folgenden Gerangel geriet Raoden anscheinend völlig in Vergessenheit, und schon bald waren alle fünf Männer verschwunden – vier jagten hinter dem einen her, der das Glück, oder den törichten Einfall, gehabt hatte, mit dem kostbaren Alkohol zu entkommen.
Vollständig überwältigt blieb Raoden inmitten der Trümmer sitzen. Das hier wird aus dir werden …
»Sieht aus, als hätten sie Euch vergessen, Sule«, stellte eine Stimme fest.
Raoden zuckte zusammen und blickte in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Träge an ein paar Treppenstufen gelehnt, lag nicht weit von ihm ein Mann, auf dessen Glatze sich die Morgensonne spiegelte. Er war zweifellos Elantrier, doch vor der Verwandlung musste er einem anderen Volk angehört haben; im Gegensatz zu Raoden stammte er nicht aus Arelon. Die Haut des Mannes war mit den verräterischen Flecken der Shaod übersät, aber die unberührten Stellen waren nicht blass, sondern tiefbraun.
Aus Angst vor einer möglichen Gefahr verkrampfte Raoden sich innerlich, doch dieser Mann wies keinerlei Anzeichen der urtümlichen Wildheit oder des körperlichen Verfalls auf, die Raoden an den anderen Elantriern bemerkt hatte. Der große muskulöse Mann hatte breite Hände und wachsame Augen, die Raoden aus einem dunkelhäutigen Gesicht entgegenblickten. Er musterte Raoden nachdenklich.
Raoden seufzte erleichtert auf. »Wer immer Ihr sein mögt, ich bin froh, Euch zu sehen. Ich dachte schon, hier drinnen seien alle entweder dabei zu sterben oder wahnsinnig.«
»Wir können nicht sterben«, entgegnete der Mann mit einem verächtlichen Schnauben. »Wir sind schon tot. Kolo?«
»Kolo.« Das fremdländische Wort kam ihm vage vertraut vor, ebenso wie der starke Akzent des Mannes. »Ihr stammt nicht aus Arelon?«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich bin Galladon aus dem unabhängigen Reich Duladel. Seit Neuestem lebe ich jedoch in Elantris, dem Land des Schlammes, des Wahnsinns und der ewigen Verdammnis. Schön, Eure Bekanntschaft zu machen.«
»Duladel?«, fragte Raoden. »Aber die Shaod trifft nur Menschen aus Arelon.« Er stand mühsam auf, wischte sich Holzstücke von der Kleidung, die sich in unterschiedlichen Phasen der Fäulnis befanden, und verzog das Gesicht, weil der Zeh wehtat, den er sich angestoßen hatte. Raoden war über und über mit Schmutz bedeckt, und mittlerweile ging auch von ihm der primitive Gestank von Elantris aus.
»In Duladel ist man von unterschiedlicher Abstammung, Sule. Arelisch, Fjordellisch, Teoisch – das gibt es dort alles. Ich …«
Raoden unterbrach den Mann mit einem leisen Fluch.
Galladon hob eine Augenbraue. »Was ist los, Sule? Habt Ihr einen Splitter an die falsche Stelle gekriegt? Obwohl es dafür wahrscheinlich keine richtigen Stellen gibt.«
»Es ist mein Zeh!«, sagte Raoden und humpelte über die rutschigen Pflastersteine. »Etwas stimmt nicht damit. Ich habe ihn mir angestoßen, als ich hingefallen bin, aber der Schmerz lässt einfach nicht nach.«
Wehmütig schüttelte Galladon den Kopf. »Willkommen in Elantris, Sule. Ihr seid tot. Euer Körper heilt nicht mehr, wie er sollte.«
»Was?« Raoden ließ sich neben den Stufen zu Boden plumpsen. Sein Zeh tat weiterhin so heftig weh wie in dem Moment, als er ihn sich gestoßen hatte.
»Sämtliche Schmerzen, Sule«, flüsterte Galladon. »Jeder Schnitt, jede Schramme, jede Prellung und jedes Wehwehchen – sie werden nicht aufhören, bis Ihr vor Leiden den Verstand verliert. Wie schon gesagt, willkommen in Elantris.«
»Wie haltet Ihr Leute das aus?«, fragte Raoden und massierte sich den Zeh, was jedoch nichts half. Es war so eine dumme kleine Verletzung, doch er musste sich zusammenreißen, damit ihm nicht vor Schmerz die Tränen in die Augen stiegen.
»Gar nicht. Entweder sind wir sehr vorsichtig, oder wir enden wie die Rulos, die Ihr auf dem Platz gesehen habt.«
»Auf dem Platz … Idos Domi!« Raoden hievte sich empor und humpelte in Richtung des Platzes zurück. Er fand den Bettlerjungen an derselben Stelle wie vorhin, in der Nähe des Eingangs der Gasse. Der Junge lebte noch … auf gewisse Weise.
Die Augen des Jungen starrten leer in die Luft, ohne zu fokussieren. Seine Lippen bewegten sich leise, ohne dass er auch nur den geringsten Laut von sich gegeben hätte. Der Hals des Jungen war völlig zertrümmert, und an der Seite befand sich eine große klaffende Wunde, durch die man die Halswirbel und die Kehle sehen konnte. Der Junge versuchte vergeblich, durch das Durcheinander zu atmen.
Auf einmal kam Raoden sein Zeh nicht mehr so schlimm vor. »Idos Domi …«, flüsterte Raoden und wandte den Kopf ab, weil sein Magen rebellierte. Er streckte den Arm aus und hielt sich an einer Häuserwand fest, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Den Kopf hielt er gesenkt, während er sich krampfhaft bemühte, nicht auch noch seinen eigenen Teil zu dem Schmutz auf der Straße beizutragen.
»Dem hier bleibt nicht mehr viel übrig«, sagte Galladon in sachlichem Tonfall und ging neben dem Bettler in die Hocke.
»Wie …?«, setzte Raoden an, brach jedoch ab, als sich sein Magen erneut meldete. Er ließ sich in den Dreck sinken und fuhr nach ein paar Atemzügen fort: »Wie lange wird er so am Leben bleiben?«
»Ihr habt es noch immer nicht kapiert, Sule«, sagte Galladon, in dessen mit starkem Akzent gesprochenen Worten Kummer mitschwang. »Er ist nicht mehr am Leben. Keiner von uns ist das. Deshalb sind wir hier. Kolo? Der Junge wird für immer so bleiben. So lange dauert nun einmal die durchschnittliche ewige Verdammnis.«
»Und es gibt nichts, was wir tun könnten?«
Galladon zuckte die Achseln. »Wir könnten versuchen, ihn zu verbrennen, falls es uns gelingen sollte, ein Feuer zu entfachen. Elantrische Körper scheinen besser zu brennen als die normaler Menschen, und manch einer ist der Ansicht, das sei ein angemessener Tod für uns.«
»Und …«, sagte Raoden, der sich noch immer nicht überwinden konnte, den Jungen anzusehen. »Und wenn wir das tun, was passiert dann mit ihm – mit seiner Seele?«
»Er hat keine Seele«, sagte Galladon. »Zumindest sagen das die Priester. Korathi, Derethi, Jesker – sie alle sagen das Gleiche. Wir sind verdammt.«
»Das beantwortet meine Frage nicht. Werden die Schmerzen aufhören, wenn man ihn verbrennt?«
Galladon blickte auf den Jungen hinab. Schließlich zuckte er nur mit den Schultern. »Manche Leute sagen, wenn man uns verbrennt oder uns den Kopf abhackt oder sonst etwas tut, um unseren Körper vollständig zu zerstören, hören wir einfach auf zu existieren. Andere sagen, die Schmerzen gehen weiter – dass wir zu purem Schmerz werden. Sie glauben, wir würden geistlos durch die Gegend schweben und nichts außer Todesqualen spüren. Mich spricht keine von beiden Möglichkeiten an. Von daher versuche ich, heil zu bleiben. Kolo?«
»Ja«, flüsterte Raoden. »Kolo.« Er bewegte den Kopf, da er endlich den Mut aufbrachte, sich den verletzten Jungen erneut anzusehen. Die gewaltige klaffende Wunde starrte ihm entgegen. Langsam sickerte Blut aus der Wunde, als befände es sich einfach nur träge in den Venen wie stehendes Wasser in einem Tümpel.
Raoden fühlte nach seiner Brust, und ihn überlief ein eiskalter Schauder. »Ich habe keinen Herzschlag«, fiel ihm zum ersten Mal auf.
Galladon sah Raoden an, als habe dieser eine völlig schwachsinnige Bemerkung von sich gegeben. »Sule, Ihr seid tot! Kolo?«
Sie verbrannten den Jungen nicht. Abgesehen davon, dass sie nicht die nötigen Werkzeuge besaßen, um ein Feuer zu entfachen, untersagte Galladon es. »Solch eine Entscheidung können wir nicht einfach treffen. Was wenn er wirklich keine Seele besitzt? Wenn er zu existieren aufhört, sobald wir seinen Körper verbrennen? Viele finden es besser, unter Qualen zu leben als gar nicht zu existieren.«
Deshalb ließen sie den Jungen an der Stelle zurück, an der er zusammengebrochen war – Galladon, ohne sich weiter Gedanken darüber zu machen, während Raoden seinem Beispiel nur folgte, weil er nicht wusste, was er sonst tun sollte. Allerdings schmerzten ihn seine Schuldgefühle mehr als der verletzte Zeh.
Offensichtlich war es Galladon egal, ob Raoden ihm folgte, ob er eine andere Richtung einschlug oder vielleicht stehen blieb, um einen interessanten Schmutzfleck an der Wand zu betrachten. Der große dunkelhäutige Mann ging den Weg zurück, den sie gekommen waren, vorbei an der einen oder anderen stöhnenden Elendsgestalt in der Gosse. Raoden hatte er den Rücken zugekehrt, und seine ganze Haltung strahlte vollkommene Gleichgültigkeit aus.
Raoden sah dem Dula hinterher und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Er war für eine politische Laufbahn ausgebildet worden, und dank der jahrelangen Vorbereitung war er daran gewöhnt, schnelle Entscheidungen zu treffen. In diesem Augenblick traf er eine. Er entschied sich, Galladon zu vertrauen.
Der Dula hatte etwas ausgesprochen Sympathisches an sich, etwas, was Raoden auf undefinierbare Weise anziehend fand, selbst wenn es von einer Schicht Pessimismus bedeckt war, die so dick war wie der Schmutzbelag auf dem Boden. Es war nicht nur Galladons klarer Verstand, nicht nur seine gelassene Art. Raoden hatte die Augen des Mannes gesehen, als er den leidenden Jugendlichen betrachtet hatte. Galladon behauptete zwar, sich in das Unvermeidliche zu fügen, aber er war traurig, es tun zu müssen.
Der Dula ließ sich wieder auf den Stufen von vorhin nieder. Raoden atmete tief durch, trat zu dem Mann und baute sich erwartungsvoll vor ihm auf.
Galladon blickte zu ihm empor. »Was?«
»Ich brauche Eure Hilfe, Galladon«, sagte Raoden und hockte sich vor den Stufen auf den Boden.
Galladon schnaubte verächtlich. »Ihr seid in Elantris, Sule. So etwas wie Hilfe gibt es hier nicht. Hier werdet Ihr bloß Schmerzen, Wahnsinn und Unmengen Dreck finden.«
»Es klingt fast, als würdet Ihr das glauben.«
»Ihr seid an den Falschen geraten, Sule.«
»Ihr seid der einzige Mensch hier drinnen, der nicht im Koma liegt und mich nicht angegriffen hat«, sagte Raoden. »Eure Taten sprechen viel überzeugender als Eure Worte.«
»Vielleicht habe ich nur nicht versucht, Euch wehzutun, weil ich weiß, dass bei Euch nichts zu holen ist.«
»Das glaube ich nicht.«
Galladon vollführte ein »Ist mir doch egal, was Ihr glaubt«-Achselzucken und wandte sich ab, indem er sich gegen die Häuserwand lehnte und die Augen schloss.
»Habt Ihr Hunger, Galladon?«, erkundigte Raoden sich leise.
Der Mann schlug ruckartig die Augen auf.
»Ich habe mich immer gefragt, wann König Iadon die Elantrier mit Nahrung versorgt«, sinnierte Raoden. »Ich habe nie gehört, dass man Vorräte in die Stadt schafft, aber ich bin stets davon ausgegangen, dass welche geschickt werden. Schließlich, habe ich mir gesagt, sind die Elantrier immer noch am Leben. Es wollte mir einfach nicht in den Kopf. Wenn die Menschen in dieser Stadt ohne Herzschlag existieren können, kommen sie wahrscheinlich auch ohne Essen aus. Natürlich bedeutet das nicht, dass der Hunger je aufhört. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war ich heißhungrig, und ich bin es immer noch. Dem Blick in den Augen meiner Angreifer nach zu schließen, würde ich darauf tippen, dass der Hunger mit der Zeit nur schlimmer wird.«
Raoden griff sich unter das schmutzbefleckte Opfergewand und zog etwas Schmales hervor, das er emporhielt, damit Galladon es sehen konnte. Ein Stück Trockenfleisch. Galladon öffnete die Augen vollständig, seine gelangweilte Miene spiegelte auf einmal Interesse wider. In seinen Augen war ein Glitzern – ein Hauch der gleichen Wildheit, die Raoden vorhin an den primitiven Kerlen beobachtet hatte. Es war kontrollierter, aber es war da. Zum ersten Mal wurde Raoden deutlich bewusst, wie sehr er auf den ersten Eindruck setzte, den der Dula bei ihm hinterlassen hatte.
»Woher habt Ihr das?«, wollte Galladon gedehnt wissen.
»Es ist aus meinem Korb gefallen, als die Priester mich hierher geführt haben. Also habe ich es mir unter die Schärpe gestopft. Wollt Ihr es nun haben oder nicht?«
Zunächst antwortete Galladon nicht. »Wieso sollte ich Euch nicht einfach angreifen und es Euch wegnehmen?« Die Worte waren nicht rein theoretisch gesprochen. Ihm war anzusehen, dass ein Teil von ihm eine solche Handlungsweise tatsächlich in Erwägung zog. Es war nur noch nicht klar, wie groß dieser Teil war.
»Ihr habt mich ›Sule‹ genannt, Galladon. Wie könntet Ihr jemanden umbringen, den Ihr als Freund bezeichnet habt?«
Galladon saß da wie gelähmt von dem winzigen Stück Fleisch. Ein kleiner Speicheltropfen lief ihm aus dem Mundwinkel, ohne dass er es bemerkt hätte. Er blickte zu Raoden empor, der immer nervöser wurde. Als sich ihre Blicke trafen, zuckte Galladon wie elektrisiert zusammen, und die Spannung fiel von ihm ab. Im nächsten Moment gab der Dula ein tiefes, schallendes Lachen von sich. »Ihr sprecht Duladenisch, Sule?«
»Nur ein paar Wörter«, räumte Raoden bescheiden ein.
»Ein gebildeter Mann? Reiche Gabe für Elantris am heutigen Tag! Na gut, verschlagener Rulo, was wollt Ihr also?«
»Dreißig Tage«, sagte Raoden. »Dreißig Tage lang werdet Ihr mich herumführen und mir erzählen, was Ihr wisst.«
»Dreißig Tage? Sule, Ihr seid kayana.«
»So wie ich das sehe«, meinte Raoden und machte Anstalten, sich das Fleisch wieder unter die Schärpe zu stecken, »gelangt die einzige Nahrung mit den Neuankömmlingen hierher. Da muss man doch ziemlich hungrig werden, bei so wenigen Opfergaben und so vielen hungrigen Mäulern. Man sollte meinen, der Hunger würde einen fast um den Verstand bringen.«
»Zwanzig Tage«, sagte Galladon, dem wieder eine Spur seiner vorherigen Leidenschaft anzusehen war.
»Dreißig, Galladon. Wenn Ihr mir nicht helft, wird es ein anderer tun.«
Einen Augenblick lang knirschte Galladon mit den Zähnen. »Rulo«, murmelte er und streckte die Hand aus. »Dreißig Tage. Glücklicherweise habe ich für den nächsten Monat sowieso keine größeren Reisen geplant.«
Lachend warf Raoden ihm das Fleisch zu.
Galladon fing es begierig auf. Doch obwohl seine Hand sich reflexartig Richtung Mund bewegte, hielt er inne. Sorgfältig ließ er das Fleisch in einer Tasche verschwinden und erhob sich. »Wie soll ich Euch … wie soll ich dich nennen?«
Raoden stockte. Wahrscheinlich ist es am besten, wenn die Leute nicht gleich wissen, dass ich aus dem Königshaus stamme. »Ach, weißt du, ›Sule‹ finde ich völlig in Ordnung.«
Galladon lachte in sich hinein. »Ein Geheimniskrämer, was? Na, dann wollen wir mal. Es ist Zeit für deine erste große Besichtigungstour.«
Kapitel 2
Als Sarene von Bord des Schiffes ging, erfuhr sie, dass sie Witwe war. Natürlich waren das schockierende Neuigkeiten, doch nicht so niederschmetternd, wie sie hätten sein können. Schließlich war sie ihrem Ehemann noch nie zuvor persönlich begegnet, ja, als Sarene ihr Heimatland verlassen hatte, waren Raoden und sie lediglich verlobt gewesen. Sie meinte, dass man mit der Hochzeit bis zu ihrer Ankunft warten würde. Zumindest in ihrer Heimat mussten beide Partner anwesend sein, wenn sie miteinander verheiratet wurden.
»Diese Klausel des Ehevertrags hat mir nie sonderlich behagt, Mylady«, sagte Sarenes Begleiter, eine Lichtkugel von Melonengröße, die neben ihr herschwebte.
Ärgerlich klopfte Sarene mit dem Fuß auf den Boden, während sie den Packleuten zusah, wie diese ihr Gepäck auf eine Kutsche luden. Der Ehevertrag war ein fünfzigseitiges Ungetüm von einem Dokument gewesen, und eine der vielen Bedingungen besagte, dass ihr Verlöbnis auch dann rechtlich bindend war, wenn entweder sie oder ihr Verlobter vor der eigentlichen Hochzeitszeremonie versterben sollte.
»Es ist eine relativ übliche Klausel, Ashe«, sagte sie. »Auf diese Weise wird der einer politischen Eheschließung zugrunde liegende Staatsvertrag nicht ungültig, wenn einem der Beteiligten etwas zustößt. Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass man sich auf die Klausel berufen hat.«
»Bis heute«, erwiderte die Lichtkugel mit tiefer Stimme, wobei sie jedes einzelne Wort deutlich aussprach.
»Bis heute«, gab Sarene zu. »Woher sollte ich denn wissen, dass Prinz Raoden im Laufe der fünf Tage sterben würde, die wir gebraucht haben, um das Fjordische Meer zu überqueren?« Sie hielt inne und runzelte nachdenklich die Stirn. »Zitiere die Klausel für mich, Ashe. Ich muss ihren genauen Wortlaut wissen.«
»›Sollte der Fall eintreten, dass der Gütige Domi einen Teil des oben erwähnten Paares vor dem festgesetzten Hochzeitstermin zu sich nach Hause beruft‹«, sagte Ashe, »›so gilt die Verlobung als gleichwertig mit einer Eheschließung in sämtlichen rechtlichen und sozialen Belangen.‹«
»Hieb- und stichfest, was?«
»Ich fürchte ja, Mylady.«
Geistesabwesend legte Sarene erneut die Stirn in Falten und verschränkte die Arme. Sie tippte sich mit dem Zeigefinger gegen die Wange, während sie weiterhin die Packleute beobachtete. Ein hoch gewachsener, hagerer Mann leitete die Arbeit mit gelangweiltem Blick und resignierter Miene. Der Mann, ein arelischer Hofdiener namens Ketol, war der einzige Empfang gewesen, den König Iadon ihr zugestanden hatte. Es war Ketol gewesen, der ihr »die bedauerliche Nachricht« mitgeteilt hatte, dass ihr Verlobter »unerwartet an einer Krankheit verstorben« sei, während sie unterwegs gewesen war. Er hatte die Erklärung in demselben teilnahmslosen, desinteressierten Tonfall abgegeben, in dem er den Packleuten Befehle erteilte.
»Also laut Gesetz«, stellte Sarene klar, »bin ich jetzt eine arelische Prinzessin.«
»Richtig, Mylady.«
»Und die verwitwete Braut eines Mannes, dem ich nie zuvor begegnet bin.«
»Auch das ist richtig.«
Sarene schüttelte den Kopf. »Vater wird sich kaputtlachen, wenn er von der Sache Wind bekommt. Das wird mir noch ewig nachhängen.«
Verärgert pulsierte Ashe ein wenig. »Mylady, der König würde ein solch ernstes Ereignis niemals auf die leichte Schulter nehmen. Der Tod von Prinz Raoden hat die königliche Familie von Arelon zweifellos in großen Kummer gestürzt.«
»Ja. Sogar in so großen Kummer, dass sie sich nicht einmal dazu überwinden konnten, ihre neue Tochter zu begrüßen.«
»Vielleicht wäre König Iadon persönlich gekommen, wenn er im Vorhinein von unserer Ankunft gewusst hätte …«
Sarene blickte finster drein, doch das Seon hatte nicht ganz unrecht. Ihre frühzeitige Ankunft, etliche Tage vor den eigentlichen Vermählungsfeierlichkeiten, war als Überraschung für Prinz Raoden vor der Hochzeit gedacht gewesen. Sie hatte wenigstens ein paar Tage persönlich und unter vier Augen mit ihm verbringen wollen. Doch mit ihrer Geheimniskrämerei hatte sie sich keinen Gefallen getan.
»Sag mal, Ashe: Wie viel Zeit lassen die Leute in Arelon üblicherweise zwischen dem Tod eines Menschen und dessen Beerdigung verstreichen?«
»Ich bin mir nicht sicher, Mylady«, gab Ashe zu. »Ich habe Arelon vor langer Zeit verlassen und hier nur so kurz gelebt, dass ich mich nicht an viele Einzelheiten erinnern kann. Allerdings habe ich in Erfahrung bringen können, dass die arelischen Bräuche meist denjenigen Eurer Heimat ähneln.«
Sarene nickte und winkte dann den Bediensteten König Iadons herbei.
»Ja, Mylady?«, fragte Ketol in trägem Tonfall.
»Wird für den Prinzen eine Totenwache abgehalten?«, erkundigte sich Sarene.
»Ja, Mylady«, erwiderte der Bedienstete. »Vor der Korathikapelle. Die Bestattung ist für heute Abend angesetzt.«
»Ich möchte mir den Sarg ansehen.«
Ketol zögerte. »Ähm … Seine Majestät hat darum gebeten, dass Ihr auf der Stelle zu ihm gebracht werdet …«
»Dann werde ich mich nur kurz in dem Trauerzelt aufhalten«, sagte Sarene und ging auf ihre Kutsche zu.
Sarene ließ einen kritischen Blick durch das volle Trauerzelt schweifen, während sie darauf wartete, dass Ketol und ein paar der Packleute ihr einen Weg zu dem Sarg bahnten. Sie musste zugeben, dass alles einwandfrei wirkte: die Blumen, die Opfergaben, die betenden Korathipriester. Merkwürdig war im Grunde nur, wie überfüllt das Zelt war.
»Es sind zweifellos viele Leute hier«, meinte sie zu Ashe.
»Der Prinz war sehr beliebt, Mylady«, antwortete das Seon, das neben ihr schwebte. »Laut unseren Berichten war er die beliebteste Figur des öffentlichen Lebens im ganzen Land.«
Sarene nickte und ging durch den Korridor, den Ketol ihr frei gemacht hatte. Prinz Raodens Sarg stand genau in der Mitte des Zeltes und wurde von einem Kreis Soldaten bewacht, der die Menschenmenge auf Abstand hielt. Auf ihrem Weg zum Sarg erblickte sie echte Trauer auf den Gesichtern der Anwesenden.
Es ist also wahr, dachte sie. Die Menschen haben ihn geliebt.
Die Soldaten machten ihr Platz, und sie trat an den Sarg. Ganz nach korathischer Tradition war er mit geschnitzten Aonen verziert; hauptsächlich Symbolen der Hoffnung und des Friedens. Der hölzerne Sarg war vollständig von einem Kreis aus üppigen Speisen umgeben, einer Opfergabe für den Verstorbenen.
»Kann ich ihn sehen?«, fragte sie und wandte sich einem der Korathipriester zu, einem kleinen, liebenswürdig wirkenden Mann.
»Es tut mir leid, mein Kind«, sagte der Priester. »Aber die Krankheit hat den Prinzen entstellt. Der König hat darum gebeten, dem Prinzen im Tode seine Würde zu belassen.«
Sarene nickte und drehte sich wieder zu dem Sarg um. Sie war sich nicht sicher, was sie zu fühlen erwartet hatte, wenn sie vor dem Toten stand, der ihr zum Ehemann bestimmt gewesen war. Sie war eigenartig … wütend.
Für den Moment wies sie dieses Gefühl von sich. Stattdessen drehte sie sich um und ließ den Blick durch das Zelt schweifen. Alles wirkte beinahe zu förmlich. Obgleich die Besucher ganz offensichtlich traurig waren, wirkten das Zelt, die Opfergaben und die Dekoration steril.
Ein Mann in Raodens Alter und von seiner angeblichen Vitalität, dachte sie. Dahingerafft vom Zitterhusten. Möglich wäre es – aber es mutet alles andere als wahrscheinlich an.
»My– … Mylady?«, fragte Ashe leise. »Stimmt etwas nicht?«
Sarene gab dem Seon einen Wink und ging zu ihrer Kutsche zurück. »Ich weiß nicht«, sagte sie leise. »Irgendetwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu, Ashe.«
»Ihr seid von Natur aus misstrauisch, Mylady«, stellte Ashe fest.
»Warum hält Iadon keine Totenwache für seinen Sohn? Ketal hat gesagt, er halte Hof – als mache ihm der Tod seines eigenen Sohnes nicht das Geringste aus.« Sarene schüttelte den Kopf. »Kurz vor meiner Abreise aus Teod habe ich mit Raoden gesprochen, und er wirkte wohlauf. Etwas stimmt nicht, Ashe, und ich möchte wissen, was.«
»Oh je …«, sagte Ashe. »Wisst Ihr, Mylady, Euer Vater hat mich doch tatsächlich gebeten, Euch möglichst von jeglichem Ärger fernzuhalten.«
Sarene lächelte. »Also das ist ja nun wirklich mal eine unmögliche Aufgabe. Komm schon, wir müssen los und meinen neuen Vater treffen.«
Sarene lehnte am Fenster der Kutsche und betrachtete die Stadt, die auf der Fahrt zum Palast an ihr vorüberzog. Im Moment saß sie schweigend da. Ein einziger Gedanke verdrängte alles andere aus ihrem Geist.
Was mache ich hier?
Ihre Worte Ashe gegenüber hatten selbstbewusst geklungen, doch sie war schon immer gut darin gewesen, ihre Sorgen zu verbergen. Sicher, sie war neugierig, was den Tod des Prinzen betraf, aber Sarene kannte sich selbst sehr gut. Ein großer Teil dieser Neugier war nichts als der Versuch, sich von ihren Minderwertigkeitsgefühlen und ihrem linkischen Wesen abzulenken – bloß nicht daran denken müssen, dass sie eine schlaksige, brüske Frau war, die die Blüte ihrer Jugend schon beinahe hinter sich hatte. Sie war fünfundzwanzig Jahre alt; sie hätte bereits vor Jahren heiraten sollen. Raoden war ihre letzte Chance gewesen.
Wie kannst du es wagen, mir wegzusterben, Prinz von Arelon!, dachte Sarene aufgebracht. Allerdings entging ihr die Ironie der ganzen Sache nicht. Es passte zu gut, dass ein Mann – zumal einer, von dem sie geglaubt hatte, dass sie ihn tatsächlich mögen könnte – starb, bevor sie ihm auch nur begegnet war. Nun war sie allein in einem fremden Land, politisch an einen König gebunden, dem sie nicht vertraute. Es war ein erschreckendes Gefühl von Einsamkeit.
Du bist früher auch schon einsam gewesen, Sarene, ermahnte sie sich selbst. Du wirst damit fertig werden. Such dir einfach etwas, um auf andere Gedanken zu kommen. Du hast einen ganzen neuen Hof, den du erkunden kannst. Genieße es!
Mit einem Seufzen richtete Sarene ihre Aufmerksamkeit erneut auf die Stadt. Trotz der beträchtlichen Erfahrung, die sie im diplomatischen Korps ihres Vaters gesammelt hatte, war sie noch nie zuvor in Arelon gewesen. Seit dem Niedergang von Elantris war Arelon von den meisten anderen Königreichen inoffiziell unter Quarantäne gestellt worden. Niemand wusste, warum die mystische Stadt mit einem Fluch belegt war, und alle hatten Angst, die elantrische Krankheit könnte um sich greifen.
Der üppige Luxus, den Sarene in Kae erblickte, überraschte sie entsprechend. Die Hauptverkehrsstraßen der Stadt waren breit und in gutem Zustand. Die Leute auf der Straße trugen vornehme Kleidung, und sie konnte keinen einzigen Bettler entdecken. Auf der einen Seite schritt eine Gruppe Korathipriester in blauen Gewändern durch die Menge und führte einen eigenartigen, in ein weißes Gewand gehüllten Menschen mit sich. Sie sah der Prozession zu und fragte sich, was sie zu bedeuten haben mochte. Dann bog die Gruppe um eine Ecke und war verschwunden.
Soviel Sarene erkennen konnte, wies Kae keinerlei Anzeichen der wirtschaftlichen Not auf, unter der Arelon angeblich litt. Die Kutsche fuhr an Dutzenden umzäunter Villen vorbei, von denen jede in einem anderen Architekturstil erbaut war. Manche waren weitläufig, mit gewaltigen Seitenflügeln und Spitzdächern, ganz nach duladenischer Bauweise. Andere wirkten mehr wie Burgen, deren Steinmauern aussahen, als habe man sie direkt aus den militaristischen ländlichen Gegenden Fjordens hertransportiert. Doch die Villen hatten alle eines gemeinsam: Reichtum. Das Volk dieses Landes mochte verhungern, aber Kae – der Sitz von Arelons Aristokratie – schien davon nichts zu ahnen.
Ein beunruhigender Schatten hing natürlich dennoch über der Stadt. In der Ferne erhoben sich die gewaltigen Mauern von Elantris, und Sarene erzitterte, als sie die öden, imposanten Steine erblickte. Fast ihr ganzes Erwachsenenleben lang hatte sie Geschichten über Elantris vernommen, Erzählungen von den Zaubern, die es einst hervorgebracht hatte, und den Ungeheuern, die nun in seinen dunklen Straßen hausten. Egal wie protzig die Häuser, egal wie reich die Straßen von Kae sein mochten, dieses eine Mahnmal war ein Zeugnis, dass in Arelon nicht alles im Lot war.
»Ich frage mich, warum sie überhaupt hier wohnen«, sagte Sarene.
»Mylady?«, erkundigte sich Ashe.
»Warum hat König Iadon seinen Palast in Kae errichtet? Warum eine Stadt aussuchen, die so nahe bei Elantris liegt?«
»Ich vermute, dass die Gründe vor allem wirtschaftlicher Natur sind, Mylady«, sagte Ashe. »Es gibt nur ein paar lebensfähige Hafenstädte an der Nordküste Arelons, und das hier ist die schönste.«
Sarene nickte. Die Bucht, die dadurch entstanden war, dass der Fluss Aredel mit dem Ozean verschmolz, bildete einen beneidenswerten Hafen. Aber dennoch …
»Womöglich sind die Gründe politischer Natur«, überlegte Sarene. »Iadon ist in stürmischen Zeiten an die Macht gekommen. Vielleicht ist er der Ansicht, nahe der alten Hauptstadt zu bleiben verleihe ihm Autorität.«
»Vielleicht, Mylady«, sagte Ashe.
Es ist ja ohnehin nicht weiter wichtig, dachte sie. Anscheinend erhöhte die Nähe zu Elantris – oder den Elantriern – keineswegs die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst von der Shaod ereilt wurde.
Sie wandte sich von dem Fenster ab und blickte zu Ashe, der über dem Sitz neben ihr schwebte. Bisher hatte sie auf den Straßen von Kae noch kein einziges Seon zu Gesicht bekommen, obwohl diese Geschöpfe – von denen es hieß, sie seien vor ewigen Zeiten durch elantrischen Zauber entstanden – in Arelon angeblich viel verbreiteter sein sollten als in ihrer Heimat. Wenn sie die Augen zusammenkniff, konnte sie schemenhaft das leuchtende Aon im Zentrum von Ashes Licht ausmachen.
»Wenigstens ist der Staatsvertrag sicher«, sagte Sarene nach einer Weile.
»Sofern Ihr in Arelon bleiben solltet, Mylady«, erklang Ashes tiefe Stimme. »Zumindest besagt das der Ehevertrag. Solange Ihr hier bleibt und Eurem ›Ehemann die Treue haltet‹, muss König Iadon sein Bündnis mit Teod erfüllen.«
»Einem toten Mann treu bleiben«, murmelte Sarene mit einem Seufzen. »Tja, das bedeutet, dass ich bleiben muss, mit oder ohne Ehemann.«
»Wenn Ihr meint, Mylady.«
»Wir brauchen diesen Vertrag, Ashe«, sagte Sarene. »Fjorden dehnt seinen Einfluss mit unglaublicher Geschwindigkeit aus. Vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen, dass die Priester aus Fjorden in Arelon niemals mächtig würden. Aber jetzt …« Sarene schüttelte den Kopf. Der Zusammenbruch der Duladenischen Republik hatte so vieles verändert.
»Wir hätten uns die letzten zehn Jahre über nicht derart auf Distanz zu Arelon halten dürfen, Ashe«, fuhr sie fort. »Wahrscheinlich befände ich mich jetzt nicht in dieser misslichen Lage, wenn wir vor zehn Jahren enge Bande mit der neuen arelischen Regierung geknüpft hätten.«
»Euer Vater hatte Angst, dass die politischen Unruhen auf Teod übergreifen könnten«, sagte Ashe. »Ganz zu schweigen von der Reod – niemand war sicher, ob das, was die Elantrier befiel, nicht auch normalen Menschen schaden könnte.«
Die Kutsche fuhr langsamer, und Sarene ließ das Thema seufzend fallen. Ihr Vater wusste, dass Fjorden eine Gefahr darstellte, und er hatte begriffen, dass man alte Bündnisse neu schmieden musste. Deshalb war sie nach Arelon gekommen. Vor ihnen schwangen die Flügel des Palasttors auf. Auch wenn sie ohne Freunde in der Fremde sein mochte, sie war nun einmal hier, und Teod war auf sie angewiesen. Sie musste Arelon auf den Krieg vorbereiten, der kommen würde: einen Krieg, der in dem Augenblick unausweichlich geworden war, als Elantris fiel.
Sarenes neuer Vater, König Iadon von Arelon, war ein dünner Mann mit einem schlauen Gesicht. Bei Sarenes Ankunft im Thronsaal nahm er gerade Rücksprache mit einigen seiner Verwaltungsbeamten, und sie stand beinahe eine Viertelstunde unbeachtet herum, bevor er ihr auch nur zunickte. Im Grunde machte ihr das Warten nichts aus – so hatte sie Gelegenheit, den Mann zu beobachten, dem sie von nun an zu gehorchen hatte –, allerdings fühlte sie sich ein wenig in ihrer Ehre gekränkt. Allein ihr Status als Prinzessin von Teod hätte ihr, wenn schon nicht einen prunkvollen, so doch zumindest einen pünktlichen Empfang gewährleisten sollen.
Während des Wartens fiel ihr eines sofort auf: Iadon sah nicht wie ein Mann aus, der den Tod seines Sohnes und Erben betrauerte. In seinen Augen war nicht das geringste Zeichen von Kummer, sein Gesicht trug keine Spur der Auszehrung und Erschöpfung, die im Allgemeinen mit dem Verlust eines geliebten Menschen einhergingen. Ja die Atmosphäre bei Hofe schien bemerkenswert frei von jeglicher spürbarer Trauer zu sein.
Ist Iadon also ein herzloser Mann?, fragte Sarene sich neugierig. Oder ist er einfach nur Herr seiner Gefühle?
In den Jahren am Hof ihres Vaters hatte Sarene gelernt, die Charaktere von Adeligen zu durchschauen. Obgleich sie nicht hören konnte, was Iadon sagte – man hatte sie angewiesen, sich im hinteren Teil des Saales aufzuhalten und abzuwarten, bis sie sich dem König nähern durfte –, vermittelten ihr seine Handlungen und Gesten eine Vorstellung von seinem Wesen. Iadon sprach bestimmt und erteilte direkte Anweisungen, wobei er gelegentlich innehielt und mit einem dünnen Finger auf den Tisch pochte. Er war ein Mann mit einer starken Persönlichkeit, entschied sie; einer, der ganz genau wusste, wie er die Dinge haben wollte. Das war kein schlechtes Zeichen. Zögerlich kam Sarene zu dem Schluss, dass dies ein Mann war, mit dem sie eventuell zusammenarbeiten könnte.
Es sollte nicht lange dauern, bis sie ihre Meinung von Grund auf revidierte.
König Iadon winkte sie zu sich. Sie verbarg sorgsam ihren Ärger über die Wartezeit und näherte sich ihm mit der angemessenen vornehmen Ergebenheit. Er unterbrach sie mitten in ihrem Knicks.
»Mir hat niemand gesagt, dass du so groß bist«, erklärte er.
»Mylord?«, fragte sie und hob den Blick.
»Tja, der Einzige, dem das etwas ausgemacht hätte, ist wohl nicht mehr da, um sich daran zu stören. Eshen!«, rief er unwirsch, woraufhin eine geradezu unscheinbare Frau in der Nähe des entgegengesetzten Saalendes gehorsam aufsprang.
»Bring sie auf ihre Gemächer und sorge dafür, dass sie alles hat und beschäftigt ist. Stickzeug oder womit auch immer ihr Frauen euch vergnügt.« Nach diesen Worten wandte der König sich an seine nächsten Besucher, eine Gruppe Kaufleute.
Sarene stand einfach nur da, ohne ihren Knicks zu Ende zu führen. Sie war wie gelähmt von Iadons eklatanter Unhöflichkeit. Nur ihre jahrelange höfische Ausbildung verhinderte, dass ihr die Kinnlade herunterklappte. Rasch, aber alles andere als energisch, hastete die Frau herbei, der Iadon den Befehl erteilt hatte – Königin Eshen, die Gattin des Monarchen. Sie nahm Sarene beim Arm. Eshen war klein und zierlich gebaut, in ihrem dunkelblonden aonischen Haar zeigten sich erst vereinzelt graue Strähnen.
»Komm, mein Kind«, sagte Eshen mit hoher Stimme. »Wir dürfen die Zeit des Königs nicht verschwenden.«
Sarene ließ sich durch eine der Seitentüren des Saales ziehen. »Gütiger Domi«, murmelte sie in sich hinein. »Was habe ich mir da nur eingebrockt?«
»… und du wirst es lieben, wenn die Rosen blühen. Ich lasse sie so von den Gärtnern pflanzen, dass man sie riechen kann, ohne sich aus dem Fenster lehnen zu müssen. Ich wünschte nur, sie wären nicht so groß.«
Verwirrt runzelte Sarene die Stirn. »Die Rosen?«
»Nein, Liebes«, fuhr die Königin fort, die kaum innegehalten hatte, »die Fenster! Du glaubst ja gar nicht, wie hell es ist, wenn die Sonne morgens durchscheint. Ich habe sie gebeten – die Gärtner, meine ich – orangefarbene aufzutreiben, weil ich Orange ja so schön finde, aber bisher haben sie nur grässlich gelbe gefunden. ›Wenn ich gelbe Blüten hätte haben wollen‹, habe ich ihnen gesagt, ›hätte ich euch Aberteenen anpflanzen lassen.‹ Du hättest sehen sollen, wie sie sich entschuldigt haben! Ich bin mir sicher, dass wir bis Ende nächsten Jahres orangefarbene Rosen haben. Meinst du nicht auch, dass das ganz reizend wäre, Liebes? Natürlich werden die Fenster dann immer noch zu groß sein. Vielleicht kann ich ein paar von ihnen zumauern lassen.«
Sarene nickte fasziniert – nicht von der Unterhaltung, sondern von der Königin. Bisher war Sarene immer davon ausgegangen, dass die Lehrer an der Akademie ihres Vaters geschickt darin gewesen waren, mithilfe vieler Worte nichts zu sagen, doch Eshen stellte sie allesamt in den Schatten. Die Königin flatterte von einem Gesprächsstoff zum nächsten wie ein Schmetterling, der nach einem Landeplatz suchte, aber niemals auf einen stieß, der für einen längeren Aufenthalt geeignet war. Jedes einzelne Thema hätte zu einem interessanten Gespräch führen können; die Königin ließ Sarene allerdings nie lange genug bei einem Punkt verharren, als dass man ihm hätte gerecht werden können.
Sarene atmete tief ein, um sich zu beruhigen, und mahnte sich zur Geduld. Sie konnte der Königin nicht deren Wesensart zum Vorwurf machen; Domi lehrte, dass die Persönlichkeit eines jeden Menschen ein Geschenk sei, das man zu genießen habe. Die Königin war auf ihre eigene, abschweifende Art reizend. Leider beschlich Sarene jedoch nach ihrer Bekanntschaft mit dem König und der Königin der Verdacht, dass es ihr nicht leichtfallen würde, in Arelon politische Verbündete zu finden.
Und noch etwas anderes bereitete Sarene Kopfzerbrechen: Das Verhalten der Königin hatte etwas entschieden Merkwürdiges an sich. Kein Mensch konnte tatsächlich so viel reden wie die Königin, die keinen einzigen Moment schweigend verstreichen ließ. Es war fast so, als bereite Sarenes Gegenwart der Frau Unbehagen. Da traf Sarene die Erkenntnis wie ein Schlag. Eshen sprach von jedem Thema, das man sich nur vorstellen konnte, abgesehen von dem allerwichtigsten: dem verstorbenen Prinzen. Misstrauisch kniff Sarene die Augen zusammen. Sicher konnte sie sich nicht sein – schließlich war Eshen eine sehr flatterhafte Person –, aber es hatte den Anschein, als benähme sich die Königin viel zu fröhlich für eine Frau, die gerade eben erst ihren Sohn verloren hatte.
»Hier ist dein Zimmer, Liebes. Wir haben deine Sachen auspacken lassen und noch einiges hinzugefügt. Du besitzt Kleidung in jeglicher Farbe, selbst in Gelb, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, warum du Gelb tragen wollen würdest. Scheußliche Farbe. Nicht dass dein Haar scheußlich wäre! Natürlich nicht. Blond ist nicht dasselbe wie Gelb. Nein! Ebenso wenig wie ein Pferd ein Gemüse ist. Wir haben noch kein Pferd für dich, aber du kannst gern jedes aus den königlichen Ställen nutzen. Wir haben viele edle Tiere, musst du wissen. Duladel ist um diese Jahreszeit sehr schön.«
»Natürlich«, sagte Sarene und sah sich in dem Zimmer um. Es war klein, aber nach ihrem Geschmack. Zu viel Platz konnte genauso einschüchternd wirken, wie zu wenig Platz beengend sein konnte.
»So, die hier wirst du brauchen, Liebes«, sagte Eshen, und deutete mit ihrer kleinen Hand auf einen Stapel Kleider, die im Gegensatz zu den anderen nicht im Schrank hingen – als seien sie erst vor Kurzem geliefert worden. Sämtliche Kleider auf dem Stapel hatten eines gemeinsam.
»Schwarz?«, fragte Sarene.
»Selbstverständlich. Du bist … du bist …« Eshen suchte mühsam nach den richtigen Worten.
»Ich soll Trauer tragen«, stellte Sarene fest. Sie stampfte unzufrieden mit dem Fuß auf; Schwarz war nicht gerade ihre Lieblingsfarbe.
Eshen nickte. »Du kannst eines davon heute Abend zur Bestattung anziehen. Es wird bestimmt ein schöner Gottesdienst werden. Ich habe mich um die Blumengestecke gekümmert.« Sie fing wieder von ihren Lieblingsblumen an, und schon bald geriet der Monolog zu einer Abhandlung, wie sehr sie die fjordellische Küche hasste. Sanft, aber bestimmt führte Sarene die Frau zur Tür, wobei sie immer wieder freundlich nickte. Als Eshen draußen im Gang stand, schob Sarene Müdigkeit nach der langen Reise vor und gebot dem Wortschwall der Königin Einhalt, indem sie die Tür schloss.
»Das wird mir sehr bald auf die Nerven gehen«, sagte Sarene zu sich selbst.
»Die Königin besitzt ein ausgeprägtes Konversationstalent, Mylady«, pflichtete ihr eine tiefe Stimme bei.
»Was hast du herausgefunden?«, wollte Sarene wissen. Sie ging zu dem dunklen Kleiderstapel und besah sich die einzelnen Stücke, während Ashe durch das offene Fenster hereingeflogen kam.
»Ich habe nicht so viele Seonen gefunden, wie ich erwartet hatte. Wenn ich mich nicht irre, war diese Stadt einmal voll von uns.«
»Das ist mir auch schon aufgefallen«, sagte Sarene und hielt ein Kleid vor dem Spiegel empor, um es dann mit einem Kopfschütteln wegzulegen. »Vermutlich liegen die Dinge nun anders.«
»Allerdings. Wie Ihr mir aufgetragen hattet, habe ich die anderen Seonen zum vorzeitigen Tod des Prinzen befragt. Leider haben sie nur zögerlich über das Ereignis gesprochen, Mylady. Sie betrachten es als ausgesprochen schlechtes Omen, dass der Prinz so kurz vor seiner Hochzeit verstorben ist.«
»Besonders für ihn«, murmelte Sarene, die sich auszog, um das Kleid anzuprobieren. »Ashe, hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube, dass der Prinz eventuell umgebracht worden ist.«
»Umgebracht, Mylady?« Ashes tiefe Stimme klang missbilligend, und die Bemerkung ließ ihn leicht pulsieren. »Wer würde so etwas tun?«
»Ich weiß es nicht, aber … etwas stimmt nicht. Das hier wirkt nicht wie ein Hof, der in Trauer ist. Nimm zum Beispiel die Königin. Sie hat kein bisschen verzweifelt gewirkt, als sie sich mit mir unterhalten hat, dabei würde man meinen, sie sollte zumindest ein wenig von dem Umstand mitgenommen sein, dass gestern ihr Sohn gestorben ist.«
»Dafür gibt es eine einfache Erklärung, Mylady. Königin Eshen ist nicht Prinz Raodens Mutter. Raoden stammt von Iadons erster Gattin, die seit über zwölf Jahren tot ist.«
»Wann hat er wieder geheiratet?«
»Gleich nach der Reod«, sagte Ashe. »Nur ein paar Monate nach seiner Thronbesteigung.«
Sarene runzelte die Stirn. »Ich finde das Ganze trotzdem verdächtig«, entschied sie und griff unbeholfen nach hinten, um sich das Kleid im Rücken zuzuknöpfen. Dann betrachtete sie sich im Spiegel und musterte das Resultat kritisch. »Na ja, zumindest passt es – auch wenn ich darin blass aussehe. Ich hatte schon Angst, dass es mir bloß bis zu den Knien gehen würde. Diese arelischen Frauen sind alle so unnatürlich klein.«
»Wie Ihr meint, Mylady«, erwiderte Ashe. Er wusste so gut wie sie, dass arelische Frauen nicht ungewöhnlich klein waren. Selbst in Teod hatte Sarene die meisten anderen Frauen um einen Kopf überragt. Ihr Vater hatte sie als Kind immer Lekystange genannt – wobei es sich um die Bezeichnung für die dünne Latte handelte, die bei seinem Lieblingssport die Torlinie markierte. Obwohl Sarene im Laufe des Heranwachsens ein wenig fülliger geworden war, ließ sich nicht bestreiten, dass sie immer noch schlaksig und hoch aufgeschossen war.
»Mylady«, unterbrach Ashe ihre Überlegungen.
»Ja, Ashe?«
»Euer Vater möchte unbedingt mit euch sprechen. Ich meine, Ihr habt Neuigkeiten zu berichten, auf die er ein Anrecht hat.«
Sarene nickte und unterdrückte ein Seufzen. Ashe fing hell zu pulsieren an. Einen Augenblick später wurde die Lichtkugel, aus der er bestand, zu einem büstenhaften, leuchtenden Kopf. König Eventeo von Teod.
»Ene?«, fragte ihr Vater, wobei sich die Lippen des schimmernden Kopfes bewegten. Er war ein kräftiger Mann mit ovalem Gesicht und einem breiten Kinn.
»Ja, Vater. Ich bin hier.« Ihr Vater musste neben einem ähnlichen Seon stehen – wahrscheinlich Dio –, das sich in ein leuchtendes Abbild von Sarenes Kopf verwandelt hatte.
»Bist du nervös wegen der Hochzeit?«, fragte Eventeo besorgt.
»Tja, also apropos Hochzeit …«, sagte sie langsam. »Ihr werdet wohl eure Reisepläne nächste Woche am besten absagen. Es würde nicht viel für euch zu sehen geben.«
»Was?«
Ashe hatte recht gehabt; ihr Vater lachte keineswegs, als er vernahm, dass Raoden gestorben war. Stattdessen färbte heftige Besorgnis seine Stimme, und das leuchtende Gesicht sah beunruhigt aus. Seine Sorge nahm noch zu, als Sarene erklärte, dass der Tod des Prinzen gleichbedeutend mit einer richtigen Hochzeit war.
»Oh, Ene, es tut mir leid«, sagte ihr Vater. »Ich weiß, wie viel du dir von dieser Hochzeit erwartet hattest.«
»Unsinn, Vater!« Eventeo kannte sie viel zu gut. »Ich war dem Mann noch nicht einmal begegnet. Wie sollte ich da irgendwelche Erwartungen hegen?«
»Du warst ihm noch nicht begegnet, aber du hattest dich per Seon mit ihm unterhalten, und ihr hattet euch all die Briefe geschrieben. Ich kenne dich, Ene. Du bist eine Romantikerin. Du hättest dich nie entschlossen, diese Sache durchzuziehen, wenn du nicht völlig überzeugt gewesen wärest, dass du Raoden lieben könntest.«
Die Worte waren wahr, und mit einem Schlag kehrte Sarenes Gefühl der Einsamkeit zurück. Die Überfahrt über das Fjordische Meer hatte sie in ständiger ungläubiger Nervosität zugebracht. Sie war sowohl freudig erregt als auch ängstlich gewesen, was das bevorstehende Treffen mit dem Mann betraf, der ihr Ehemann werden sollte. Allerdings hatte die Vorfreude die Ängstlichkeit überwogen.
Sie war schon des Öfteren von Teod fort gewesen, aber immer in Begleitung anderer Menschen aus ihrer Heimat. Diesmal war sie allein unterwegs, da sie der Hochzeitsgesellschaft vorausgereist war, um Raoden zu überraschen. Sie hatte die Briefe des Prinzen so oft gelesen und wieder gelesen, dass sie allmählich das Gefühl entwickelt hatte, ihn zu kennen. Und der Mensch, den sie sich anhand dieser Briefseiten zusammengesetzt hatte, war ein vielschichtiger, mitfühlender Mann, auf dessen Bekanntschaft sie sich schon sehr gefreut hatte.
Und nun würde sie ihn niemals kennenlernen. Sie fühlte sich nicht nur allein, sondern noch dazu verschmäht – wieder einmal. Ungewollt. Sie hatte all die Jahre gewartet, von einem nachsichtigen Vater ungedrängt, der nicht ahnte, wie sehr die Männer in ihrer Heimat sie mieden, wie sie sich von ihrer kecken, ja arroganten Art verschrecken ließen. Zu guter Letzt hatte sie einen Mann gefunden, der gewillt war, sie zu nehmen, und Domi hatte ihn ihr im letzten Augenblick entrissen.