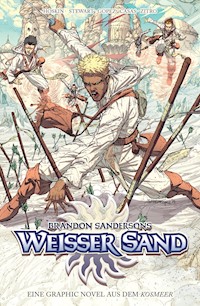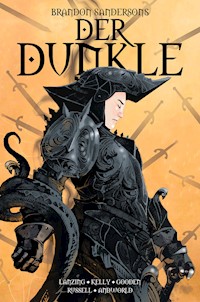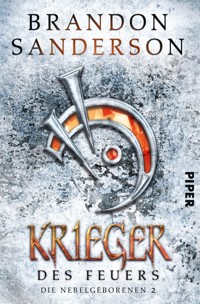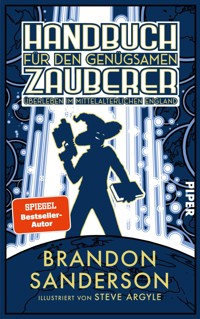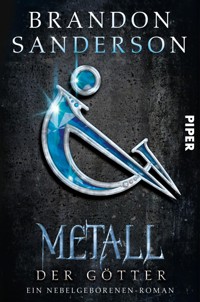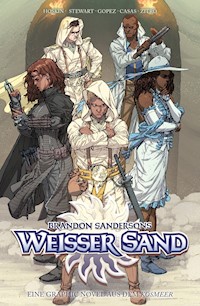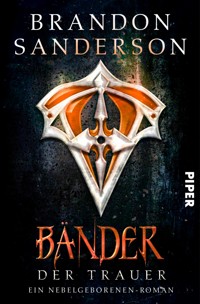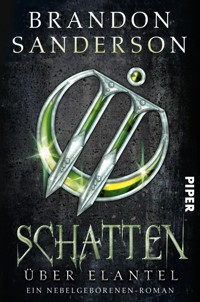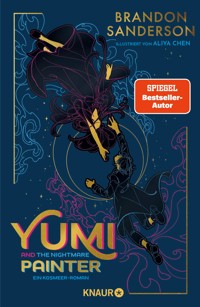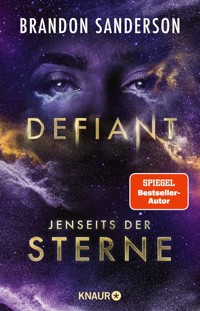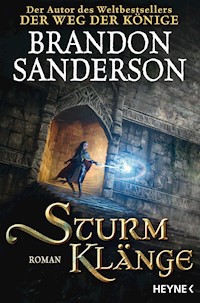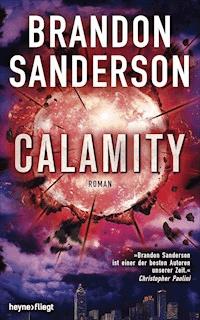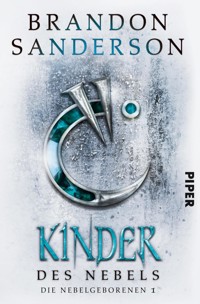
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Fesselnd und magisch: der fulminante Auftakt zu einer atemberaubenden Fantasy-Saga von Brandon Sanderson Die Landschaft ist von Asche bedeckt, der Himmel blutrot. Nachts steigen geheimnisvolle Nebel vom Boden auf. Diese düstere Welt, das Letzte Reich, regiert der Oberste Herrscher schon seit über tausend Jahren mit eiserner Faust. Das Volk der Skaa hält der grausame Despot als Sklaven, die Oberschicht wird von sogenannten Obligatoren und Inquisitoren kontrolliert. Es scheint, als hätte das Böse endgültig die Oberhand über die Welt gewonnen. Doch dann taucht ein junger Mann namens Kelsier auf, ein Nebelgeborener. Er will den Obersten Herrscher endgültig vernichten – mithilfe der Skaa und seiner neuen Magie, der Allomantie: Nebelgeborene können mithilfe von Metallen magische Fähigkeiten entwickeln. Stoffe wie Eisen, Stahl, Zinn, Zink, Messing oder Bronze lassen ihre Sinne schärfer werden oder ihre Kräfte wachsen. Mit vereinten magischen Kräften wollen die Skaa um Kelsier und seine Schülerin Vin das Unvorstellbare wagen und den seit Urzeiten waltenden Alleinherrscher stürzen. Vielschichtig und fesselnd: High-Fantasy-Welten von Brandon Sanderson High Fantasy oder epische Fantasy bezeichnet Fantasy, die in einer magischen, uns völlig fremden Welt spielt. Wie J.R.R. Tolkien mit seinem Mittelerde oder Robert Jordan mit Rad der Zeit entwirft auch Brandon Sanderson mit beeindruckender Vorstellungskraft und Liebe zum Detail ebenso komplexe wie anschauliche Welten und magische Systeme. Einstieg in die Nebelgeborenen-Saga voller Magie und Metalle Nach seinem gefeierten Debütroman »Elantris« legt Fantasy-Autor Brandon Sanderson mit der Trilogie um die mit magischen Fähigkeiten kämpfenden Nebelgeborenen nach. »Die Kinder des Nebels« ist der gelungene, temporeiche Einstieg in die Welt des Letzten Reiches, in dem eine Gruppe Abtrünniger versucht, die Welt von ihrem grausamen Herrscher zu befreien. *** Weitere Bände der Reihe *** Erstes Zeitalter der Nebelgeborenen: Kinder des Nebels (Band 1) Krieger des Feuers (Band 2) Held aller Zeiten (Band 3) Zweites Zeitalter der Nebelgeborenen (»Wax & Wayne«-Reihe): Hüter des Gesetzes (Band 4) (vormals erschienen als: Jäger der Macht) Schatten über Elantel (Band 5) Bänder der Trauer (Band 6) Metall der Götter (Band 7)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1146
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Michael Siefener
ISBN 978-3-492-99086-8
© Brandon Sanderson 2006
Titel der amerikanischen Originalausgabe : »Mistborn – The Final Empire 1«, Tor Books, New York 2006
© Piper Verlag GmbH, München 2018
Erstmals erschienen im Wilhelm Heyne Verlag, München 2009
Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Michael Siefener liegen beim Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Karten und Illustrationen: Isaac Stewart
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/ oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
Erster Teil – Der Überlebende von Hathsin
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Zweiter Teil – Rebellen unter einem Himmel aus Asche
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Dritter Teil – Kinder einer blutenden Sonne
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Vierter Teil – Tänzer in einem Meer aus Nebel
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Fünfter Teil – Glaubende an eine vergessene Welt
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Epilog
Ars Arcanum
Allomantisches Kurzglossar
Danksagung
Für Beth Sanderson,
die schon länger Fantasy liest,
als ich auf der Welt bin.
Und die es verdient hat,
einen Enkel zu haben,
der genauso verrückt ist wie sie …
Manchmal befürchte ich, dass ich nicht der Held bin, den alle in mir sehen.
Die Philosophen versichern mir, die Zeit sei gekommen, und die Zeichen seien eindeutig. Aber ich frage mich immer noch, ob sie nicht den falschen Mann haben. So viele Menschen sind von mir abhängig. Sie sagen, ich halte die Zukunft der gesamten Welt in den Händen.
Was würden sie wohl sagen, wenn sie wüssten, dass ihr Meister – der größte Held aller Zeiten, ihr Retter – an sich selbst zweifelt? Vielleicht wären sie gar nicht mal entsetzt. Und genau das ist es, was mir in gewisser Hinsicht die meisten Sorgen bereitet. Vielleicht zweifeln sie in ihren Herzen ebenfalls – genau wie ich.
Sehen sie in mir einen Lügner?
Prolog
Asche fiel vom Himmel.
Graf Tresting runzelte die Stirn und sah hinauf zum rötlichen Mittagshimmel, während er über sich und seinem geschätzten Gast einen Schirm aufspannte. Ascheregen war nicht ungewöhnlich im Letzten Reich, doch Tresting hatte gehofft, Rußflecken auf seinem neuen Mantel und der roten Weste vermeiden zu können, die vor kurzem mit dem Kanalboot direkt aus Luthadel eingetroffen waren. Zum Glück war es nicht sehr windig; der Schirm würde also das Schlimmste abhalten.
Tresting stand mit seinem Gast auf einer kleinen Terrasse, welche vom Hügel aus die Felder überblickte. Hunderte Menschen in braunen Kitteln arbeiteten in der niedergehenden Asche und kümmerten sich um das Getreide. Ihren Bemühungen haftete etwas Schwerfälliges an, aber so waren die Skaa nun einmal. Diese Bauern waren ein träger, unproduktiver Haufen. Sie beschwerten sich natürlich nicht, dazu waren sie nicht dumm genug. Sie arbeiteten einfach mit gebeugten Köpfen weiter und gingen teilnahmslos ihren Tätigkeiten nach. Die Peitsche des Zuchtmeisters vermochte sie für kurze Zeit zu entschiedeneren Bewegungen anzutreiben, doch sobald er weiterging, verfielen sie wieder in ihre gewohnte Mattigkeit.
Der Graf wandte sich an den Mann, der neben ihm auf dem Hügel stand. »Man sollte doch glauben, dass mehr als tausend Jahre Feldarbeit sie etwas effektiver gemacht hätten«, bemerkte er.
Der Obligator nickte und hob eine Braue. Es war, als sei diese knappe Bewegung nur geschehen, um sein charakteristischstes Merkmal zu unterstreichen: verschlungene Tätowierungen, welche die Haut um die Augen herum bedeckten. Diese Tätowierungen waren enorm; sie reichten bis hoch zur Stirn und setzten sich auch an den Nasenflügeln fort. Er war ein Prälan – ein wirklich sehr wichtiger Obligator. Im Haus hatte Tresting seine eigenen Obligatoren, doch sie waren nur niedere Würdenträger und trugen kaum mehr als ein paar eintätowierte Zeichen um die Augen. Dieser Mann hier war mit demselben Kanalboot aus Luthadel eingetroffen, das auch Trestings neue Kleider befördert hatte.
»Ihr solltet erst einmal die Stadt-Skaa sehen«, meinte der Obligator, während er sich umdrehte und die Skaa-Arbeiter beobachtete. »Diese hier sind eigentlich recht emsig, wenn man sie mit denen in Luthadel vergleicht. Ihr habt eine größere …, will sagen, eine direkte Kontrolle über Eure Skaa hier. Was glaubt Ihr, wie viele habt Ihr diesen Monat verloren?«
»Etwa ein halbes Dutzend«, sagte Tresting. »Einige sind an den Schlägen gestorben, andere an Erschöpfung.«
»Flüchtige?«
»Niemals!«, betonte Tresting. »Kurz nachdem ich das Land von meinem Vater geerbt habe, gab es ein paar Ausreißer. Ich habe ihre gesamten Familien hinrichten lassen. Da hat der Rest schnell den Mut verloren. Ich habe nie begriffen, wie man mit den Skaa Schwierigkeiten haben kann. Meiner Meinung nach sind diese Kreaturen einfach zu kontrollieren, wenn man nur hart genug durchgreift.«
Der Obligator nickte; er bewegte sich kaum in seiner grauen Robe. Anscheinend war er zufrieden, was ein gutes Zeichen war. Die Skaa waren streng genommen nicht Trestings Eigentum. Wie alle Skaa gehörten sie dem Obersten Herrscher. Tresting hatte die Arbeiter nur von seinem Gott gemietet, so wie er auch für die Dienste der Obligatoren Seiner Majestät bezahlen musste.
Der Obligator senkte den Blick auf seine Taschenuhr und schaute dann hoch zur Sonne. Trotz des Ascheregens war es heute sehr hell; die Sonne leuchtete in einem strahlenden Karmesinrot hinter der rauchigen Schwärze des oberen Himmels. Tresting zog ein Taschentuch hervor und wischte sich damit über die Stirn. Er war dankbar für den Schatten unter dem Schirm, der ihn ein wenig vor der Mittagshitze schützte.
»Sehr gut, Tresting«, meinte der Obligator. »Ich werde Euren Vorschlag wie gewünscht Graf Wager unterbreiten. Er wird von mir einen wohlwollenden Bericht über Eure Tätigkeit hier erhalten.«
Tresting unterdrückte einen Seufzer der Erleichterung. Es bedurfte immer eines Obligators, um einen Vertrag oder sonstige geschäftliche Vereinbarungen zwischen Adligen zu bezeugen. Natürlich hätte auch einer der niederen Obligatoren, wie Tresting sie selbst beschäftigte, ein solcher Zeuge sein können, doch es war viel besser, Straff Wagers eigenen Obligator zu beeindrucken.
Der Obligator drehte sich zu ihm um. »Ich werde heute Nachmittag mit dem Kanalboot abreisen.«
»Jetzt schon?«, fragte Tresting. »Wollt Ihr nicht bis zum Abendessen bleiben?«
»Nein«, entgegnete der Obligator. »Allerdings gibt es da noch eine Sache, über die ich mit Euch sprechen muss. Ich bin nicht nur auf Geheiß von Graf Wager hergekommen, sondern auch, weil ich mich um eine Angelegenheit der Bezirksinquisition zu kümmern habe. Es läuft das Gerücht um, dass Ihr mit Euren Skaa-Frauen zu tändeln beliebt.«
Tresting spürte, wie Kälte in ihm hochkroch.
Der Obligator lächelte. Vermutlich sollte es entwaffnend wirken, doch Tresting empfand es als unheimlich. »Seid unbesorgt, Tresting«, beschwichtigte der Obligator. »Wenn man sich über Eure Taten wirklich Gedanken machen würde, dann hätte man an meiner statt einen Stahlinquisitor hergeschickt.«
Tresting nickte langsam. Inquisitor. Er hatte noch nie eines dieser unheimlichen Geschöpfe gesehen, aber er hatte viele Geschichten über sie gehört.
»Ich habe keine weiteren Fragen mehr, was Euren Umgang mit den Skaa-Frauen angeht«, meinte der Obligator und betrachtete wieder die Felder. »Was ich hier gesehen und gehört habe, weist darauf hin, dass Ihr hinterher aufzuräumen pflegt. Ein Mann wie Ihr – so effizient und leistungsfähig – könnte es in Luthadel weit bringen. Noch ein paar Jahre Arbeit, ein paar kluge Handelsgeschäfte, und … wer weiß?«
Der Obligator wandte sich von ihm ab, und Tresting lächelte. Das war zwar kein Versprechen, ja nicht einmal eine Prophezeiung – Obligatoren waren eher als Bürokraten und Zeugen tätig denn als Priester –, aber ein solches Lob aus dem Munde eines Dieners des Obersten Herrschers zu hören … Tresting wusste, dass manche Adligen die Obligatoren als beunruhigend erachteten – einige empfanden sie sogar als Ärgernis –, doch in diesem Augenblick hätte Tresting seinen vornehmen Gast küssen können.
Er wandte den Blick wieder auf die Skaa, die still unter der blutigen Sonne und den träge niedersegelnden Ascheflocken arbeiteten. Tresting war seit je einer jener Landadligen, die auf ihren Anwesen wohnten und davon träumten, irgendwann nach Luthadel zu ziehen. Er hatte von den Bällen und anderen Festlichkeiten gehört, vom Glanz und den Intrigen, und all das begeisterte ihn geradezu unmäßig.
Heute Nacht werde ich feiern, dachte er. Da gab es dieses junge Mädchen aus der vierzehnten Hütte, das er schon seit einiger Zeit beobachtete …
Er lächelte abermals. Noch ein paar Jahre Arbeit, hatte der Obligator gesagt. Vielleicht konnte Tresting sein Ziel schneller erreichen, wenn er etwas härter arbeitete? In der letzten Zeit war seine Skaa-Bevölkerung angewachsen. Wenn er sie ein wenig stärker antrieb, konnte er möglicherweise in diesem Sommer eine zusätzliche Ernte einbringen und den Vertrag mit Graf Wager schneller erfüllen.
Tresting nickte, während er die Masse der trägen Skaa beobachtete. Einige arbeiteten mit Hacken, andere auf Händen und Knien und wischten die Asche von dem knospenden Getreide. Sie beschwerten sich nicht. Sie hofften nichts. Sie wagten kaum zu denken. So sollte es sein, denn sie waren Skaa. Sie waren …
Tresting erstarrte, als einer der Skaa plötzlich aufschaute. Der Mann begegnete Trestings Blick, und ein Funke – nein, ein ganzes Feuer – des Trotzes zeigte sich in seiner Miene. So etwas hatte Tresting noch nie gesehen, jedenfalls nicht im Gesicht eines Skaa. Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück. Eiseskälte durchfuhr ihn, als der seltsame, hoch aufgerichtete Skaa seinem Blick standhielt.
Und lächelte.
Tresting schaute weg. »Kurdon!«, rief er.
Der stämmige Zuchtmeister rannte den Hang hoch. »Ja, Herr?«
Tresting drehte sich um und deutete auf …
Er runzelte die Stirn. Wo hatte dieser Skaa gestanden? Wenn sie mit gebeugtem Kopf arbeiteten und ihre Körper von Ruß und Schweiß bedeckt waren, konnte man sie so schwer auseinanderhalten. Er glaubte, den Platz zu kennen, wo der … ein leerer Platz, an dem nun niemand mehr stand.
Aber nein, das war unmöglich. Der Mann konnte sich nicht so schnell aus der Gruppe entfernt haben. Wohin hätte er auch gehen sollen? Er musste noch irgendwo dort unten sein und den Kopf nun angemessen gebeugt halten. Doch jener Augenblick der Widerspenstigkeit war unverzeihlich.
»Herr?«, fragte Kurdon noch einmal.
Der Obligator stand neben ihm und sah ihn neugierig an. Es wäre nicht klug, den Mann wissen zu lassen, dass sich einer der Skaa soeben unverschämt verhalten hatte.
»Nimm die Skaa im südlichen Abschnitt etwas härter ran«, befahl Tresting und deutete auf die betreffende Stelle. »Ich sehe, dass sie sogar für Skaa zu träge sind. Peitsch ein paar von ihnen aus.«
Kurdon zuckte die Achseln und nickte. Es gab kaum einen Grund für eine Züchtigung, aber Tresting brauchte auch keinen Grund, wenn er seine Arbeiter auspeitschen lassen wollte.
Sie waren schließlich nur Skaa.
Kelsier hatte die Geschichten gehört.
Er hatte Geflüster über lange vergangene Zeiten gelauscht, als die Sonne noch nicht rot gewesen war. Geschichten über Zeiten, in denen der Himmel nicht voller Rauch und Asche gewesen war, in denen die Pflanzen nicht um ihr Wachsen und Gedeihen hatten kämpfen müssen und in denen die Skaa keine Sklaven gewesen waren. Doch diese Zeiten waren beinahe vergessen. Sogar die Legenden darüber wurden immer verschwommener.
Kelsier beobachtete die Sonne. Sein Blick folgte der riesigen roten Scheibe, die nun auf den westlichen Horizont zukroch. Still stand er eine Weile da, allein auf dem verlassenen Feld. Das Tagwerk war getan, die Skaa waren zurück in ihre Hütten getrieben worden. Bald würden die Nebel kommen.
Er seufzte, drehte sich um und nahm seinen Weg durch Furchen und über Pfade, vorbei an den großen Aschehaufen. Er vermied es sorgsam, auf die Pflanzen zu treten, doch er wusste nicht recht, warum er sich diese Mühe machte. Das Getreide schien der Mühen kaum wert. Es war blass, hatte verwelkte braune Blätter und schien genauso niedergedrückt zu sein wie diejenigen, die sich um es kümmerten.
Die Hütten der Skaa erhoben sich vor ihm im schwindenden Licht. Schon sah Kelsier, wie sich die Nebel bildeten, wie sie die Luft verwölkten und den hügelartigen Gebäuden ein unwirkliches Aussehen verliehen. Die Hütten waren unbewacht; es war nicht nötig, Wachen aufzustellen, denn kein Skaa wagte sich nach draußen, sobald die Nacht angebrochen war. Die Angst vor den Nebeln war zu stark.
Irgendwann muss ich sie davon befreien, dachte Kelsier, während er sich einem der größeren Gebäude näherte. Doch alles zu seiner Zeit. Er zog die Tür auf und schlüpfte nach drinnen.
Sofort verstummte das Gespräch. Kelsier schloss die Tür hinter sich und lächelte die etwa dreißig Skaa an, die sich in dem Raum befanden. In der Mitte brannte ein schwaches Feuer, und der große Kessel darüber war angefüllt mit Wasser, in dem Gemüse schwamm – die Vorbereitungen für das Abendessen. Natürlich würde die Suppe sehr dünn sein, wie immer, aber ihr Geruch war köstlich.
»Guten Abend allerseits«, sagte Kelsier mit einem Lächeln, stellte das Gepäck neben sich und lehnte sich gegen die Tür. »Wie war euer Tag?«
Seine Worte brachen die Stille auf, und die Frauen machten sich wieder an die Zubereitung des Abendessens. Eine Gruppe Männer saß um einen grob gezimmerten Tisch und warf Kelsier unzufriedene Blicke zu.
»Unser Tag war mit Arbeit angefüllt, Reisender«, sagte Tepper, einer der Skaa-Ältesten. »Der bist du irgendwie entronnen.«
»Ich habe nie großen Gefallen an Feldarbeit gefunden«, erwiderte Kelsier. »Sie ist viel zu hart für meine zarte Haut.« Er grinste und hob Hände und Arme, die mit vielen Schichten dünner Narben bedeckt waren. Sie verliefen der Länge nach an den Armen, als ob sie von einem wilden Tier zerfleischt worden wären.
Tepper schnaubte verächtlich. Für einen Ältesten war er noch recht jung, kaum vierzig und höchstenfalls fünf Jahre älter als Kelsier. Doch der dünne Mann hatte das Gehabe von jemandem, der es gewohnt war zu befehlen und dies gern tat.
»Es ist nicht die Zeit für Leichtfertigkeiten«, sagte Tepper streng. »Wenn wir einen Reisenden beherbergen, erwarten wir von ihm, dass er sich benimmt und jedes Aufsehen vermeidet. Als du dich heute Morgen von den Feldern fortgeschlichen hast, hätte das den Männern in deiner Nähe eine Auspeitschung einbringen können.«
»Stimmt«, meinte Kelsier. »Aber sie hätten auch ausgepeitscht werden können, weil sie am falschen Ort standen, weil sie eine zu lange Pause eingelegt hatten oder husteten, als der Zuchtmeister vorbeiging. Ich habe einmal gesehen, wie ein Mann ausgepeitscht wurde, nur weil sein Herr behauptete, er habe ›unangemessen gezwinkert‹.«
Tepper saß steif und mit zusammengekniffenen Augen da und hatte einen Arm auf den Tisch gelegt. Sein Blick war unnachgiebig.
Kelsier seufzte und rollte mit den Augen. »Bestens. Wenn ihr wollt, dass ich gehe, mache ich mich gleich wieder auf den Weg.« Er warf sich das Gepäck über die Schulter und zog unbekümmert die Tür auf.
Sofort quoll dichter Nebel durch die offen stehende Pforte, umschmiegte Kelsiers Körper, sank zu Boden und kroch wie ein zögerliches Tier über den Lehm. Einige keuchten entsetzt auf, doch die meisten waren so verblüfft, dass sie nicht das geringste Geräusch von sich gaben. Kelsier stand eine Weile da und schaute hinaus in den düsteren Nebel, dessen kreisende Strömungen von den glühenden Kohlen des Kochfeuers schwach erhellt wurden.
»Mach die Tür zu.« Teppers Worte waren kein Befehl, sondern eine Bitte.
Kelsier entsprach ihr, drückte die Tür zu und unterbrach damit den Strom des weißen Dunstes. »Der Nebel ist nicht das, was ihr glaubt. Ihr habt viel zu viel Angst vor ihm.«
»Diejenigen, die sich in den Nebel hineinwagen, verlieren ihre Seele«, flüsterte eine Frau. Ihre Worte warfen eine Frage auf. War Kelsier durch den Nebel gewandert? Wenn ja, was war mit seiner Seele geschehen?
Wenn ihr nur wüsstet, dachte Kelsier. »Das heißt wohl, dass ich bleiben soll.« Er bedeutete einem Jungen mit einem Wink, ihm einen Schemel zu bringen. »Das ist gut, denn es wäre eine Schande gewesen, wenn ich hätte gehen müssen, ohne euch meine Neuigkeiten mitzuteilen.«
Mehr als nur ein Skaa schaute bei dieser Bemerkung auf. Das war der wahre Grund, aus dem sie seine Anwesenheit ertrugen – warum selbst die ängstlichen Landarbeiter einen Mann wie Kelsier beherbergten, einen Skaa, der dem Willen des Obersten Herrschers trotzte, indem er von einer Plantage zur nächsten zog. Er mochte zwar ein Abtrünniger und eine Gefahr für die ganze Gemeinschaft sein, doch er brachte Neuigkeiten aus der Welt da draußen mit.
»Ich komme gerade aus dem Norden«, sagte Kelsier. »Aus den Ländern, in denen die Hand des Obersten Herrschers nicht so deutlich spürbar ist wie hier.« Er redete mit klarer Stimme, und die Leute beugten sich unwillkürlich in seine Richtung, während sie arbeiteten. Am kommenden Tag würden Kelsiers Worte vor den mehreren hundert Skaa wiederholt werden, die in den anderen Hütten lebten. Die Skaa mochten zwar unterjocht sein, aber sie waren unheilbar geschwätzig.
»Im Westen herrschen örtliche Grafen«, erklärte Kelsier, »und sie sind weit vom eisernen Griff des Obersten Herrschers und seiner Obligatoren entfernt. Einige dieser fernen Adligen sind der Ansicht, dass glückliche Skaa besser arbeiten als misshandelte Skaa. Einer von ihnen, Graf Renoux, hat seinen Zuchtmeistern sogar befohlen, ungenehmigte Auspeitschungen zu unterlassen. Es geht das Gerücht um, dass er darüber nachdenkt, seinen Feld-Skaa einen Lohn zu zahlen, wie ihn die Handwerker in der Stadt bekommen.«
»Unsinn«, sagte Tepper.
»Ich bitte um Entschuldigung«, erwiderte Kelsier. »Ich wusste nicht, dass Hausvater Tepper vor kurzem auf Graf Renoux’ Besitzungen war. Als du kürzlich mit ihm zu Abend gegessen hast, muss er dir etwas erzählt haben, das ich noch nicht weiß.«
Tepper errötete. Die Skaa reisten nicht, und auf keinen Fall speisten sie mit Grafen zu Abend. »Du willst mich zum Narren halten, Reisender«, meinte Tepper, »aber ich weiß, was du vorhast. Du bist derjenige, den man den Überlebenden nennt. Die Narben an deinen Armen verraten dich. Du bringst nichts als Schwierigkeiten – du bereist die Plantagen und schürst überall Unzufriedenheit. Du tust dich an unserem Essen gütlich, erzählst uns deine großartigen Geschichten und Lügen, verschwindest wieder und überlässt es Leuten wie mir, die falschen Hoffnungen auszulöschen, die du unseren Kindern aufschwatzt.«
Kelsier hob eine Braue. »Aber, aber, Hausvater Tepper. Deine Sorgen sind vollkommen unbegründet. Ich habe nicht vor, euch das Essen wegzunehmen. Ich habe mein eigenes dabei.« Kelsier ergriff sein Gepäck und warf es vor Teppers Tisch auf die Erde. Der offene Beutel fiel zur Seite, und eine ganze Ansammlung von Lebensmitteln rollte auf den Boden. Feines Brot, Früchte und sogar ein paar dicke, geräucherte Würste befanden sich darunter.
Eine Sommerfrucht rollte über den gestampften Lehmboden und kullerte gegen Teppers Fuß. Der Skaa betrachtete die Frucht mit verblüfftem Blick. »Das ist das Essen eines Adligen!«
Kelsier schnaubte. »Wohl kaum. Wisst ihr, für einen Mann von solchem Rang und Ansehen hat euer Graf Tresting einen bemerkenswert schlechten Geschmack. Seine Speisekammer ist eine Schande für sein Haus.«
Tepper wurde noch blasser. »Dahin bist du also heute Nachmittag verschwunden«, flüsterte er. »Du bist zum Herrenhaus gegangen. Du hast … den Meister bestohlen!«
»Allerdings«, bestätigte Kelsier. »Vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass zwar der Geschmack eures Grafen beklagenswert ist, was das Essen angeht, aber sein Auge für gute Soldaten erheblich besser ist. Es war eine große Herausforderung für mich, bei Tageslicht in sein Haus zu schleichen.«
Tepper starrte noch immer den Sack mit den Nahrungsmitteln an. »Wenn die Zuchtmeister das hier finden …«
»Dann schlage ich vor, dass ihr es verschwinden lasst«, meinte Kelsier. »Ich wette, es schmeckt etwas besser als eure verwässerte Gemüsesuppe.«
Zwei Dutzend gierige Blicke verschlangen die Lebensmittel. Falls Tepper noch etwas hatte einwenden wollen, dann war er nicht schnell genug, denn sein Schweigen wurde allgemein als Zustimmung gedeutet. Innerhalb weniger Minuten war der Inhalt des Beutels untersucht und verteilt worden, und der Suppentopf stand blubbernd und unbeachtet auf dem Feuer, während die Skaa nun ein viel exotischeres Mahl genossen.
Kelsier lehnte sich gegen die hölzerne Wand der Hütte und sah den Leuten dabei zu, wie sie ihr Essen gierig verzehrten. Er hatte die Wahrheit gesagt: Das Angebot aus der gräflichen Speisekammer war bedrückend alltäglich. Doch das hier war ein Volk, das seit seiner Kindheit nichts als Suppe und Haferschleim kannte. Für sie waren Brot und Früchte seltene Delikatessen, die sie in der Regel höchstens als verdorbene Überreste von den Hausdienern erhielten.
»Deine Geschichte ist unterbrochen worden, junger Mann«, bemerkte ein ältlicher Skaa, der nun heranhumpelte und sich auf einen Schemel neben Kelsier setzte.
»Ich nehme an, dafür ist später noch Zeit«, sagte Kelsier. »Sobald auch der letzte Beweis meines Diebstahls verzehrt ist. Möchtest du nichts davon haben?«
»Das ist nicht nötig«, erwiderte der alte Mann. »Als ich das letzte Mal Grafenessen probiert habe, hatte ich danach drei Tage Bauchschmerzen. Neue Geschmäcker sind wie neue Ideen. Je älter man ist, desto schwieriger ist es, sie zu verdauen.«
Kelsier schwieg darauf. Der alte Mann bot wahrlich keinen beeindruckenden Anblick. Seine ledrige Haut und seine Glatze ließen ihn eher gebrechlich als weise erscheinen. Doch er musste stärker sein, als er aussah, denn nur wenige Plantagen-Skaa wurden so alt wie er. Viele Grafen duldeten es nicht, dass die Alten der täglichen Arbeit fernblieben, und die regelmäßigen Auspeitschungen, die zum Leben eines Skaa gehörten, setzten den Älteren schrecklich zu.
»Wie ist noch gleich dein Name?«, fragte Kelsier.
»Mennis.«
Kelsier warf Tepper einen Blick zu. »Also, Hausvater Mennis, verrate mir etwas. Warum überlässt du ihm die Führung?«
Mennis zuckte die Schultern. »Wenn du in mein Alter kommst, wirst auch du dir genau überlegen, womit du deine Kraft vergeudest. Manche Schlacht ist es nicht wert, dass sie geschlagen wird.« Es lag etwas Unausgesprochenes in Mennis’ Blick; er redete von Dingen, die größer waren als sein eigener Kampf mit Tepper.
»Dann seid ihr also zufrieden?«, fragte Kelsier und deutete mit dem Kopf auf das Innere der Hütte und ihre halbverhungerten, überarbeiteten Bewohner. »Ihr seid zufrieden mit einem Leben voller Auspeitschungen und endloser Plackerei?«
»Wenigstens ist es ein Leben«, erwiderte Mennis. »Ich weiß, welchen Lohn Unzufriedenheit und Rebellion bringen. Das Auge des Obersten Herrschers und der Zorn des Stahlamtes können viel schrecklicher sein als ein paar Peitschenschläge. Männer wie du predigen die Veränderung, aber ich frage mich, ob dies ein Kampf ist, den wir überhaupt ausfechten können.«
»Du befindest dich bereits mitten in diesem Kampf, Hausvater Mennis. Und du bist gerade dabei, ihn auf furchtbare Weise zu verlieren.« Kelsier zuckte die Achseln. »Aber was weiß ich schon? Ich bin nur ein reisender Bösewicht, der euch das Essen wegnimmt und eure Jugend zu beeindrucken versucht.«
Mennis schüttelte den Kopf. »Du machst Scherze darüber, aber Tepper könnte Recht haben. Ich fürchte, dein Besuch wird uns nichts als Kummer bringen.«
Kelsier lächelte. »Aus diesem Grunde habe ich ihm nicht widersprochen – wenigstens nicht, was die Schwierigkeiten angeht, die ich mache.« Er hielt inne, und sein Lächeln wurde breiter. »Ich würde sogar sagen, dass Teppers diesbezügliche Bemerkung das einzig Vernünftige ist, das er seit meiner Ankunft gesagt hat.«
»Wie machst du das?«
»Was?«
»So viel lächeln.«
»Ach, ich bin einfach nur ein glücklicher Mensch.«
Mennis schaute auf Kelsiers Hände. »Weißt du, solche Narben habe ich bisher nur an einem einzigen anderen Mann gesehen – und der ist schon tot. Sein Leichnam wurde an Graf Tresting zurückgeschickt als Beweis dafür, dass seine Bestrafung erfolgt war.« Mennis sah auf zu Kelsier. »Er wurde dabei erwischt, wie er von Rebellion sprach. Tresting hat ihn in die Gruben von Hathsin geschickt, wo er bis zu seinem Tod gearbeitet hat. Der Knabe hat weniger als einen Monat durchgehalten.«
Kelsier schaute herunter auf seine Hände und Unterarme. Manchmal brannten sie noch, aber er war sicher, dass der Schmerz nur in seinem Kopf existierte. Er schaute auf zu Mennis und lächelte. »Du fragst, warum ich lächle, Hausvater Mennis? Nun, der Oberste Herrscher glaubt, er hat alles Lachen und alle Freude allein für sich gepachtet. Ich habe nicht vor, ihm das zuzugestehen. Das ist wenigstens einmal eine Schlacht, die nicht so viele Mühen erfordert.«
Mennis starrte Kelsier an, und für einen Augenblick glaubte Kelsier, der alte Mann würde sein Lächeln erwidern. Doch schließlich schüttelte Mennis nur den Kopf. »Ich weiß nicht. Ich …«
Das Brüllen schnitt ihm die Worte ab. Es kam von draußen, vielleicht aus nördlicher Richtung, auch wenn der Nebel alle Geräusche verzerrte. Die Leute in der Hütte verstummten und lauschten den schwachen, hohen Schreien. Trotz der Entfernung und des Nebels hörte Kelsier den Schmerz, der in diesen Schreien steckte.
Kelsier verbrannte Zinn.
Nach den vielen Jahren der Übung fiel es ihm leicht. Das Zinn befand sich zusammen mit den anderen allomantischen Metallen in seinem Magen. Er hatte sie bereits vor einiger Zeit geschluckt, und nun warteten sie darauf, dass er sie einsetzte. Mit seinem Geist griff er in sich hinein und tastete nach dem Zinn. Dadurch berührte er Mächte, die er immer noch kaum verstand. Das Zinn in ihm flackerte lebhaft auf und brannte in seinem Magen; es war ein Gefühl, als hätte er ein heißes Getränk zu schnell hinuntergestürzt.
Die allomantische Kraft brandete durch seinen Körper und schärfte Kelsiers Sinne. Der Raum um ihn herum wurde ganz deutlich sichtbar, und das schwache Feuer war nun beinahe blendend hell. Er spürte die Maserung des Holzschemels, auf dem er saß. Er schmeckte noch immer die Überreste des Brotlaibs, von dem er vor einiger Zeit gegessen hatte. Wichtiger noch, er hörte die Schreie mit übernatürlich scharfen Ohren. Zwei Frauen schrien; die eine war älter, die andere jünger, vielleicht sogar noch ein Kind. Die jüngeren Schreie entfernten sich immer mehr.
»Arme Jessi«, sagte eine Frau in seiner Nähe; ihre Worte dröhnten in Kelsiers überempfindlichem Gehör. »Dieses Kind war ein Fluch für sie. Es ist besser für eine Skaa, wenn sie keine schönen Töchter hat.«
Tepper nickte. »Es war klar, dass Graf Tresting früher oder später nach dem Mädchen rufen würde. Das haben wir alle gewusst. Auch Jessi.«
»Es ist trotzdem eine Schande«, sagte ein anderer Mann.
Aus der Ferne waren die Schreie weiterhin zu hören. Kelsier verbrannte noch mehr Zinn und vermochte nun die Richtung einzuschätzen. Die Stimme bewegte sich auf das Herrenhaus zu. Das Kreischen weckte etwas in ihm, und er spürte, wie sein Gesicht rot vor Wut wurde.
Kelsier drehte sich um. »Gibt Graf Tresting die Mädchen zurück, wenn er mit ihnen fertig ist?«
Der alte Mennis schüttelte den Kopf. »Graf Tresting ist ein gesetzesfürchtiger Edelmann. Er lässt die Mädchen nach ein paar Wochen umbringen. Schließlich will er nicht die Aufmerksamkeit der Inquisitoren auf sich ziehen.«
So lautete das Gesetz des Obersten Herrschers. Er konnte es sich nicht leisten, Bastardkinder herumlaufen zu lassen – Kinder, die Kräfte besaßen, von denen die Skaa nicht einmal wissen durften, dass sie überhaupt existierten.
Die Schreie verblassten, doch Kelsiers Wut nahm beständig zu. Sie erinnerten ihn an andere Schreie. An die Schreie einer Frau aus seiner Vergangenheit. Ruckartig stand er auf; der Schemel fiel hinter ihm um.
»Vorsichtig, Junge«, sagte Mennis besorgt. »Erinnere dich an das, was ich dir über das Verschwenden von Energie gesagt habe. Du wirst niemals eine Rebellion anführen, wenn du heute Nacht getötet wirst.«
Kelsier warf dem alten Mann einen raschen Blick zu. Dann zwang er sich trotz der Schreie und Schmerzen zu einem Lächeln. »Ich bin nicht hier, um euch zur Rebellion anzustacheln, Hausvater Mennis. Ich will nur Schwierigkeiten machen.«
»Wozu sollte das gut sein?«
Kelsiers Lächeln wurde breiter. »Eine neue Zeit bricht an. Wenn du noch ein wenig weiterlebst, wirst du sehen, dass sich im Letzten Reich große Dinge ereignen. Ich danke euch allen für eure Gastfreundschaft.«
Mit diesen Worten zog er die Tür auf und schritt hinaus in den Nebel.
In den frühen Morgenstunden war Mennis noch immer wach. Je älter er wurde, desto schwieriger schlief er ein. Das war besonders dann so, wenn er sich wegen etwas Sorgen machte, zum Beispiel wegen der Tatsache, dass der Reisende nicht in die Hütte zurückgekehrt war.
Mennis hoffte, dass Kelsier zur Vernunft gekommen und weitergereist war. Doch das war unwahrscheinlich, denn Mennis hatte das Feuer in Kelsiers Augen gesehen. Es war eine Schande, dass ein Mann, der die Gruben überlebt hatte, hier auf einer abgelegenen Plantage den Tod finden würde, indem er ein Mädchen zu schützen versuchte, das alle längst aufgegeben hatten.
Wie würde Graf Tresting reagieren? Es hieß, er sei außerordentlich grob zu allen, die es wagten, ihn bei seinen nächtlichen Vergnügungen zu stören. Falls Kelsier es wirklich gelang, die Freuden des Meisters zu unterbrechen, könnte Tresting durchaus auf den Gedanken kommen, in diesem Zusammenhang all seine Skaa zu bestrafen.
Allmählich erwachten auch die anderen Skaa. Mennis lag auf der harten Erde – seine Knochen schmerzten, der Rücken beschwerte sich, die Muskeln waren erschöpft – und versuchte herauszufinden, ob es sinnvoll war, überhaupt aufzustehen. Jeden Tag gab er den Kampf beinahe auf. Jeden Tag wurde es ein wenig schwieriger. Irgendwann würde er einfach in der Hütte bleiben und warten, bis die Zuchtmeister kamen und all jene töteten, die entweder zu krank oder zu alt für die Arbeit waren.
Aber nicht heute. Er sah zu viel Angst in den Augen der Skaa – sie wussten, dass Kelsiers nächtliche Taten ihnen Schwierigkeiten bringen würden. Sie brauchten Mennis; sie zählten auf ihn. Er musste aufstehen.
Also tat er es. Sobald er sich bewegte, ließen die Schmerzen des Alters ein wenig nach, und es gelang ihm, sich aus der Hütte und auf die Felder zu schleppen, wobei er sich auf einen jüngeren Mann stützte.
Nun fiel ihm ein Geruch in der Luft auf. »Was ist das?«, fragte er. »Riechst du auch den Rauch?«
Schum – der junge Mann, auf den Mennis sich stützte – blieb stehen. Die letzten Überreste des Nachtnebels waren zerstoben, und die rote Sonne stieg hinter dem üblichen Schleier aus schwarzen Wolken am Horizont auf.
»In letzter Zeit rieche ich andauernd Rauch«, sagte Schum. »Die Ascheberge sind in diesem Jahr sehr ungestüm.«
»Nein«, sagte Mennis, der immer besorgter wurde. »Dieser Geruch ist anders.« Er drehte sich nach Norden, wo sich mehrere Skaa versammelten. Er ließ Schum los, watschelte auf die Gruppe zu und wirbelte dabei Staub und Asche auf.
Inmitten der Skaa entdeckte er Jessi. Ihre Tochter, von der alle angenommen hatten, Graf Tresting habe sie genommen, stand neben ihr. Die Augen des jungen Mädchens waren rot vor Schlafmangel, doch sie schien unverletzt zu sein.
»Sie ist zurückgekehrt, nicht lange nachdem man sie geholt hat«, erklärte die Frau soeben. »Sie ist heimgekommen und hat an die Tür geklopft und im Nebel geweint. Flen war sicher, dass es nur ein Nebelgeist ist, der ihre Gestalt angenommen hat, aber ich habe dafür gesorgt, dass sie trotzdem hereingelassen wird! Mir war egal, was er sagt, denn ich hatte sie noch nicht aufgegeben. Ich habe sie heute Morgen hinaus ins Sonnenlicht geführt, und sie ist nicht verschwunden. Das beweist, dass sie kein Nebelgeist ist!«
Mennis taumelte vor der rasch anwachsenden Menge zurück. Begriff es denn niemand? Kein Zuchtmeister eilte herbei, um die Versammlung aufzulösen. Keine Soldaten kamen, um die Morgenzählung vorzunehmen. Irgendetwas stimmte ganz und gar nicht. Ganz außer sich, hastete er auf das Herrenhaus zu.
Als er dort ankam, hatten auch andere bereits die gewundene Rauchsäule bemerkt, die im Morgenlicht nur sehr undeutlich zu sehen war. Mennis war nicht der Erste, der den Rand des kleinen Plateaus auf dem Hügel erreichte, doch bei seinem Eintreffen machte die Gruppe Platz für ihn.
Das Herrenhaus war verschwunden. Nur eine geschwärzte, schwelende Narbe war von ihm geblieben.
»Beim Obersten Herrscher!«, flüsterte Mennis. »Was ist denn hier passiert?«
»Er hat sie alle umgebracht.«
Mennis drehte sich um. Jessis Tochter hatte diese Worte gesprochen. Sie blickte auf das untergegangene Haus, und ihre jugendliche Miene drückte große Zufriedenheit aus.
»Sie waren schon tot, als er mich von hier weggebracht hat«, sagte sie. »Alle miteinander: die Soldaten, die Zuchtmeister, die Adligen … alle tot. Sogar Graf Tresting und seine Obligatoren. Der Meister hatte mich allein gelassen, weil er nachsehen wollte, was das für ein Lärm war. Auf dem Weg nach draußen habe ich ihn in seinem eigenen Blut liegen sehen, mit Stichwunden in der Brust. Der Mann, der mich gerettet hat, hat eine brennende Fackel in das Haus geworfen.«
»Hatte dieser Mann Narben an Händen und Armen, die bis über die Ellbogen reichten?«, fragte Mennis.
Das Mädchen nickte stumm.
»Was für ein Dämon war denn das?«, murmelte einer der Skaa unbehaglich.
»Ein Nebelgeist«, flüsterte ein anderer, der offensichtlich vergessen hatte, dass Kelsier auch bei Tageslicht gesehen worden war.
Aber er ist ja tatsächlich in den Nebel hinausgegangen, dachte Mennis. Und wie hat er das hier zustande bringen können? Graf Tresting besaß über zwei Dutzend Soldaten! Hatte Kelsier vielleicht irgendwo eine Rebellenbande versteckt?
Kelsiers Worte aus der vergangenen Nacht klangen ihm in den Ohren. Es bricht eine neue Zeit an …
»Aber was ist mit uns?«, fragte Tepper entsetzt. »Was passiert mit uns, wenn der Oberste Herrscher davon erfährt? Er wird glauben, dass wir das getan haben. Er wird uns in die Gruben schicken, oder er sendet uns einen Koloss, damit er uns an Ort und Stelle tötet! Warum hat dieser Kerl das getan? Weiß er denn nicht, welchen Schaden er damit angerichtethat?«
»Doch, das weiß er«, sagte Mennis. »Er hat uns gewarnt, Tepper. Er ist hergekommen, um Schwierigkeiten zu machen.«
»Aber warum?«
»Weil er wusste, dass wir niemals aus eigenem Antrieb eine Rebellion anzetteln würden. Jetzt lässt er uns keine andere Wahl mehr.«
Tepper erbleichte.
Oberster Herrscher, dachte Mennis, das kann ich nicht. Ich kann doch morgens kaum noch aufstehen – und schon gar nicht dieses Volk retten.
Doch was blieb ihm anderes übrig?
Mennis drehte sich um. »Hol die Leute zusammen, Tepper. Wir müssen fliehen, bevor die Kunde von dieser Katastrophe den Obersten Herrscher erreicht.«
»Wohin sollen wir denn gehen?«
»Zu den Höhlen im Osten«, schlug Mennis vor. »Die Reisenden sagen, dass sich rebellische Skaa dort versteckt halten. Vielleicht nehmen sie uns auf.«
Tepper wurde noch blasser. »Aber … wir müssten tagelang reisen. Und die Nächte im Nebel verbringen.«
»Entweder tun wir das«, sagte Mennis, »oder wir bleiben hier und sterben.«
Tepper stand eine Weile starr da, und Mennis glaubte schon, der Schock habe ihn überwältigt. Doch dann eilte der jüngere Mann davon und rief wie befohlen die anderen zusammen.
Mennis seufzte und schaute auf die schwankende Rauchsäule, während er Kelsier stumm verfluchte.
Eine neue Zeit, in der Tat.
Erster Teil
Der Überlebende von Hathsin
Ich betrachte mich als einen Mann mit Prinzipien. Aber welcher Mann behauptet das nicht von sich? Selbst der Mörder sieht, wie ich bemerkt habe, seine Taten in gewisser Hinsicht als »moralisch« an.
Vielleicht würde jemand, der über mein Leben liest, mich als einen religiösen Tyrannen bezeichnen. Er könnte mich überheblich nennen. Wieso sollte die Meinung dieses Menschen weniger gelten als meine eigene?
Ich vermute, es läuft alles auf diese eine Tatsache hinaus: Am Ende bin ich derjenige, der die Armeen hat.
Kapitel 1
Asche fiel vom Himmel.
Vin sah zu, wie die flaumigen Flocken durch die Luft trieben. Gemächlich. Sorglos. Frei. Die Rußwolken senkten sich wie schwarze Schneeflocken auf die dunkle Stadt Luthadel herab. Sie trieben in die Ecken, wirbelten in den Brisen umher und stoben in winzigen Windhosen über die Pflastersteine. Sie schienen so unbekümmert zu sein. Wie es wohl wäre, genauso zu sein?
Vin saß still in einem der Wachtlöcher der Mannschaft – in einem verborgenen Alkoven, der in die Ziegelwand des geheimen Unterschlupfs eingelassen war. Ihretwegen konnte gern ein Mitglied der Bande die Straße nach Anzeichen für Gefahr absuchen. Vin war nicht im Dienst; das Wachtloch war lediglich einer der wenigen Orte, an denen sie Einsamkeit finden konnte.
Vin liebte die Einsamkeit. Wenn du allein bist, kann dich niemand betrügen. Das waren Reens Worte gewesen. Ihr Bruder hatte ihr viele Dinge beigebracht und diese stets dadurch untermauert, dass er genau das getan hatte, was er ihr immer vorhergesagt hatte: Er hatte sie betrogen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du es lernen kannst. Jeder wird dich betrügen, Vin. Jeder.
Die Asche fiel weiterhin. Manchmal stellte Vin sich vor, sie selbst wäre wie die Asche oder der Wind oder der Nebel. Wie etwas ohne Gedanken, das einfach nur existierte, das nicht nachdachte, sich nicht sorgte und nicht verletzt wurde. Dann wäre sie … frei.
Aus der Nähe hörte sie ein Schlurfen. Kurz darauf klappte die verborgene Tür in der hinteren Wand der kleinen Kammer auf.
»Vin!«, sagte Ulef, während er den Kopf in den Raum steckte. »Hier bist du! Camon sucht dich schon seit einer halben Stunde.«
Genau das ist der Grund, warum ich mich hier versteckt habe.
»Du solltest dich auf den Weg machen«, sagte Ulef. »Es geht gleich los.«
Ulef war ein schlaksiger Junge, ganz nett auf seine Art, ziemlich naiv, falls man jemanden, der in der Unterwelt aufgewachsen war, wirklich jemals naiv nennen konnte. Das bedeutete natürlich nicht, dass er sie nicht betrügen, verraten und hintergehen würde. Verrat hatte nichts mit Freundschaft zu tun; er war nur eine Frage des Überlebens. Das Leben auf der Straße war hart, und wenn ein Skaa-Häuptling sich davor schützen wollte, erwischt und hingerichtet zu werden, dann musste er praktisch denken.
Und Unbarmherzigkeit war das praktischste aller Gefühle. Auch das hatte Reen gesagt.
»Also?«, fragte Ulef. »Kommst du jetzt? Camon ist schon ziemlich wütend.«
Wann ist er das nicht? Vin nickte jedoch und kletterte aus dem engen, aber tröstlichen Wachtloch. Sie drückte sich an Ulef vorbei, sprang durch die verborgene Tür in einen Korridor und eilte dann durch einen heruntergekommenen Vorratsraum. Er war einer von vielen an der Hinterseite des Ladens, der als Fassade und Schutz diente. Der eigentliche Unterschlupf der Mannschaft befand sich in einer Felshöhle unter dem Gebäude.
Sie verließ den Laden durch eine Hintertür, während Ulef ihr folgte. Sie hatte ein paar Häuserblocks entfernt zu tun, in einem reicheren Viertel der Stadt. Vor ihr lag eine schwierige Aufgabe – eine der schwierigsten, die Vin je zu bewältigen gehabt hatte. Falls Camon nicht erwischt wurde, würde eine Menge für sie dabei herausspringen. Falls doch … nun, Adlige und Obligatoren auszunehmen, war immer ein gefährliches Geschäft, aber sicherlich war es besser, als in einer der Schmieden oder in den Hüttenwerken zu arbeiten.
Vin trat aus der Gasse in eine dunkle, von Wohnhäusern gesäumte Straße in einem der vielen Skaa-Armutsquartiere, die es in dieser Stadt gab. Skaa, die zu krank zum Arbeiten waren, lagen in den Ecken und Gossen; Asche trieb um sie herum. Vin hielt den Kopf gesenkt und zog sich gegen die noch immer fallenden Flocken die Kapuze ihres Umhangs über den Kopf.
Frei. Nein, ich werde niemals frei sein. Dafür hat Reen gesorgt, bevor er gegangen ist.
»Da bist du ja endlich!« Camon hob einen fetten Finger und zeigte damit auf Vins Gesicht. »Wo hast du gesteckt?«
Vin ließ es nicht zu, dass sich Hass oder Auflehnung in ihren Augen zeigten. Sie schaute einfach nur nach unten und entsprach somit Camons Erwartungen. Es gab andere Möglichkeiten, Stärke zu zeigen. Diese Lektion hatte sie allein gelernt.
Camon brummelte leise, hob dann die Hand und versetzte ihr eine heftige Ohrfeige. Die Macht des Schlages warf Vin gegen die Wand, und ihre Wange brannte vor Schmerz. Sie sackte vor der Holzwand zusammen, ertrug die Bestrafung aber schweigend. Noch ein Bluterguss. Sie war stark genug, damit umgehen zu können. Das war ihr schon oft gelungen.
»Hör mir zu«, zischte Camon. »Das hier ist eine wichtige Sache. Es geht um Tausende von Kastlingen – das ist hundertmal mehr Geld, als du wert bist. Ich will nicht, dass du es vermasselst. Verstanden?«
Vin nickte.
Camon betrachtete sie kurz; sein plumpes Gesicht war zornesrot. Schließlich wandte er den Blick von ihr ab und murmelte ein paar unverständliche Worte in sich hinein.
Er war über irgendetwas verärgert – etwas, das nichts mit Vin zu tun hatte. Vielleicht hatte er von dem Skaa-Aufstand im Norden vor einigen Tagen gehört. Themos Tresting, einer der Provinzgrafen, war anscheinend ermordet und sein Haus bis auf die Grundmauern niedergebrannt worden. Solche Unruhen waren schlecht für das Geschäft, denn sie machten die Adligen wachsamer und weniger leichtgläubig. Und das wiederum konnte Camons Gewinn beträchtlich schmälern.
Er sucht nach jemandem, den er bestrafen kann, dachte Vin. Vor einer solchen Sache ist er immer nervös. Sie sah auf zu Camon und schmeckte Blut auf der Lippe. Offenbar hatte sie ihre Gedanken nicht ganz verbergen können, denn er schaute sie aus den Augenwinkeln an und machte ein finsteres Gesicht. Dann hob er die Hand, als wolle er sie noch einmal schlagen.
Vin setzte ein wenig von ihrem »Glück« ein.
Sie verbrauchte nur ein winziges Stück davon; den Rest benötigte sie für die bevorstehende Arbeit. Sie richtete das »Glück« auf Camon und beruhigte damit seine Nervosität. Der Anführer der Mannschaft hielt inne. Er bemerkte Vins innerliche Berührung nicht, doch er spürte ihre Auswirkungen. Einen Augenblick lang stand er reglos da, dann seufzte er, wandte sich von ihr ab und ließ die Hand sinken.
Vin wischte sich über die Lippen, als Camon davonschlurfte. Der Diebesmeister wirkte sehr überzeugend in seinem edlen Anzug. Es war die beeindruckendste Verkleidung, die Vin je gesehen hatte. Ein weißes Hemd steckte unter einer dunkelgrünen Weste mit gravierten Goldknöpfen. Die schwarze Jacke war lang, wie es die gegenwärtige Mode vorschrieb, und dazu trug Camon einen passenden schwarzen Hut. An den Fingern funkelten Ringe, und er trug sogar einen feinen Duellstab. Tatsächlich gelang es Camon ausnehmend gut, einen Adligen darzustellen. Wenn es darum ging, eine Rolle zu spielen, dann waren nur wenige Diebe so gut wie Camon. Vorausgesetzt, er schaffte es, sein Temperament zu zügeln.
Der Raum, in dem sie sich befanden, war weniger beeindruckend. Vin kämpfte sich auf die Beine, während Camon mit einem anderen Mitglied der Mannschaft schimpfte. Sie hatten eine Zimmerflucht im obersten Stock eines örtlichen Hotels gemietet. Es war nicht allzu vornehm, doch das sollte es auch nicht sein. Camon würde die Rolle des Grafen Jedue spielen, eines Adligen vom Lande, dem es finanziell schlechtging und der nach Luthadel gekommen war, weil er verzweifelt ein paar rettende Geschäfte machen wollte.
Der Hauptraum war in eine Art Audienzzimmer verwandelt worden, in dem ein großer Schreibtisch stand, wohinter Camon Platz nehmen würde, und die Wände waren mit billiger Kunst geschmückt. Zwei Männer standen neben dem Schreibtisch; sie trugen die Kleidung formeller Diener und würden Camons Lakaien spielen.
»Was ist das für ein Aufruhr?«, fragte ein Mann, der soeben das Zimmer betrat. Er war groß, trug ein einfaches graues Hemd und eine graue Hose und hatte ein dünnes Schwert umgegürtet. Theron war der andere Anführer bei dieser Unternehmung, die unter seiner Aufsicht stand. Er hatte Camon beteiligt, weil er jemanden brauchte, der den Grafen Jedue spielte, und jedermann wusste, dass Camon darin beinahe unschlagbar war.
»Hmm? Aufruhr?« Camon sah auf. »Ach, das war nur ein kleines disziplinarisches Problem. Mach dir deshalb keine Sorgen, Theron.« Camon unterstrich seine Bemerkung mit einer nachlässigen Handbewegung – es gab durchaus gute Gründe dafür, dass gerade er einen Adligen spielen sollte. Er war so anmaßend, dass er tatsächlich aus einem der Großen Häuser hätte stammen können.
Theron kniff die Augen zusammen. Vin ahnte, was ihm durch den Kopf ging. Er überlegte sich, wie risikoreich es wohl war, ein Messer in Camons fetten Rücken zu rammen, sobald diese Scharade hier vorbei war. Schließlich richtete er den Blick auf Vin. »Wer ist das?«, wollte er wissen.
»Nur ein Mitglied meiner Mannschaft«, antwortete Camon.
»Ich war der Meinung, wir brauchen sonst niemanden mehr.«
»Also, sie brauchen wir unbedingt«, erklärte Camon. »Beachte sie einfach nicht. Mach dir keine Gedanken um meinen Teil der Operation.«
Theron betrachtete Vin eingehend und hatte nun offenbar ihre blutige Lippe bemerkt. Sie sah weg. Therons Blick ruhte allerdings weiterhin auf ihr und glitt an ihrem Körper herab. Sie trug ein einfaches weißes geknöpftes Hemd und eine grobe Arbeitshose. Mit ihrem dürren Körper und dem jungenhaften Gesicht war sie alles andere als verführerisch; vermutlich wirkte sie nicht einmal so alt, wie sie war, nämlich sechzehn Jahre. Doch manche Männer bevorzugten solche Frauen.
Sie überlegte, ob sie bei ihm ein wenig von ihrem »Glück« einsetzen sollte, doch dann wandte er sich endlich von ihr ab. »Der Obligator ist bald hier«, sagte Theron. »Seid ihr so weit?«
Camon rollte mit den Augen und wuchtete seine Masse in den Sessel hinter dem Schreibtisch. »Es ist alles bestens. Lass uns jetzt allein! Geh zurück auf dein Zimmer und warte.«
Theron runzelte die Stirn, drehte sich um und schritt aus dem Raum, während er etwas in sich hineinmurmelte.
Vin betrachtete die Ausstattung, die Diener, nahm die Atmosphäre in sich auf. Schließlich ging sie auf Camons Schreibtisch zu. Der Anführer blätterte gerade einen Stapel Papier durch und schien sich zu überlegen, welche Schriftstücke er auf den Schreibtisch legen sollte.
»Camon«, sagte Vin leise, »die Diener sind zu fein.«
Camon runzelte die Stirn und hob den Blick. »Was brabbelst du da?«
»Die Diener«, wiederholte Vin; sie sprach noch immer im Flüsterton. »Graf Jedue ist doch angeblich verzweifelt. Er mag zwar aus früheren Zeiten noch wertvolle persönliche Kleidung besitzen, aber er wird sich wohl kaum mehr so edel ausgestattete Diener leisten können. Er würde Skaa dafür nehmen.«
Camon sah sie finster an, aber er sagte nichts darauf. In körperlicher Hinsicht gab es kaum einen Unterschied zwischen einem Skaa und einem Adligen. Die Diener aber, die Camon eingestellt hatte, waren wie unbedeutendere Adlige gekleidet – es war ihnen erlaubt worden, farbenprächtige Westen zu tragen, und sie standen ein wenig zu selbstsicher da.
»Der Obligator soll doch glauben, dass du fast verarmt bist«, betonte Vin. »Pack den Raum lieber mit einer Menge Skaa voll.«
»Was weißt du denn schon?«, erwiderte Camon und warf ihr einen finsteren Blick zu.
»Genug.« Sogleich bedauerte sie dieses Wort; es klang zu aufmüpfig. Camon hob eine juwelenbesetzte Hand, und Vin rüstete sich für einen weiteren Schlag. Sie konnte es sich nicht leisten, noch mehr von ihrem »Glück« einzusetzen. Es war ihr sowieso kaum mehr etwas davon verblieben.
Doch Camon schlug sie nicht. Stattdessen seufzte er und legte ihr eine schwammige Hand auf die Schulter. »Warum musst du mich immer wieder reizen, Vin? Du weißt doch, welche Schulden dein Bruder hinterlassen hat, als er weggelaufen ist. Begreifst du denn nicht, dass ein weniger barmherziger Kaufmann als ich dich schon vor langer Zeit an die Hurenmeister verkauft hätte? Wie würde es dir denn gefallen, im Bett irgendeines Adligen zu dienen, bis er deiner müde wird und dich hinrichten lässt?«
Vin schaute hinunter auf ihre Schuhspitzen.
Camons Griff wurde fester; seine Finger zwickten ihre Haut dort, wo Schulter und Hals zusammentrafen. Unwillkürlich keuchte sie auf. Er grinste über ihre Reaktion.
»Ehrlich, ich weiß nicht, warum ich dich noch behalte, Vin«, sagte er und verstärkte den Druck noch weiter. »Ich hätte mich deiner schon vor Monaten entledigen sollen, als dein Bruder mich hintergangen hat. Ich vermute, ich habe einfach ein zu gutes Herz.«
Endlich ließ er sie los und bedeutete ihr, sie solle sich neben der großen Zimmerpflanze an die Wand stellen. Sie tat, wie er ihr befohlen hatte, und brachte sich in eine Position, von der aus sie den ganzen Raum überblicken konnte. Sobald Camon wegsah, rieb sie sich die Schulter. Bloß ein weiterer Schmerz. Damit kann ich umgehen.
Camon saß kurze Zeit schweigend da, dann winkte er die beiden »Diener« an seine Seite, wie sie es erwartet hatte.
»Ihr beiden!«, sagte er. »Ihr seid zu gut gekleidet. Geht und zieht euch etwas an, in dem ihr wie Skaa-Diener ausseht – und bringt noch sechs weitere Männer mit.«
Bald war das Zimmer so voll, wie Vin es vorgeschlagen hatte. Kurze Zeit später traf der Obligator ein.
Vin sah zu, wie der Mann den Raum betrat. Er war kahl geschoren wie alle Obligatoren und trug eine dunkelgraue Robe. Die Amtstätowierungen um seine Augen wiesen ihn als Prälan aus, einen hochrangigen Beamten in der Finanzverwaltung des Ministeriums. Eine Reihe unbedeutenderer Obligatoren folgte ihm; ihre Tätowierungen waren weitaus weniger kunstvoll.
Camon erhob sich, als Prälan Härr eintrat. Es war ein Zeichen des Respekts, den sogar ein Angehöriger eines der Großen Häuser einem Obligator vom Range Härrs zollen würde. Härr hingegen verneigte sich nicht und entbot auch keinen anderen Gruß, sondern setzte sich vor Camons Schreibtisch. Einer aus der Mannschaft, der als Diener verkleidet war, eilte herbei und servierte dem Obligator gekühlten Wein und Früchte.
Härr fingerte in den Früchten herum, während der Diener gehorsamst vor ihm stand und reglos das Tablett hielt, als wäre er bloß ein Möbelstück. »Graf Jedue«, sagte Härr schließlich. »Ich bin froh, dass wir endlich Gelegenheit haben, uns kennenzulernen.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Euer Gnaden«, sagte Camon.
»Was war noch gleich der Grund, aus dem Ihr nicht ins Verwaltungsgebäude kommen konntet und ich Euch hier besuchen muss?«
»Meine Knie, Euer Gnaden«, erklärte Camon. »Meine Ärzte haben mir empfohlen, mich so wenig wie möglich zu bewegen.«
Du hattest zu Recht Bedenken, dich in eine der Verwaltungsfestungen locken zu lassen, dachte Vin.
»Ich verstehe«, meinte Härr. »Schlimme Knie. Ein unglücklicher Umstand für einen Mann, der sein Geld mit Transporten verdient.«
»Nun, ich muss die Reisen ja nicht persönlich unternehmen, Euer Gnaden«, meinte Camon und neigte den Kopf. »Ich brauche sie nur zu organisieren.«
Gut, dachte Vin. Sorge dafür, dass du unterwürfig bleibst, Camon. Du musst verzweifelt wirken.
Für Vin war es unbedingt nötig, dass diese Scharade erfolgreich war. Camon drohte ihr zwar immer wieder und schlug sie, aber er betrachtete sie als seinen Glücksbringer. Sie war nicht sicher, ob er wusste, warum seine Pläne in der Regel aufgingen, wenn sie im Raum war, doch offensichtlich war er davon überzeugt. Das machte sie wertvoll – und Reen hatte immer gesagt, es sei der sicherste Weg, in der Unterwelt am Leben zu bleiben, wenn man sich unentbehrlich machte.
»Ich verstehe«, sagte Härr noch einmal. »Ich befürchte jedoch, dass unser Treffen zu spät für Eure Zwecke stattfindet. Das Ministerium hat bereits über Euren Antrag entschieden.«
»So schnell?«, fragte Camon in ehrlichem Erstaunen.
»Ja«, antwortete Härr und nippte an seinem Wein, aber er entließ den Diener noch immer nicht. »Wir haben beschlossen, keinen Vertrag mit Euch abzuschließen.«
Verblüfft nahm Camon Platz. »Es tut mir leid, das zu hören, Euer Gnaden.«
Härr ist zu dir gekommen und redet mit dir, dachte Vin. Das bedeutet, dass er noch Verhandlungsspielraum hat.
»Allerdings«, fuhr Camon fort, dem offenbar dieselbe Erkenntnis wie Vin gekommen war, »ist das besonders misslich, da ich vorhatte, dem Ministerium ein noch günstigeres Angebot zu machen.«
Härr hob eine tätowierte Braue. »Ich bezweifle, dass dies etwas ändern wird. Einige Mitglieder des Rates sind der Ansicht, das Ministerium erhalte bessere Leistungen, wenn wir ein stabileres Haus finden, das unsere Leute transportiert.«
»Das wäre ein großer Fehler«, meinte Camon sanft. »Ich will ehrlich zu Euch sein, Euer Gnaden. Wir beide wissen, dass dieser Vertrag die letzte Rettung für das Haus Jedue bedeutet. Da unser Vertrag mit Farwan geplatzt ist, können wir es uns nicht mehr leisten, unsere Kanalboote nach Luthadel fahren zu lassen. Ohne den Schutz des Ministeriums ist mein Haus finanziell ruiniert.«
»Das vermag mich nicht zu überzeugen, Euer Ehren«, sagte der Obligator.
»Nicht?«, meinte Camon. »Stellt Euch doch einmal die Frage, wer Euch besser dient, Euer Gnaden. Ist es das Haus, das Dutzende von Verträgen hat, denen es seine Aufmerksamkeit schenken muss, oder ist es das Haus, das den Vertrag mit Euch als seine letzte Gelegenheit ansieht, den Ruin abzuwenden? Das Amt für Finanzen wird keinen besseren Partner als denjenigen finden, der völlig verzweifelt ist. Erlaubt mir, dass meine Boote Eure neuen Obligatoren aus dem Norden holen … erlaubt meinen Soldaten, sie zu eskortieren, und Ihr werdet nicht enttäuscht sein.«
Gut, dachte Vin.
»Ich … verstehe«, sagte der Obligator, der nun nicht mehr so sicher zu sein schien.
»Ich wäre bereit, Euch einen erweiterten Vertrag anzubieten und einen Festpreis von fünfzig Kastlingen für jeden Kopf und jede Reise zu machen, Euer Gnaden. Eure frisch erkorenen Obligatoren könnten nach Belieben auf unseren Booten reisen und hätten immer die Eskorte, die sie benötigen.«
Der Obligator hob eine Braue. »Das ist die Hälfte des früheren Preises.«
»Ich habe es Euch ja gesagt«, meinte Camon. »Wir sind verzweifelt. Mein Haus muss seine Boote in Fahrt halten. Fünfzig Kastlinge bescheren uns keinen Gewinn, aber das ist gleichgültig. Sobald wir den Kontakt zum Ministerium hergestellt haben, der uns Stabilität verspricht, können wir andere Vertragspartner finden, die unsere Geldtruhen füllen.«
Härr sah nachdenklich drein. Es war ein fabelhaftes Geschäft – eines, das unter normalen Umständen verdächtig gewesen wäre. Doch Camon hatte in sehr überzeugender Weise das Bild eines Hauses am Rande des finanziellen Ruins gezeichnet. Theron, der andere Anführer, hatte fünf Jahre damit verbracht, diesen Augenblick vorzubereiten. Eine solche Gelegenheit durfte sich das Ministerium nicht entgehen lassen.
Härr erkannte dies mit aller Klarheit. Das Stahlministerium war nicht nur die mächtigste Bürokratie und rechtliche Autorität im Letzten Reich, es war auch ein eigenes Adelshaus. Je reicher es war, und je besser seine Handelsbeziehungen waren, desto mehr Einfluss besaßen die einzelnen Abteilungen des Ministeriums aufeinander – und auf die Adelshäuser.
Doch Härr zögerte immer noch. Vin sah den Blick seiner Augen, und das Misstrauen darin kannte sie genau. Er würde den Vertrag trotzdem nicht abschließen.
Jetzt bin ich an der Reihe, dachte Vin.
Vin setzte ihr »Glück« bei Härr ein. Probeweise streckte sie ihre Fühler nach ihm aus – sie war nicht einmal sicher, was sie da tat oder warum sie dazu in der Lage war. Doch ihre Berührung war rein instinktiv, wenn auch durch viele Jahre des Gebrauchs sehr geübt. Sie war zehn Jahre alt gewesen, als sie erkannt hatte, dass andere Leute das, was ihr möglich war, nicht zu tun vermochten.
Sie drückte gegen Härrs Empfindungen und dämpfte sie. Er wurde weniger misstrauisch, weniger ängstlich. Und immer gefügiger. Seine Sorgen schmolzen dahin, und Vin erkannte, wie sich das ruhige Gefühl der Beherrschung in seinen Augen zeigte.
Doch noch immer schien er ein wenig unsicher zu sein. Vin drückte heftiger. Nachdenklich legte er den Kopf schräg, öffnete den Mund und wollte etwas sagen, doch sie stemmte sich noch einmal gegen ihn und setzte dazu ihr letztes Quäntchen »Glück« ein.
Er hielt abermals inne. »Also gut«, sagte er schließlich. »Ich werde diesen neuen Vorschlag dem Rat vorlegen. Vielleicht können wir doch noch eine Übereinkunft erzielen.«
Wenn jemand diese Worte liest, dann soll er wissen, dass Macht eine schwere Bürde ist. Niemand sollte danach trachten, von ihren Ketten gefesselt zu werden. Die Prophezeiungen von Terris sagen, dass ich die Macht haben werde, die Welt zu retten.
Sie deuten aber auch an, dass ich ebenso die Macht habe, sie zu vernichten.
Kapitel 2
In Kelsiers Augen bot die Stadt Luthadel – der Sitz des Obersten Herrschers – einen düsteren Anblick. Die meisten Gebäude waren aus Steinquadern errichtet, und die Dächer der Gebäude, die in der Regel aus Steinquadern bestanden, waren bei den Reichen mit Schiefer gedeckt und ansonsten mit Schindeln. Die Häuser standen eng beieinander, was ihnen ein gedrungenes Aussehen verlieh, obwohl sie für gewöhnlich drei Stockwerke hoch waren.
Die Mietshäuser und Läden waren sehr gleichförmig; dies hier war kein Ort, an dem man freiwillig die Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Es sei denn, man gehörte dem Hochadel an.
In der ganzen Stadt verteilt standen etwa ein Dutzend monolithischer Festungen. Sie besaßen ganze Reihen von speerartigen Türmen und tiefen Toreingängen, waren reich verziert und bildeten die Heimstätten des Hochadels. Zudem waren sie das Zeichen der bedeutenden Adelsfamilien. Jede, die es sich leisten konnte, eine Festung zu errichten und ihre Gegenwart in Luthadel so deutlich zu machen, trug den Ehrentitel eines »Großen Hauses«.
Der größte Teil des offenen Geländes innerhalb der Stadt lag um diese Festungen herum. Die Freiflächen inmitten der Siedlungen waren wie Lichtungen in einem Wald, und die Festungen glichen vereinzelten Felsen, die sich hoch über den Rest der Landschaft erhoben. Schwarze Felsen. Wie der Rest der Stadt, so waren auch die Festungen geschwärzt von den zahllosen Jahren des Ascheregens.
Jedes Gebäude in Luthadel – eigentlich jedes Gebäude, das Kelsier je gesehen hatte – war mehr oder weniger geschwärzt. Sogar die Stadtmauer, auf der er nun stand, besaß einen Überzug aus Ruß. Für gewöhnlich waren alle Bauwerke an der Spitze, wo sich die Asche sammelte, am schwärzesten, doch Regenwasser und Tau hatten die Flecken auf dem Gesims und über die Mauern verteilt. Wie Farbe, die an einer Leinwand herablief, schien die Finsternis in ungleichmäßigen Schlieren über die Hauswände zu kriechen.
Die Straßen waren natürlich vollkommen schwarz. Kelsier stand abwartend da und betrachtete die Stadt, während eine Gruppe von Skaa-Arbeitern auf der Straße unter ihm die jüngsten Aschehaufen beseitigte. Sie würden sie zum Kanarel bringen, der mitten durch die Stadt floss, und die Asche von ihm forttragen lassen, damit sie nicht irgendwann noch die gesamte Stadt unter sich begrub. Manchmal fragte sich Kelsier, warum das ganze Reich nicht längst ein großer Aschehaufen war. Er vermutete, dass die Asche irgendwann in den Erdboden eindringen würde. Schon jetzt erforderte es eine beinahe lächerlich große Anstrengung, die Städte und Felder so weit von der Asche zu befreien, dass sie nutzbar waren.
Zum Glück gab es für diese Arbeit immer genügend Skaa. Die Arbeiter unter ihm trugen einfache Umhänge und Hosen, die aschefleckig und abgetragen waren. Wie die Plantagenarbeiter, die er vor mehreren Wochen verlassen hatte, mühten sie sich mit niedergedrückten, mutlosen Bewegungen ab. Andere Gruppen von Skaa kamen an den Arbeitern vorbei; sie wurden von den Glocken in der Ferne gerufen, welche die Stunde schlugen und zur Arbeit in den Schmieden oder Mühlen riefen. Luthadels wichtigstes Exportgut war Metall. Die Stadt beherbergte Hunderte von Schmieden und Eisenhütten, doch die Strömung des Flusses machte sie auch zu einem hervorragenden Ort für Mühlen, die sowohl Getreide mahlten als auch Textilien herstellten.
Die Skaa arbeiteten weiter. Kelsier wandte sich von ihnen ab und blickte in die Ferne, zum Stadtzentrum, in dem sich der Palast des Obersten Herrschers wie ein massiges Insekt mit vielen Wirbelsäulen erhob: Krediksheim, der Berg der Tausend Türme. Der Palast war so groß wie mehrere Adelsfestungen zusammengenommen und bei weitem das gewaltigste Gebäude in der Stadt.
Während Kelsier dastand und über die Stadt nachsann, ging ein weiterer Ascheregen nieder. Sanft fielen die Flocken auf Straßen und Gebäude. Eine Menge Ascheregen in der letzten Zeit, dachte er und war froh über einen Grund, sich die Kapuze seines Mantels über den Kopf ziehen zu können. Offenbar sind die Ascheberge wieder aktiv.
Es war unwahrscheinlich, dass jemand in Luthadel ihn erkennen würde; seit seiner Gefangennahme waren drei Jahre vergangen. Dennoch verschaffte ihm die Kapuze ein beruhigendes Gefühl. Wenn alles gutging, würde eine Zeit kommen, in der Kelsier gern gesehen und freudig erkannt wurde. Doch bis dahin war Anonymität vermutlich besser.
Schließlich kam eine Gestalt die Mauer entlang. Der Mann – er hieß Docksohn – war kleiner als Kelsier und hatte ein quadratisches Gesicht, das gut zu seiner leicht untersetzten Figur passte. Die Kapuze eines unauffälligen braunen Mantels bedeckte seine schwarzen Haare, und er trug denselben kurzen Bart wie damals vor zwanzig Jahren, als seine Gesichtsbehaarung erstmals gesprossen war.
Wie Kelsier, so hatte auch er die Kleidung eines Adligen angelegt: eine farbige Weste, einen dunklen Mantel und eine dunkle Hose sowie einen dünnen Mantel gegen die Asche. Es waren keine Sachen, die Reichtum andeuteten, aber sie waren aristokratisch und wiesen auf die Mittelschicht von Luthadel hin. Die meisten Menschen von adliger Abstammung waren nicht reich genug, um als Mitglied eines Großen Hauses gelten zu können, doch im Letzten Reich war nicht Geld das bestimmende Merkmal des Adels. Wichtiger waren Abstammung und Geschichte. Der Oberste Herrscher war unsterblich und erinnerte sich offenbar genau an die Männer, die ihn während der frühen Jahre seiner Herrschaft unterstützt hatten. Die Abkömmlinge dieser Männer wurden unweigerlich bevorzugt, wie arm sie inzwischen auch geworden sein mochten.
Die Kleidung würde die Patrouillen davon abhalten, zu viele Fragen zu stellen. Im Fall von Docksohn und Kelsier war sie natürlich eine Lüge. Keiner von beiden war adlig, auch wenn Kelsier tatsächlich ein Halbblut war. Doch dies war beinahe schlimmer, als nur ein gewöhnlicher Skaa zu sein.