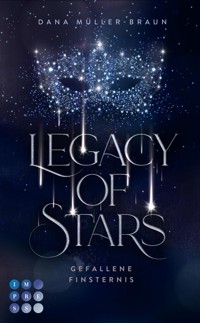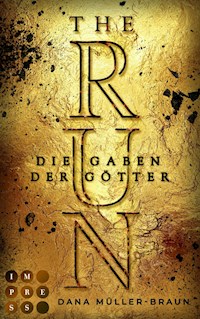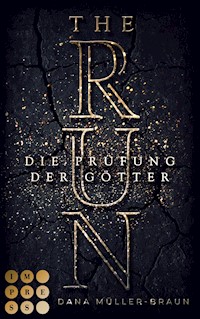Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: impress.audio
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Spiel mit dem Feuer** Die 18-jährige Elya ist nicht der Typ Mädchen, der in einer neuen Umgebung gleich mit den Coolsten herumhängt und eine Freundschaft nach der anderen schließt. Deswegen fällt ihr der Umzug nach June Lake auch alles andere als leicht, so vertraut ihr das Seehaus ihrer Großmutter auch erscheint. Doch für ihr gewohntes Sich-Abschotten bleibt keine Zeit. Elya wird gleich vom ersten Tag an von der Ortsclique unter die Fittiche genommen und zu Strandpartys und Klettertouren geschleppt. Doch irgendwas stimmt nicht mit diesen viel zu schönen und viel zu draufgängerischen Leuten. Allem voran nicht mit dem düsteren Levyn, mit dem sie sich vom ersten Moment an wie magisch verbunden fühlt. Erst langsam beginnt Elya zu begreifen, dass ihre Welt nicht die einzige Realität ist… //Die romantisch-dramatische »Elya«-Trilogie von Spiegel-Bestsellerautorin Dana Müller-Braun umfasst die Bände: -- Elya 1: Der weiße Drache -- Elya 2: Das Bündnis der Welten -- Elya 3: Das Licht der Finsternis//
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dana Müller-Braun
Elya 1: Der weiße Drache
**Spiel mit dem Feuer** Die 18-jährige Elya ist nicht der Typ Mädchen, der in einer neuen Umgebung gleich mit den Coolsten herumhängt und eine Freundschaft nach der anderen schließt. Deswegen fällt ihr der Umzug nach June Lake auch alles andere als leicht, so vertraut ihr das Seehaus ihrer Großmutter auch erscheint. Doch für ihr gewohntes Sich-Abschotten bleibt keine Zeit. Elya wird gleich vom ersten Tag an von der Ortsclique unter die Fittiche genommen und zu Strandpartys und Klettertouren geschleppt. Doch irgendwas stimmt nicht mit diesen viel zu schönen und viel zu draufgängerischen Leuten. Allem voran nicht mit dem düsteren Levyn, mit dem sie sich vom ersten Moment an wie magisch verbunden fühlt. Erst langsam beginnt Lya zu begreifen, dass ihre Welt nicht die einzige Realität ist …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© privat
Dana Müller-Braun wurde Silvester ’89 in Bad Soden im Taunus geboren. Geschichten erfunden hat sie schon immer – Mit 14 Jahren fing sie schließlich an ihre Phantasie in Worte zu fassen. Als das Schreiben immer mehr zur Leidenschaft wurde, begann sie Germanistik, Geschichte und Philosophie zu studieren. Wenn sie mal nicht schreibt, baut sie Möbel aus alten Bohlen, spielt Gitarre oder verbringt Zeit mit Freunden und ihrem Hund.
Wenn das Licht kommt und die Finsternis vertreibt,
denk daran, dass du nicht besser siehst.
Denn das, was wirklich zählt, kann dein Herz auch in der Dunkelheit verstehen.
Für all diejenigen, die mit dem Herzen sehen.
Die sich nicht von Rasse, Hautfarbe oder Religion leiten lassen.
Für diejenigen, die den Menschen sehen und sein Schweigen hören.
Prolog
Mit laut pochendem Herzen wache ich auf. Dunkelheit umgibt mich. Erdrückende Finsternis, die mir Angst mit hundert Nadelstichen in die Haut und hinein in meine Nervenstränge rammt. Alles, was ich höre, ist dieses rhythmische Schlagen. Mein Puls. Mein Herz. Dessen alles verzehrende Hiebe, die meinen Körper beben lassen.
Wo bin ich?
Ich blinzle und bemühe mich, gegen die Schwärze um mich herum anzukämpfen. Etwas zu sehen. Mich zu erinnern.
Ein seltsamer Geruch erfüllt meine Nase. Lässt mich einatmen, als wäre dieser Duft mein Lebenselixier.
Zitternd stehe ich auf und versuche den Lichtschalter zu finden. Aber ich bin nicht in meinem Zimmer. Ich habe auch nicht auf meinem Bett, sondern auf Moos gelegen.
Ich stocke, als mir bewusst wird, dass ich in einem Wald bin. Angst klettert meine Kehle hinauf. Normalerweise habe ich keine Ängste. Ja, normalerweise bin ich ein Mensch, der sich in alles hineinstürzt, ohne über die Folgen nachzudenken. Aber jetzt …
Die Luft ist kühl und warm zugleich und dann spüre ich einen leichten Windhauch auf meiner Haut. In meinem Nacken.
»Du bist es wirklich.«
Ich atme erleichtert aus, als ich begreife, dass jemand hinter mir steht, und die Stimme in mein Bewusstsein vordringt. Sie klingt nicht bedrohlich. Beinahe vertraut. So vertraut, dass sich die Angst ein wenig legt und mir die dunklen Schatten plötzlich wie ein warmer Mantel erscheinen.
»Wer bin ich?«
Ich schreie innerlich, als er nicht antwortet. Ich brauche etwas. Jemanden, der mir hilft, in dieser Dunkelheit zu sehen. Ihn zu sehen. Ein Licht. Ein …
Vor mir flackert die Luft. Ein leichtes Glitzern bewegt sich auf mich zu. Ein Leuchten. Es redet mit mir. In einer wunderschönen Sprache, die ich nicht verstehe. Als es bei mir ankommt, erhellt sich der dunkle Wald um mich herum ein wenig. Wie ein großes Glühwürmchen schwebt es vor mir, aber etwas in mir begreift, dass es aus einer anderen Welt stammt. Aus einer Welt, in die auch ich gehöre.
Ich beiße die Zähne zusammen und drehe mich um. Starre in dunkle Augen. Schwarze Augen, die von Schatten umgeben sind. Sie reflektieren kaum das Licht. Er ist ein junger Mann und trotzdem zieren schwarze Schuppen sein Gesicht wie eine Maske.
»Was mache ich hier?«, frage ich tonlos. Ängstlich.
Der Kerl starrt mich weiter an, so als würde er nicht glauben, dass ich vor ihm stehe. Dabei sollte ich doch die Verwunderte hier sein.
Dann, ganz plötzlich, weiten sich seine Augen. Er sieht sich unruhig um. »Du musst von hier verschwinden!«
Es ist ein Befehl. Aber selbst wenn ich wollte, ich kann ihm nicht Folge leisten. Meine Beine sind durch Furcht, die sie mit brennender Säure füllt, wie festgenagelt. Umgeben von schweren Ketten der Bewegungslosigkeit, die es mir schier unmöglich machen, zu fliehen.
»Warum?«
Meine Stimme mischt sich in der Luft mit einem silbrigen Nebel und schwirrt vor mir herum. Vor diesem Glimmen. Vor seinen dunklen Augen. Ich will nicht weg von hier, denn etwas in mir weiß, dass ich hierhergehöre. Zu ihm und in diese Welt der Finsternis.
»Die Anguis kommen!«, flüstert er rau. »Ich hätte dich niemals hierherholen dürfen. Niemals!«
Seine Stimme bricht und bevor ich antworten kann, bevor ich es begreifen kann, stößt er mich mit voller Wucht nach hinten. Mein Körper gehorcht mir nicht und fällt zu Boden, als würde er nicht mehr zu mir gehören.
»Renn weg!«, schreit er mich an.
Und endlich gehorche ich. Meine Beine zwingen mich wieder nach oben und dann hinein in den Wald. Ich renne und renne. Der Wind peitscht mir ins Gesicht. Tränen verlassen meine Augen. Tränen der Angst, aber auch ausgelöst von der schneidenden Luft. Meine panischen Schritte werden durch den weichen moosbedeckten Boden gedämpft und lassen mich beinahe taub zurück, bis ich einen markerschütternden Schrei höre. Die Luft in meiner Lunge weicht, presst sich hinaus und ich kann keine neue erreichen. Sie nicht in mich aufsaugen. Ich schlucke bittere Galle, während ich an meinem Hals herumdrücke, an der Haut reiße. Ihn anflehe, wieder Luft zu holen. Das hier ist kein Traum. Er ist nicht so wie all die anderen Träume. Dieser hier ist real und tödlich.
Als ich endlich wieder Luft bekomme, renne ich weiter. Laufe um mein Leben, bis ich einen dunklen Schatten erkenne, der sich über den Boden schlängelt. Zu mir. Er sieht aus wie eine Schlange. Eine riesige Schlange, mit etwas Menschlichem in ihren Augen.
Ich weiche zurück. Stoße gegen etwas Hartes. Etwas Vertrautes.
Ich kenne ihn so gut. Aber als ich mich umdrehe und ihn mit diesen hasserfüllten Augen, den schwarzen Schuppen und dem verformten Gesicht sehe, schrecke ich zurück.
»Geh weg von ihr!«, knurrt er.
Der reptilienartige schwarze Schatten richtet sich auf. Er ist ein Mensch. Ein Mensch mit Schlangenaugen. Ein Anguis.
»Du bist nicht mein Herrscher! Sie ist es!«, faucht das Ding. Seine gespaltene Zunge schnellt hervor, während er redet.
»Du bist hier in meiner Welt!«
Die Stimme, die mir sonst so vertraut ist, wirkt plötzlich fremd. Düster. Rau. Böse. Aber sie gibt mir das Gefühl, in Sicherheit zu sein.
»Sie muss sterben!«
Mit diesen Worten explodiert die Wut hinter mir und sie stürmen aufeinander zu. Das Leuchten, das immer noch neben mir in der Luft flackert, lässt eine Sicht auf die beiden schwarzen Gestalten zu. Die Stärke ihres Kampfes ist unmenschlich. Lässt den Wald und die Erde erzittern. Ein weiteres Beben zwingt mich zurückzuweichen. Direkt in die Arme eines Menschen. Meine Brust platzt fast vor Schreck und Angst, bis ich mich umdrehe und ihn erkenne.
»Jason!«
Erleichtert sehe ich in die dunkelgrünen Augen meines besten Freundes. Sein Haus ist nicht weit von meinem entfernt, die beide am Waldrand liegen. Er muss gekommen sein, um mir zu helfen.
»Lya«, haucht er bedrohlich.
Ich befreie mich aus seinem Griff und weiche einen Schritt zurück, als seine Augen aufleuchten und sich rote Schuppen darum bilden. Mein Körper stirbt beinahe vor Angst. Jede Faser in ihm reißt an mir. Will weg von hier. Weg von mir.
»Du musst sterben!«
Ich erschaudere. Schreie innerlich. Aber ich bin wie erstarrt. Bin nicht in der Lage, mich zu wehren. Diesen Beschützer zu rufen, der gerade mit dem Schlangenwesen kämpft.
Jason zieht ein Schwert. Es glänzt goldgrün und nimmt mir beinahe die Sicht. Er legt das kalte Metall an meinen Hals.
»Warum?«, bringe ich endlich zitternd hervor. Wieder bin ich erstarrt. Wieder kann ich nichts tun. Aber etwas in mir weiß, dass ich nicht in Gefahr bin.
»Weil du das Gleichgewicht herstellst und ihm seinen Tod bringen wirst. Du wirst ihn Stück für Stück umbringen. Weil dein Überleben ihn seines kosten wird.«
»Ich –«
Er wartet nicht auf meine Erwiderung. Ein leiser Schnitt. Ein ohrenbetäubendes Geräusch, das meinen Kopf beinahe platzen lässt. Ich spüre mein warmes Blut und falle wie schwerelos zu Boden. Ich weiß, dass ich sterbe. Ersticke. Verblute. Ich weiß es, aber ich fühle es nicht.
Alles, was ich höre, ist dieses immer wiederkehrende Surren der Klinge und dann das Geräusch eines Körpers, der zu Boden fällt. Meine Glieder verkrampfen sich, aber ich selbst habe keine Kontrolle mehr über sie. Ich muss tot sein. Ja, ich bin tot. Ich bin wie schwerelos zu Boden gesunken und habe den dumpfen Aufprall meines Körpers gehört, als wäre es ein schönes Geräusch.
Meine Augen sind wässrig. Das und die Tatsache, dass ich die markerschütternden Schreie höre, ist das Einzige, was mich daran erinnert, dass ich noch lebe. Aber wie ist das möglich? Ich sollte tot sein. Nichts mehr spüren, außer der Schwerelosigkeit des Todes.
Ganz langsam, als würde mein Körper sich selbstständig machen, zucken meine Finger. Mein Herz beginnt wieder zu schlagen. Meine starre Sicht wandelt sich. Und als ich endlich wieder einatme, ziehe ich nicht nur Luft in meine Lungen. Es ist, als würde ich etwas Warmes, Vertrautes mit einatmen, das meinen Körper und meinen Geist erfüllt. Mich vollständig macht. Meine Seele heilt. Das Leuchten um mich herum wird stärker.
Bilder blitzen vor mir auf. Uralte Bilder. Bilder von ihm und …
Sein Gesicht taucht über mir auf. Seine Augen weiten sich, als er etwas zu begreifen scheint. Etwas in mir zu sehen scheint. Sein Atem geht schnell. Seine Ausstrahlung ist immer noch gefährlich. Und obwohl er mir vertraut vorkommt, spüre ich die Angst in mir kitzeln. Sie warnt mich.
Er öffnet seinen Mund. Seine Stimme ist belegt und rau. Umgeben von warmen Schatten und einer Vergangenheit, die ich nicht begreifen kann.
»Lyria?!«
Kapitel 1
»Elya?«
Ich schlage meine Augen auf und starre in die meiner Mutter. Sie sieht mich nachdenklich an, beinahe mitleidig, aber seit dem Vorfall im Wald vor sechs Monaten hat ihr Blick immer diesen Beigeschmack. Sie sieht mich mit anderen Augen an. So als wäre ich zerbrechlich oder verrückt. Eins von beidem.
»Du hast schon wieder geschrien, Schatz«, murmelt sie und streicht mir behutsam über meine nasse Stirn. Ich nicke einfach nur, um nicht auf meine Albträume eingehen zu müssen. Denn sie alle verstehen nicht, was der wirkliche Grund dafür ist.
Natürlich war es grausam. Jason und ich wurden morgens in einem Wald gefunden. Ich hatte mich zusammengekauert und war nicht ansprechbar, während Jason … Jason neben mir lag. Tot. Von einem wilden Tier zerfetzt. Dass ich dann ohne einen Kratzer in der Notaufnahme wach wurde, ist das, was mir Angst bereitet. Und die Tatsache, dass sie alle nicht verstehen wollen, was wirklich passiert ist. Dass uns kein wildes Tier angegriffen und mich verschont hat, weil Jason mich beschützt hat. Nein. Jason hat mir die Kehle durchgeschnitten. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Und diese Erinnerung ist so tief in mir verankert, dass ich es weiß. Mir sicher bin, dass es passiert ist. Aber wahrscheinlich würde ich nicht einmal mir selbst glauben. Also muss ich wohl damit leben.
Mit brennender Brust denke ich an meine blutverschmierten Hände. Daran, wie ich wach wurde und … Ich muss es gewesen sein. Ich muss ihn umgebracht, ihn zerfetzt haben. Denn dort war kein wildes Tier.
»Hast du alles gepackt?«
»Mom!«, nörgle ich und ziehe die Decke über meinen Kopf. Verscheuche damit all die Gedanken und sperre sie zurück in den dunklen Teil meines Herzens, wo ich sie schon die ganze Zeit aufbewahre. »Denkst du wirklich, dass ich wieder normal werde, wenn wir umziehen?«
»Es ist ein Anfang, Schätzchen. An diesem Ort sind zu viele schreckliche Dinge passiert. Deine Freunde sind tot.«
Ich presse meine Lippen aufeinander und bemühe mich ruhig zu atmen. In dieser Nacht sind noch drei weitere Mitschüler im Wald gefunden worden. Meine Mutter ist der Meinung, dass ich nicht begriffen habe, dass sie tot sind. Wahrscheinlich denkt sie so, weil ich nicht trauere. Ihre Strategie ist es, mich immer wieder daran zu erinnern, damit ich meinen Schock überwinde. Aber ich weiß, dass sie tot sind. Ich kann es nur nicht fühlen.
»Dir wird es gut gehen. Du wirst neue Freunde finden. Eine andere Umgebung. Eine andere –«
»Ja. Ich habe alles gepackt«, gebe ich nach und beantworte ihre Frage. Gegen sie habe ich sowieso keine Chance.
»Dann lass uns losfahren. Die Möbelpacker bringen den Rest. Ed kümmert sich darum.«
Wieder nicke ich einfach nur, wühle mich aus meinem Bett und ziehe mir einen Pulli über. Lustlos greife ich nach meiner Tasche und sehe meine Mutter auffordernd an. Sie verzieht den Mund. Wahrscheinlich hätte sie liebend gern noch weiter über meine Gefühle und Ängste gesprochen, aber dafür bin ich einfach noch nicht bereit. Und vielleicht werde ich es nie sein, solange niemand begreifen will, dass ich es war, die als Erste getötet wurde.
Nachdem auch Mom ihre Tasche geholt hat und ich mir Schuhe übergezogen habe, verfrachten wir die letzten Sachen ins Auto. Mom verabschiedet sich noch von Ed, unserem Nachbarn, während ich bereits im Auto sitze. Ich kann keinen mitleidigen Blick mehr ertragen. Vielleicht hat Mom recht und eine neue Stadt wird mir guttun. Zumindest wird dort niemand wissen, was geschehen ist. Für sie werde ich nur ein normales Mädchen sein.
»Du wirst es in June Lake lieben, Schatz. Deine Großeltern und ich haben dort immer Urlaub gemacht. Es ist traumhaft schön«, sagt Mom, als sie sich hinter das Steuer setzt und den Motor startet.
Wieder nicke ich nur. Ich kenne die alten Geschichten vom Haus am See, das mein Großvater für meine Großmutter gebaut hat. Mom hat als Kind die Ferien dort verbracht und jetzt werden wir genau dort wohnen.
Nachdem meine Mutter sich mit meinen Großeltern zerstritten hatte, waren wir nie wieder in ihrem Haus gewesen. Das letzte Mal war ich so klein, dass ich mich nicht einmal mehr daran erinnern kann. Den Streit haben sie zwar nicht beendet, aber da meine Großeltern zu alt zum Reisen sind und Angst haben, dass ich mich umbringe, wenn ich in der Stadt bleibe, in der »das Unheil« geschehen ist, haben sie uns das Haus angeboten. Mom hätte es wahrscheinlich niemals angenommen, wenn nicht auch sie der Meinung wäre, dass ich kurz vorm Suizid stehe.
»Schlaf noch ein bisschen«, murmelt sie mir zu, während wir durch dichte Wälder fahren. Ich habe zwar keine Lust, ihren Anweisungen Folge zu leisten, als wäre ich ein kleines Kind, aber allein um nicht reden zu müssen, schließe ich die Augen und tue eine Weile so, als würde ich wirklich schlafen, bis mich die Müdigkeit in einen traumlosen Schlaf zerrt.
***
Als ich wach werde, brennt die Sonne glühend in unser Auto. Gähnend strecke ich meine Arme und sehe mich um. Immer noch Wälder, überall, wo ich hinsehe. Nur dass sie jetzt trockener wirken.
»Ich brauche einen Kaffee.«
»In zwanzig Minuten gibt es eine Raststätte, da halten wir an und frühstücken etwas. Wir wollen ja nicht, dass du uns umkippst.«
Ich verdrehe genervt die Augen. Ich hasse es, dass sie jeden meiner Schritte bis ins kleinste Detail verfolgt. Was und wie viel ich esse, wie viel ich rede, wie oft ich duschen gehe und an wie vielen Tagen ich einfach gar nicht aus dem Bett komme.
Nachdem ich endlich meinen ersehnten Kaffee bekommen und mir ein wenig Ei hineingezwängt habe, fahren wir weiter.
»In einer halben Stunde sind wir da«, murmelt Mom irgendwann neben mir und sieht sich nervös um. Sie wird wahrscheinlich einige Menschen wiedertreffen, die sie kennt. Ich hingegen werde dort niemanden kennen. Und Freunde habe ich auch noch nie sonderlich leicht gefunden. Nicht einmal meine Klassenkameraden, die in diesem Wald gestorben sind, waren wirklich meine Freunde. Bis auf Jason.
Als Mom noch aufgeregter wird, sehe ich mich nachdenklich um. Durch die Bäume kann ich Wasser glitzern sehen. Sie lichten sich nach und nach, bis ein See mit einer riesigen Holzhütte und einem Steg auf der anderen Seite sichtbar wird. Auf dem aufgeschütteten Sand und der Wiese um den See herum stehen Menschen, hören Musik, feiern oder springen ins Wasser. Motorboote fahren über das wunderschöne Gewässer und ziehen schreiende Jugendliche auf einer Gummibanane hinter sich her.
»Sieh nur, Schätzchen, sie haben einen solchen Spaß«, sagt Mom aufgeregt und deutet auf den See, als könnte ich das übersehen. »Das ist das Bootshaus«, erklärt sie mit einem Deut auf die Holzhütte.
Ich atme schwer. Warum müssen wir ausgerechnet in den Sommerferien hierherziehen? Warum genau dann, wenn es hier nur so von feierlustigen Jugendlichen wimmelt?
»Dieses Mal gibst du dir Mühe, nicht wahr? Das haben wir so abgemacht.«
»Abgemacht?«, schnaube ich wütend. Viel eher war es so, dass Mom das abgemacht hat und ich sie einfach nur angestarrt habe. Sie denkt zwar, dass ich nicht auf Menschen zugehe, dass ich mich in mich selbst zurückziehe, niemanden an mich heranlasse und deshalb keine Freunde habe. Aber so ist das nicht. Ich habe es mehr als einmal probiert und bin immer wieder zum selben Entschluss gekommen: Die Jugendlichen in meinem Alter sind einfach anders. Sie verstehen mich nicht. Und bisher war es immer so, dass eher sie mich nicht als ihre Freundin haben wollten.
Und dann kam diese Nacht, diese schwarze Nacht, und hat einen Teil in mir zerbrochen. Den Teil, den ich in diesen Jugendlichen am See sehe. Die Freude am Leben.
»Glaub mir, Schätzchen, dieser Ort wird dein Leben verändern. Du wirst sehen, dass hier Menschen sind, die genauso sind wie du.«
»Und wie bin ich, Mom?«, entgegne ich resigniert, während wir jetzt so nah am Bootshaus vorbeifahren, dass ich einige Gesichter erkennen kann. Sie sehen so gar nicht aus, als wären sie auch nur ansatzweise so wie ich.
»Anders, Schätzchen. Aber gut anders.«
»Nenn mich nicht immer so«, brumme ich und lasse mich im Sitz nach unten sinken, um diesen dämlichen Kindern nicht bei ihren Spielchen zusehen zu müssen.
»Lya, bitte!«, ermahnt sie mich.
Eigentlich sagt sie damit nur, dass sie mich zwingen wird, mit diesem Haufen da herumzuhängen. Komme, was wolle.
Das kann ja heiter werden.
»Wir machen noch einen kleinen Abstecher zum Bootshaus. Ich habe eine Überraschung für dich!«
»O nein. Nein. Nein. NEIN!«, schreie ich sie aufgebracht an und rutsche noch weiter hinunter. »So gehe ich da nicht rein, Mom! Ich habe noch meine Schlafanzughose an!«
»Du siehst wunderschön aus, so wie immer!«
»Tu mir das nicht an! Bitte!«, flehe ich und spitze meine Lippen. Das wirkt eigentlich immer.
»Na gut, wir fahren erst ins Haus und dann zum Bootshaus. Du hast da nämlich einen Job!«
Sie sagt es, als wäre es wirklich eine Überraschung, während ich mit einem schrecklichen Würgereiz kämpfe. Das kann unmöglich ihr Ernst sein.
»Was für einen Job?!«
»Sie brauchten leider keine Kellnerinnen mehr. Die Sommerjobs im Bootshaus sind sehr beliebt. Aber die Wasserskianlage brauchte noch eine … ähm …«
»Mom!«
»Na ja, die kleineren Kinder, die es noch nicht so gut können, muss jemand aus dem Wasser holen, wenn sie den Start nicht schaffen, und sie wieder … hinstellen.«
»Ich soll kleine Kinder wieder … hinstellen? Ist das wirklich dein Ernst?!«
Ich kann kaum fassen, was sie da sagt. Eine bescheuertere Aufgabe hätte sie mir nicht zuteilen können. Ich hasse Kinder. Ich hasse sie sogar noch mehr als ich Menschen an sich hasse. Wie kann sie mir das antun?
»Ach, Lya, versuch es wenigstens. Ich habe Earl sehr lange überreden müssen, damit er dir diesen Job gibt.«
»Na super, jetzt bin ich auch noch unerwünscht!«, fauche ich zornig. Sie ist wirklich drauf und dran, mein Leben noch mehr zu versauen.
»Das hat rein gar nichts damit zu tun«, brummt sie und schüttelt genervt den Kopf. Dass sie sich überhaupt anmaßt, genervt zu sein, macht mich noch wütender. »Earl stellt normalerweise nur Kids ein, die er schon sein Leben lang kennt. Das ist hier nun einmal so. Man unterstützt sich gegenseitig.«
»Kids?« Ich hebe vorwurfsvoll meine Augenbrauen.
»Hör auf, so zickig zu sein, Lya!«
»Zickig?!«, empöre ich mich gereizt. »Du zerstörst mein Leben, Mom! Und du bestimmst einfach, wie ich es zu leben habe. Das ist … ungerecht!«
»Du brauchst das, glaub mir!«
»Ach so, hab fast vergessen, dass du ein abgeschlossenes Psychologiestudium hast und deshalb genau weißt, was eine Jugendliche in meiner Situation braucht!«, gifte ich sie an.
Sie schnalzt aufgebracht mit der Zunge. Das macht sie immer, wenn ich lauter werde, und ich hasse es. »Entschuldige, dass eine Mutter, die Architektin und keine Psychologin ist, die Gabe verliert, zu wissen, was gut für ihr Kind ist«, schnaubt sie sarkastisch.
»Keine Mutter weiß das. Du verstehst einfach nicht …«
»Was? Wie es ist, achtzehn zu sein? Wie es ist, wenn man immer nur der Außenseiter ist? Wenn man etwas erlebt, das das ganze Leben auf den Kopf stellt? Glaub mir, Lya, ich weiß besser, wie sich das anfühlt, als du denkst!«
Ich funkle sie zornig an, sage aber nichts mehr. Wenn ich ihr jetzt vorwerfe, dass sie keine Ahnung hat, wie es ist, getötet zu werden oder zu wissen, dass direkt in meiner Nähe weitere Menschen gestorben sind, gebe ich ihr nur die perfekte Vorlage, um über diesen Vorfall zu sprechen. Und das ist das Letzte, was ich will. Außerdem weiß ich tief in meinem Inneren und hinter dieser giftigen Fassade, die ich über die letzten Jahre und Monate aufgebaut habe, dass sie es nur gut meint. Also schweige ich und sehe dabei zu, wie Mom einen holprigen Waldweg entlangfährt, bis sich vor uns das Holzhaus meiner Großeltern auftut. Eigentlich ist es jetzt mein Haus. Grams wollte es uns zwar überlassen, aber da der Streit mit meiner Mutter zu tief sitzt, haben sie es auf meinen Namen überschrieben. Für mich spielt es keine Rolle, denn egal wie oft wir uns streiten oder unterschiedlicher Meinung sind, wir gehören zusammen und es ist nur ein dummer Name auf einem Papier, der rein gar nichts aussagt.
»Was meinst du?«, fragt Mom, bringt das Auto zum Stehen und schnallt sich ab, während sie mich erwartungsvoll mustert.
Ich starre wie in Trance auf das riesige dunkle Holzhaus vor mir. Es wird von einer großzügigen Veranda umgeben, umrahmt mit einem spielerisch verzierten Geländer. Kleine Erker mit Sprossenfenstern setzen sich von dem alten Haus und seinem in der Sonne glitzernden Dach ab. Den Berg hinunter steht ein weiteres kleines Holzhaus, wahrscheinlich der Bootsschuppen des Anwesens. Ein riesiger Steg führt daneben entlang, hinein in den See.
»Wow. Mom, das ist wunderschön.«
»Und es gehört dir«, feixt sie und zwinkert mir belustigt zu. Sie macht sich ständig über Grams Aktion lustig, das Haus auf mich zu überschreiben und nicht auf sie. Aber ich weiß, dass es sie verletzt. Auch wenn sie das gern zu überspielen versucht.
Ich schüttle lachend den Kopf und steige aus. Mom und ich konnten Streitigkeiten schon immer gut fallen lassen.
Der Weg zum Eingang ist mit weißen Kieselsteinen bedeckt. Er sieht so edel aus, dass ich mich frage, ob meine Schuhe sauber genug sind, um ihn entlangzugehen. Als ich am Eingang angekommen bin, entdecke ich ein weiteres Holzhaus, nur ein paar Meter von unserem entfernt.
»Nachbarn?«, erkundige ich mich und deute Mom mit meinem Blick, was ich meine.
Sie lächelt mich wissend an. »Das gehört auch dir, Schätzchen.«
»Uns«, verbessere ich sie und mustere das Haus, das nur ein wenig kleiner ist als unseres.
»Es ist in den Ferien immer vermietet. Die Einnahmen gehen zur Hälfte auf ein Konto, das dafür gedacht ist, Geld bereit zu haben, falls mal etwas an dem Haus gemacht werden muss, und zur anderen auf ein Sparkonto, das auf deinen Namen läuft.«
»Ich finde, dass du das Geld bekommen solltest«, beschwere ich mich und verziehe genervt den Mund.
»Sieh es so, Lya: Je mehr Geld du selbst zusammensammelst, desto weniger muss deine arme Mutter für dein College ausgeben.«
Ich schweige. Das Thema College ist nicht gerade mein liebstes. Vor allem die Tatsache, dass Mom immer noch davon ausgeht, ich würde schon noch zur Vernunft kommen und mich bewerben. Aber ich gehöre dort nicht hin.
Sie lacht herzhaft, während sie den Schlüssel aus ihrer Tasche kramt und die schwere Holztür aufschließt.
Eigentlich habe ich mir vorgenommen, alles hier zu hassen, und zumindest was die Jugendlichen angeht, habe ich das bisher auch sehr gut hinbekommen, aber als ich den langen Flur erblicke, der mit der Fensterfront des Wohnzimmers endet, von wo aus man den See sehen kann, kann ich nicht anders, als es einfach nur wunderschön zu finden. Und obwohl es ziemlich urig eingerichtet ist, vor allem im Gegensatz zu unserem alten Haus, das Mom selbst geplant und eingerichtet hat, fühle ich mich irgendwie heimisch. Als würde ich schon immer hierhergehören.
»Komm, ich zeige dir dein Zimmer!«, sagt sie aufgeregt, greift nach meiner Hand und zieht mich die offene Holztreppe hinauf. Etwas, an das ich mich mit meiner Höhenangst definitiv gewöhnen muss. Sie läuft den Flur entlang und öffnet eine Tür ganz am Ende des Ganges.
Das Erste, was ich erspähe, ist der See. Auch hier gibt es eine riesige Fensterfront, die auf einen kleinen Balkon führt.
»Wow!«, entfährt es mir, woraufhin Moms Augen vor Glück strahlen. So sehr, dass ich es nicht einmal bereuen kann, meinem Erstaunen freien Lauf gelassen zu haben. »Willst du das Zimmer nicht?«
»Ich habe meine gesamte Kindheit hier gewohnt. Jetzt ist es deins!«, quietscht sie stolz und schiebt mich an meinen Schultern in das wunderschöne große Zimmer. Durch ein weiteres Fenster an der linken Seite kann ich das Nachbarhaus sehen. Mein Haus. Das ist alles so surreal.
Ansonsten ist das Zimmer mit allem ausgestattet, was man braucht, und ich beginne mich zu fragen, wo meine Möbel noch Platz finden sollen.
»Alles, was du nicht haben willst, tauschen wir durch deine Möbel aus. Ansonsten lagern wir sie in der Stadt.«
»Mir gefällt es so«, flüstere ich und berühre ehrfürchtig das Holzbett, das mit wunderschönen Schnitzereien verziert ist.
»Zieh dir was an, dann fahren wir ins Bootshaus«, sagt Mom schuldbewusst und stellt meine Tasche neben mir ab. Ich habe gar nicht bemerkt, dass sie sie mitgenommen hat. Mom ist wirklich immer vorbereitet.
Widerwillig nicke ich, während sie den Raum verlässt und meine Tür schließt. Ich schlucke schwer und öffne die Glastüren, die auf den Balkon führen. Ein warmer Wind bläst mir entgegen und meine Lider schließen sich wie automatisch, bevor ich wieder auf den See hinabsehe. Als ich begreife, dass mein Körper anfängt sich hier wohlzufühlen, wende ich meinen Blick ab und starre auf einen jungen Mann, vielleicht ein wenig älter als ich, der auf dem Balkon des Nachbarhauses steht und telefoniert. Aufgebracht geht er hin und her und brummt irgendetwas in sein Handy. Er redet so leise, dass ich nicht hören kann, was er sagt. Nervös streicht er sich das dunkle Haar zurück und stemmt sich mit seinen Armen auf das Geländer, sein Blick auf den See gerichtet. Ich gehe einen Schritt zurück, damit er mich nicht entdeckt, bin aber nicht in der Lage, wieder hineinzugehen und ihn sein Telefonat allein zu Ende bringen zu lassen. Als würde sein Anblick mich magisch anziehen. Als wäre er mir auf eine seltsame Art vertraut.
Ich neige meinen Kopf ein wenig.
»Nein, das werde ich nicht!«, schreit er plötzlich in sein Telefon.
Ich zucke zusammen und stoße unbeholfen gegen einen kleinen Klapptisch, der zusammen mit zwei Stühlen in der Ecke des Balkons steht. Als mich sein Blick trifft, raubt er mir den Atem. Beinahe so als würde er alles aus mir herausziehen. Meine Seele und mein Herz zerquetschen. Angst kriecht in jede Faser meines Körpers und lässt ihn erstarren. Rote Augen funkeln mich an. So bösartig, dass ich am liebsten vom Balkon springen würde. Es ist, als würde die Luft um mich herum flimmern und dunkler werden. Wie Schatten, die mich ummanteln und zu sich locken.
Er steht einfach nur da und starrt mich an. Eine halbe Ewigkeit. Und ich drohe jede Sekunde zu ersticken oder vor Angst an einem Herzinfarkt zu sterben.
Dann endlich wendet er seinen Blick ab, schmeißt sein Handy in den See und stürmt zurück in sein Haus. Das Klatschen des Telefons im Wasser hallt in meinen Ohren nach.
Ich schnappe nach Luft. Wie automatisch sinke ich auf meine Knie und keuche. Was zum Teufel war das? Diese roten Augen. Als würde er jegliches Leben aus mir herausziehen. Und dieser Zorn. Dieser unbändige Hass, den ich gespürt habe.
Langsam befreit sich meine Seele wieder und die leichte Dunkelheit um mich herum verschwindet. Ich werde ganz eindeutig verrückt. Rot leuchtende Augen gibt es nicht. Es muss irgendeine logische Erklärung dafür geben. Oder ich bin durch die lange Fahrt so durch den Wind, dass ich es mir wirklich nur eingebildet habe.
Ich schüttle den Kopf und bemühe mich, wieder ruhig zu atmen, bevor ich mich aufrichte und in mein Zimmer gehe, um mich umzuziehen. Hoffentlich sehe ich diesen Kerl nie wieder. Nicht einmal vor Jason hatte ich solch eine Angst – und das, obwohl er mich getötet hat.
»Lya!«, schreit meine Mutter von unten, als ich gerade meine Hose überziehe. Ich fasse mich und laufe die offene Holztreppe zu ihr hinunter. Sie steht bereits an der geöffneten Haustür und lässt genervt ihren Schlüssel von der einen zur anderen Hand wandern. Ohne darauf zu achten, gehe ich hinaus an die frische Luft und werfe noch einen kurzen Blick zu dem Nachbarhaus.
»Wer wohnt da zurzeit?«, frage ich beiläufig, während ich in das Auto einsteige und Mom auf dem Fahrersitz Platz nimmt.
»Eine Familie, die das Haus immer in den Sommerferien mietet. Ich kenne sie nicht, aber wir können sie ja mal zum Essen einladen.«
»Bitte nicht«, seufze ich und schnalle mich an, während meine Mutter mir merkwürdige Blicke zuwirft, aber nicht nach meiner Reaktion fragt. Etwas, das so ganz und gar nicht zu ihr passt. Aber ich schweige, weil ich keine Lust habe, ihr am Ende doch von meinen Halluzinationen berichten zu müssen.
***
Als wir am Bootshaus ankommen und ich aus dem Auto aussteigen will, hält Mom mich am Arm fest und sieht mir tief in die Augen. »Bitte sei nett«, fleht sie beinahe.
Ich verenge meinen Blick. Will sie mir damit etwa sagen, dass ich unhöflich bin? Genervt verziehe ich den Mund, nicke und steige aus dem Auto. Musik und freudige Schreie dröhnen an meine Ohren. Und obwohl ich den Spaß darin erkenne, machen sie mir Angst und lassen all meine Körperzellen auf Alarm springen.
»Lya? Schätzchen?«
Wie in Trance nicke ich meiner Mutter zu, während mich ein Aufprall auf dem Wasser zusammenzucken lässt. Na super, offensichtlich hat meine Mom recht und ich bin wirklich nicht mehr gesellschaftsfähig.
»Ist alles in Ordnung?«
»Jaja«, murmle ich und starre auf den Jungen, der nach seinem Sprung ins Wasser gerade wieder auftaucht. Sein Körper ist beinahe unmenschlich schön. Seine Muskeln sind so definiert, dass man sie selbst aus der Entfernung in jedem Detail bewundern kann. Elegant wirft er sein nasses dunkelblondes Haar zurück und mir einen selbstsicheren Blick zu. Seine grünen Augen sehen genauso unmenschlich schön aus wie der Rest an ihm. Und auch die anderen Jugendlichen, die ich von hier erkennen kann, sind wirklich hübsch. Was ist das hier? Eine Schmiede für schöne Menschen?
»Lya!«
Die Stimme meiner Mutter klingt wütend. Unschuldig drehe ich mich zu ihr um und entdecke einen großen Mann neben ihr. Seine Haut ist ein wenig dunkler als meine und sein graues Haar ist zu einem Pferdeschwanz gebunden. Unwillkürlich werfe ich einen Blick auf meine eigenen Haare, die ungebürstet über meine Schultern hängen und mir bis zum Bauch reichen. Genauso wie seine sind sie grau, fast weiß. Meine Mutter sagt zwar immer, sie wären silbern, aber wahrscheinlich will sie mich damit nur beruhigen und davon abhalten, sie wieder zu färben. Sie hat gut reden, mit ihren wunderschönen gewellten blonden Haaren. Meine hängen einfach nur von meinem Kopf hinunter. Und zu allem Überfluss haben sie auch noch die gleiche Farbe wie die meiner Grams. Schlimmer geht es nicht.
»Das ist meine Tochter Elya. Lya, das ist Earl«, stellt sie uns vor. Ich gehe einen Schritt auf ihn zu und ergreife seine Hand. Auf irgendeine Weise wirkt Earl vertraut. So als würde ich ihn schon ewig kennen. Seine dunkelgrünen Augen ruhen voller Wärme auf mir.
»Es freut mich, dich wiederzusehen«, haucht er und schenkt mir ein liebevolles Lächeln, während ich die Schwielen an seinen Händen spüren kann.
»Äh«, mache ich verwirrt, während er meine Hand wieder loslässt.
»Earl hat dich als Kind gesehen, Lya«, erklärt Mom.
Ich nicke irritiert. Das letzte Mal, als ich hier war, bin ich zwei Jahre alt gewesen. Ob man das als ein Wiedersehen bezeichnen kann, wage ich zu bezweifeln.
»Bist du bereit?«, fragt Earl und sieht mich erwartungsvoll an.
Ich runzle irritiert die Stirn.
»Für dein Probearbeiten«, erklärt er, als er meinen verdutzten Gesichtsausdruck sieht.
»Ja, ist sie«, antwortet Mom für mich und für einen kleinen Moment hasse ich sie.
»Jackson!«, ruft Earl nach unten zum Wasser. »Er wird dich einarbeiten«, fügt er an mich gerichtet hinzu.
Mit zusammengebissenen Zähnen starre ich hinunter zum See – und als wäre ich verflucht, kommt der dunkelblonde Schönling auf mich zu. O bitte nicht!
Ich schließe einen Moment lang die Augen, in der Hoffnung, dass das alles nur ein dummer Traum ist, bis ich seine Wärme spüre.
»Hey. Ich bin Ayron. Aber nenn mich Jackson. Das machen sowieso alle hier.« Er streckt mir lachend seine Hand entgegen, wie zuvor Earl. Nur dieses Mal fällt es mir um einiges schwerer, sie zu ergreifen. Am liebsten würde ich im Erdboden versinken. Hätte ich gewusst, dass ich heute schon arbeiten muss – und dann auch noch zusammen mit einem Halbgott –, hätte ich mir zumindest die Haare gekämmt. Und vielleicht sogar ein wenig Schminke aufgelegt. Jetzt ist der erste Eindruck dahin und er wird mich für genauso gestört halten wie all die anderen.
»Ayron Jackson«, erklärt Earl und lächelt mich wieder aufmunternd an. »Dann macht ihr mal. Cynthia und ich trinken einen auf alte Zeiten.«
»Ja, alter Kerl, trink mal auf längst vergangene Jugenderinnerungen«, feixt Jackson und schlägt ihm liebevoll auf die Schulter, bevor er wieder mich ansieht. »Komm mit!«
Ich folge ihm den Weg hinunter zum See. Die Blicke der anderen verfolgen mich. Wenn ich vorher gedacht habe, es könne nicht schlimmer werden, werde ich jetzt eines Besseren belehrt.
Als meine Schuhe im Sand versinken und der See direkt vor mir die Sonnenstrahlen glitzernd tanzen lässt, greift sich Jackson ein Shirt aus einer kleinen Holzhütte und zieht es sich über. »Wie heißt du eigentlich?«
»Lya«, antworte ich knapp.
Er presst die Lippen aufeinander. Wahrscheinlich um ein Lachen zu überdecken. Wie immer benehme ich mich einfach nur bescheuert. Aber so bin ich nun einmal.
»Hast du einen Badeanzug oder Bikini dabei, Lya?«
Ich schüttle den Kopf und beiße mir auf die Unterlippe. Mein Leben ist wirklich das beschissenste von allen. Wie konnte Mom mich nur derart ins kalte Wasser werfen?
»Kein Problem«, winkt er ab, sieht sich um und pfeift dann laut. »Perce!«, ruft er und innerhalb von ein paar Sekunden kommt ein blondes Mädchen in einem gelben Bikini angerannt und berührt erfreut meine Schulter. Jackson allerdings wirft sie einen seltsamen Blick zu, ohne dass er es bemerkt.
»Du musst Elya sein!«
»Ähm …«, stammle ich.
»Sie bevorzugt Lya«, mischt sich Jackson ein und wirft mir ein kleines Lächeln zu. »Hast du noch einen Bikini für sie? Ihre Klamotten werden sonst … ziemlich nass.«
»Klar!«, quietscht Perce und stürmt in die kleine Hütte, während ich ihr stumm nachstarre und versuche, die unangenehme Stille zwischen Jackson und mir zu verdrängen. Zurück kommt sie mit einem wirklich sehr knappen Bikini und streckt ihn mir freudestrahlend entgegen. »Ich bin übrigens Percy. Meine Eltern haben mich wahrscheinlich schon gehasst, bevor ich überhaupt geboren wurde.«
Sie lacht herzhaft und auch ich ringe mir ein Lachen ab. Ich wäre gern eine von ihnen. Ein Mädchen, das lacht und Spaß hat. Sich keine Sorgen macht. Aber das bin ich nicht. Und auch sie werden es bemerken und spätestens dann nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Ich habe mein Leben lang gelernt, was passiert, wenn ich Menschen an mich heranlasse. Es gab nie wirklich jemanden, dem ich etwas bedeutet habe. Dem ich wichtig war. Der mich wirklich hätte lieben können. Abgesehen natürlich von meiner Mom, aber bei der Geburt wurde sie durch die Natur nur so mit Oxytocin und Endorphinen vollgestopft, dass sie gar nicht anders konnte, als mich zu lieben. Zumindest war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Mein Vater hingegen … Er schreibt mir Pflichtkarten zum Geburtstag und ganz selten besucht er uns sogar. Aber Liebe empfindet er für mich nicht.
»Ich … ähm …«, murmle ich, als mir bewusst wird, wie lange ich in Gedanken versunken war, deute auf den Bikini in meiner Hand und dann auf die kleine Hütte.
»Ja, zieh dich um und dann geht es los«, stimmt mir Jackson zu und erklärt Perce, dass wir sie nicht länger brauchen und sie ihren freien Tag genießen soll.
Als ich den Bikini anhabe, ist das einzig Positive an der Situation, dass es keinen Spiegel gibt, in dem ich das Unheil auch noch sehen könnte. Ich ziehe mein Shirt darüber und trete wieder hinaus zu Jackson.
»Super, komm mit.«
Er geht auf dem kleinen Strand vor dem Wasser entlang, bis wir zum Start der Wasserskianlage kommen. Auch hier gibt es einen kleinen Holzschuppen und weiter oben einen Laden, in dem man sich Wasserskier oder Waveboards ausleihen kann.
»Deine Aufgabe ist eigentlich leicht. Du musst nur da unten stehen und den Kindern helfen sich aufzurichten. Ihnen erklären, dass sie ihr gesamtes Gewicht nach hinten verlagern sollen, und sie aus dem Wasser ziehen, wenn sie es nicht geschafft haben. Weiter hinten um den See stehen ein paar Bademeister. Also musst du die Kinder nur retten, wenn sie direkt hier umfallen«, feixt er und deutet auf ein paar Jungs in roten Badehosen, die am Ufer stehen und wachsam den Kindern beim Wasserskifahren zusehen.
»Was machst du?«, frage ich plump. Viel zu plump. Wie immer.
»Ich mache vorher einen kleinen Kurs mit den Kindern, Übungen im Trockenen, und dann stehe ich hier bei dir. Wenn du willst, zeige ich dir, wie es geht.«
»Ich mag Wasser nicht«, antworte ich und werfe einen Blick auf das kalte Nass. Ich mochte es noch nie. Etwas, das meine Mutter genau weiß, und trotzdem hat sie mich in diesen Job gezwungen.
»Na, da seid ihr ja an den richtigen Ort gezogen«, lacht er und berührt meine Schulter, um mich an den Startpunkt zu führen.
Etwas Seltsames zuckt durch meinen Körper. Etwas flimmert vor mir in der Luft. Doch bevor ich es wirklich realisieren kann, sind das Gefühl und dieses Leuchten wieder verschwunden.
»Ich zeige dir, wie es geht«, reißt er mich wieder in die Realität und kniet sich zu dem Kind, das gerade von einem anderen Jungen meines Alters eingewiesen wird. »Hey, kleiner Mann. Hast du Angst?«, fragt er liebevoll.
Der Junge schüttelt nervös den Kopf.
»Wow, ziemlich mutig. Ich muss zugeben, dass ich jedes Mal eine tierische Angst habe.«
»Wirklich?«, hakt der Junge mit zittriger Stimme nach.
»Klar, aber sag das auf keinen Fall den Mädchen hier am See«, raunt Jackson und wirft mir ein Lächeln zu. Und tatsächlich spüre auch ich, wie sich ein Lächeln auf meinen Lippen breitmacht. »Hör zu. Du siehst mir wie ein ziemlich starker Junge aus. Kannst du deine ganze Kraft aufwenden und dich nach hinten legen, wenn es losgeht?«
Der Junge nickt wieder.
»Wenn du die Schnalle in die Hand bekommst, wird sie dich mit einem Schwung nach vorn ziehen. Aber wir wollen ja nicht, dass nur dein Oberkörper nach vorn gezogen wird, sondern auch deine Beine. Also musst du deinen ganzen Körper einsetzen. In Ordnung?«
»Ja«, sagt der Junge entschlossen.
»Ach, und noch eins. Beim ersten Mal klappt es eigentlich nie. Aber dann weißt du genau, was ich meine, und danach wird es einfacher.«
Er legt dem Jungen die Schlaufe in die Hand und sagt ihm Bescheid, als es losgeht. Für einen kurzen Moment wird der Junge auf den Skiern die kleine Rampe entlanggezogen, doch kaum berührt er das Wasser, klatscht sein Oberkörper wie der einer Puppe vornüber ins Wasser. Ich atme erschrocken aus, während Jackson zu ihm ins Wasser geht und ihn herausfischt. Und obwohl der Junge ziemlich erschrocken und atemlos aussieht, stellt er sich sofort wieder hinten an.
»Jetzt du«, fordert Jackson mich auf und hält mir seine Hand entgegen, um mich zu sich zu ziehen.
Ich weite panisch meine Augen. »So was kann ich nicht.«
»Was genau? Schwimmen? Du kannst hier stehen«, lacht er und verzieht belustigt die Lippen.
»Nein … so mit Kindern reden«, murmle ich schüchtern.
Eigentlich gehöre ich nicht zu der Sorte Mädchen, die bei einem Kerl zu einem unsicheren Püppchen mutieren. Bei Jackson ist das etwas anderes. Er schüchtert mich ein. Nicht nur, weil er hübsch ist. Da ist noch etwas anderes.
»Komm schon.«
Widerwillig sauge ich die heiße Luft um mich ein und knie mich zu ihm. Der andere Helfer hat sich mittlerweile nach oben verzogen und raucht eine Zigarette.
»Hey du«, murmle ich dem Jungen zu, der jetzt an der Reihe ist. Er sieht mich ängstlich an. »Du musst deinen Körper ganz doll anspannen und dein Gewicht nach hinten legen. So wie ihr es gelernt habt. In Ordnung?«
Der Blick des Jungen wird skeptisch, beinahe belustigt. Die Angst, die ich gerade noch zu sehen glaubte, ist verschwunden. »Das ist meine zehnte Runde, Ma’am.«
»Ma’am?!«, wiederhole ich schockiert.
Jackson presst seine Lippen aufeinander und lacht tonlos.
»Sie haben graue Haare«, verteidigt sich der Junge, während ich die Schnalle packe und sie ihm in die Hand drücke. Ein Teil von mir wünscht sich wirklich, dass er auf die Schnauze fällt. Aber der kleine Dreckskerl beherrscht es natürlich perfekt.
»Das ist ein kleiner Junge, mach dir nichts draus. Er weiß nicht, dass es bei euch Mädels jetzt in ist, sich graue Haare zu färben.«
Na super. Jetzt auch noch Jackson.
»Das ist meine Naturhaarfarbe«, brumme ich, während ich provokativ auf meine Haare deute.
Jackson hebt die Brauen und stellt sich zu mir. Hätte er nicht einfach hocken bleiben können? Jetzt überragt er mich um eineinhalb Köpfe. »Gefällt mir«, murmelt er und geht dann an mir vorbei.
Kapitel 2
Nachdem Jackson mir den Übungsraum und den Shop gezeigt hat, musste ich noch ein paar Kindern aus dem Wasser helfen, bis die Wasserskianlage abends endlich zumachte. Ich half ihm, die Technik zu überprüfen, auch wenn ich eigentlich nur danebenstand und so tat, als würde ich alles verstehen. Als wir dann noch die Matte gesäubert, uns umgezogen und ein paar Stühle und die Schaumstoff-Boards, mit denen die Jüngeren üben, im Schuppen verstaut hatten, machten wir uns auf den Weg zum Bootshaus.
»Bleibst du heute?«
»Was?«, erwidere ich verwirrt, während ich mich über den matschigen Weg kämpfe, ohne auszurutschen.
»Das Spring-Break-Fest«, erklärt er und lächelt schadenfroh, als er meinen holprigen Gang beobachtet.
»Spring Break?«, erwidere ich erschrocken. Auf nackte Frauen und saufende Teenies habe ich recht wenig Lust.
»Das nennen wir hier nur so. Ist alles ein wenig harmloser. Wir feiern einfach den Sommeranfang. Und dass die Urlauber da sind. Die meisten kennen wir schon, seit wir klein sind.«
»Also bist du kein Urlauber?«, erkundige ich mich gespielt desinteressiert. Nicht etwa, weil ich mich von seinem gottähnlichen Aussehen blenden lasse. Nein. Es wäre nett, ein paar Leute hier zu kennen, wenn ich ab jetzt hier wohnen soll. Urlauber kennenzulernen bringt mir dabei recht wenig.
Er nickt und sieht dann auffordernd zwischen dem Bootshaus und mir hin und her.
»Ich bin nass«, antworte ich knapp. Ziemlich arme Ausrede, aber etwas Besseres fällt mir nicht ein.
»Ich könnte dich nach Hause bringen, draußen warten und dann wieder hierher mitnehmen.«
Skeptisch mustere ich seine vor Freude strahlenden Augen.
»Earl hat mich gebeten, dich unter meine Fittiche zu nehmen. Und jetzt, da ich dich wirklich leiden kann, fällt es mir sogar ausgesprochen leicht.«
»Meine Mom fährt mich heim«, nuschle ich, während ich auf einem Stein ausrutsche, Jackson mich aber mit Leichtigkeit am Arm festhält und am Stürzen hindert.
»Zurück wird sie wohl kaum fahren«, sagt er und deutet auf das Bootshaus vor uns. Auf der Stegterrasse erkenne ich meine Mutter, die trunken mit Earl tanzt und singt, ein Sektglas in ihrer Hand.
»O Mom«, murmle ich beschämt und schlage mir die Hand vor die Stirn. »Aber ich gehe trotzdem.«
Ich laufe am Bootshaus vorbei, um durch den Wald nach Hause zu laufen.
»Nach Hause fahre ich dich auf jeden Fall. Ich warte dann genau zehn Minuten vor deiner Tür. Wenn du nicht kommst, fahre ich wieder.«
Ich verziehe den Mund, nicke aber. Wenn ich es mir recht überlege, war die Fahrt ziemlich lang und der Weg ganz schön dunkel. Woher Jackson weiß, dass ich keinen Führerschein habe, ist mir allerdings ein Rätsel.
Ich folge ihm zu einem roten Pick-up und steige ein. Das zum Thema, man solle nicht mit Fremden mitfahren. Vielen Dank, Mom!
Jackson schweigt die ganze Fahrt über. Irgendwann scheint auch er zu bemerken, wie unangenehm das ist, und dreht die Musik lauter.
Als wir endlich mein Haus erreichen, stürme ich aus dem Wagen.
»Bis gleich, Lya«, ruft er mir durch sein geöffnetes Fenster zu.
Ich drehe mich um, eigentlich um ihm zu sagen, dass ich ins Bett gehen werde. Dann aber fällt mein Blick auf seine glänzenden grünen Augen und seine Lippen, die zu einem freudigen Lächeln verzogen sind.
»Beeilung!«, weist er mich feixend an und spätestens jetzt gehorcht mir mein Verstand nicht mehr.
Eilig krame ich den Schlüssel heraus und sprinte in mein Zimmer. Zehn Minuten. Wie zum Teufel soll ich das schaffen? Ich sehe aus wie ein Zombie!
Ich krame unruhig die Schminke aus meiner Tasche und klatsche sie mir ins Gesicht, bevor ich mein Gepäck nach etwas zum Anziehen durchforste. Die Männer mit den Möbeln und unseren Kartons werden wohl erst morgen auftauchen, also habe ich keine Wahl. Ich greife mir ein weißes Sommerkleid und werfe es mir über, nachdem ich Perces Bikini durch einen von mir ausgetauscht habe. Meine noch etwas nassen Haare binde ich mir zu einem Knoten nach oben und mustere mich im Spiegel. Mein Blick fällt auf meinen Hals. Da, wo eigentlich ein Schnitt prangen sollte. Da, wo meine Haut weicher und schöner ist als an jeder anderen Stelle meines Körpers. Die Stelle, die mir Jasons Verrat deutlich zeigen sollte, jetzt aber nur in meinem Herzen existiert. In meinem gebrochenen Herzen. Denn auch Jason war ganz offensichtlich nicht in der Lage, mich zu lieben. Und trotz allem … Obwohl ich mich genau erinnere, dass er mich getötet hat, vermisse ich ihn. Vermisse ihn, so wie ich mein Leben lang meinen Vater vermisst habe.
Mit zusammengepressten Lippen schließe ich meine Augen, sammle mich kurz und eile dann die Treppe wieder hinunter. Als ich die Haustür hinter mir schließe, höre ich ein wütendes Knurren.
»Ich will, dass du dich von ihr fernhältst, Levyn! Also wirst du heute Abend nicht dort auftauchen! Sie braucht normale Menschen um sich. Freunde. Nicht so kranke Spinner wie dich!«
Jacksons Stimme klingt bedrohlich. Ganz anders, als ich sie bisher wahrgenommen habe. Als ich einen weiteren Schritt auf seinen Truck zugehe, erkenne ich auch den Grund. Levyn ist der Junge mit den roten Augen vom Balkon.
Unsicher zucke ich zusammen und stoße dabei gegen eine seltsame Topfpflanze. Na super. Sobald dieser Grusel-Dämon in meiner Nähe ist, werde ich zu einem anderen Menschen. Einem tollpatschigen Menschen.
Als ich aufblicke, treffen mich seine Augen wie ein Stromschlag. Aber dieses Mal ist es etwas anderes. Dieses Mal habe ich keine Angst und seine Augen sind auch nicht mehr rot, sondern dunkelgrün, fast schwarz. Also habe ich mir dieses Glühen heute Mittag wirklich nur eingebildet.
»Lya, steig ein«, sagt Jackson in einem herrischen Ton und kommt auf mich zu. Er greift nach meinem Arm, zieht mich zum Auto, öffnet die Tür und drückt mich förmlich auf den Sitz, während ich einfach nur diesen Jungen anstarren kann. Levyn. Wie kann er plötzlich wie ein normaler Mensch aussehen? Wie ein fast schon netter Mensch, wäre da nicht dieses grausame Glitzern in seinen Augen.
Er lächelt mich selbstsicher an und kommt um das Auto herum. »Hab gehört, du bist meine neue Vermieterin. Darauf müssen wir gleich unbedingt einen trinken.«
»Du bleibst zu Hause, Levyn!«, knurrt Jackson und setzt sich neben mich. Der Motor heult wütend auf.
»Süß, Jackson, wie du meinen Vater spielst. Aber nicht einmal der könnte mich davon abhalten. Also bis gleich, Elya«, richtet er sich an mich, dreht sich um und steigt ein paar Meter weiter in sein eigenes Angeber-Auto – einen schwarzen Lamborghini. Als wäre er Batman in seinem Batmobil.
»Könnt ihr euch irgendwie nicht leiden?«, frage ich mit belegter Stimme. Auch wenn dieser Levyn dieses Mal weniger angsteinflößend war, habe ich in seiner Nähe wieder keine Luft bekommen und eine Dunkelheit gespürt.
»Weißt du, was Jungs wie er mit Mädchen wie dir machen, Lya? Sie reißen euch das Herz raus und lassen es in ihren Fingern zu Staub zerbröseln, während ihr dabei zuseht. Und sie – sie lachen über eure Naivität.«
Ich hebe erschrocken meine Brauen. »Wow. Du scheinst ihn wirklich zu hassen.«
»Es ist viel mehr als Hass, Lya. Tu mir einfach den Gefallen und halte dich von ihm fern.«
»In zwei Monaten ist er doch sowieso wieder weg«, versuche ich ihn zu beruhigen.
»Levyn lebt hier. Nicht genau am See, deshalb mieten seine Eltern für die Ferien immer euer Haus, aber er ist auch nach dem Sommer noch da.«
Ich verziehe den Mund. Meine Gefühle verwirren mich. Etwas in mir hat Angst vor ihm. Ein anderer Teil ist froh über das, was Jackson sagt. Warum auch immer. Und ein weiterer, ziemlich verborgener Teil in mir zweifelt alles an, was Jackson mir sagt. Als wäre an all dem hier etwas falsch.
»Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dich entschieden hast mitzukommen.«
»Klar«, nuschle ich, werfe einen Blick in den Rückspiegel und bemerke, dass Levyn uns verdächtig nah auffährt.
»Der ist echt so ein Penner. Unfassbar.«
»Lass ihn. Wenn er Spaß daran hat«, murmle ich.
Als wir endlich am Bootshaus angekommen sind, schert Levyn aus, überholt uns und fährt in die Parklücke, die Jackson angesteuert hat. Jackson hat recht. Er ist wirklich ein Penner.
Wir steigen aus und gehen zusammen ins Bootshaus. Levyn bleibt seltsamerweise in seinem Auto sitzen. Dafür hatte er es aber ziemlich eilig.
Ich schüttle den Kopf und werfe einen Blick auf die gefüllte Bar. Es wirkt heimisch hier. Fast gemütlich. Und irgendwie erinnert es mich an Hawaii. Das Strohdach über der Bar, die mit Bambus verziert ist, die hölzernen Säulen, in die mir unbekannte Symbole eingeritzt sind, und die bunten Lampions, die kreuz und quer an der Decke hängen und den Raum in ein warmes Licht tauchen. Meine Augen wandern über die behangenen Wände. Ich erkenne Schilder, Bilder und sogar Waveboards, die auf die Reiselust des Besitzers hindeuten.
Perce, die gerade auf mich und Jackson zustürmt, reißt mich mit ihrem freudigen Gequietsche aus meinen Gedanken. »Ach wie schön, du bist mitgekommen!«, jubelt sie, nimmt meine Hand und zieht mich zu einer Gruppe Jugendlicher, die um einen Tisch herumsitzen. »Das ist Lya«, stellt sie mich vor.
Ich winke unbeholfen, anstatt jedem die Hand zu geben, wie es sich gehört.
»Das ist Kyra.«
Sie deutet auf ein hübsches blondes Mädchen. So wie die Augen aller anderen am Tisch, sind ihre grün.
Sind die etwa alle irgendwie verwandt? Und was ist nur mit ihren Namen schiefgelaufen? Wobei ich mich am wenigsten beschweren kann. Wahrscheinlich hatten unsere Eltern früher einen Geheimclub. Der Club der verbitterten Gestörten, dessen Mitglieder ihren Kindern Scheißnamen geben werden. Sie haben ihr Ziel erreicht.
»Das sind Arya und Tym.«
Mir winken zwei ebenfalls blonde und grünäugige Jugendliche zu. Arya, das Mädchen, hat eine ganz spezielle Aura. Sie wirkt zurückhaltend, aber trotzdem stark. Beinahe wie jemand, der bereits viel Lebenserfahrung gesammelt hat. Tym sieht Arya noch ähnlicher, weshalb ich der festen Überzeugung bin, dass die beiden wirklich verwandt sind.
»And last but not least …«
Die Stimme jagt mir einen unangenehmen Schauer über den Rücken.
»Levyn, ich habe dir gesagt, dass du dich verpissen sollst«, stöhnt Jackson neben mir.
»Lass ihn doch. Er gehört nun einmal dazu«, flüstert Perce und bietet Levyn den Platz neben sich an.
Siegessicher lässt er sich sinken und sieht abwechselnd mich und Jackson an. »Jackson, lass die Kleine einfach selbst entscheiden, was sie will.«
»Nenn mich nicht Kleine!«, gifte ich ihn an und danke Gott dafür, dass ich endlich in der Lage bin, etwas vor ihm herauszubekommen.
»Wie denn sonst?«, raunt er, steht auf und beugt sich verdächtig nah zu mir. Sein Geruch betäubt mich. Ich bin drauf und dran, mich ihm noch ein wenig zu nähern, um mehr von diesem Duft einatmen zu können, als Levyn einen Satz nach hinten macht und mich anstarrt, als wäre ich giftig. In seinen Augen blitzt für den Bruchteil einer Sekunde ein roter Schimmer auf. Der, den ich bereits auf dem Balkon in ihnen gesehen habe. Also doch keine Einbildung. Was ist das?
Ich keuche. Vor Panik und vor Scham.
»Was ist los mit dir, Levyn?«, fragt Arya, deren Stimme so samtig ist, dass ich mich am liebsten in sie reinlegen würde. Trotzdem ist sie auch hart und undurchsichtig. Stark.
»Ich habe ganz vergessen, dass ich an einem anderen Tisch erwartet werde«, knurrt er zwischen zusammengepressten Zähnen. Seine vor Zorn funkelnden Augen sind auf mich gerichtet.
»Gut«, brummt Jackson neben mir.
Levyn kommt auf mich zu und läuft mit starrenden Augen an mir vorbei, dann dreht er sich noch einmal um. »Pass mit diesem Drecksack Jackson auf. Er ist gefährlich für dich. Und ich würde mich ungern in deiner Nähe aufhalten, um dich zu beschützen.«
»Bitte was?!«, stoße ich hervor. Ich habe Gemeinheiten von ihm erwartet. Jackson hat mich gewarnt. Aber das? Und vor allem wirkt eher Levyn gefährlich, nicht Jackson.
Von meiner Neugier gelenkt gehe ich einen Schritt auf ihn zu. Er weicht augenblicklich zurück. Eigentlich wollte ich etwas Cooles sagen. Etwas total Selbstbewusstes. Aber nichts verlässt meinen Mund.
Stattdessen ergreift Levyn das Wort: »Halt dich bloß von mir fern!«, zischt er und verengt seinen düsteren Blick noch weiter. Angst klettert meine Wirbelsäule hinauf und schnürt mir die Kehle zu. Für einen kurzen Moment ist es, als würde das Licht gedimmt werden.
»Ich bin dafür, dass sie dich anfasst. Vielleicht fällst du dann tot um«, mischt sich Jackson ein.
Er also auch noch? Was bitte soll meine Nähe Schreckliches mit ihm machen?
»Versuch’s doch mal, Lya. Du wärst meine Heldin.«
»Kein Bedarf«, knurre ich und lasse mich neben Perce auf Levyns frei gewordenen Platz sinken. »Ist das normal? Oder dreht der vollkommen durch?«, frage ich sie, als Levyn sich zu einer anderen Gruppe Jugendlicher gesetzt hat.
»Der hat nen leichten Knall«, murmelt Perce wenig überzeugt. »Aber wir kennen ihn, seit wir klein sind. Unsere Eltern sind zusammen im … also sie arbeiten zusammen. So ist das unter uns Einheimischen. Keiner wird ausgeschlossen.« Sie wirft Jackson einen mahnenden Blick zu. »Keiner!«
»Du kennst meine Meinung dazu. Und nicht nur meine. Du weißt, was das heißt.«
Auch wenn er es heimlich macht, sehe ich genau, dass er mit seinen Augen auf mich deutet. Was habe ich zu bedeuten?
»Was hat das alles mit mir zu tun?«
»Ach, Jackson macht sich Sorgen, weil Levyn immer Ärger macht, wenn hier neue Mädchen auftauchen. Er zieht dann seine Macho-Herzensbrecher-Nummer ab. Nur verschwinden die meisten Mädels nach dem Sommer wieder. Du wirst bleiben. Und das bereitet ihm Kopfzerbrechen.«
»Warum? Weil du denkst, dass ich nicht stark genug bin, mich nicht in einen Vollidioten zu verlieben?«, richte ich mich an Jackson. Mein Blick fällt kurz auf Aryas Hand, die sich unruhig zu einer Faust ballt, aber sofort wieder entspannt, als sie meinen Blick sieht.
»Kein Mädchen ist das«, brummt er und setzt sich endlich.
»Ich bin kein normales Mädchen«, zische ich. Dabei war ich bis jetzt schon dreimal nicht in der Lage, mich auch nur ansatzweise gegen die Gefühle zu wehren, die er in mir ausgelöst hat. Ob es Angst oder Faszination war, wehren konnte ich mich nicht.
»Glaub mir, Lya, das weiß ich.«
»Schätzchen!«, ertönt die trunkene Stimme meiner Mutter.
»O Gott!«, murmle ich und verstecke mich hinter meinen Händen – ohne Erfolg. Mom stürzt sich auf mich, legt ihr gesamtes Gewicht auf meine Schultern und küsst mich auf die Schläfe. Angewidert und wütend wische ich mir ihren nassen Kuss aus dem Gesicht. »Mom! Verschwinde!«, raune ich ihr zu. Die anderen kichern bereits.
»Ooooooh! Du bist hier mit Freunden. Sorry! Vor denen soll ich dich ja nicht Schätzchen nennen!«
Okay, es kann definitiv doch noch schlimmer werden.
Ich schließe benommen meine Augen und lasse meine Stirn langsam gegen meine Handfläche sinken. Zum ersten Mal in meinem Leben sitze ich abends mit Menschen in meinem Alter zusammen und fühle mich nicht ganz so fehl am Platz wie sonst und schon kommt meine verrückte Mutter und zerstört alles. Fehlt nur noch, dass sie ihnen erzählt, was ich durchgemacht habe, und mein Leben ist beendet.
»Dann lasse ich euch mal allein!«, singt sie vor sich hin, steht auf und tanzt davon.
»Das ist unmöglich gerade wirklich passiert«, nuschle ich und vergrabe mein Gesicht noch weiter in meinen Händen.
»Doch, ist es«, haucht Arya mit einem kühlen Lachen in der Stimme. »Aber es war doch süß. Sie wirkt nett.«
»Nett?!«, stoße ich hervor und starre sie durch meine Finger hindurch an. Sie hebt lächelnd die Schultern.
»Und du kommst woher?«, erkundigt sich Tym, der gerade dem Kellner die Getränke abnimmt.
»Aus Montana … Livingston«, murmle ich in der Hoffnung, dass sie nichts damit anzufangen wissen.
»Ist das nicht da, wo dieser Junge …«, beginnt Kyra, bevor Perce sie durch ein kaum merkliches Kopfschütteln zum Schweigen bringt.
Etwas stimmt mit dieser Gruppe nicht. Es ist fast so, als wüssten sie mehr über mich.
Ich mustere Kyra und ihre hellblonden Haare einen Moment. Sie ist wirklich hübsch, aber etwas Falsches geht von ihr aus.
»Ja, da, wo der Junge und die anderen Jugendlichen von einem Tier getötet wurden«, bestätige ich ihre Frage nüchtern.
Sie verzieht entschuldigend den Mund.
»Hast du Freunde verloren?«, erkundigt sich Tym mitfühlend.
Ich schüttle den Kopf und nehme einen Schluck Bier, um meine Gedanken an Jason zu verdrängen. Ich will nicht an ihn denken – nicht daran, dass ich dachte, er wäre mein bester Freund, und auch nicht daran, dass ich ihn für meinen Mörder halte, obwohl ich hier ganz offensichtlich ziemlich lebendig sitze.
Ich stelle das Bier wieder vor mir ab. Kaum zu fassen, dass wir in Kalifornien so offen Alkohol trinken dürfen. In unserem Alter. »Das war nicht in meiner Gegend.«
Ich habe keine Ahnung, warum ich lüge. Vielleicht, weil ich die Fragen nicht beantworten will oder weil ich nicht mit diesen Blicken angesehen werden will, die sich allmählich auf ihren Gesichtern breitgemacht haben.
Ein lautes Lachen zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich und unterbricht Gott sei Dank die erdrückende Stille. Als ich aber entdecke, woher das Lachen stammt, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich mich wirklich darüber freuen soll.
Ich beobachte das dunkelhaarige Mädchen, das neben Levyn sitzt und sich köstlich über irgendetwas amüsiert. Als ich meinen Blick weiterschweifen lasse, ziehe ich skeptisch die Brauen zusammen. Die Leute bei Levyn sind dunkelhaarig und auch sie haben grüne Augen. So langsam kann man wirklich nicht mehr von Zufall sprechen.
»Was stellt ihr hier nur mit euren Genen an?«, frage ich abwesend und starre weiter auf das dunkelhaarige Mädchen. Zumindest rede ich mir das ein, denn eigentlich schaffe ich mir nur einen Weg, Levyn aus dem Augenwinkel zu beobachten. Es ist, als würde sich ein Teil meiner Seele nach ihm sehnen.
»Hier gibt es eben die Clans. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz«, holt mich Jackson aus meinen Gedanken. »Irgendwann bei unseren Vorfahren fing es an, dass sich immer ähnlich aussehende Menschen zusammentaten. Das hat bis heute angehalten«, erklärt er, als wäre es das Normalste der Welt und nicht total rassistisch.
»Und warum habt ihr dann gesagt, Levyn würde zu euch gehören?«