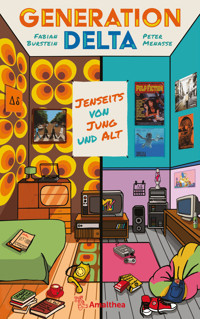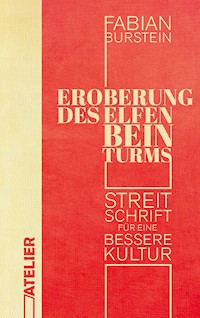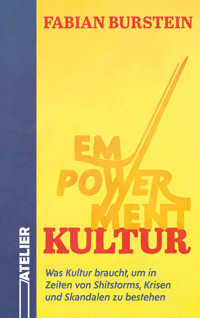
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fabian Burstein kennt die Probleme moderner Kulturarbeit. Einem von der BILD-Zeitung initiierten deutschlandweiten Shitstorm ausgesetzt zu sein (»Sombrero-Verbot«), von Markus Söder besödert und von Rechtsextremisten beschimpft und bedroht zu werden, das hat er alles am eigenen Leib erlebt. Doch wer denkt, dass er sich beim nächsten Mal lieber zurückhalten wird, der irrt sich gewaltig. Denn Burstein hat seine Lehren gezogen und schreibt darüber, wie sich die Kultur – unsere Kultur – wieder einen Platz in den Herzen der Menschen zurückerobern kann, damit wir sie vor Populisten und den Feinden der Demokratie verteidigen können. Mit willensstarker Kulturpolitik, selbstbewusstem und investigativem Kulturjournalismus und verbesserten Strukturen und Strategien. Aber natürlich wäre sein neues Buch nicht vollständig, ohne Schlaglichter auf den einen oder anderen handfesten Kulturskandal zu werfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Aus taktischen Gründen leise zu treten,hat sich noch immer als Fehler erwiesen.«
Johanna Dohnal, Erste Frauenministerin Österreichs
Inhalt
TEIL 1 – DER KULTURKAMPF
TEIL 2 – DER MACHT AUF DER SPUR
TEIL 3 – AUF DEM WEG ZUR KULTURMACHT
Quellenangaben und Anmerkungen
TEIL 1
DER KULTURKAMPF
Im April 2023 machte ich eine Erfahrung, auf die ich sehr gerne verzichtet hätte. Ich geriet in einen deutschlandweiten Shitstorm, dessen hasserfüllte Ausläufer bis in meine Heimatstadt Wien zu spüren waren. Die BILD-Zeitung hatte mit ihrem berühmtberüchtigten Gespür für eskalative Aufmacher eine Senior:innentruppe auf die Titelseite gehoben, die von einem »Auftrittsverbot wegen Sombrero und Kimono«1 betroffen war. Den Hintergrund des »Eklats« lieferte die BILD-Zeitung gleich im Untertitel mit: »Tanzgruppe verletzt angeblich ›interkulturelle Sensibilität‹.« Auslöser für die mediale Empörung war eine Entscheidung, die ich als Leiter des Kulturprogramms der Bundesgartenschau 2023, kurz BUGA 23, in Mannheim getroffen hatte. Im Rahmen einer kleinen Programmschiene für Vereine und zivilgesellschaftliche Initiativen war eine Gruppe der Arbeiterwohlfahrt – besser bekannt als AWO – mit ihrem Senior:innenballett auf uns zugekommen, um sich für einen Auftritt zu bewerben. Eine Jury, die wir eigens für diese Schiene installiert hatten, wertete den Beitrag als rühriges Sinnbild für Lebensfreude im Alter und schlug ihn für die Aufnahme in die Reihe vor. An dieser Stelle könnte die Geschichte eigentlich vorbei sein.
Durch kurz vor Eröffnung der BUGA 23, bei der wir unter anderem den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, das Haifa Symphony Orchestra sowie zahlreiche Diplomat:innen und internationale Gäste erwarteten, kamen Abbildungen einer tänzerischen »Weltreise« auf meinen Schreibtisch, die mich hochgradig beunruhigten. Eine aufmerksame Mitarbeiterin aus meinem Team hatte die Problemlage erkannt und unmittelbar an mich weitergegeben. Die AWO-Senior:innen waren auf den Abbildungen zum Beispiel in pinkfarbene Kimonos gehüllt, wie man sie in ihrer plakativen Anmutung aus Kostümshops kennt. Sie trugen dazu schwarze Perücken und Geisha-Schirme, offenbar um einen tänzerischen Halt in Asien darzustellen. Die ägyptische Kultur wurde mit einem Pharaonen-Outfit und den zweidimensionalen Seitenansichten aus den allseits bekannten Wandmalereien präsentiert – in entsprechenden Online-Einträgen gilt diese Darstellung längst als unauthentischer »Phantasietanz«. Ähnlich gelagerte Kostümierungen hatten sich die Damen rund um die Themen Orient, Indien und Mexiko ausgedacht. Insgesamt strotzte die Auftrittskluft vor Klischees. Sie erweckte den Eindruck, dass sich komplexe Kulturen an einem einzelnen Merkmal wie zum Beispiel einem Sombrero oder eben einer schwarzen Perücke festmachen lassen. Wer die Debatte rund um das sogenannte »Blackfacing« – also die Darstellung von »People of Color« durch weiße Menschen mit Hilfe von schwarzer Schminke – verfolgt hat, weiß, dass insbesondere die Nachahmung von körperlichen Merkmalen in der Kritik steht. Anerkannte Instanzen wie etwa die Schweizer Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus schreiben in diesem Zusammenhang:
»›Blackfacing‹ gilt als rassistisch, da die Identität und Erfahrungen Schwarzer Menschen als eine Art Kostüm behandelt werden, welches Weiße Menschen einfach an- und ausziehen könnten. Damit werden die Erfahrungen von People of Color herabgesetzt. Weiße Menschen nehmen sich das Recht heraus, mit ›Blackfacing‹ für Schwarze Menschen sprechen und handeln zu können und nehmen People of Color damit den Raum, dies für sich selbst zu tun. Problematisch sind besonders die stereotypen Darstellungen, die mit ›Blackfacing‹ einhergehen. Auf diese Weise werden Vorurteile wiedergegeben und weiterhin verfestigt.«2
Dass diese Einordnung einen breiten gesellschaftlichen Konsens darstellt, beweist der Umstand, dass Blackfacing seit 2020 bei Facebook, ansonsten nicht gerade ein Ort der vorauseilenden Sensibilität, als rassistischer Inhalt gemeldet werden kann.3
Für mich war zu diesem Zeitpunkt klar, dass sich genau solche Einschätzungen natürlich auch auf andere Bevölkerungsgruppen, andere körperliche Merkmale und ganz konkret auch auf den vorliegenden Auftritt umlegen lassen.
Aber ganz jenseits von theoretischen Diskursen und Definitionen:
Dachte ich in diesem Moment, dass von Diskriminierungs- und Kolonialismuserfahrungen betroffene Menschen so etwas als geschmacklos oder gar rassistisch empfinden könnten?
Ehrlich gesagt: Ja.
Dachte ich, dass die Senior:innen abwertende oder im schlimmsten Fall rassistische Motive haben?
Nein.
War ich zu diesem Zeitpunkt ein engagierter Teilnehmer der gereizt geführten Debatte rund um die sogenannte »kulturelle Aneignung«, vielleicht sogar mit abschließender Positionierung und unnachgiebiger Winnetou-Verachtung?
Ganz und gar nicht – für mich hatte bis dato immer nur der Grundsatz gegolten, dass wir solche Diskussionen ernsthaft führen müssen, um die Grenzen zwischen harmlosem Amüsierbedürfnis und unsensibler Veräppelung auszuloten. Allerdings mit dem konsequenten Ansinnen, uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln und nicht stur an Ritualen und Gewohnheiten festzuhalten, die andere unter Umständen kränken und erniedrigen.
Als die Bilder der Kostüme auf meinem Schreibtisch lagen, gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Vor meinem inneren Auge sah ich Handyvideos, die den Auftritt dokumentierten und sich via Social Media auf eine ganz reale Weltreise begaben, wo sie auf unterschiedlichen Kontinenten für diplomatische Eklats sorgen würden. Ich erinnerte mich an die »Penacho de Moctezuma« im Weltmuseum Wien, eine wertvolle Federkrone aus dem Aztekenreich, die gemeinhin als Symbol für koloniale Raubgüter gilt und zuletzt sogar den mexikanischen Präsidenten auf den Plan gerufen hatte.4 Und natürlich kamen mir die zahlreichen Debatten rund um ägyptisches Diebesgut in deutschen Museen in die Sinn, bei denen just die Schätze der Pharaonen und die museale Ausschlachtung zu touristischen Zwecken eine entscheidende Rolle spielen. Am schwersten wog für mich jedoch die Vorstellung, dass bei dem Auftritt Vertreter:innen migrantischer Gruppen im Publikum sitzen, die diese Simplifizierung ihrer kulturellen Lebenswelt als Affront und gleichzeitig als Sinnbild für das interkulturelle Verständnis unseres Programms empfinden könnten. Ein Programm, das auch maßgeblich von Künstler:innen aus den Mannheimer Partnerstädten Haifa und Czernowitz, von Persönlichkeiten wie der Black-Lives-Matter-Ikone Moor Mother oder UN-Habitat-Botschafterin Sona Jobarteh und von den diversen Communities der Stadtgesellschaft geprägt war.
Ich las natürlich auch Texte zu dem Thema. Zum Beispiel jenen, den Noa K. Ha, wissenschaftliche Geschäftsführerin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, unter dem Titel »Schluss mit lustig«5 auf der Seite des Deutschen Kulturrates veröffentlicht hatte. Zur Einordnung: Der Deutsche Kulturrat e. V. ist das einende Dach der Bundeskulturverbände mit all ihren Facetten und Schattierungen. Er steht also nicht im Verdacht, ein politisch überkorrektes Wokeness-Verkündigungsorgan zu sein. Dort stand:
»Warum meinen wir, dass es eine gute und lustige Verkleidung ist, sich ein stereotypisiertes Kostüm der vermeintlich nichteuropäischen Anderen überzuziehen – und sich nicht zu fragen, was dieser Akt der Verkleidung mit Kolonialismus und Rassismus zu tun haben könnte? Diese Stereotypen und ethnisierenden Kostüme führen von Jahr zu Jahr zu einer Diskussion darüber, ob Kostüme rassistisch sein können – und es tut mir leid, dass es sich hier um keinen Spaß mehr handelt, denn ja, diese Kostüme sind rassistisch. Warum? Weil sie eine Geschichte der Plünderung und der kulturellen Enteignung reproduzieren. Eine Geschichte, die bis heute nicht abgeschlossen ist, weil wir bis heute darüber debattieren, wem denn all die Objekte in den europäischen ethnologischen Museen gehören und wem sie zurückgegeben werden sollten, wenn sie unrechtmäßig erworben wurden – oder um es drastischer zu formulieren: Bénédicte Savoy sprach davon, dass an diesen Objekten Blut hängt. Daher brauche es eine Auseinandersetzung mit der deutschen und europäischen kolonialen Vergangenheit.«
Ich fand diese Standortbestimmung von Noa K. Ha sehr differenziert und daher auch überzeugend. Eine Gesellschaft, die ihre koloniale Vergangenheit noch nicht überzeugend aufgearbeitet hat, kann gar nicht auf eine »wertfreie« Kostümierung pochen, wenn es just um die Darstellung jener Kulturen geht, die vom Kolonialismus am schlimmsten betroffen waren.
Es stand viel auf dem Spiel, weil wir als Großveranstaltung mit mehr als 2,2 Millionen Besucher:innen zu Recht eine besondere Aufmerksamkeit genossen.
Im Sog dieser Abwägungen und unter dem Zeitdruck der bevorstehenden Eröffnung traf ich also eine Entscheidung, die ich nach wie vor für gut argumentierbar halte: nämlich dass ein Teil der Kostüme nicht für eine große Bühne mit bundesweiter Strahlkraft geeignet war. Mit der Hypothese, dass sich dieser Umstand relativ friktionsfrei über die zuständige Mitarbeiterin kommunizieren lässt – ja dass die Gruppe vielleicht sogar dankbar ist, weil wir sie vor einem Affront bewahren –, erlag ich wiederum einer groben Fehleinschätzung mit weitreichenden Konsequenzen.
Die Leiterin der AWO-Tanzgruppe ging ansatzlos zu einem Lokalreporter des Mannheimer Morgen, der bereits mit seinem ersten Text zu der Causa die Erkenntnis reifen ließ, dass einzelne Medienvertreter:innen bereit sein würden, für diese Geschichte ihren Verstand und ihren journalistischen Ethos zu opfern. Die Debatte zum sensiblen Umgang mit anderen Kulturen wurde mit einem neuen populistischen Spin aufgeladen – plötzlich ging es um die generelle Diskriminierung von Senior:innen und damit um die Diskriminierung einer Alterskategorie, die rund ein Viertel der deutschen Gesamtbevölkerung ausmacht. In dem Artikel wurde jene Mitarbeiterin mit vollem Namen genannt, die in ihrer Funktion als Eventmanagerin die Kommunikation mit den Senior:innen übernommen hatte, aber in keiner Weise als Verantwortliche oder gar Person öffentlichen Interesses einzustufen ist. Gemeinsam mit der zuständigen Pressesprecherin, die stellvertretend für mich der Sorge Ausdruck verliehen hatte, dass »der Eindruck entstehen könnte, es würden kulturelle und religiöse Stereotype zur Unterhaltung ausgeschlachtet werden«, wurde sie zum Opfer erster persönlicher Attacken. Die Wortlaute dieser E-Mails zeigten uns bereits, dass wir hier in etwas ganz Übles hineingeraten waren. Anonyme Beschimpfungen, Drohungen und Gewaltfantasien legten sich über Schlagworte wie »Woke-Wahnsinn« – eine explosive Mischung.
Parallel arbeiteten wir, zugegebenermaßen auch angetrieben durch zahlreiche weitere Medienanfragen, bereits an einem Kompromiss mit der Tanzgruppe, dessen grundständige Ambivalenz sich sehr gut mit einem Zitat des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger6 veranschaulichen lässt:
»Das Dilemma eines jeden Staatsmannes ist es, dass er in einer begrenzten Zeitspanne an langfristigen Lösungen arbeiten muss. Besteht er in jedem Moment auf absoluten Prinzipien, wird er die Möglichkeiten einer Gesellschaft überfordern und sie radikalisieren. Ist er nicht die bereit, die Gesellschaft zu fordern, wird er nicht in der Lage sein, sie auf die Zukunft vorzubereiten.«
Umgelegt auf die Situation im April 2023 bedeutete das: Meine Entscheidung ist dem Umstand geschuldet gewesen, dass ich es als Pflicht einer ambitionierten Kulturlandschaft und ihrer Protagonist:innen sehe, auch in gesellschaftlich brisanten Spannungsfeldern Flagge zu zeigen. Und zwar so, dass man nicht nur sein Facebook-Profil mit den Farben einer Protestbewegung einfärbt, sondern sich stattdessen ganz konkret zur Projektionsfläche gesellschaftlicher Diskurse macht. Nun, da wir mit den ersten Konsequenzen unserer Positionierung konfrontiert waren, griff aber auch meine Verantwortung als Leiter eines Programms, das in seiner Gesamtheit integrativ und beziehungsstiftend und eben nicht radikalisierend wirken sollte. Für so eine Situation hatte Kissinger ebenfalls die passenden Worte parat: »Mit diesem Dilemma umzugehen, da die richtige Balance zu finden, ist schwierig.«
Kurzfristig dachten wir, ebendiese Schwierigkeit mit einem Kompromiss bewältigt zu haben. Wir vereinbarten mit den Senior:innen Adaptierungen an den Kostümen, stellten ihnen als wertschätzendes Signal eine größere Bühne zur Verfügung und verständigten uns auf Stillschweigen gegenüber den Medien, um die Eskalationsspirale frühzeitig zu stoppen. Unser diesbezügliches Statement schrieben wir explizit mir zu, um den Hass von der bislang betroffenen Kollegin wegzulenken. Zwei Dinge hatten wir bei dieser scheinbaren Befriedung nicht am Schirm:
Erstens: Die zu diesem Zeitpunkt bereits platzierte Anfrage einer BILD-Redakteurin bezog sich nicht auf einen kleinen Beitrag im Regionalteil – die BILD hatte wohl längst in einen Kampagnenmodus mit bundesweiter Schlagkraft geschaltet. Sie brachte den Konflikt kurz darauf auf die Printtitelseite und machte ein »Sombrero-Verbot« zum Sinnbild für eine angebliche Zensur, zum »Schlag ins Gesicht für die rüstigen AWO-Tänzerinnen«.
Zweitens: Die beiden Leiterinnen der Gruppe, die sich anders als das Gros der Damen bei den Gesprächen völlig uneinsichtig gezeigt hatten, witterten offenbar ihre Warhol’schen fünfzehn Minuten Ruhm und pfiffen kurzerhand auf unser Agreement. Mit der Geschichte einer unschuldigen Senior:innendarbietung, die auf dem Altar der Political Correctness geopfert wurde, tingelten sie durch eine gierige Medienlandschaft und luden Reporter:innen in ihre privaten Gärten ein – nicht ohne dabei die Belastungen der medialen Präsenz zu beklagen.
Was eine BILD-Kampagne in Kombination mit einem klassischen Kulturkampfthema anrichten kann, zeigt zum Beispiel die dritte Folge des Podcasts »Boys Club – Macht & Missbrauch bei Axel Springer«, die unter dem Titel »Die Kampagne«7 die Geschichte des Asylwerbers Alassa Mfouapon erzählt. Mit manipulativen Schlagzeilen und einem menschenverachtenden Framing von Fakten wurde Mfouapon zur Zielscheibe eines rechten Mobs. Der Streifzug durch die Formulierungen im Rahmen der digitalen Hetzjagd machte in der Podcastfolge sogar eine Triggerwarnung notwendig.
Meine Situation war sicher nicht mit jener von Alassa Mfouapon vergleichbar, weil ich als Leiter des Kultur- und Veranstaltungsprogramms einer bekannten Biennale per se öffentlich exponiert war und deshalb die Schwankungsbreiten der medialen Darstellung aushalten musste. Zudem war ich nicht von Verfolgung, Fluchttraumata und Entwurzelung betroffen. Die gesellschaftlichen Mechanismen, die so eine Kampagne lostritt, sind aber sehr wohl vergleichbar.
In Bezug auf den »Sombrero-Skandal« bedeutete das, dass zig Lokalzeitungen in allen Ecken des Landes und darüber hinaus ohne seriöse Rechercheapparate völlig unhinterfragt die plakative Erzählung der BILD-Zeitung in einer Art Zweitverwertung übernahmen und damit deutschlandweit eine Armada an Wutbürger:innen und Internettrollen mobilisierte. Innerhalb kürzester Zeit wurden unsere E-Mail-Postfächer und Social-Media-Präsenzen mit Tausenden Hassnachrichten überflutet. Besonders leid tat mir das für die vielen Kolleg:innen, die ohne ihr Zutun in diese Situation geraten waren und dennoch hinter der Entscheidung standen. Wenn sie mich in dem einen oder anderen Moment für die Aufregung und den enormen öffentlichen Druck verflucht haben, wäre das nur verständlich – sie haben es mich jedenfalls nie spüren lassen.
Die Tonalität der Schreiben und Kommentare war erstaunlich homogen und folgte Mustern, die man bereits aus der Corona-Leugner- und Impfgegnerbewegung kannte: Eine rechte Gesinnung verwob sich mit apokalyptischen Prognosen zu Demokratie und Meinungsfreiheit inklusive Vergleichen mit dem Dritten Reich. In den Tagen der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen erlangten Rechtsradikale, die sich wehleidig mit gelben »Ungeimpft«-Davidsternen schmückten und so die Opfer des Holocaust verhöhnten, traurige Berühmtheit. Wir bekamen nun eine Abwandlung dieser Geisteshaltung zu spüren, die sich zum Beispiel anhand von Auszügen einer E-Mail verdeutlichen lässt:
»Es ist unfassbar, welchen geistigen Dünnpfiff ihr linksgrün versifften Faschisten da von euch gebt! (…) Wir hatten schon mal einen Österreicher – und das ist an Sie, Burstein, gerichtet – der von ›entarteter Kunst‹ sprach – damals kam der Irre aus Braunau, heute kommt der Irre aus Wien! Ja, ich vergleiche Sie und Ihre woken Kumpanen mit Adolf. Genauso geistesgestört, totalitär und intolerant! Regt ihr (…) Flachpfeifen euch eigentlich auch darüber auf, wenn ein Japaner auf dem Oktoberfest in Lederhose herumläuft? Und überhaupt, wie kann ein Afrikaner es wagen, westliche Kleidung zu tragen, der soll gefälligst in seiner Stammestracht herumlaufen und hier keine kulturelle Aneignung betreiben? Na, merkt ihr (…) Meinungsfaschisten was? (…) Ihr seid sowas von abartig und pervers! Linksfaschisten, schert euch mit eurer kranken, totalitären, fachistischen [sic] Ideologie zum Teufel! Ihr widert mich einfach nur an!«
Natürlich gab es auch Rückmeldungen, die mit etwas mehr Raffinesse formuliert waren, aber im Inhalt eine ähnliche Stoßrichtung verfolgten. Auch das ist eine Entwicklung, die in der Querdenkerbewegung ihren vorläufigen Höhepunkt fand: Extreme Positionen und die dazugehörigen Formulierungen sind mittlerweile ein Phänomen, das kein Milieu ausspart. So schrieb mir ein öffentlich Bediensteter einer ostdeutschen Landeshauptstadt, der laut Signatur im Bereich Protokoll und Internationale Verbindungen arbeitete: