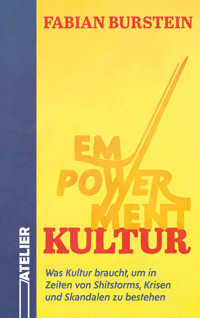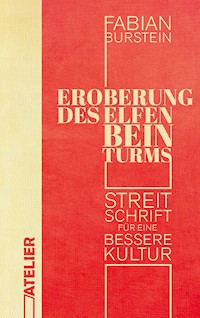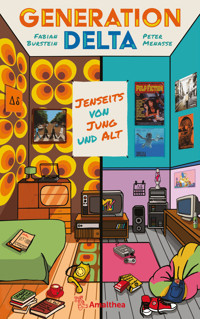
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fabian Burstein (42 Jahre alt) und Peter Menasse (77) verbindet eine mittlerweile zwanzig Jahre währende Freundschaft, die jenseits von Herkunftsepochen und Lebensphasen Bestand hat. Und die beiden eint eine These: Eine Vielzahl aktueller Krisen basiert auf Misstrauen zwischen den Generationen. Ihr gegenseitiges Unverständnis mündet immer öfter in schweren Konflikten, die die Grundlagen unserer Gesellschaft erschüttern. Am Beispiel ihrer Freundschaft wollen Burstein und Menasse einen Gegenentwurf wagen. Anhand großer Themen wie Klimawandel, Ideologie, Geschlechterverhältnis, Bildung und Arbeitswelt entwickeln sie einen Weg, der die Kluft zwischen den Generationen überwindet: die Generation Delta, eine Haltung und zugleich die Hoffnung auf eine Jugend, die imstande ist, mit Unterschieden zu leben
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GENERATIONDELTA
FABIAN BURSTEIN
PETER MENASSE
JENSEITSVONJUNGUND ALT
Bleiben wir verbunden!
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage amalthea.atund abonnieren Sie unsere monatliche Verlagspost unteramalthea.at/newsletter
Wenn Sie immer aktuell über unsere Autor:innen undNeuerscheinungen informiert bleiben wollen, folgenSie uns auf Instagram oder Facebook unter@amaltheaverlag
Sie möchten uns Feedback zu unseren Büchern geben?Wir freuen uns auf Ihre Nachricht an [email protected] zur Sicherheit unserer Produkte finden Sie hier:amalthea.at/gpsr
© 2025 by Amalthea Signum Verlag GmbH, WienAm Heumarkt 19, A-1030 WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Annalena WeberUmschlagillustration: Emma ZoppiISBN 978-3-99050-289-1eISBN 978-3-903441-45-3
Inhalt
Ein kurzer Dialog als Prolog
Tag 1:Was uns zusammenhält und warum wir darüber reden wollen
Tag 2:Warum wir uns erinnern sollten und welche Rolle Ideologie in unserem Leben spielt
Tag 3:Weshalb Leidenschaft eine wichtige politische Kategorie ist und wie wir sie für unser Anliegen einsetzen
Tag 4:Wieso es auch für zwei weiße Männer aus zwei verschiedenen Generationen Sinn macht, über Geschlechtergerechtigkeit nachzudenken
Tag 5:Wie wir den Humor aus der Kulturkampfzone evakuieren
Tag 6:Woran wir glauben und warum das eigentlich nichts mit Religion zu tun hat
Tag 7:Über den Sinn und Unsinn von Regeln und warum es gut wäre, sich nicht ständig zu maßregeln
Tag 8:Warum wir dem Bildungssystem niemals ein Nicht genügend geben würden – wir halten nämlich nichts von solchen Benotungen
Tag 9:Warum wir Selbstkritik für eine wichtige Kulturtechnik halten und wie wir gleich mal bei uns selbst anfangen
Tag 10:Warum wir der Gegenwart trotzen, indem wir an die Zukunft glauben
Einige Tage nach Tag 10:Am Schluss bleibt nur die Generation Delta
Über die Autoren
Ein kurzer Dialog als Prolog
FABIAN BURSTEIN: Peter, ich weiß nicht, ob du das kennst … Es gibt Bücher, die prägen dich für dein restliches Leben. Generation X von Douglas Coupland war für mich so ein Buch. Ich habe es in meinen Teenagerjahren, wahrscheinlich 1997, gelesen. Dass ein Buchtitel imstande ist, das Lebensgefühl einer ganzen Generation zu verkörpern, war für mich ein Initiationserlebnis. Und dann erst die Kapitelüberschriften, von denen ich mir viele bis heute gemerkt habe: »Gib es auf, die Vergangenheit zu recyceln«, »Erkaufte Erfahrungen zählen nicht« oder »Abenteuer ohne Risiko ist Disneyland«. Ich war ergriffen, desillusioniert, popkulturell stimuliert. In meiner Welt hat Douglas Coupland den perfekten Generationenroman geschrieben. Für mich hat er dadurch die Tür zu einer ganzen literarischen Kategorie zugeschlagen. Ich meine das als Kompliment. Aber das Thema »Generationen« lass ich mir ganz sicher nicht nehmen – schon gar nicht, wenn ich dich damit ein bisschen ärgern kann. In Bezug auf unseren Titel halte ich es mit Oscar Wilde: »Nachahmung ist die höchste Form der Anerkennung.«
PETER MENASSE: Da ist er schon, der große Unterschied zwischen uns beiden: Ihr seid eine Generation mit einem eigenen Buchstaben, euch kann niemand ein U für ein X vormachen, oder so. Und wir, die ab 1945 Geborenen? Sie nennen uns »Babyboomer«, nicht weil wir gleich nach unserer Geburt selbst Babys in die Welt gesetzt hätten, sondern das bezieht sich auf die Nachkriegsproduktivität unserer Eltern. Dieser Name deutet auf eine hoffnungslos fremdbestimmte Generation hin. Daher darfst du dich nicht wundern, dass ich im Jahr 1962, da war ich nämlich im Teenageralter, erstens Fußball gespielt, zweitens Fußball gespielt und drittens minder intellektuelle Literatur gelesen habe, wie Der Graf von Monte Christo oder Die drei Musketiere. Ich bin dir also dankbar, dass du mit mir gemeinsam die »Generation Delta« begründest. Aber wie erklären wir der staunenden Welt diesen Begriff?
FABIAN BURSTEIN: Ich glaube, wir müssen gar nichts erklären. Es reicht, wenn wir uns so wie immer begegnen. Nämlich als Freunde mit mehr als dreieinhalb Jahrzehnten Altersunterschied, die sich über ihre Haltung als gemeinsame Generation definieren. Das ändert natürlich nichts daran, dass wir uns gerne auseinandersetzen, um es höflich auszudrücken.
PETER MENASSE: Gut, dann lass uns über Gemeinsamkeiten und Unterschiede reden. Und weil ich weiß, wie sehr du Lebensweisheiten in Floskelform liebst, lege ich gleich mal nach und halte fest: »Durchs Reden kommen d’Leut z’samm.«
FABIAN BURSTEIN: Um den großen Philosophen d’Artagnan zu zitieren: »En garde!«
TAG 1
Was uns zusammenhält und warum wir darüber reden wollen
FABIAN BURSTEIN: Hast du heute einen Mittagsschlaf gehalten?
PETER MENASSE: Selbstverständlich. Ich halte fast täglich einen Mittagsschlaf. Wünsch dir nicht, dass du mich an einem Nachmittag ohne vorheriges Nickerchen erlebst. Ich wäre unausgeschlafen, unkonzentriert, grantig.
FABIAN BURSTEIN: Welche Bedeutung hat der Mittagsschlaf für dich?
PETER MENASSE: »Bedeutung« ist ein etwas großes Wort für ein Thema wie den Mittagsschlaf. Ich bin körperlich einfach nicht mehr ganz so fit wie ein 40-Jähriger. Meine Mutter ist fast 100 geworden – die Mittagsschläfchen waren ihr stets heilig. Offensichtlich wurde das Bedürfnis nach einer mittäglichen Erholungsphase genetisch an mich weitergegeben.
FABIAN BURSTEIN: Würdest du sagen, dass dieses Bedürfnis eine Alterserscheinung ist?
PETER MENASSE: Natürlich. In jungen Jahren bin ich in der Mittagszeit im Büro gesessen. An Hinlegen war da nicht zu denken. Mittlerweile habe ich das Pensionsalter bei Weitem überschritten. Es gibt zwei entscheidende Unterschiede: Ich arbeite nicht mehr ganz so viel. Und ich brauche längere Ruhephasen.
FABIAN BURSTEIN: Seit unserem letzten Treffen hat sich auch bei mir etwas altersbedingt verändert. Ich habe meine erste Lesebrille.
PETER MENASSE: Das ist der Klassiker bei Menschen rund um die 40. Aufgrund meiner starken Kurzsichtigkeit trage ich seit dem zwölften Lebensjahr Brille. Paradoxerweise bin ich heute wesentlich besser dran als damals. Das verdanke ich einer Alterserscheinung namens grauer Star. Ich hatte eine Operation, bei der man mir Kunstlinsen eingesetzt hat. Auf diese Weise sind Kurz- und Weitsichtigkeit verschwunden. Aber das verschlechtert sich schon wieder – ich brauche bald wieder zusätzlich eine Brille.
FABIAN BURSTEIN: Jetzt sind wir mittendrin in den Klischees des Älterwerdens. Wir unterhalten uns über Wehwehchen. Das ist eigentlich untypisch für unsere Gespräche. Dein fortschreitendes Alter hat sich nie in ausufernden Erzählungen über körperliche Leiden bemerkbar gemacht.
PETER MENASSE: Es ist ja auch sinnlos und zudem mäßig spannend. Natürlich tut mir im Gegensatz zu früher vieles weh. Aber darüber rede ich nicht. Es gibt jedoch ein Zitat meines Vaters, das ich mir immer öfter vergegenwärtige. Er sagte schmunzelnd »Ich bin Patient der gesamten Heilkunde.«
Twentysomethings
FABIAN BURSTEIN: Mich treibt eine scheinbar paradoxe Beobachtung um. Bei Twentysomethings hat das Reden über Unpässlichkeiten Hochkonjunktur. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, diverse Überforderungen, Probleme mit dem Bewegungsapparat – das alles nimmt ziemlich viel Raum ein. Einerseits ist das toll, weil es von einer Enttabuisierung zeugt. Anderseits ist es schon befremdlich, dass ich mit Jüngeren wesentlich häufiger über ihre Beschwerden spreche als mit dir. Im Berufsleben ist das ein allgegenwärtiges Phänomen. Junge Kolleg:innen achten sehr genau darauf, dass sie ihre physischen und psychischen Grenzen nicht überschreiten. Im Kern finde ich das gut – nur das Ausmaß verstört mich hie und da. Die Nachwehen der Coronapandemie, kriegerische Auseinandersetzungen und die schlechten Wirtschaftsdaten machen die Lage unübersichtlich. Es besteht eine klare wissenschaftliche Evidenz, dass die seelische Gesundheit junger Menschen in den letzten Jahren gelitten hat. Zusätzlich müssen wir mit einem völlig neuen Phänomen namens Long Covid umgehen. Gleichzeitig gibt es aber auch ein Phänomen, von dem ich im Studium im Rahmen einer Psychologievorlesung gehört habe, nämlich den sogenannten Krankheitsgewinn. Das Phänomen beschreibt positive soziale »Nebenwirkungen« von Krankheiten, zum Beispiel mehr Zuneigung und Unterstützung durch Angehörige, das Entbundensein von lästigen Pflichten oder die Schonung durch Kollegen. Es ist auch ein eskapistisches Phänomen: Ich habe einen gesellschaftlich akzeptierten Grund, um unangenehmen Situationen und Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das Entscheidende am »Krankheitsgewinn« ist: Er entfaltet seine Wirkung sowohl bei tatsächlich als auch bei vermeintlich Erkrankten. Wobei sich bei den vermeintlich Erkrankten natürlich die Frage stellt: Wie schlimm muss erst der Leidensdruck im »Normalbetrieb« sein, dass ich aus der Rolle des Kranken so einen Mehrwert ziehe. Wie sagte schon der ehemalige Bundeskanzler Fred Sinowatz: »Das klingt alles sehr kompliziert.« Diese Komplexität entbindet uns aber leider nicht von der Aufgabe, die Zukunft zu gestalten.
PETER MENASSE: Ich lese natürlich dauernd über die Befindlichkeiten der Jungen, habe dazu aber keinen tiefergehenden Zustand. Wenn wir ehrlich sind: Dieses Phänomen, das du beschreibst, kann sich ja nur eine Oberschichtpopulation leisten. Es handelt sich um eine Art Einzelkindsyndrom, bei dem Wohlstand zu einem stetigen Kreisen um sich selbst und die eigenen Bedürfnisse geführt hat. Es gibt aber ganz viele junge Menschen, die sich solche Allüren gar nicht leisten können, weil sie reinbeißen und hackeln müssen. Wir sollten aufpassen, dass wir anekdotenhafte Erlebnisse nicht mit echten gesellschaftlichen Phänomenen verwechseln.
FABIAN BURSTEIN: Und wie, bitteschön, verarbeiten Menschen, die »reinbeißen und hackln müssen«, die Verunsicherungen unserer krisenhaften Gegenwart?
PETER MENASSE: So wie sie es bereits in der Nachkriegszeit, in der Ölpreiskrise der 1970er-Jahre, während der Hochblüte des Kalten Krieges oder während des Jugoslawienkrieges gehandhabt haben: Sie machen weiter und arbeiten an einer besseren Zukunft. Dass ihnen dafür natürlich kein perfektes, aber ein wesentlich verbessertes Gesundheits- und Sozialsystem zur Verfügung steht, ist doch ein großer Fortschritt.
FABIAN BURSTEIN: Ich bin ehrlich gesagt kein Freund des »Reißts-euch-g’fälligst-z’samm«-Dogmas. Laut meiner Frau, eine sehr fähige und liebenswürdige Psychotherapeutin, ist das eine kontraproduktive Haltung. Ich will aber nicht verhehlen, dass ich deinen harten Formulierungen etwas abgewinnen kann. Den Referenzrahmen von der eigenen Befindlichkeit auf ein größeres Ganzes auszuweiten, hat noch nie geschadet. Übrigens: Das von dir ersonnene Einzelkindsyndrom erinnert mich an eine Episode aus meinem Berufsleben. Ich war mal im Zuge einer Tagungsorganisation ständig mit den veganen Essgewohnheiten meiner jungen Mitarbeiter:innen befasst. Sie hatten mir mitgeteilt, dass sie nicht »nur Beilagen« essen wollen. Diese selbstverständliche Forderungshaltung hat mich tierisch aufgeregt …
PETER MENASSE: Veganer, die einen tierisch aufregen: sehr schön.
FABIAN BURSTEIN: … Mach dich nicht lustig. Ich will mit dir eine große Erkenntnis teilen. Bei einem Führungskräfte-Coaching hat mir eine sehr kluge Psychologin nahegelegt, mich nicht an solchen Themen abzuarbeiten. Es sei als Chef nicht meine Aufgabe, Menschen zu ändern. Meine Aufgabe bestehe darin, das Beste aus dem Istzustand herauszuholen. Das sei Teil der »Dienstleistung«, die ich in meiner Funktion anbiete. Diese Einordnung hat mich wirklich geerdet. In ihr steckt viel Potenzial für ein unaufgeregteres Miteinander zwischen den Generationen.
PETER MENASSE: Apropos vegan. Unter meinen Kindern gibt es auch Veganer und Vegetarier. Ich habe damit kein Problem. Ich verstehe gut, dass man Mitleid mit Tieren hat und sie deshalb nicht essen will. Ich würde diesen Übergang aber einfach nicht mehr schaffen, obwohl ich auch kaum mehr Fleisch esse.
FABIAN BURSTEIN: Ich bin ja selber seit zwölf Jahren Vegetarier. Mir ging es bei meiner Anekdote aber nicht um das grundsätzliche Bedürfnis nach einer fleischlosen Alternative, sondern um die despektierliche Behandlung des Themas »Beilagen« …
PETER MENASSE: Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ich wollte uns nur aus der Managementratgeber-Ecke holen.
Freundschaft
FABIAN BURSTEIN: O. k., ich habe verstanden. Dann nutze ich den Moment, um zum eigentlichen Thema dieses Buches vorzudringen. Es geht um unsere Freundschaft. Unlängst hat mich deine Frau gefragt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Du kannst dich scheinbar nicht mehr daran erinnern.
PETER MENASSE: Vergesslichkeit … Ich darf mich auf mein Alter ausreden. Das ist analog zu dem von dir eingebrachten »Krankheitsgewinn« der »Altersgewinn«.
FABIAN BURSTEIN: Für unser heutiges Treffen habe ich noch mal genau zu unserer ersten Begegnung recherchiert. Ausgangspunkt war eine Art Rezension über das Filmmagazin ray, die du im März 2006 für den Standard geschrieben hast. Darin hast du dich sehr wertschätzend über meine Kolumne TV-Protokolle geäußert.
PETER MENASSE: Ich habe positiv über dich geschrieben?
FABIAN BURSTEIN: Nicht unmittelbar über mich. Über meine Texte.
PETER MENASSE: Da zeigt sich wieder: Es ist richtig, das Werk vom Autor zu trennen (lacht).
FABIAN BURSTEIN: Bei solchen Kommentaren profitierst du ganz eindeutig von deinem Alter. Deine verbalen Frechheiten bleiben ob meiner Subordination ungesühnt. Im Nachgang zu deinem Artikel habe ich mich bei dir bedankt und wir haben uns auf einen Kaffee getroffen. Das ist mittlerweile 18 Jahre her. Die TV-Protokolle gibt es schon lange nicht mehr, aber der stetige Austausch zwischen uns ist geblieben.
PETER MENASSE: 18 Jahre. Das ist selbst für Freundschaften unter Gleichaltrigen eine lange Zeit.
FABIAN BURSTEIN: Wenn du auf die letzten 18 Jahre deines Lebens zurückblickst: Was hat sich bei dir verändert?
Tod
PETER MENASSE: Das ist eine schwierige Frage. Natürlich rücken jenseits der 70 neue, weniger wünschenswerte Gedanken in den Vordergrund. Die Frage ist, ob ich darüber reden will! Früher war zum Beispiel der Gang über den Friedhof mit einer gewissen Leichtigkeit verbunden. Man hat sich die Geburts- und Sterbejahre angesehen, die Differenz ausgerechnet und dann seine Scherze gemacht – nach dem Motto: »Vü g’wachsen warat er eh nimma.« Mittlerweile erlebe ich in einer immer höheren Frequenz, dass Menschen in meinem Alter den Holzpyjama anziehen. Du spürst deine eigene Endlichkeit und der humoristische Umgang mit dem Tod rückt in weite Ferne. Ich stelle mir dann die Frage: Welche Möglichkeiten habe ich, mit der eigenen Vergänglichkeit umzugehen? Schließlich will ich ja nicht daran verzweifeln. Man formuliert Wünsche wie: Möge es, wenn es so weit ist, ein gnädiger Tod ohne Leiden sein. Das Nachdenken über den Tod ist eine Kategorie, die sich langsam in mein Leben eingeschlichen hat.
FABIAN BURSTEIN: Was wäre, wenn ich dir gestehe, dass der Tod auch in der Lebensphase, in der ich mich befinde, eine immer größere Rolle spielt? Bei dir ist es die erhöhte Frequenz, mit der sich der Tod in dein Leben drängt. Bei mir ist es das Initiationserlebnis, dass ich nicht einer unsterblichen Altersgruppe angehöre. In den Vierzigern erlebt man die ersten Todesfälle von Gleichaltrigen, die auf Krankheit und körperlichen Verfall zurückzuführen sind. Die eigene Generation schlägt plötzlich eine direkte Brücke zum Tod. Die damit verbundenen Ängste haben bei mir vor allem mit dem Vatersein zu tun. Meine Kinder nicht beim Aufwachsen begleiten zu können – das ist für mich ein unerträglicher Gedanke. War das bei dir auch so?
PETER MENASSE: Ich habe nie viel über den Tod nachgedacht. Ich kann auch nicht wirklich gut mit dem Tod umgehen – ich versuche mich da abzugrenzen. Ich bin auch kein sehr empathischer Mensch, wenn es darum geht, den Tod anderer zu betrauern. Das ist reiner Selbstschutz.
Persönlicher Werdegang
FABIAN BURSTEIN: Es gibt viele Dinge, die sich bei dir in den letzten 18 Jahren nicht verändert haben. Du machst PR, bist Publizist, engagierst dich in der Kulturbranche. Da ist der Peter von heute ganz nah an dem von damals dran. Bei mir waren die letzten 18 Jahren vom Erwachsenwerden geprägt. Zwischen 23 und 42 passiert so viel auf privater und beruflicher Ebene, dass sich diese Altersabschnitte wie zwei verschiedene Leben anfühlen. Als wir uns begegnet sind – ich 23, du 58 – war ich ein junger Werbetexter am Sprung zum Kreativdirektor. Ich wusste, dass mein Platz in der Kultur ist. Ich war ständig von der Angst getrieben, den Absprung zu verpassen und hatte das Gefühl, eine ultimative Entscheidung treffen zu müssen – im Glauben, dass man Dinge »exklusiv« tun muss. Da warst du für mich wirklich ein »Role Model«. Bei dir durften so viele berufliche Identitäten vom PR-Agentur-Besitzer bis zum Magazin-Chefredakteur nebeneinander existieren. Dabei hast du auch eine große Contenance ausgestrahlt. Warst du mit 23 auch so getrieben und zerrissen?
PETER MENASSE: Das war 1970. In dieser Zeit war ich Student und habe den ersten Studienabschnitt an der Wirtschaftsuniversität Wien, damals noch »Hochschule für Welthandel«, absolviert. Danach gab es eine dreijährige Unterbrechung, weil es mich einfach nicht mehr gefreut hat. Die enden wollenden Aufstiegschancen haben mich dann doch dazu bewegt, den zweiten Studienabschnitt fertig zu machen. Mit 23 war ich also ein arbeitender Mensch in einer subalternen Position, der fast jeden Abend gefeiert hat. Um vier Uhr ins Bett und um sieben Uhr ins Büro – das war eher die Regel als die Ausnahme. Mein Erwachsenwerden hat eigentlich mit meiner Hochzeit begonnen. Meine erste Frau hat eine wunderbare Tochter in die Ehe mitgebracht. Dann kam bald eine zweite, gleich wunderbar. Da bin ich innerhalb kürzester Zeit sehr seriös geworden – das hat damals die Verwandlung zum Mann mit Krawatte, nein, mit Verantwortung ausgelöst.
FABIAN BURSTEIN: Das ausschweifenden Nachtleben in den ersten Berufsjahren kommt mir bekannt vor. Ich bin sehr jung in die Werbebranche eingestiegen. Ein exzentrisches Lifestyle-Konzept, wo das Saufen zum Agenturalltag gehörte. Vielleicht war das ein Mitgrund für meine innere Unruhe. Ich fühlte mich in einer Welt gefangen, in der sich relativ durchschnittliche Typen wie Rockstars aufgeführt haben. Die Werber zelebrierten lächerliche Awards mit Namen wie »Werbehahn« im Stil einer Oscar-Verleihung. Diese Aufgeblasenheit im Mantel einer völlig von Ironie befreiten Ernsthaftigkeit hat mich zur Verzweiflung gebracht. Meine größte Angst bestand darin, dass ich aus wirtschaftlicher Bequemlichkeit in dem Zirkus hängen bleiben könnte. Wendepunkt war eine schwere Grippe mit 40 Grad Fieber, die mich just nach einer besonders wilden Nacht in der Bar »Hold« auf der Josefstädter Straße für zwei Wochen niedergestreckt hatte. Die Leichtigkeit des Seins war noch nie meine große Stärke. Ich habe das heftige Kranksein sofort als Zeichen gewertet, dass ich etwas ändern muss.
PETER MENASSE: Es ist toll, dass du so eine Entscheidung treffen konntest. Viele Menschen verharren in untragbaren Situationen. Ich habe mich dann doch sehr früh vom Exzess emanzipiert. Mein Freund Franz, mit dem ich damals um die Häuser gezogen bin, war da anders. Er wurde ein schwerer Alkoholiker und ist daran auch zugrunde gegangen.
FABIAN BURSTEIN: Die unglaublichen Verwüstungen, die Alkohol hinterlassen kann, machen offenbar vor keiner Generation halt. In der Kunst- und Kulturbranche begleitet mich das Säufertum als Sinnbild eines exzentrischen Geniebegriffs bis heute. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich seit zwölf Jahren gar keinen Alkohol mehr trinke. Ich will dem Chaos mit maximaler Klarheit begegnen. Da ich sehr viel arbeite, identifiziere ich mich auch mit der Haltung von Spitzensportlern, die Leistungsfähigkeit existenziell mit der körperlichen Verfassung verknüpfen. Darf ich gedanklich ein wenig springen und dir eine ganz andere Frage stellen?
PETER MENASSE: Tu dir keinen Zwang an.
FABIAN BURSTEIN: Wie hast du es damals als fast 60-Jähriger geschafft, einen 23-Jährigen wie mich ernst zu nehmen?
PETER MENASSE: Hm. Ich glaube, ich denke nicht in Alterskategorien. Meine Lebenswährung sind Argumente. Wenn mir jemand etwas Gescheites sagt, höre ich hin. Ich habe Kinder, die älter sind als du. Die habe ich auch immer ernst genommen. Natürlich gibt es autoritäre Männer, die junge Menschen nicht akzeptieren, die ihre Ehefrau nicht akzeptieren, die in ihrem generalisierenden Macho-Kult denken, sie seien die einzig Wichtigen. So bin ich aber definitiv nicht sozialisiert. Ich habe auch kein Problem mit einem Politiker, nur weil er jung ist – ich habe dann ein Problem mit ihm, wenn er schlechte Politik macht.
FABIAN BURSTEIN: War dein Aufwachsen, wie bei mir, von sehr selbstbewussten Frauen geprägt?
Geschlechterrollen
PETER MENASSE: Ja. Meine Mutter war Alleinerzieherin. Ihr Stärke hatte aber nichts mit Dominanz zu tun. Sie war eine liebevolle, tolerante Frau, die mir unheimlich viel Vertrauen geschenkt hat. Es war genau dieses Vertrauen, das mich nicht allzu sehr über die Stränge hat schlagen lassen. Gleichzeitig konnte sie aber nicht verhindern, dass mir ein cholerischer Stiefvater das Leben schwer gemacht hat. Es gibt wohl kein Licht ohne Schatten. Insgesamt war mein Weg von starken, selbstbewussten, lieben Frauen geprägt, die mir auch regelmäßig die Leviten lasen. Die Männer haben eher ausgelassen. Wobei ich auch hier nicht generalisieren will. Mein Onkel, der ehemalige Fußballnationalspieler Hans Menasse, war für mich eine durchaus prägende Figur, und zwar im positiven Sinne.
FABIAN BURSTEIN: Dominanz würde ich meiner Mutter oder meiner Oma auch nicht unterstellen. Sie sind aber beide sehr resolut. Das hat mich schon geprägt – ich suhle mich zum Beispiel nicht in meiner gleichberechtigten Rolle als Vater und Familienmitorganisator. Dieses Selbstverständnis wurde mir von Kindesbeinen an abverlangt und auch vorgelebt. Da sehe ich in der nachrückenden Generation einen anderen, fast schon rückwärtsgewandten Habitus. Ständig stolpere ich über bürgerliche Jungväter, die in Podcasts und Büchern über ihre fragilen Vatergefühle schwadronieren und sich dabei unglaublich progressiv vorkommen, weil sie im Grunde ihres Herzens davon ausgehen, dass das eigentlich Frauensache ist.
PETER MENASSE: Wenn du wie ich von einer Frau erzogen wirst, die in der Nazizeit von der Schule ausgeschlossen war, flüchten musste, keinen Beruf lernen konnte und dann alleine den Haushalt schupft und nebenbei Bildung nachholt, wenn du das erlebst, entwickelst du von vornherein niemals das Gefühl, dass eine Frau etwas nicht schaffen könnte. Meine Großmutter, eine Schneiderin, über die es übrigens ein Buch gibt, hat von Männern nicht sehr viel gehalten. Es war immer an ihr, die Familie zu ernähren. Im frühen 20. Jahrhundert war das ein völlig verdrehtes Rollenbild, aber sie hat es erfolgreich durchgezogen.
FABIAN BURSTEIN: Steckt in dir eigentlich noch ein Hauch Machismo? Mir kommt es gerade so vor, als ob wir hier ein bisschen die sozialen Erwünschtheiten einer gesellschaftsliberalen Blase füttern und uns als gendersensible Traummänner stilisieren.
PETER MENASSE: Bestimmt, aber diesen Hauch lasse ich nicht zum Wintersturm werden. Ob das alles so stimmt, wie wir es sehen, werden wir nur wissen, sollten unsere Frauen demnächst ein Buch schreiben und uns auffliegen lassen.
Alter und Kompetenz
FABIAN BURSTEIN