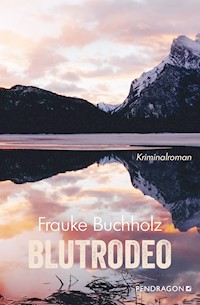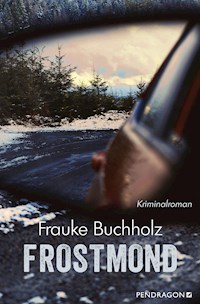Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Ted-Garner-Reihe
- Sprache: Deutsch
Im vierten Band der preisgekrönten Thriller-Reihe wird dem ehemaligen Profiler Ted Garner alles abverlangt. Ein grausamer Mord an einer -jungen Familie holt ihn ein letztes Mal zurück in den Dienst. Die Spur des Täters führt tief in die Wildnis -Kanadas und in die Reservate der First Nations. -Garner, getrieben von übersteigertem Ehrgeiz und Vorurteilen, ist schnell überzeugt, den Schuldigen in einem jungen Indigenen gefunden zu haben, der erst kürzlich aus der Haft entlassen wurde. Doch als er bei weiteren Ermittlungen auf die Unterstützung der Stammespolizei angewiesen ist, wird ihm klar, dass viel mehr hinter dem Fall steckt. In der eisigen Natur des kanadischen Nordens gerät Garner in einen erbarmungslosen Kampf auf Leben und Tod. Ein hochaktueller Thriller über Verschwörungsmythen, Endzeitparanoia und was sie mit einer Gesellschaft machen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frauke Buchholz
ENDZEIT
INHALT
Teil I
Ted Garner 4. Oktober Montreal
Ted Garner 5. Oktober Montreal
Teil II
Ted Garner 15. Oktober, 2 Jahre später Regina
Ted Garner 16. Oktober Regina
Ted Garner 17. Oktober North Battleford
Ted Garner 17. Oktober Mistahi-maskwa Cree Nation
Ted Garner 18. Oktober Regina
Ted Garner 19. Oktober Kamloops
Ted Garner 20. Oktober Kamloops
Ted Garner 20. Oktober British Columbia Wildlife Park
Ted Garner 21. Oktober Kamloops
Ted Garner 21. Oktober Adams Lake
Ted Garner 22. Oktober Kamloops
Ted Garner 25. Oktober Regina
Ted Garner 26. Oktober Regina
Ted Garner 30. Oktober Regina
Teil III
Hay River Das Drehkreuz des Nordens
Geneviève Paradis 24. Dezember Hay River
Geneviève Paradis 2. Januar Hay River
Ted Garner 2. Januar Regina
Ted Garner 3. Januar Hay River
Ted Garner 4. Januar Hay River
Ted Garner 4. Januar Deneh Reservation
Ted Garner 4. Januar Great Slave Lake
Ted Garner 6. Januar Deneh Reservation
Jason Ross 12. Oktober Moose Jaw
Epilog
Gewidmet dem Aktivisten Leonard Peltier
Quellenangaben und weiterführende Literatur
Ist doch unsere zivilisierte Welt nur eine große Maskerade
Arthur Schopenhauer
Teil I
Ted Garner4. OktoberMontreal
Es war 16:40 Uhr Ortszeit, als Ted Garner aus dem Flughafengebäude des Trudeau International Airports ins Freie trat. Die Temperaturanzeige neben der Uhr über dem gläsernen Ausgangsportal stand auf acht Grad Celsius, und obwohl die Sonne von einem wolkenlosen, klaren Himmel schien, war die Luft frisch. Er rollte seinen neuen Samsonite-Koffer Richtung Taxistand und stieg in einen der wartenden blau-weißen Wagen mit der Aufschrift Bonjour Montreal. Es war eines der wenigen französischen Wörter, die Garner kannte. „Librairie Le Port d’Esprit“, sagte er, doch seine Aussprache war so mangelhaft, dass er das Ziel mehrfach wiederholen musste, bevor der Fahrer nachsichtig grinsend nickte und endlich losfuhr. Während sie auf die Stadtautobahn auffuhren und das Flughafengelände allmählich hinter sich ließen, überschwemmten Garner Erinnerungen an den Montreal-Fall vor fast genau einem Jahr. Damals war er die über 3 000 Kilometer von Regina nach Quebec über den Transcanada Highway mit seinem neuen BMW gefahren, der jetzt am Grund des Chilliwack River vor sich hin rostete. Zusammen mit Jean-Baptiste LeRoux, einem Kollegen von der Kripo Montreal, hatte er versucht, den grausamen Mord an einem indigenen Mädchen aufzuklären. Sie waren nicht gerade ein Dream-Team gewesen, und Garner hatte nie mehr etwas von LeRoux
gehört, doch er würde LeRoux’ Ehefrau in knapp fünfzehn Minuten wiedersehen. Falls sie heute in der Buchhandlung Le Port d’Esprit arbeitete. Er würde ihr die tausend Dollar zurückgeben, die sie ihm geliehen hatte, und vielleicht einen Kaffee mit ihr trinken. Mehr nicht. Sie waren beide verheiratet. Dennoch schlug sein Herz unwillkürlich schneller.
In der Ferne tauchte die Skyline der City am Ufer des St. Lawrence auf. Der Fahrer nahm die nächste Ausfahrt, und sie kurvten durch die von Ahornbäumen und Silberpappeln gesäumten Alleen des alten Stadtviertels Plateau Mont Royal, dessen Hügel der Stadt ihren Namen gegeben hatte, nachdem französische Pelzhändler im Jahre 1611 hier den ersten Handelsposten errichtet hatten. Heute war es ein trendiges Viertel mit liebevoll restaurierten Häusern, Studentencafés, gemütlichen Restaurants, lebhaften Bars, modernen Galerien und Theatern. Das Taxi hielt in einer Seitenstraße der Rue Saint-Denis, Garner bezahlte, nahm seinen Koffer und stieg aus. Er verharrte einen Moment vor dem Schaufenster der Librairie. Zwischen Reiseführern, Bildbänden und französischen Romanen lagen noch immer die beiden Schopenhauerbücher. Le monde comme volonté et représentation. Parerga et Paralipomena. Garner spürte einen Stich in der Brust. Die Oktobersonne stand tief, und sein Gesicht und Oberkörper spiegelten sich in der dunklen Scheibe. Ein hagerer Mann um die vierzig in einem teuren grauen Anzug. Schütteres blondes Haar, scharf geschnittene Gesichtszüge. Kein Adonis, aber auch nicht unattraktiv. Bis auf die Eisblock-Ausstrahlung einer unterkühlten Intelligenz, die ihm etwas Unnahbares gab. Garner ging zum Eingang und stieß die Tür auf. Obwohl er sich sagte, dass er lediglich seine Schulden bezahlen wollte, spürte er eine seltsame Mischung aus Angst und Erregung, als er die Buchhandlung betrat. Er hatte sie mit einem Blick erspäht. Sophie LeRoux. Sie stand vor einem der wandhohen, vollgepackten Regale und zog ein Buch heraus, das sie lächelnd der älteren Dame neben ihr reichte. Die Kundin trollte sich Richtung Kasse und Sophie folgte ihr. Als sie Garner erblickte, schien das Lächeln in ihrem schönen Gesicht einzufrieren. Als hätte sie einen Schock erlitten.
„Garner“, sagte sie. Eine Mixtur aus Überraschung, Freude und Verwirrung.
„Bonjour“, sagte Garner. Er fühlte sich wie ein Idiot, doch wie ein glücklicher. Sie standen einen Moment schweigend voreinander, dann sagte sie auf Englisch: „Ich muss eben noch kassieren.“ Ihre Stimme war dunkel, und er liebte den französischen Akzent darin. Während er wartete, bis die Kundin das Geschäft verlassen hatte, versuchte Garner, seine Gefühle zu sortieren, doch alles, was er spürte, war eine große Wärme, die sich von der Herzgegend in ihm ausbreitete wie die einer gerade eingestöpselten Heizdecke.
„Ça va?“, fragte Sophie, als sie endlich allein waren. Sie trat zu dicht an ihn heran und hielt ihm ihr Gesicht zu dem französischen Wangenkuss entgegen, der ihm stets zu intim war. Er hauchte etwas zwischen Haut und Luft und atmete ein teures Parfum ein. „Ich habe mir große Sorgen um dich gemacht, Ted.“ Die Heizdecke wurde beinahe unerträglich warm. Er zog seine Brieftasche heraus und entnahm ihr ein Bündel Hundertdollarscheine.
„Merci“, sagte er, und drückte ihr das Geld in die Hand. Ihre Finger berührten sich leicht, und Garner unterdrückte den Impuls, ihre Hand festzuhalten und in seine zu legen.
„Sprichst du nur noch Französisch?“, fragte Sophie und lächelte wieder. Garner grinste.
„Non“, sagte er. Die einzigen anderen Wörter, die er kannte, waren voulezvous coucher avec moi, doch die verkniff er sich lieber.
„Hast du Zeit für einen Kaffee?“, wechselte er stattdessen ins Englische.
„Heute sieht es schlecht aus. Marie ist krank und ich bin alleine hier.“ Das Bedauern in ihrer Stimme war unüberhörbar. „Wie lange bleibst du denn in Montreal?“
„Keine Ahnung“, sagte Garner. „Vielleicht ein paar Tage.“ Ihre Blicke tauchten ineinander, und obwohl sie sich während des Montreal-Falls nur wenige Male begegnet waren, spürte er wieder das magische Band zwischen ihnen. „Eine hauchdünne Spur in meinem letzten Fall, die wahrscheinlich ins Leere führt“, setzte er hinzu. Sie sah ihn erwartungsvoll an, doch er schwieg. Es war Zeit zu gehen. Dennoch stand er wie festgewurzelt.
„Wenn du nichts Besseres vorhast, könnten wir morgen Abend zusammen essen gehen“, sagte Sophie.
Das Schweigen zwischen ihnen war so tief, dass er das Gefühl hatte, in einen Abgrund zu fallen.
„Ich habe nichts Besseres vor“, sagte er schließlich. Seine Stimme klang gepresst.
„20:00 Uhr im L’Orphée? Ein kleines Restaurant ganz in der Nähe.“
„Oui“, sagte Garner. Er nickte ihr zu und stürzte aus der Buchhandlung, ohne sich zu verabschieden. Mit hastigen Schritten eilte er zurück auf die Rue Saint-Denis, den Koffer hinter sich herziehend. Was für ein Volltrottel er war! Schopenhauer hatte recht gehabt, das Wesen aller Erscheinungen war der unbewusste Wille, ein unerklärlicher Drang, ein machtvolles Streben aus Trieben, Wünschen und Sehnsüchten. Was zog ihn ausgerechnet an Sophie LeRoux so an, dass es alle Regeln der Vernunft außer Kraft setzte und sein Herz flattern ließ wie einen gefangenen Schmetterling?
Er winkte ein Taxi herbei und ließ sich in das Best Western Hotel in der City fahren, das er von seinem letzten Aufenthalt kannte. Er checkte ein, nahm den Lift in die 5. Etage und hielt die Keycard vor das Türschloss. Bett, Schrank, Schreibtisch, Nasszelle. Funktional, antiseptisch. Wie sein Leben. Er nahm die beiden neuen weißen Hemden, die er zusammen mit dem grauen Anzug in Vancouver gekauft hatte, aus dem Koffer und hängte sie in den Schrank. Sein alter Samsonite lag auf der Rückbank des BMWs und rostete ebenfalls am Grund des Chilliwack River vor sich hin. Er hatte mehr als Glück gehabt, dass der Wagen nicht zu seinem Sarg geworden war. Garner trat ans Fenster und blickte hinaus auf die Stadt. Es war früher Abend, und die Dunkelheit senkte sich über die Hochhäuser, durch deren gläserne Fassaden das kalte künstliche Licht schien. Eingezwängt in sein Betonbett floss der St. Lawrence dahin wie ein Band aus flüssigem Blei. Noch am Morgen war er in Vancouver gewesen und hatte aus einem fast identischen Hotelzimmer auf die Brandung des Pazifiks geschaut. Bei dem Gedanken an den letzten Fall überflutete ihn eine Welle von Hass. Nach allem, was seine Ex-Kollegin Nora Jackson ihm gesagt hatte, würde die RCMP Vancouver die Ermittlungen einstellen. Sie hatten den Skalpmörder und seine Komplizen gestellt und erschossen, doch sie hatten nur die Handlanger getötet, während die Drahtzieher frei herumliefen und weiter ihren blutigen Geschäften nachgingen. Die 6. Familie. Rocco Giuliani. Wie ein Spinnennetz überzog die Mafia die kanadische Gesellschaft und schaltete gnadenlos alle aus, die sich ihr widersetzten. Im Tresor des Casinos hatten sie einen Vertrag zur Übergabe der Geschäftsführung an einen gewissen Serge Fortin gefunden. Eine Montrealer Firmenadresse. Morgen würde Garner Monsieur Fortin einen kleinen Besuch abstatten. Es war die einzige Spur zu Rocco Giuliani, die er hatte. Garners Magen knurrte. In Vancouver hatte er lediglich einen Kaffee mit Nora Jackson getrunken und dann einen bescheidenen Lunch an Bord der Maschine eingenommen. Er beschloss, etwas zu essen und dann ins Bett zu gehen. Nach Westküstenzeit war es bereits 21:30 Uhr, und Garner fühlte sich müde und zerschlagen. Der Fall hatte mehr an seinen Kräften gezehrt, als er sich eingestehen wollte. Er verließ sein Zimmer, nahm den Aufzug nach unten und fragte an der Rezeption nach einem amerikanischen Restaurant in der Nähe. Garner war kein Freund von Schnecken und Fröschen in Knoblauchsoße. Das Reuben’s Deli and Steakhouselag nur zweihundert Meter entfernt. Es war deutlich kühler als in Vancouver, und in seinem grauen Anzug fröstelte er. Er würde sich morgen einen Wintermantel kaufen müssen. Das Restaurant war gut besucht, doch Garner fand noch einen Platz an einem Katzentisch neben dem Tresen. Die Kellnerin sprach ein akzentfreies Englisch, und er bestellte Steak mit Pommes frites und eine Cola. Dankbar schaufelte er alles in sich hinein, goss die Cola hinterher, bezahlte und eilte durch die Kälte zurück ins Hotel. Obwohl er hundemüde war, ging er nicht auf sein Zimmer, sondern folgte wie eine taumelnde Motte dem verführerisch leuchtenden Schild Bar de l’Hôtel. Er redete sich ein, dass er einen Whiskey bräuchte, um sich aufzuwärmen, doch er wusste, dass er ohne einen Drink nicht würde einschlafen können. Als der Barkeeper einen Royal Canadianvor ihn hinstellte, leerte Garner ihn in einem Zug. Der Barkeeper grinste und füllte sofort nach. Während sich eine wohlige Wärme in seiner Magengegend ausbreitete, dachte Garner an die beiden Rendezvous, die ihm morgen bevorstanden, und er wusste nicht, welches ihm gefährlicher erschien, das mit Serge Fortin oder Sophie LeRoux. Er leerte auch den zweiten Whiskey, warf einen Zwanzigdollarschein auf den Tresen und nahm den Lift nach oben. Sein Kopf schwamm, doch es dauerte eine Ewigkeit, bis er endlich in einen unruhigen Schlaf fiel.
Ted Garner5. OktoberMontreal
Er erwachte zu früh, duschte kalt, zog sich an und frühstückte im Hotel. Dann googelte er noch einmal die Firmenadresse, die Nora Jackson ihm gegeben hatte und wies den Youngster an der Rezeption an, ihm ein Taxi zu rufen. Nach nur wenigen Kilometern Fahrt durch die City hielt der Fahrer vor einem der gläsernen Skyscraper am Place Ville-Marie. SYNMAX Real Estate Agency – Agence Immobilière stand in eleganten schwarzen Lettern über dem Eingangsportal. Garner bezahlte, stieg aus und betrat ein imposantes Foyer. Marmorfußboden, riesige Grünpflanzen in anthrazitfarbenen Steinkübeln, moderne Kunst an den Wänden. Geschniegelte Typen in teuren Businessanzügen hasteten an ihm vorbei, zwei gestylte Frauen, die aussahen wie vom Cover der Vogue, saßen auf einem schwarzen Ledersofa und starrten auf ihre iPhones, hinter mehreren Countern aus dunklem Palisander hockten coole Menschen vor Computern oder telefonierten. Wie ein Chamäleon tauchte Garner in die Atmosphäre urbaner Geschäftigkeit ein, der neue graue Anzug die perfekte Tarnung. Er ging zu einem der Desks und fragte nach Serge Fortin.
„11. Etage“, sagte eine junge Tussi und lächelte ein Automatenlächeln. „Soll ich Sie anmelden?“
„Nicht nötig“, sagte Garner. Er wandte sich brüsk ab und steuerte zielstrebig auf einen der Lifts zu. Die Tür öffnete sich, und er stieg unbehelligt in den Aufzug. Während er lautlos nach oben glitt, dachte er noch einmal über seine Strategie nach. Er hatte keinerlei Ermittlungsbefugnis, und niemand wusste von seinem, wohlmeinend ausgedrückt, spontanen, weniger wohlmeinend, wahnwitzigen Privatausflug nach Montreal. Das Spiel war gefährlich, doch für den Notfall steckte die Walther im Schulterholster. Der Lift hielt, und Garner ging einen ausgestorben wirkenden Flur entlang. Alle Bürotüren waren geschlossen, nur das Sekretariat stand offen. Garner versuchte sich an einem freundlichen Gesichtsausdruck und fragte die attraktive Blondine, die mit einem arroganten kleinen Lächeln von ihrem Bildschirm hochblickte, nach Serge Fortin.
„Haben Sie einen Termin?“, schoss sie die Standardfrage aller Vorzimmermiezen auf ihn ab. Er zückte seinen Dienstausweis. Ted Garner. RCMP Regina. Sie zog die Augenbrauen hoch und musterte ihn ungeniert. Ihr Lächeln wurde schmal.
„Einen Moment bitte.“ Sie klopfte vorsichtig an die Zwischentür und verschwand kurz in Fortins Büro, bevor sie mit eingefrorener Miene grünes Licht gab. Garner betrat den Raum, ohne zu klopfen, und schloss die Tür hinter sich. Serge Fortin saß hinter einem mit Aktenbergen bedeckten Schreibtisch und blickte ihm aus freundlichen braunen Augen hinter einer modischen Titanbrille entgegen. Er war um die Fünfzig, trug einen dunkelblauen Dreiteiler mit weißem Hemd und Krawatte und strahlte eine Seriosität aus, die auch nur den geringsten Funken Misstrauen ihm gegenüber sofort als Charakterfehler seines Verhandlungspartners erscheinen lassen musste.
„Was kann ich für Sie tun, Mister Garner?“, fragte Fortin und wies ihn mit einer eleganten Handbewegung an, in dem Ledersessel ihm gegenüber Platz zu nehmen. Sein Englisch war fast akzentfrei, sein Blick intelligent und hellwach. Garner setzte sich. Der Sessel war weich und bequem. Er beschloss, sofort in die Offensive zu gehen.
„Bei einem Mordfall in British Columbia wurde in einem indianischen Casino namens Lucky Starein Vertrag gefunden, der von Ihnen aufgesetzt und unterschrieben ist.“ Garner bohrte seinen Blick in den von Fortin, doch der lächelte weiter freundlich und schwieg.
„Laut Vertrag sollte die Geschäftsführung des Casinos an Sie übergehen“, setzte Garner hinzu.
Fortin zeigte nicht die geringste Regung. Er saß weiter da wie der Buddha im Zustand der Erleuchtung und ließ Garner kommen. Psychologische Kriegsführung. Oder Pokern auf Meisterniveau. Auch Garner schwieg jetzt. Das Schweigen wurde drückend.
„Ich setze viele Verträge auf “, sagte Fortin schließlich. „Ich bin Justiziar einer der größten Immobilienkonzerne Kanadas. Wir kaufen und verkaufen Grundstücke, Häuser und Firmen im ganzen Land. Es ist mein Beruf.“ Wieder das nachsichtige Lächeln. Ein gütiger Vater mit viel Geduld gegenüber seinem etwas zurückgebliebenen Sohn.
„Welche Interessen stecken hinter der Übernahme eines abgelegenen indianischen Casinos in British Columbia?“, fragte Garner.
„Dieselben Interessen wie überall“, meinte Fortin achselzuckend. „Wirtschaftliche.“ Der Mann war aalglatt.
„Könnten Sie das bitte präzisieren?“ Garner hatte Mühe, seine Wut in Zaum zu halten. „Casinos auf Reservatsland unterliegen bestimmten Gesetzen. Eine Abtretung von Grundbesitz an Nicht-Indigene ist meines Wissens nicht statthaft.“
„Dafür müsste ich erst einmal den Vertrag heraussuchen“, sagte Fortin. „Ich kann mich nicht an die Details aller Verhandlungen, die über meinen Tisch gehen, erinnern.“ Seine Stimme klang gänzlich ungerührt. „Doch soweit ich Sie verstanden habe, ging es ja nicht um den Erwerb der fraglichen Immobilie, sondern lediglich um einen Austausch der Geschäftsführung. Natürlich halten wir uns stets an die Gesetze. Wahrscheinlich stand das Casino kurz vor der Insolvenz und ein Investment seitens SYNMAX, um die Profitabilität des Unternehmens zu erhöhen, sollte durch eine temporäre Einflussnahme auf das Management abgesichert werden. Frisches Geld und professionelle Beratung gegen finanzielle Beteiligung an den Gewinnen.“ Sein Lächeln hatte jetzt etwas Süffisantes. „Wissen Sie, Monsieur Garner, unsere indigenen Mitbürger sind oft etwas naiv in Geschäftsdingen. Da unterstützen wir sie gerne.“
Kalter Hass stieg in Garner hoch, und er musste sich bremsen, nicht die Walther zu zücken und dem schmierigen Anwalt an die Schläfe zu halten. Er dachte an den blutigen Skalp von Lenny Laronge, den er aus der Jackentasche des Auftragskillers gezogen hatte. Lenny Laronge war alles andere als naiv gewesen. Er hatte Business Administration an der University of British Columbia studiert, war zurückgekehrt ins Reservat und hatte ein Casino eröffnet, um die Lebensverhältnisse seiner Stammesgenossen zu verbessern. Das Casino lief glänzend, und genau das hatte die Mafia angezogen wie eine Horde hungriger Hyänen. Es ging nicht um frisches, sondern um schmutziges Geld, das im Casino gewaschen werden sollte.
„Sagt Ihnen der Name Rocco Giuliani etwas?“ Garners und Fortins Augen verhakten sich sekundenlang ineinander, doch es war unmöglich, eine Regung in Fortins Mimik zu erkennen.
„Ich glaube nicht.“ Fortin schaute auf die Uhr. „Leider habe ich gleich einen Termin. Doch selbstverständlich bin ich gerne behilflich, soweit das in meiner Macht steht. Sie ermitteln im Auftrag der RCMP Regina?“
Die braunen Mausaugen blickten weiterhin freundlich, doch in Fortins Stimme schwang ein fein dosiertes Erstaunen mit. Eiskaltes Kalkül, dachte Garner. Der Mann war gefährlich. Gleich würde die Falle zuschnappen.
„Ja“, log Garner. Seine Hand glitt unmerklich zur Waffe. Fortin würde ihn jetzt zwingen, seine Karten auf den Tisch zu legen. Eine Legitimation verlangen, die Zuständigkeit der RCMP Regina für Quebec infrage stellen. Das Spiel war aus.
Doch Fortin lächelte kommentarlos. „Ich liebe die Prärie. Erinnert mich noch heute an den Wilden Westen. Weites Land, mutige Männer.“ Er fixierte Garner. „Leben Sie in Regina?“
Garner nickte knapp.
„Ein guter Ort, um Kinder großzuziehen“, meinte Fortin. Sein Lächeln hatte jetzt etwas Boshaftes. „Viel gesünder als die Großstadt. Weniger Kriminalität.“ Er erhob sich. Das Gespräch war offensichtlich beendet. „Wenn Sie mir sagen, wie ich Sie am besten erreichen kann, werde ich meine Sekretärin bitten, die entsprechenden Unterlagen für Sie zu kopieren und Ihnen schnellstmöglich zukommen zu lassen. Falls Sie dann noch Fragen haben, machen Sie am besten gleich einen Termin aus. Für morgen wird Chantal sicher noch ein paar Minuten freischaufeln können.“
Was für ein Entgegenkommen, dachte Garner. Er beschloss, es vorerst nicht auf die Spitze zu treiben und erst einmal abzuwarten, was der gerissene Anwalt ihm kredenzen würde. Morgen war ein neuer Tag.
„Ich wohne im Best Western Downtown“, sagte er. „Zimmer 511.“
„Au revoir, Monsieur Garner. Nice to meet you.“ Hinter der Titanbrille war ein kurzes Blitzen zu sehen, doch vielleicht war es nur das Licht gewesen und Garner hatte sich getäuscht. Dennoch hatte er ein ungutes Gefühl, als er das Büro verließ. Chantal blickte kurz von ihrem PC hoch und sagte ebenfalls: „Au revoir, Monsieur Garner.“ Er trat an ihren Schreibtisch und bat um einen Termin für den morgigen Vormittag. Sie zog eine Schnute und scrollte durch verschiedene Dateien, bis sie den Kalender ihres Chefs gefunden hatte.
„Ich muss erst schauen, ob ich einen seiner Termine verschieben kann“, sagte sie zögernd. „Wie kann ich Sie erreichen?“
Garner gab ihr seine Handynummer. Als er wieder den ausgestorbenen Flur entlangging und den Lift ins Erdgeschoss nahm, spürte er eine seltsame Getriebenheit. Er durchquerte eilig das Foyer und trat ins Freie. Erst auf der Straße hatte er das Gefühl, wieder durchatmen zu können. Es war später Vormittag, und auf dem Place Ville-Marie herrschte dichter Verkehr. Er verharrte eine Weile und starrte wie in Trance auf die vorbeifahrenden Autos, bis sich sein Puls einigermaßen beruhigt hatte. Vielleicht hätte er Fortin ins Knie schießen und zwingen sollen, die Wahrheit auszuspucken. Doch er war kein Mafioso. In dem riesigen, futuristisch anmutenden Gebäudekomplex aus Glaspalästen und Bürotürmen befand sich auch ein Shopping Center. Garner steuerte auf den Eingang zu und nahm die Rolltreppe nach oben. Er fand eine Filiale der Hudson’s Bay Companyund probierte einen schwarzen Wollmantel an. Die bandagierte Schulter schmerzte noch immer bei jeder unvorsichtigen Bewegung. Als er sich im Spiegel betrachtete, schossen ihm die Worte der ermordeten Psychologin Claudia Hofstätter in den Sinn: die dunkle Aura. Eine Nebelkrähe mit gebrochenem Flügel. Der Mantel passte, er behielt ihn an, ging zur Kasse und bezahlte. Während er zurück zum Ausgang eilte, dachte er, dass Nora Jackson recht hatte. Sie würden niemals an Rocco Giuliani herankommen, geschweige denn ihm irgendetwas nachweisen können. Es würde immer durchtriebene Anwälte wie Fortin geben, die für schmutziges Geld die Interessen der 6. Familie schützten und ihren kriminellen Geschäften ein Saubermann-Image verschafften. Ärger und Frustration kochten in ihm hoch. Er brauchte dringend Bewegung. Garner folgte dem dicht befahrenen Boulevard René-Lévesque und bog nach einem guten Kilometer in die Rue Saint-Urbain ein. Die Straßen wurden schmaler, und er passierte das chinesische Viertel, das ihn an die albtraumhafte Zeit nach dem Mord an Claudia Hofstätter in Vancouver denken ließ, als er sich, von Zweifeln und Schuldgefühlen geplagt, in seinem Rattenloch in Chinatown verkrochen hatte. Auf dem Place d’Armes verweilte er ein paar Minuten vor dem Denkmal, das an die Gründung der Stadt im Jahr 1642 erinnerte. Stolz blickte die Bronzestatue Paul Chomedey de Maisonneuves von ihrem steinernen Sockel herab, in der rechten Hand eine Flagge, in der Linken den Knauf eines Degens, zu ihren Füßen die Figur eines besiegten Irokesen. Doch nur knapp einhundertzwanzig Jahre später war es genau auf diesem alten Exerzierplatz gewesen, dass die Garnison Montreal ihre Waffen den einrückenden britischen Soldaten aushändigte, nachdem die französischen Truppen in der Schlacht auf der Abraham-Ebene vernichtend geschlagen worden waren. Durch den Pariser Frieden 1763 fiel La Nouvelle Franceendgültig an Großbritannien und wurde durch eine Königliche Proklamation noch im selben Jahr in Québec umbenannt. Der französische Einfluss und die Abgrenzung zu den englischsprachigen Provinzen Kanadas waren jedoch bis heute deutlich spürbar. Hinter dem schwarzen Geäst der kahlen Bäume auf dem Place d’Armes erhob sich die aus grauem Kalkstein erbaute Doppelturmfassade der Basilique Notre-Dame, daneben das Ende des 17. Jahrhunderts errichtete Priesterseminar des Sulpizianerordens. Beeindruckt bestaunte Garner die historischen Gebäude. Seine eigene Heimatstadt Regina war erst 1906 zur Hauptstadt der ein Jahr zuvor gegründeten Provinz Saskatchewan erklärt worden, ein kleines Prärienest, nur durch die Canadian Pacific Railway mit der Zivilisation im Osten verbunden. Obwohl er sich in Montreal wie ein Provinzler fühlte, liebte Garner die Prärie. Das offene Land, die endlosen Weizenfelder, der weite Himmel. Der Place d’Armes erschien ihm wie eine Oase inmitten einer riesigen Steinwüste. Auf der nordwestlichen Platzseite thronte der klassizistische Hauptsitz der Bank of Montreal, daneben Hochhausbauten im Art-déco-Stil, der stählerne Wolkenkratzer der National Bank of Canada. Es war, als spiegele sich die rasante Entwicklungsgeschichte Kanadas in all ihren Widersprüchen genau an diesem Platz. Als er vor der imposanten, 1829 fertiggestellten neugotischen Basilika stand, setzte plötzlich das dröhnende Geläute der Glocken ein, und wie von einer unsichtbaren Schnur gezogen, stieg er die Stufen zum Hauptportal hoch und betrat die Kirche. Farbiges Licht strömte durch die hohen Bleiglasfenster ins Innere und erzeugte eine mystische Atmosphäre, der sich selbst Garner nicht entziehen konnte. Ein Geruch nach Weihrauch und altem Gemäuer hing in der Luft. Seine Schritte hallten auf dem Steinfußboden des Mittelschiffs wider, der zu der halbkreisförmigen Apsis führte. Das riesige Altarbild zeigte die Darstellung der Kreuzigung Christi. Aus einer Mauernische blickte die Jungfrau Maria, umgeben von einem goldenen Strahlenkranz, sanft auf ihn herab. Ein flackerndes Meer von Kerzen auf einem Eisengestell, daneben eine Spendenbox. Ohne zu wissen warum, warf Garner einen Dollar ein und zündete eine der weißen Wachskerzen an. Er war kein Christ, und er lehnte alle Dogmen ab. Das Leben war sinnlos, die Hoffnung auf Erlösung nur schöner Schein. Man wurde geboren, lebte eine Weile mehr oder weniger glücklich und starb. Dennoch war es auf seltsame Weise tröstlich, die Dunkelheit der Welt und seiner eigenen Seele durch eine Kerze zu erhellen. Wenigstens für einen kurzen Moment und für einen lumpigen Dollar. Während er die im Luftzug leise hin- und her zuckenden Flämmchen beobachtete, dachte er, dass Sophie LeRoux, wie die meisten Frankokanadier, wahrscheinlich katholisch war. War für gläubige Katholiken die Scheidung noch immer ein Tabu? Er erschrak selbst über seine Gedanken und hastete durch das Seitenschiff vorbei an dunklen Nischen und Beichtstühlen, in denen seine eigenen Dämonen zu hausen schienen.
Plötzlich hatte er es eilig, zurück ins Freie zu kommen. Er folgte weiter der Rue Saint-Urbain, bis er das Ufer des St. Lawrence erreichte. Eingezwängt zwischen Kaianlagen und Betonmauern floss der mächtige Strom träge dahin. Ein frischer Wind wehte, und obwohl er den Kragen seines neuen Wollmantels hochklappte, fror er. Die Temperaturen waren seit gestern gefallen, und es würde nicht mehr lange dauern, bis der kanadische Winter einsetzte. Tonnen von Schnee würden die Stadt unter sich begraben, und der St. Lawrence würde für Monate zufrieren, bis sich im Frühjahr mächtige Eisschollen lösten und am Ufer zu bizarren gläsernen Formationen auftürmten. Garner schlenderte die Promenade du Vieux-Port entlang, vorbei an Hafenbecken mit im Wellengang schaukelnden vertäuten Yachten, bis er zu einem künstlich angelegten Strand kam. Hier am Urban Beach war vor fast genau einem Jahr die Leiche der jungen Cree-Indianerin angeschwemmt worden. Die Spur ihrer Mörder hatte in den Montrealer Nachtclub geführt, in dem die RCMP seinen Kollegen LeRoux halb tot und vollgepumpt mit Drogen gefunden hatte. Auch die berühmt-berüchtigte Rotlichtszene der Stadt wurde von der Mafia beherrscht, und LeRoux und er waren bei ihren Ermittlungen beinahe draufgegangen. Würde es ihm dieses Mal gelingen, an die Hintermänner zu kommen? Er stand lange an dem verlassenen Flussufer mit dem schmutzig gelben Sand, von dem die bunten Deckchairs und provisorischen Sommerbars bereits abgeräumt worden waren, und schaute auf die graue Wasserfläche, dann stieg er an der Station Vieux-Port in die Metro und fuhr zurück in sein Hotel. Er fragte an der Rezeption, doch bisher hatte niemand etwas für ihn abgegeben. Garner nahm den Lift in sein Zimmer, hielt die Keycard vor das Schloss und warf sich aufs Bett. Der Nachmittag verfloss in einem zähen Warten. Er zappte durch verschiedene Fernsehprogramme und rief mehrmals die Rezeption an, aber weder waren irgendwelche Vertragsunterlagen für ihn angekommen noch poppte eine Nachricht auf seinem Handy für einen neuen Termin bei Fortin auf. Je näher der Abend rückte, desto getriebener fühlte Garner sich. Er überprüfte die Walther und legte sie in den Safe. Vielleicht käme sie ja morgen schon zum Einsatz. Eine merkwürdige Unruhe hatte ihn erfasst, und er war versucht, Sophie LeRoux anzurufen und das Rendezvous abzusagen, doch er wollte sie nicht kränken. Es würde das letzte Wiedersehen sein. Nicht nur für gläubige Katholiken war die Scheidung ein Tabu. Er würde seine Gefühle beerdigen. Als die Dämmerung das Zimmer in ein diffuses Licht tauchte, stand er auf und ging unter die Dusche. Er ließ das warme Wasser lange über seinen Körper fließen, dann trocknete er sich ab, nahm frische Unterwäsche und eines der neuen weißen Hemden aus dem Schrank und zog sich an. Doch während er in den grauen Anzug glitt und den Mantel überstreifte, spürte er dieselbe freudige Erregung wie am Vortag. Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Er nahm erneut die Metro und fuhr die wenigen Stationen zum Plateau Mont Royal. In dem Künstler- und Ausgehviertel herrschte reger Betrieb. Menschen gingen lachend über die Gehsteige, und Gesprächsfetzen in dem kehligen Französisch Quebecs drangen an sein Ohr, ohne dass er ihren Sinn verstand. Die Aureolen der Straßenlaternen leuchteten wie blasse Monde, und aus den Bars klang Jazzmusik. Es war gleichzeitig fremd und schön, fast wie in einem Traum. Das L’Orphée lag ein wenig abseits vom Trubel in einer ruhigen Seitenstraße. Die schwarzen Äste der Bäume zeichneten sich gegen den sternklaren Nachthimmel ab, und der Wind wirbelte durch die trockenen Blätter, die sich in kleinen Haufen am Straßenrand gesammelt hatten und geheimnisvoll raschelten. Wie auf einer beleuchteten Theaterbühne sah er Sophie LeRoux durch die dunkle Scheibe an einem Fenstertisch sitzen. Sein Blick verfing sich einen Moment an ihrem klaren Halbprofil, bevor er sich einen Ruck gab und das Restaurant betrat. An den wenigen, weiß gedeckten Tischen saßen ausschließlich Paare. Das Licht war gedämpft, und in silbernen Kandelabern brannten Kerzen.
„Bonsoir“, lächelte sie ihm entgegen.
„Bonsoir“, antwortete er wie ein Papagei und zog den Mantel aus. Es war sehr warm im Raum.
„Du darfst ruhig Englisch sprechen.“ Sie lachte. Garner liebte es, wenn sie lachte. Er setzte sich auf den Stuhl ihr gegenüber und merkte, wie er sich ein wenig entspannte. Es war immer einfach mit ihr gewesen, eine seltsame Nähe, so als ob sie sich schon seit jeher gekannt hätten. Sie trug ein rotes, tief dekolletiertes Kleid aus einem seidigen Stoff, das einen reizvollen Kontrast zu dem kurz geschnittenen brünetten Haar bildete und die mondäne Eleganz, die sie ausströmte, noch betonte. Ihre Lippen waren von demselben tiefen Rot wie der Nagellack an den Fingern ihrer feingliedrigen Hand, mit der sie den Kellner lässig herbeiwinkte. Der Ober lächelte sie eine Spur zu intensiv an, und sie bestellte eine Flasche Merlot, ohne Garner zu fragen. Doch auch er lächelte ein Einverständnis, obwohl er einen Whiskey bevorzugt hätte. Die Macht einer schönen Frau, dachte Garner.
„Wie war dein Tag?“, fragte Sophie.
„Interessant“, sagte Garner.
„Was macht dein Fall? Kommst du voran?“
„Ist besser, wenn du nicht zu viel weißt“, entgegnete Garner.
„Pass bloß auf dich auf, Ted.“ Sie sah ihm tief in die Augen.
Sophie war keine, die unnötig Fragen stellte, doch er hörte die Besorgnis in ihrer Stimme, und eine irrationale Freude stieg in ihm hoch. Obwohl sie seit dem letzten Winter nur zwei Mal miteinander telefoniert hatten, gleich nach dem verfluchten Calgary-Fall, bei dem sein Vater und er in die Hände eines gefährlichen Psychopathen gefallen und beinahe verbrannt wären, und zuletzt als er in der Klemme steckte und Geld brauchte, schien es Garner, als seien sie niemals getrennt gewesen.
„Magst du Schnecken?“ Sophie nahm die Speisekarte zur Hand und zwinkerte ihm zu. Sie lachte, als sie Garners Gesicht sah. „Es gibt auch Steak“, meinte sie.
„Ich nehme Schnecken“, sagte Garner. „Danach das Steak.“
„Du bist wirklich ein mutiger Mann, Ted“, sagte Sophie und lachte wieder. Ihre Zähne waren ebenmäßig und von derselben Farbe wie die langen Perlmuttohrringe an ihren Läppchen, die bei jeder Kopfbewegung leise hin und her schwangen. Er hätte gerne das kleine Muttermal unterhalb ihres linken Mundwinkels geküsst. Der Kellner kam zurück an ihren Tisch, entkorkte mit großem Zeremoniell die Weinflasche und goss eine Kostprobe in sein Glas. Obwohl er keine Ahnung von Wein hatte, spülte Garner den Schluck langsam im Mund hin und her und nickte. Der Kellner schenkte ihm ein arrogantes Lächeln und goss zwei Gläser ein. Sophie wechselte ein paar Sätze auf Französisch – Garner verstand nur das Wort ‚Steak‘ – mit dem Kellner, dessen idiotisches Dauerlächeln und verstohlener Blick auf Sophies Dekolleté ihn extrem nervten, dann trollte er sich endlich Richtung Küche. Sophie hob ihr Glas und sagte: „Cheers, Cowboy.“ Unwillkürlich musste Garner grinsen. Sie stießen miteinander an und Garner dachte, dass er sich schon lange nicht mehr so frei gefühlt hatte.
„Wie geht es eigentlich deinem Vater?“, fragte Sophie.
„Er ist seinen Verletzungen erlegen“, sagte Garner. „Hat das Bewusstsein nicht mehr erlangt“, fügte er hinzu.
Sophies Gesicht wurde ernst. Sie beugte sich ein wenig vor und legte ihre Hand auf seinen Arm. Sie fühlte sich federleicht und warm an. „Dann wirst du nie mehr erfahren, ob er eine Mitschuld trug.“
„Nein“, sagte Garner.
„Vielleicht ist es besser so.“
„Vielleicht“, sagte Garner.
Sie schwiegen eine Weile ein ganz und gar einvernehmliches Schweigen. Es gab nur wenige Menschen, mit denen man das konnte, dachte Garner. Außer Sophie kannte er niemanden. Als sie die Hand zurückzog, spürte er ein leises Bedauern.
„Und wie geht es dir?“, fragte er schließlich. Er musste sich auf die Zunge beißen, um nicht die eine Frage zu stellen, die ihm unter den Nägeln brannte. Was war mit Jean-Baptiste?
„Mir gehts fantastisch“, lächelte sie, doch er fand, dass ihr Lächeln unecht wirkte. „Ich lebe in der magischen Welt der Bücher. Wenn ich nicht in der Buchhandlung arbeite, lese ich.“ Sie nahm einen großen Schluck von ihrem Wein. „Ich glaube, Jean-Jacques Rousseau hatte recht: Die Welt der Fantasie ist die einzige Welt, in der es sich zu leben lohnt.“
„Lesen ist ein bloßes Surrogat des eigenen Denkens“, entgegnete Garner. „Man lässt dabei seine Gedanken von dem Andern am Gängelbande führen. Arthur Schopenhauer.“ Garner war kein Fantast, und er mochte weder Romane noch Gedichte.
„Auch Schopenhauer ist trotz seines genialen Verstandes im wirklichen Leben gescheitert“, meinte Sophie.
Hinter ihrem Lächeln spürte Garner eine Melancholie und Zerbrechlichkeit, die ihr eine geheimnisvolle Tiefe verliehen. Er hätte sie gerne beschützt, doch er wusste nicht wie. Wieder fragte er sich, was ihn an ihr so anzog. Außer ihrer Begeisterung für die Philosophie schienen sie völlig gegensätzlich, doch es gab auch Komplementärteilchen, die einander perfekt ergänzten.
„Scheitern gehört dazu. Davon darf man sich nicht unterkriegen lassen“, sagte Garner. „Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. Mein Wahlspruch.“
Jetzt lachte Sophie wieder und Garner fühlte sich auf seltsame Art froh. Auch das wirkliche Leben konnte schön sein, dachte er. Und dieser Abend war keine Fantasie.
„Auf Samuel Beckett und die kontinuierliche Verbesserung unseres Scheiterns“, sagte Sophie und stieß erneut mit ihm an. Ihm schwindelte ein wenig, doch er wusste nicht, ob vom Wein, der Wärme im Lokal oder ihrer Nähe. Als der Kellner zwei Teller mit Schneckengehäusen, in deren Öffnungen etwas Grünliches schimmerte, vor sie hinstellte und Garner sich abmühte, mit der zweizinkigen Schneckengabel das wurmartige, verkrumpelte Fleisch herauszupulen, ohne dass das Gehäuse aus der Zange rutschte und die Kräuterbutter sein weißes Hemd ruinierte, spukte die Beckett-Sentenz wie ein Mantra in seinem Kopf herum und er musste grinsen. Try again. Fail again. Fail better. Er spülte die Schnecken mit Rotwein hinunter und freute sich auf sein Steak. Sophie bestellte eine zweite Flasche Merlot, und Garner protestierte nicht, obwohl sein Kopf bereits schwamm. Während des Essens floss das Gespräch zwischen ihnen leicht und frei, sie erzählte von Büchern, die sie gelesen hatte, er von der grandiosen Natur auf Vancouver Island, der Wildheit des Pazifiks, seiner einsamen Nacht am Strand. Die Stunden verflogen. Erst als der Kellner die Tische abräumte, merkte Garner, dass sie die letzten Gäste waren. Es war spät geworden. Zeit, um die Rechnung zu bitten. Doch etwas hielt ihn davon ab. Plötzlich war es still zwischen ihnen, das Klappern des Geschirrs das einzige Geräusch. Er wagte weder, sie nach Jean-Baptiste zu fragen noch nach einem Wiedersehen.
„Wir sind getrennt“, sagte Sophie. Garner erschrak. Es war, als habe sie seine Gedanken erraten. „Jean-Baptiste war lange in der Klinik. Burn-out.“ Das Wort ‚getrennt‘ hing zwischen ihnen wie ein Rasiermesser. Ihr Blick war sehr tief. Garner hätte sie gerne geküsst, doch er saß wie festgeklebt auf seinem Stuhl und schwieg. Der Moment kam und verging. Sie lächelte, aber ihr Lächeln sah traurig aus.
„Trinken wir noch einen Absacker?“, fragte sie.
Garner zögerte. Er hörte, wie die Tür geöffnet wurde, und spürte einen kalten Luftzug im Rücken. Ein später Gast? Das Restaurant würde bald schließen. Schritte, die sich ihrem Tisch näherten und plötzlich verharrten. Ein gedämpfter Knall, etwas blitzte auf, und Sophie sackte zusammen. Auf der Höhe ihres Herzens verfärbte sich der Stoff ihres Kleides in einen nassen Fleck, der sich wie in Zeitlupe ausbreitete. Noch ehe Garner richtig begriff, was geschehen war, war der Schütze verschwunden wie eine Erscheinung. Alles, was Garner sah, war der Schatten eines Mannes, der aus der Tür huschte und mit der Dunkelheit verschmolz. Garner sprang hoch und stürzte auf Sophie zu. Er nahm sie behutsam in seine Arme und legte ihren Körper vorsichtig auf dem Boden ab, ihren Kopf auf seinen Schoß gebettet. Er strich sanft über ihr Gesicht, doch ihr Blick war starr. Wie von weiter Ferne hörte er die aufgeregte Stimme des Kellners, aber alles, was er verstand, waren die Wörter ambulance und police. Garner saß da wie gelähmt. Irgendwann Sirenen und Blaulicht, Sanitäter, die sich über ihn und Sophie beugten, das schreckliche Wort morte. Sophie unter einem weißen Tuch auf einer Trage, er in eine Silberfolie gewickelt auf einem Stuhl, Fragen und Erklärungen, die in gebrochenem Englisch auf ihn einprasselten wie ein Trommelfeuer. Herzschuss. Schalldämpfer. Keine Zeugen. Entkommen. Nein, Garner hatte ihn nicht erkannt, auch der Kellner, der gerade schmutziges Geschirr in die Küche gebracht hatte, hatte nur einen kurzen Blick von hinten auf den Mann erhascht, als er das Lokal verließ, mittelgroß, dunkler Anorak, Kapuze. Nein, natürlich hatte er den Mörder nicht verfolgt, er hatte sofort die Polizei und den Notdienst gerufen, ja, er hatte alles richtig gemacht, der Mann war gefährlich. War Garner der Ehemann der Toten? Nur ein Freund aus Regina. Garners Stimme war so brüchig wie gesplittertes Eis. Hatte er einen Verdacht? Garner schüttelte den Kopf. Er unterschrieb etwas und hinterließ seine Personalien und die Hoteladresse. Morgen früh müsste er aufs Präsidium kommen und seine Aussagen zu Protokoll geben. Sie würden LeRoux benachrichtigen. Getrennt hieß nicht geschieden. Er war ihr rechtmäßiger Ehemann. LeRoux würde erfahren, dass Sophie mit Garner hier gewesen war. Der Gedanke verursachte ihm Übelkeit. Als er aufstand, drehte sich alles, doch er lehnte das Angebot der Polizisten, ihn zum Hotel zu fahren, ab und rief ein Taxi. Es war fast zwei Uhr morgens, als er wie betäubt in die Lobby trat. Der junge Mann hinter dem Tresen lächelte ihm zu. Die Rezeption war die ganze Nacht besetzt. „Monsieur Garner?“ Garner nickte. „Etwas ist für Sie abgegeben worden.“ Er händigte Garner ein Kuvert aus, auf dem sein Name stand. Garner nahm den Umschlag wortlos entgegen und stieg in den Lift. Er wankte in sein Zimmer und zog den Mantel aus. Das Jackett seines neuen Anzugs und das weiße Hemd waren voller Blut. Sophie LeRoux’ Blut. Eine Welle der Verzweiflung überrollte Garner. Ohne dass er sich dagegen wehren konnte, rannen Tränen seine Wangen herab, und er schluchzte hemmungslos wie ein Kind. Als die Tränen irgendwann abebbten, öffnete er mit steifen Fingern das Kuvert und zog ein Papier heraus. Ein Flugticket nach Regina für morgen Abend. Ausgestellt auf seinen Namen. In dem Umschlag steckte noch etwas. Ein Foto. Als Garner es herausnahm, stockte ihm der Atem. Es war ein Foto seiner beiden Söhne vor der Miller Comprehensive Highschool in Regina. Auf der Rückseite stand in einer zierlichen Handschrift Bon voyage, Monsieur Garner.
Teil II
Ted Garner15. Oktober, 2 Jahre späterRegina
„Die unbeständigste und am stärksten gefährdete Beziehung im Leben ist die zwischen uns und unserem Ehepartner. In einer so engen Beziehung über einen langen Zeitraum Harmonie und Verstehen aufrechtzuerhalten, kann sehr schwierig sein. Sie müssen aktiv etwas dafür tun.“
Garner versuchte, abwechselnd Blickkontakt zu Theresa und Harold Taylor aufzunehmen, die ihm gegenüber mit einem Abstand von einem guten Meter zueinander auf zwei Stühlen hockten, doch Harold hielt den Kopf gesenkt und nestelte nervös an dem Brillengestell in seinen Händen herum, und Theresas linkes Augenlid flatterte so stark, dass Garner Mühe hatte, nicht selbst wegzuschauen. Die in einem besänftigenden Hellgrün gestrichenen Wände des Therapieraums schienen wieder einmal ihre Wirkung zu verfehlen. Garner kämpfte verzweifelt gegen die Unlust an, die ihn bei all seinen Klientengesprächen nach kurzer Zeit befiel.
„Ich möchte Ihnen heute eine Methode vorstellen, die sich in der Paartherapie sehr bewährt hat.“ Er zwang sich zu einem motivierenden Therapeutenlächeln. „Beziehungs-Diaden sind ein wunderbares Werkzeug, das Sie verwenden können, wann immer es nötig ist, um die Kommunikation zwischen Ihnen zu verbessern.“
Harold setzte die Brille wieder auf, verschränkte die Arme und starrte auf irgendetwas Unsichtbares, das auf dem Fußboden lag. Sein kariertes Hemd spannte über der breiten Brust und dem sich vorwölbenden Bierbauch. Er hatte die Beine übereinandergeschlagen, und der linke Fuß in dem ausgetretenen Winterstiefel wippte unruhig hin und her. Garner hätte schwören können, dass Theresa ihn in seine Praxis geschleppt hatte. Wahrscheinlich hatte sie ihm die Pistole auf die Brust gesetzt: Paartherapie oder ich bin weg. Und wer sollte dann seine Socken waschen?
„Ich lade Sie jetzt ein, diese kraftvolle Methode einmal mit mir auszuprobieren.“ Garner zog die Mundwinkel noch weiter nach oben. „Ist das okay für Sie?“
Theresa nickte wie ein Wackeldackel, Harold senkte den Kopf noch ein Stückchen weiter, was Garner als Zustimmung deutete.
Von ihrem Erstgespräch vor einer Woche, zu dem Theresa allein erschienen war, wusste Garner, dass beide Mitte fünfzig waren, seit 28 Jahren verheiratet, drei erwachsene Kinder, er Automechaniker, sie Sekretärin bei der Regina Leader Post. Ihre Anamnese war die übliche Litanei, bei der alle Sätze mit „er“ begannen und mit „zu wenig“ und „nie“ weitergingen, und die ihm inzwischen zu den Ohren rauskam.
„Die Methode ist ganz einfach“, fuhr Garner fort. „Ich werde Ihnen nacheinander drei Zettel mit Bitten an Ihren Partner geben. Sie lesen die Bitte vor und erlauben dem anderen, fünf Minuten ohne Unterbrechung zu reden, während Sie nur zuhören und sich dann bedanken. Nach drei Bitten wechseln wir die Rollen.“ Wieder schaute er aufmunternd von einem zum anderen. „Wer von Ihnen möchte beginnen?“
„Meinetwegen“, sagte Theresa in herablassendem Ton. War das die Antwort, die sie Harold innerlich schon vor 28 Jahren auf seinen Heiratsantrag hin gegeben hatte? Während er ihr eines der vorbereiteten Blätter in die Hand drückte, dachte Garner an die These eines bekannten Psychotherapeuten: Bei Beziehungen weiß man in der ersten Viertelstunde, wie sie werden, und braucht dann Jahre, um sich das einzugestehen.
Theresa las den ersten Satz mit tonloser Stimme ab wie ein Roboter. Harold hockte auf seinem Stuhl und starrte weiter auf den Fußboden. Theresas Augenlid flatterte jetzt so heftig, als wolle es sich jeden Moment loslösen und davonfliegen.
„Sage mir etwas, was du an mir liebst.“
Harold sah Garner mit einem hilflosen Blick aus den wässrigen Augen hinter den dicken Brillengläsern an und schwieg.
„Halten Sie bitte Blickkontakt mit Ihrer Frau“, mahnte Garner. „Sie haben fünf Minuten Zeit.“
Harold schwieg weiter. „Sie kocht lecker“, murmelte er endlich.
„Sagen Sie das bitte Ihrer Frau“, forderte Garner ihn auf.