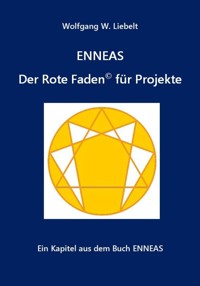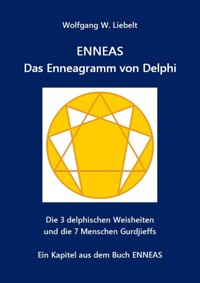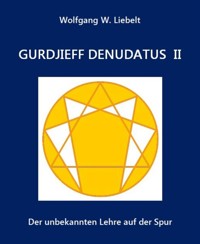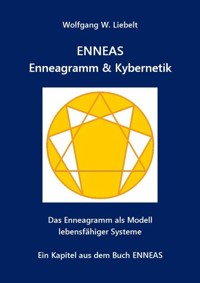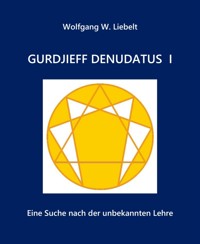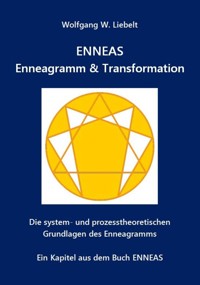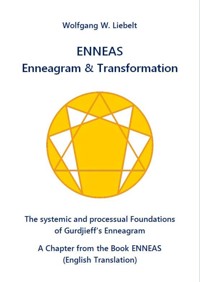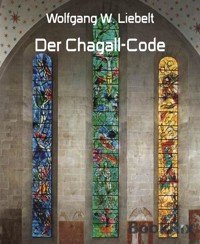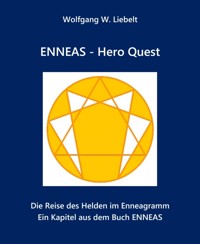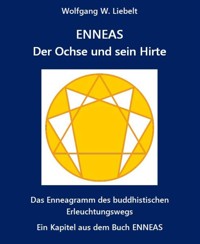
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die buddhistische Geschichte vom Ochsen und seinem Hirten wurde um ca. 1150 vom Chan-Meister Kuoan Shiyuan geschrieben. Aus der Begegnung des aus Indien stammenden Mahayana-Buddhismus und dem Daoismus entstand in China der Chan- bzw. Versenkungsbuddhismus, der zum Vorläufer des japanischen Zen-Buddhismus wurde.
Der im Essay verwendete Bilderzyklus mit den zehn "Ochsenbildern" ist bis heute der populärste und wurde bereits oft aus buddhistischer Perspektive interpretiert.
Gemäß dem Anliegen von ENNEAS habe ich die zehn Stationen in das Enneagramm eingefügt und die Bildfolge anhand dessen "Grammatik", so wie ich sie verstehe, betrachtet und gedeutet.
Durch die alternative Sichtweise auf der Basis des Enneagramms ergaben sich neue, interessante Aspekte. Dabei blieb die Essenz der Geschichte erhalten bzw. hat eine Bestätigung erfahren, vielleicht sogar eine Vertiefung und Erweiterung des Verstehens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ENNEAS - Der Ochse und sein Hirte
Das Enneagramm des buddhistischen Erleuchtungswegs
Für Georg I. Gurdjieff, dessen Leben, Lehre und Werk mich seit mehr als 20 Jahren faszinieren und inspirierenBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDas Enneagramm vom Ochsen und seinem Hirten
Die nächste Abbildung zeigt die ins Enneagramm integrierten Stationen des Bilderzyklus im Überblick.
Die Geschichte der Ochsenbilder
Als allgemeine Einführung zitiere ich zum Thema "Geschichte" der zehn Ochsenbilder aus dem Wikipedia-Beitrag "Der Ochse und sein Hirte" wie folgt:
"Die Grundlage für den bis heute noch populärsten Bildzyklus (insgesamt sind vier überliefert) wurde von dem song-chinesischen Linji-Chan-Meister Kuoan Shiyuan … um 1150 geschrieben und illustriert. Später fügte Chi-yuan ein Vorwort und kurze Geleitworte zu jedem Bild hinzu. Diese Version erfuhr in China und Korea keine grosse Verbreitung, erfreute sich aber im mittelalterlichen Japan grosser Beliebtheit."
Ochs und Hirte im Enneagramm
Die Anordnung der zehn Bilder im Kreis des Enneagramms erfolgte ganz natürlich im Uhrzeigersinn (von der 0 zur 9), das heisst in evolutionärer Richtung. Evolution stellte in Gurdjieffs Lehre einen Prozess der Vergeistigung von Materie, im vorliegenden Fall die Beschreibung einer spirituellen Entwicklung eines Menschen, des Hirten, dar.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die gegenläufigen Prozesse im Universum als Involution angesehen werden. Da die beiden Prozesse der Evolution und der Involution permanent in Gegenrichtung ablaufen, muss ein Mensch, der sich spirituell entwickeln will, bildlich gesprochen gegen den Strom schwimmen. Denn: "Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen." (Hermann Hesse)
Die Punkte des Enneagramms, von Gurdjieff auch „Brechungen“ genannt, werden als Ereignisse bzw. Ergebnisse aufgefasst und die Strecken zwischen jeweils zwei Punkten als Prozesse, die die Ergebnisse erzeugen bzw. durch das Eintreten der Ereignisse abgeschlossen werden. Die Bezeichnungen der Punkte wurden daher entsprechend ergebnis- bzw. ereignisbezogen umformuliert (Beispiel: "Das Zähmen des Ochsen" wurde umformuliert in "Der Ochse ist gezähmt").
Eine Ausnahme bildet der Punkt 0, der für einen Zustand steht, in dem keine Bewegung im Sinne einer spirituellen Entwicklung stattfindet.
Durch die Linien der Triade und der Hexade werden die Bilder bzw. Stationen zueinander in Beziehung gesetzt. In der folgenden Betrachtung werden die Ochsenbilder mittels der Gesetzmässigkeiten und der inneren Logik des Enneagramms interpretiert, wodurch sich interessante und auch erstaunliche Aspekte und Erkenntnisse ergeben.
Punkt 0: Der Schlaf des Hirten
Diese Station gibt es in der Original-Erzählung nicht. Daher fehlt natürlich auch ein entsprechendes Bild. Es muss aber logischerweise eine Situation gegeben haben, bevor sich der Hirte auf die Suche nach dem Ochsen macht.
Der Punkt 0 steht also für den Status, in dem sich der Hirte zu Beginn seines Entwicklungszyklus befindet. Mit dem Schlaf des Hirten ist der von mir so genannte, alltägliche "Wachschlaf" gemeint, ein Zustand, in dem sich die meisten Menschen fast ständig befinden. Das ist auch der Ansatz von Gurdjieff, der zudem der Meinung war, dass Menschen normalerweise keinen stabilen Wesenskern besitzen, sondern aus ständig wechselnden Ichs bestehen. Daraus leitet sich das Ziel ab, dass Menschen aufwachen und wach bleiben müssen, was bedeutet, ein dauerndes „Wach- und Ich-Bewusstsein“ zu entwickeln. Der Titel von Gurdjieffs drittem Buch drückt das recht treffend aus: "Die Welt ist nur dann wirklich, wenn ICH BIN".
Julian Jaynes, 1923 in New Weston/Massachusetts geboren, lehrte ab 1964 Psychologie an der Princeton University. Seine "Urknalltheorie des Bewusstseins" (Kirkus Review) hat weit über den Kreis der Fachleute hinaus heftige Diskussionen ausgelöst. Er starb im Jahr 1997.
Da es die verschiedensten Auffassungen gibt, was denn das Bewusstsein sei, zeigt Jaynes im ersten Kapitel seines Buchs "Der Ursprung des Bewusstseins" (rororo-Taschenbuch, Juni 1993), was Bewusstsein nicht ist und was daraus gefolgert werden kann:
Das Bewusstsein ist kein Abbild unseres Erlebens
Wenn wir uns erinnern, sehen wir uns, als wären wir ein fremder Beobachter. Wir sehen in der Erinnerung nicht, wie und was wir in der jeweiligen Situation gesehen haben.
Das Bewusstsein ist nicht notwendig für die Begriffsbildung
Begriffe sind Abstraktionen (z.B. Baum) von konkreten Objekten (Eiche, Linde, Tanne etc.). Begriffe sind nichts weiter als Klassen von gleichwertigen Dingen. Diese Abstraktionsleistung ist nicht nur dem Menschen zu eigen; auch die "Biene hat einen Begriff von der Blume als solcher, der Adler einen Begriff von einer unzugänglichen Felsnase und die Drossel einen Begriff von einer hochgelegenen Astgabel im Schutz des grünen Laubes" (Jaynes, Der Ursprung des Bewusstseins, Seite 47).
Das Bewusstsein ist nicht notwendig für das Lernen
Aus lernpsychologischer Sicht wird Lernen als ein Prozess der relativ stabilen Veränderung des Verhaltens, Denkens oder Fühlens aufgefasst. Jaynes nennt drei Typen des Lernens: das Erlernen von Signalen, Fertigkeiten und Problemlösungen. Man denke an die Konditionierung des Pawlowschen Hundes, das Üben oder das Nachahmungslernen, um die zunächst provokativ klingende Hypothese akzeptieren zu können. Bei der Suche nach einer Problemlösung spielt das Bewusstsein beim Menschen zwar oft eine wichtige Rolle, ist jedoch wie gewisse Untersuchungen zeigen, keineswegs unter allen Umständen notwendig. Vielfach findet Lernen unbewusst statt, z.B. durch Werbung bzw. Manipulation generell.
Das Bewusstsein ist nicht notwendig für das Denken
Jaynes zeigt, dass der eigentliche Denkprozess, der gemeinhin als das Herz- und Kernstück des Bewusstseins betrachtet wird, überhaupt nicht bewusst ist und dass lediglich seine Initialisierung (er nennt das "Struktionen" als Bestandteil von "InStruktionen" und "KonStruktionen"), sein Material und sein Endergebnis im Bewusstsein wahrgenommen werden.
Das Bewusstsein ist nicht notwendig für die Vernunfttätigkeit
Es ist eine weitverbreitete und althergebrachte Annahme, dass das Bewusstsein der Sitz der Vernunft ist, wobei Jaynes den Begriff "Vernunft" als Fähigkeit zum schlussfolgernden sowie kreativen Denken auffasst. Kreatives Denken durchläuft verschiedene Stadien: in einer Vorbereitungsphase wird das zu lösende Problem zuerst bewusst durchgearbeitet, dann folgt eine Inkubationsphase ohne irgendwelche bewusste Konzentration auf das Problem und darauf die Erleuchtung, die im Nachhinein logisch begründet wird. Die Vorbereitungsphase besteht im Wesentlichen aus dem Aufstellen einer komplexen Struktion (siehe oben) bei gleichzeitiger bewusster Aufmerksamkeit gegenüber dem Material, auf das die Struktion sich beziehen soll. Der dann eintretende Vorgang der Schlussfolgerung als solcher, hat jedoch keine Repräsentation im Bewusstsein. Wie viele Beispiele grosser Entdeckungen zeigen, musste der Denker das Problem vergessen, damit sich die Lösung als „Heureka-Erlebnis“ einstellen konnte.
Der Sitz des Bewusstseins
Auf die Frage, wo unser Bewusstsein seinen Sitz hat, wird üblicherweise der Kopf genannt, wobei man an einen Raum denkt, der hinter den Augen liegt und in den man bei der Selbstbeobachtung "hineinschaut". Das heisst dann auch "Introspektion". Allerdings ist dort kein solcher Raum. Wir erfinden ihn ständig neu in unseren Köpfen und denen anderer Menschen, wohl wissend, dass er in der Anatomie nicht existiert. Auch die Verortung des Bewusstseins im Kopf ist ein kollektiver Konsens aus reiner Gewohnheit heraus. Zu anderen Zeiten (im antiken Griechenland oder im Ägypten der Pharaonen) wurde der Sitz des Bewusstseins im Herzen und knapp darüber angesiedelt. Ausserkörperliche Erlebnisse z.B. bei Operationen oder im LSD-Rausch zeigen, dass das Bewusstsein nicht unbedingt vom Körper abhängig ist. Selbst die moderne, weit fortgeschrittene Gehirnforschung ist nicht in der Lage, etwas über den Sitz des Bewusstseins auszusagen, ja nicht einmal, was es ist oder wie es zustande kommt. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Buchtitel des Nobelpreisträgers und Gehirnforschers Sir John Eccles: "Wie das Selbst (das Bewusstsein, meine Anm.) sein Gehirn steuert". Laut Jaynes hat das Bewusstsein keinen Ort ausser dem, den wir ihm in unserer Vorstellung zuweisen.
Nach diesen Überlegungen stellt sich die Frage, ob das Bewusstsein überhaupt erforderlich ist. Tatsächlich spielt das Bewusstsein bei den meisten menschlichen Aktivitäten keine ausschlaggebende Rolle.
Demnach kann der Hirte ohne Bewusstsein leben und funktionieren, aber eigentlich fehlt ihm etwas - das Bewusstsein seiner selbst. Er hat in diesem Stadium – wie Jaynes es so treffend formuliert - kein Bewusstsein davon, wovon er kein Bewusstsein hat. Er weiss also nicht, was er nicht weiss. Und dennoch: wodurch auch immer - er fängt an zu blinzeln, erlebt kurzes Aufblitzen von Bewusstsein, und beginnt zu ahnen, dass da noch etwas mehr sein muss.
Interessant ist, dass der Hirte scheinbar keine Herde hat und somit auch keinen Ochsen… Da er aber ein Hirte ist (das weiss er), fehlt ihm der Ochse und tief im Inneren von Menschen allgemein kann die Ahnung erwachen, dass da noch etwas mehr sein muss… In diesem Fall ist der erste Schritt vom Punkt 0 weg getan und stellt den Beginn einer möglicherweise langen Reise dar.
Es gibt aber insgesamt drei Varianten, wie sich der Prozess zwischen Punkt 0 und 1 vollziehen und enden kann:
Variante A: dieser Prozess, der dazu führt, sich auf den Pfad der spirituellen Entwicklung zu machen, findet gar nicht statt. Ein Mensch verbringt sein ganzes Leben im Wachschlaf, ohne jemals einen Bewusstseinsimpuls verspürt zu haben. Der Hirte vermisst keinen Ochsen und verbleibt auf Punkt 0, bis er stirbt.
Variante B: ein Mensch verspürt im Laufe seines Lebens einen oder mehrere Bewusstseinsimpulse, aber er ignoriert oder verdrängt sie. Er bricht den beginnenden Prozess 1 ab und fällt auf Punkt 0 zurück, wo er verbleibt. In der Metapher blitzt beim Hirten hin und wieder der Gedanke auf, dass er eigentlich einen Ochsen haben müsste, weil er doch ein Hirte ist, aber dieser Gedanke verblasst, weil er fremde Rinder anderer Besitzer hütet…
Variante C: ein Mensch verspürt früher oder später in seinem Leben einen oder mehrere Bewusstseinsimpulse. Er nimmt sie wahr und ahnt, dass ihm etwas fehlt. Der Hirte kommt zu dem Schluss, dass ein Hirte auch einen Ochsen haben sollte. Er vermisst diesen Ochsen, was ihn zum Punkt 1 führt.
Punkt 1: Die Ochsensuche beginnt
So macht sich der Hirte auf die Suche nach dem Ochsen und der Mensch begibt sich auf den Weg und wird zum Menschen des Weges, wie in alten Lehren Menschen genannt werden, die den Ruf nach spiritueller Entwicklung vernehmen – und ihm folgen.
Punkt 1 markiert also den Beginn der Suche nach dem Ochsen. Der Motor ist seine SehnSUCHt. Nur: Wo soll er suchen? Wen kann er nach dem Ochsen fragen? Der Mensch des Weges begegnet bei seiner Suche den verschiedensten Angeboten in Form von Büchern und/oder mehr oder weniger seriösen Lehrern, Gurus oder Meistern. Er folgt diesem oder jenem Hinweis. Mag jedoch die Suche noch so intensiv sein, die Ochsenspur bzw. die passende, wahre Lehre zu finden, dafür gibt es keine Garantie. Möglicherweise gelangt der Suchende nie an Punkt 2, wird des Suchens müde oder überdrüssig und gibt irgendwann frustriert auf.
Variante A: Der Suchende vergisst oder verdrängt seine Suche und fällt ganz auf Punkt 0 zurück.
Variante B: Der Suchende gibt auf, aber seine Suche und die Frustration über den Misserfolg bleiben ihm Zeit seines Lebens in Erinnerung. Dieser Suchende fällt mit dieser Erinnerung in den Prozess zwischen den Punkten 0 und 1 zurück und verbleibt dort für den Rest seiner Tage mit dem tragischen Gefühl, seine Bestimmung oder die Erfüllung seiner Sehnsucht nicht gefunden zu haben.
Variante C: Der Suchende stösst auf Bücher und/oder begegnet wahren Lehrern, die in ihm eine Resonanz erzeugen und die Hoffnung nähren, auf dem richtigen Weg zu sein. Er antizipiert Punkt 4, an dem sich seine Hoffnung konkretisiert. Der Hirte findet die Ochsenspur und kann nun optimistisch sein, den Ochsen zu fangen. Im Enneagramm ist das - dem Lauf der Hexade folgend - der Blick von Punkt 1 nach Punkt 4.
Punkt 2: Die Ochsenspur ist gefunden
Nachdem er auf die Spur gestossen ist, folgt der Hirte der Ochsenspur durch Feld, Wald und Wiese. Der Mensch des Weges macht sich mit der gefundenen Lehre vertraut. In diesem Stadium handelt es sich vorwiegend um ein Sammeln von Wissen, sei es, dass er in einschlägigen Büchern forscht und/oder den Lehren seines Meisters lauscht. Die Ochsenspur wird deutlicher und frischer, das Wissen vertieft und verdichtet sich mehr und mehr. Die Belohnung eines mehr oder weniger langen Bemühens und Strebens liegt im Erblicken des Ochsen. Der Mensch des Weges ist nicht nur im Besitz von Wissen - er hat jetzt Gewissheit. Mit dem Erreichen des Punktes 3 ist der Zyklus der Wissenssammlung abgeschlossen.
Jedoch gilt auch für diesen Prozess, dass es keine Garantie auf Erfolg gibt. Möglicherweise verfolgt der Hirte den Ochsen auch unentwegt, ohne ihn jemals zu Gesicht zu bekommen. Der Mensch des Weges häuft Wissen um Wissen an oder macht sich abhängig von seinem Meister und verbleibt so in dieser Abhängigkeit, ohne jemals den Durchbruch zu erzielen.
Das Erreichen von Punkt 3, entscheidet darüber, ob der Hirte bzw. der Mensch des Weges im Prozess 3a stecken bleibt oder seine spirituelle Entwicklung im Prozess 3b fortsetzen kann. Das entspricht der Funktion des Punktes 3, der zum Dreieck gehört. Die Dreieckspunkte, von Gurdjieff auch "Schockpunkte" genannt, können u.a. als Portale zu einer höheren Sphäre aufgefasst werden, aus der entscheidende Impulse kommen. So spürt der Meister, dass sein Schüler bereit ist und gibt ihm den letzten erforderlichen "Schubs" über die Schwelle. Welcher Schubs es sein muss, ist individuell vom Schüler abhängig. Ein wahrer Lehrer weiss, welche Art von Impuls sein Schüler benötigt.
Punkt 3: Der Ochse wird erblickt
Den Ochsen sehen und ihn haben ist zweierlei. Es geht nun darum, des Ochsen habhaft zu werden. Der Ochse versucht, dem Hirten zu entkommen. Der Hirte bleibt ihm auf den Fersen. Mal bekommt er den Ochsen am Schwanz zu fassen, mal entwischt er ihm wieder. Er müht sich aber weiter ab, den Ochsen in seine Gewalt zu bekommen, weil er sich von Punkt 3 aus an Punkt 6 - dem Lauf der Triade folgend - in seiner Phantasie bereits auf dem Ochsen sitzen und losreiten sah.
An Punkt 3 hat der Mensch des Weges die Vision, an Punkt 6, der die Schwelle zum transzendierenden Zyklus des Seins bildet, ein konstantes und wie Gurdjieff es nennt "objektives Bewusstsein" erworben zu haben. Interessant ist, dass das lateinische Wort "conscientia" ursprünglich "Gewissen" (etwas gewiss wissen) bedeutete und später als Lehnübersetzung mit „Bewusstsein“ wiedergegeben wurde.
Im Prozess 3b "flackert" die Gewissheit des Menschen des Weges noch zwischen Wissen und einem beginnenden Verstehen. Er muss die an Punkt 3 erworbene Gewissheit erproben und weiter festigen. So, wie im ersten Zyklus das Wissen zunimmt, so wächst im zweiten Zyklus das Verstehen der Bedeutung des erworbenen Wissens, was eine höhere Stufe der spirituellen Entwicklung darstellt. Zum Denkzentrum gesellt sich das Gefühlszentrum; besser gesagt, die beiden Zentren verbinden sich zu dem Fundament, auf dem der dritte Zyklus des Seins ab Punkt 6 aufbauen kann.
Punkt 4: Der Ochse ist gefangen
Der Prozess zwischen den Punkten 4 und 5 wird oft mit einer sogenannten "Nachtmeerfahrt" verglichen, weil es hier keinen Blick, keine Perspektive, keinen Hoffnungsschimmer in Form einer Enneagramm-Linie gibt. Bildhaft gesprochen muss der Mensch des Weges den Tiefpunkt des Kreises durchschreiten, muss durch das "finstere Tal wandern" wie es im Psalm 23 heisst. Nur fester Glaube an seine Mission und ein eiserner Wille verleihen dem Menschen des Weges die Disziplin und die Kraft, durchzuhalten, bis er den Punkt 5 erreicht hat. Erst dann lässt ihn die Linie vom Punkt 5 zum Punkt 7 erneut die mögliche weitere Entwicklung ahnen.
Konkret sind auf vielen spirituellen Wegen Meditationsübungen zu absolvieren. Abgesehen von Herausforderungen wie schmerzende Beine oder dem Kampf gegen die Müdigkeit beim Zazen (Sitzmeditation im Zen-Buddhismus), ist es ein Ringen darum, bewusst im Hier und Jetzt zu bleiben.
Der Hirte hat den Ochsen zwar gefangen, aber er muss mit ihm ringen, um ihm das Zaumzeug anzulegen, damit er aufsteigen kann und in der Lage ist, den Ochsen zu reiten. Rein vom Wort her sind Zaum und Zähmen miteinander verwandt (sich im Zaum halten, seine Begierde bezähmen).
Punkt 5: Der Ochse ist gezähmt