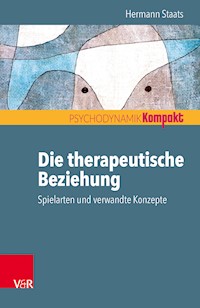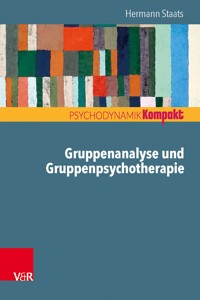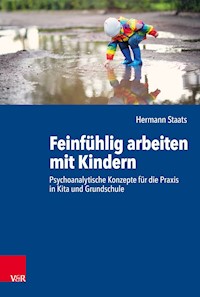Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Entwicklungspsychologische Theorien sind Grundlage psychoanalytischen Denkens. Wir benutzen sie, um unser Erleben und Verhalten besser zu verstehen - in Psychotherapien, pädagogischen Beziehungen und in der sozialen Arbeit. Theorien und Modelle der Psychoanalyse werden in diesem Buch mit Ergebnissen der empirischen Entwicklungspsychologie verbunden und offene Fragen herausgearbeitet. Der Autor beschreibt hier im zweiten Band Entwicklungsprozesse von der Schulzeit bis ins hohe Alter. Er zeigt, wie psychoanalytische Konzepte zu unterschiedlichen und sich oft ergänzenden Antworten kommen - etwa bei der Nutzung digitaler Medien, einem lang andauernden Übergang zum Erwachsenenalter, den Herausforderungen des Lebens mit Kindern und in der therapeutischen und pädagogischen Arbeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Hermann Staats, Prof. Dr. med., ist Arzt für Psychotherapeutische Medizin, Psychoanalytiker, Gruppenanalytiker und Paar- und Familientherapeut. Er arbeitet als Sigmund-Freud-Professor für psychoanalytisch orientierte Entwicklungspsychologie an der FH Potsdam und in eigener Praxis, ist Vorsitzender der Forschungskommission der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft, Mitglied der Forschungskommission der Deutschen Gesellschaft für Gruppenanalyse und Gruppenpsychotherapie D3G und Lehranalytiker und Supervisor der DPG, DGPT, IPA und D3G.
Hermann Staats war Oberarzt an der Universität Göttingen, Leiter der Ärztlich-Psychologischen Beratungsstelle dort und später Leiter des Familienzentrums an der FH Potsdam. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik und Mitglied zahlreicher Fachgesellschaften. Buchveröffentlichungen zu Übertragungen in Paaren und Gruppen (Das Zentrale Thema der Stunde, 2001), zum feinfühligen Arbeiten mit Kindern (2014, 2. Aufl. 2021), zu Gruppenpsychotherapie und Gruppenanalyse (mit Th. Bolm und A. Dally, 2014) zur therapeutischen Beziehung (2017), zur Psychoanalyse der Angststörungen (mit C. Benecke 2017) und zur Supervision in Gruppen (mit Christiane Bakhit, 2021).
Hermann Staats
Entwicklungspsychologische Grundlagen der Psychoanalyse
Band 2: Jugend, Erwachsenwerden und Altern
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten verändern sich ständig. Verlag und Autoren tragen dafür Sorge, dass alle gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Eine Haftung hierfür kann jedoch nicht übernommen werden. Es empfiehlt sich, die Angaben anhand des Beipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2021
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-036853-8
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-036854-5
epub: ISBN 978-3-17-036855-2
mobi: ISBN 978-3-17-036856-9
Geleitwort zur Reihe
Die Psychoanalyse hat auch im 21. Jahrhundert nichts von ihrer Bedeutung und Faszination verloren. Sie hat sich im Laufe ihres nun mehr als einhundertjährigen Bestehens zu einer vielfältigen und durchaus auch heterogenen Wissenschaft entwickelt, mit einem reichhaltigen theoretischen Fundus sowie einer breiten Ausrichtung ihrer Anwendungen.
In dieser Buchreihe werden die grundlegenden Konzepte, Methoden und Anwendungen der modernen Psychoanalyse allgemeinverständlich dargestellt. Worin besteht die genuin psychoanalytische Sichtweise auf Forschungsgegenstände wie z. B. unbewusste Prozesse, Wahrnehmen, Denken, Affekt, Trieb/Motiv/Instinkt, Kindheit, Entwicklung, Persönlichkeit, Konflikt, Trauma, Behandlung, Interaktion, Gruppe, Kultur, Gesellschaft u. a. m.? Anders als bei psychologischen Theorien und deren Überprüfung mittels empirischer Methoden ist der Ausgangspunkt der psychoanalytischen Theoriebildung und Konzeptforschung in der Regel zunächst die analytische Situation, in der dichte Erkenntnisse gewonnen werden. In weiteren Schritten können diese methodisch trianguliert werden: durch Konzeptforschung, Grundlagenforschung, experimentelle Überprüfung, Heranziehung von Befunden aus den Nachbarwissenschaften sowie Psychotherapieforschung.
Seit ihren Anfängen hat sich die Psychoanalyse nicht nur als eine psychologische Betrachtungsweise verstanden, sondern auch kulturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche sowie geisteswissenschaftliche Perspektiven hinzugezogen. Bereits Freud machte ja nicht nur Anleihen bei den Metaphern der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts, sondern entwickelte die Psychoanalyse im engen Austausch mit geistes- und kulturwissenschaftlichen Erkenntnissen. In den letzten Jahren sind vor allem neurowissenschaftliche und kognitionspsychologische Konzepte und Befunde hinzugekommen. Dennoch war und ist die klinische Situation mit ihren spezifischen Methoden der Ursprung psychoanalytischer Erkenntnisse. Der Blick auf die Nachbarwissenschaften kann je nach Fragestellung und Untersuchungsgegenstand bereichernd sein, ohne dabei allerdings das psychoanalytische Anliegen, mit spezifischer Methodik Aufschlüsse über unbewusste Prozesse zu gewinnen, aus den Augen zu verlieren.
Auch wenn psychoanalytische Erkenntnisse zunächst einmal in der genuin psychoanalytischen Diskursebene verbleiben, bilden implizite Konstrukte aus einschlägigen Nachbarwissenschaften einen stillschweigenden Hintergrund wie z. B. die derzeitige Unterscheidung von zwei grundlegenden Gedächtnissystemen. Eine Betrachtung über die unterschiedlichen Perspektiven kann den spezifisch psychoanalytischen Zugang jedoch noch einmal verdeutlichen.
Der interdisziplinäre Austausch wird auf verschiedene Weise erfolgen: Zum einen bei der Fragestellung, inwieweit z. B. Klinische Psychologie, Entwicklungspsychologie, Entwicklungs-psychopathologie, Neurobiologie, Medizinische Anthropologie zur teilweisen Klärung von psychoanalytischen Kontroversen beitragen können, zum anderen inwieweit die psychoanalytische Perspektive bei der Beschäftigung mit den obigen Fächern, aber auch z. B. bei politischen, sozial-, kultur-, sprach-, literatur- und kunstwissenschaftlichen Themen eine wesentliche Bereicherung bringen kann.
In der Psychoanalyse fehlen derzeit gut verständliche Einführungen in die verschiedenen Themenbereiche, die den gegenwärtigen Kenntnisstand nicht nur klassisch freudianisch oder auf eine bestimmte Richtung bezogen, sondern nach Möglichkeit auch richtungsübergreifend und Gemeinsamkeiten aufzeigend darstellen. Deshalb wird in dieser Reihe auch auf einen allgemein verständlichen Stil besonderer Wert gelegt.
Wir haben die Hoffnung, dass die einzelnen Bände für den psychotherapeutischen Praktiker in gleichem Maße gewinnbringend sein können wie auch für sozial- und kulturwissenschaftlich interessierte Leser, die sich einen Überblick über Konzepte, Methoden und Anwendungen der modernen Psychoanalyse verschaffen wollen.
Die Herausgeberinnen und Herausgeber
Cord Benecke, Lilli Gast,
Marianne Leuzinger-Bohleber und Wolfgang Mertens
Inhalt
Geleitwort zur Reihe
Vorwort
1 Einleitung: Aufbau und Zielsetzung
2 Schule und Latenzzeit
2.1 »Ich bin, was ich kann« – Latenzzeit, Lernen und das Selbstbild
2.2 Latenz im Hinblick auf die psychosexuelle Entwicklung
2.3 Objektbeziehungen der Latenzzeit
2.4 Latenz im Hinblick auf die kognitive Entwicklung
2.5 Geschwisterbeziehungen
3 Fremd werden: Präadoleszenz
3.1 Präadoleszenz und Einsamkeit
3.2 Über-Ich-Entwicklung
4 Selbständig werden: Adoleszenz
4.1 Adoleszenz als Neubeginn
4.2 Gesellschaftliche Bedeutung der Adoleszenz
4.3 Liebespartner – Sexualität als Motor von Entwicklungen
4.4 Gruppenzugehörigkeiten: Familie, Freunde, Peers
4.5 Identität und Gruppenzugehörigkeiten
5 Digitale Welten
5.1 Virtuelle und analoge Beziehungen
5.2 Digitale Spiele
5.3 Identitätsentwicklung in digitalen Welten
5.4 Medienkompetenz
6 Das »auftauchende Erwachsenenalter« (Emerging Adulthood [EA]) und der Übergang zum Erwachsenenalter
6.1 Anpassung von Entwicklungsaufgaben an veränderte soziale Realitäten
6.2 Ablösung von der Herkunftsfamilie
6.3 Etablierung von Partnerschaft, Elternschaft und Beruf
6.4 Emerging Adulthood (EA) als eigene Entwicklungsphase
6.5 Identitätsexploration als Kernaufgabe des »Emerging Adulthood«
7 Generativität: Erwachsenwerden
7.1 Sich selbst finden: Entwicklungspsychologische Aspekte des Erwachsenenalters
7.2 Phasen des Erwachsenenalters
7.3 Partnerschaft: Interdependenz in Beziehungen und in der Familie
7.4 Vater sein und Mutter sein
7.5 Ein-Eltern-, Pflege-, Patchwork-, Regenbogen- und Inseminationsfamilien
7.6 Selbstentwicklung und Identität im Erwachsenenalter
8 Aktives Alter und hohes Lebensalter, Sterben und Tod
8.1 Die Beziehung zum Körper
8.2 Großelternschaft, Kinder und Enkel
8.3 Umgehen mit Verlusten
8.4 Sterben
Literatur
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Entwicklungspsychologische Konzepte spielen in der Psychoanalyse eine große Rolle – wir benutzen sie, um uns zu erklären, wie und warum jemand so geworden ist, wie er ist, und aus welchen Gründen sich eine bestimmte Symptomatik entwickelt hat. Dabei vermuten wir kausale Zusammenhänge. Die vielfältigen Theorien innerhalb der Psychoanalyse sind Werkzeuge, um Hypothesen zu generieren, die dann in der Beziehung zum Patienten geprüft und in gemeinsamer Arbeit modifiziert werden. Neben einem allgemeinen »Schatz« an entwicklungspsychologischen Konzepten gibt es schul- und störungsspezifische Modelle, die weitere Perspektiven einbringen.
Entwicklungen und Theorien sind in den folgenden Kapiteln so dargestellt, dass Unterschiede der Konzepte und Modelle als Beiträge innerhalb eines Diskurses verstanden werden. Im Fokus steht das Interesse an Beziehungen und ihrer Entwicklung – Beziehungen zu anderen Menschen, zu sich selbst, zu Gruppen, Kulturen und materiellen Dingen. Die wechselseitige Beeinflussung interpersonellen Verhaltens und intrapsychischen Erlebens wird herausgearbeitet, die Entwicklung psychischer Strukturen aus Beziehungserfahrungen vor dem Hintergrund biologischer und sozialer Faktoren in ihren bewussten und unbewussten Dimensionen beschrieben. Das Lernen von Beziehungen in Beziehungen und ihre weitere Entwicklung ist ein weitgehend nicht bewusster und erst nachträglich reflektierter Prozess.
Zu diesem Buch tragen Erfahrungen aus der klinischen Arbeit mit erwachsenen Menschen, mit Kindern und Jugendlichen, mit Gruppen und Familien bei; die Lehre an Hochschulen und an Ausbildungsinstituten sowie Forschung zu den Verknüpfungen interpersoneller und intrapsychischer Aspekte des Verhaltens und Erlebens stehen damit in einem engen Zusammenhang. Viele Menschen haben mit ihren Fragen und Überlegungen zu diesem Buch beigetragen. Danken möchte ich meinen Studierenden, vor allem Alina Schönwetter, die für dieses Buch Literatur gesucht und Fragen formuliert haben, Astrid Kunze, die auf Unklarheiten hingewiesen und zu einer klareren Darstellung beigetragen hat, meinen Lehrern und Kollegen und den Patienten und Familien, denen Sie in der einen oder andern Form in diesem Buch begegnen. Svenja Taubner hat vielfältige Überlegungen, Vorschläge und Materialien eingebracht, besonders in die Kapitel zur Adoleszenz und dem jungen Erwachsenenalter; Anja Boencke und Antje von Boetticher haben den Beitrag zu den digitalen Medien kommentiert, Tanja Hoffmann hat zum Kapitel »Altern, Sterben und Tod« beigetragen. Von den vielen offenen, nach Verstehen und Klarheit suchenden Gesprächen hoffe ich mit diesem Buch etwas weiterzugeben.
Wechselwirkungen zwischen Sprache und individuellen und gesellschaftlichen Denkmustern sind in einem entwicklungspsychologischen Buch ein implizites Thema. Die männliche und die weibliche Form werden im Text zusammen verwendet, wenn es für die Lesbarkeit hilfreich ist, beide Formen schließen in der Regel alle Geschlechter ein. Leserinnen und Leser können aus dem Zusammenhang leicht erschließen, wann spezifisch eines der Geschlechter gemeint ist.
Potsdam und Göttingen, Frühjahr 2021
Hermann Staats
1 Einleitung: Aufbau und Zielsetzung
»Was ist und zu welchem Zweck betreiben wir Entwicklungspsychologie?« Oerter und Montada (2008, S. 3) verweisen darauf, dass in der »etwa hundertjährigen Geschichte der empirischen Entwicklungspsychologie« auf diese Frage unterschiedliche Antworten gegeben wurden. »Verschiedene Forschungstraditionen gingen von unterschiedlichen Fragestellungen und Menschenbildern aus und bildeten unterschiedliche Konzepte und Theorien der Entwicklung«. Siegler et al. (2005, S. XI) beginnen ihr Lehrbuch mit dem Satz: »Es ist eine aufregende Zeit, um ein Lehrbuch über Kindesentwicklung zu schreiben«. Schneider und Lindenberger (2018) argumentieren ähnlich.
Für psychoanalytische Entwicklungstheorien gilt dies in einem vielleicht noch stärkeren Ausmaß als in der akademischen Entwicklungspsychologie. Tyson und Tyson (1990, dt. 2009) haben ihr klassisches »Lehrbuch der psychoanalytischen Entwicklungspsychologie« für Studierende geschrieben, die immer wieder durch die »Vielzahl widersprüchlicher und sich ausschließender Theorien« in Verwirrung geraten seien. Sie zielten auf eine »Synthese psychoanalytischer Entwicklungstheorien« (S. 15). Der Fokus liegt hier auf der frühen Entwicklung des Kindes. Zur Schulzeit, Adoleszenz und dem Erwachsenenalter finden sich nur vergleichsweise kurze Abschnitte. Heute gibt es nicht mehr eine einheitliche psychoanalytische Entwicklungspsychologie. Widersprüche und Konflikte tragen zur Faszination des Feldes bei. Dies gilt in besonderem Ausmaß für Theorien späterer Entwicklungen. Psychologische, neurobiologische und sozialwissenschaftliche Untersuchungen haben zu einer Explosion unseres Wissens geführt. Zur Bedeutung dieser Wissensexplosion haben sich psychoanalytische Autorinnen und Autoren sehr unterschiedlich positioniert:
• Die Ergebnisse empirischer Studien zur Entwicklung von Menschen und neue Konzepte der Entwicklungspsychologie werden als wenig wichtig für psychoanalytische Theorien angesehen und ignoriert.
• Einzelne entwicklungspsychologische Konzepte (wie etwa »Bindung« oder »Mentalisieren«) werden Grundlage neuer klinischer Modelle und Behandlungsstrategien. Mit ihnen gelingt es, die Komplexität menschlicher Entwicklung – wieder – auf ein vergleichsweise einfach überschaubares und für die klinische Praxis als Leitschnur nutzbares Modell zu reduzieren. So kann der Anschluss der Psychoanalyse an empirisch arbeitende Wissenschaften leichter gehalten und weiterentwickelt werden.
• Viele primär klinische Beiträge nutzen ausgewählte entwicklungspsychologische Befunde, um das eigene therapeutische Vorgehen zu begründen.
Ziel dieses Buches ist es, die wichtigsten Entwicklungsmodelle innerhalb der Psychoanalyse darzustellen. Wo dies möglich ist, werden die unterschiedlichen Beiträge und Sichtweisen dieser Modelle aufeinander bezogen. Gegensätzliche Auffassungen sind herausgearbeitet, auch ohne dass eine Synthese gelingt. Aktuelle psychoanalytische Fragen und Ergebnisse der empirischen Entwicklungspsychologie werden miteinander verbunden. Historisch wichtige Konzepte sind – in einem besonderen Format erkennbar – kurz dargestellt. Folgerungen für die therapeutische oder pädagogische Praxis werden ebenfalls hervorgehoben präsentiert (»Folgerungen für die Praxis«). Am Ende jedes Kapitels sollen offene Fragen ein Weiterdenken zu den Inhalten fördern.
In diesem zweiten Band der »Psychoanalytischen Entwicklungspsychologie« werden Entwicklungsprozesse der Schulzeit, der Adoleszenz, des »auftauchenden Erwachsenenalters«, des Erwachsenseins und der Elternschaft bis in das hohe Alter dargestellt. Band 1, »Schwangerschaft, Geburt und Kindheit«, umfasst die Zeit von der Schwangerschaft bis zum Übergang in die Schule. Der zweite Band ist für sich lesbar. Er verweist an vielen Stellen auf die im Lebensverlauf wichtig bleibenden Konzepte kindlicher Entwicklungen, wie sie im ersten Band dargestellt sind. Ein Kapitel zur Bedeutung digitaler Welten und Abschnitte zu Veränderungen familiärer Modelle, zu Sexualität und Aggression ergänzen den chronologischen Aufbau. Schulzeit, Erwachsenwerden und Altern sind in hohem Ausmaß von sozialen Faktoren abhängig. Entwicklungswege verzweigen sich daher vielfältig – und damit auch Modelle psychischer Entwicklungen. Die Auswahl der zu diesen Lebensphasen aufzugreifenden Themen und Theorien ist eine Herausforderung. Verweise auf weiterführende Literatur ergänzen daher die Darstellungen. Die Aufteilung der Kapitel folgt Entwicklungsphasen, die durch das Lösen bestimmter Aufgaben gekennzeichnet sind. Das Erleben in Beziehungen steht im Mittelpunkt. Wenn Ergebnisse aus anderen Wissenschaften psychoanalytische Theorien ergänzen, in Frage stellen oder bestätigen, wird versucht, Ungewissheiten zu erhalten und zwischen Hypothesen und empirischen Belegen zu unterscheiden.
Entwicklungsstörungen werden in diesem Buch nur beispielhaft betrachtet. Die relativ neue Disziplin der Entwicklungspsychopathologie stellt eine Verbindung aus Klinischer Psychologie und Entwicklungspsychologie dar. Der Komplexität dieser interdisziplinären Forschungsrichtung gerecht zu werden, würde das Ausmaß dieses Buches sprengen. Entwicklungspsychologie, Sozialisationsforschung, Neurobiologie, Genetik und Entwicklungspsychopathologie wachsen teilweise zu einer neuen Disziplin zusammen, die als »Entwicklungswissenschaft« bezeichnet wird. Es liegt in der Tradition des neugierigen Denkens Freuds, Ergebnisse aus Nachbarwissenschaften aufzugreifen und für ein Verstehen subjektiver seelischer Prozesse zu nutzen. Die Konzepte, auf die sich Therapeutinnen und Therapeuten dabei beziehen, haben Auswirkungen auf ihre jeweilige Behandlungspraxis. Die Vielfalt psychoanalytischer Theorien wird in diesem Buch als eine Bereicherung angesehen – und zugleich mit dem Wissen um die Beschränkung eines einzelnen Ansatzes (und mit Kenntnissen zu seiner Entstehung) verbunden.
Literatur zur vertiefenden Lektüre
Poscheschnik, G. & Traxl, B. (Hrsg.) (2016). Handbuch Psychoanalytische Entwicklungswissenschaft. Gießen: Psychosozial Verlag.
Schneider, W. & Lindenberger, U. (Hrsg.) (2018). Entwicklungspsychologie. Weinheim: Beltz.
Siegler et al. (2016). Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Heidelberg: Springer.
2 Schule und Latenzzeit
»Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein.Stock und Hut, stehen ihm gut, ist gar wohlgemut.Doch die Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr!Da besinnt sich das Kind, kehrt nach Haus geschwind«(Volkslied, Franz Wiedemann, 1821–1882)
Einführung
Die Zeit der ersten 4 bis 6 Schuljahre – in Deutschland das 6. bis 10. oder 12. Lebensjahr – wird aus psychoanalytischer Perspektive unter den Begriff der »Latenzzeit« gefasst – einer Entwicklungsphase zwischen dem 6. bis 10., bei deutlichen interindividuellen Unterschieden auch bis zum 12. Lebensjahr. Freud (1905) nutzt den Begriff der Latenz im Sinne einer spezifisch menschlichen »Verzögerung« der Entwicklung hin zur Geschlechtsreife. Er verband ihn mit der Sublimierung von Triebenergie und der Entwicklung von Kultur. Erikson (1973) formulierte vor diesem Hintergrund psychosoziale Entwicklungsaufgaben für das Spielalter und das Schulalter: »Ich bin, was ich mir zu werden vorstellen kann« und »Ich bin, was ich lerne«.
Nach dem Finden eines eigenen Platzes in der Familie und dem Bewältigen der damit verbundenen Konflikte ist die Selbstentwicklung eines Kindes durch das Lernen von neuen Fähigkeiten geprägt. Schule wird ein wichtiger Ort. Mit den neu erworbenen Fähigkeiten werden Kinder selbständiger. Sie erschließen sich neue, eigene Räume, die oft noch selbstverständlich mit der Familie geteilt werden. Diese ruhigere Zeit der »Latenz« bietet idealerweise einen sicheren Rahmen in Familie und Schule. Unter stabilen Bedingungen kann sozial und kognitiv gelernt werden. Spiele sind vom Lernen und Vertiefen neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten geprägt, das Meistern von Herausforderungen ist oft mit einem Erleben von Triumph und Lust verbunden.
Neugierig wird die Welt der unbelebten Objekte erkundet. Theorien zu Zusammenhängen und Funktionen der äußeren Welt entwickeln sich. Damit werden vermehrt Lehrerinnen, Lehrer und andere Menschen außerhalb des engeren Familienkreises emotional wichtig. Oft ist das Zusammengehörigkeitsgefühl in Familien in dieser Zeit hoch. Eltern bleiben in der Regel der zentrale Bezugspunkt ihrer Kinder. Auch wenn die Regulation von Affekten und Beziehungen schon weitgehend gelingt und Einschränkungen der elterlichen Kompetenzen realistisch erkannt werden, besteht weiterhin eine Idealisierung der Eltern und eine hohe Identifizierung mit den Eltern und Geschwistern.
Die Latenzzeit wird durch die Präadoleszenz begrenzt. Mit diesem Übergang erleben Kinder zunehmend Distanz zu ihren Eltern. Körperliche Veränderungen leiten diesen Schritt ein. Die Pubertät und einige damit einhergehende soziale Rollenübernahmen treten in den westlichen Kulturen zeitlich immer früher auf. Entwicklungsprozesse von Kindern werden auch durch den steigenden Konsum und den Einfluss der digitalen Medien beschleunigt. Die dort vermittelten Rollenbilder beeinflussen die kindliche Entwicklung ebenso wie Rollenbilder des »realen Lebens«. Im Zusammenhang mit dieser Beschleunigung von Entwicklungsprozessen wird diskutiert, ob es zu einer Verkürzung oder dem »Verschwinden« der Latenzzeit kommt (Guignard, 2011).
Lernziele
• Kenntnis über die Ich- und Über-Ich-Weiterentwicklung in der Latenzzeit.
• Selbstregulation durch neue Befriedigungsformen und Anpassungsmöglichkeiten kennen – Sublimierung – und
• auf die Entwicklung von Störungsbildern (Hyperaktivität) beziehen können.
• Aufmerksamkeit für horizontale (Geschwister-)Beziehungen fördern.
2.1 »Ich bin, was ich kann« – Latenzzeit, Lernen und das Selbstbild
Die Zeit der Grundschule, die »Latenzzeit«, kann als prägend für das Bild von »Kindheit« gesehen werden, das wir in unserer westlichen Kultur haben. Kinder lernen und werden mit dem Erwerben neuer Kompetenzen zunehmend selbständiger. Die Sprache und das symbolische Denken entwickeln sich, die Motorik wird differenziert und geübt. Radfahren, Schwimmen, Klettern, Lesen, Schreiben und Rechnen werden erlernt. Neue Aufgaben werden mit zunehmend höherer Autonomie übernommen. Diese zunehmende Selbständigkeit entfaltet sich vor dem Hintergrund und im Schutz der Familie. Sorge der Eltern wird oft schon als einengend erlebt. Kinder denken – wie »Hänschen klein« das tut – bereits an das Hinausgehen in die Welt und erleben sich als dazu fähig. Die scheinbare Rücksichtnahme auf die Eltern (»Doch die Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr! Da besinnt sich das Kind, kehrt nach Haus geschwind.«) ist auch ein Schutz vor der Kränkung, noch auf die elterliche Sorge angewiesen zu sein. Eltern kreditieren hier Kompetenzen – sie schreiben ihren Kindern wachsende Fähigkeiten zu und fördern damit eine Verselbständigung. Aus Sicht des Selbsterlebens von Kindern kann die Latenzzeit beschrieben werden mit einem – »Ich bin, was ich kann«. Ich kann jetzt schwimmen, lesen Rad fahren, in die Schule gehen – die Veränderungen sind mit Übergängen in neue Gruppen verbunden und verändern so das Selbsterleben (»Schwimmer« sein und »Schulkind«). Konflikte ranken sich um das lustvolle Erleben der eigenen Kompetenz und das »Noch-nicht-Können« mit Gefühlen von Versagen und Minderwertigkeit. Als Lösung entwickelt sich idealtypisch ein Vertrauen des Kindes auf seine grundlegenden sozialen und intellektuellen Fähigkeiten. Dieses Vertrauen in sich schlägt sich als verinnerlichte Struktur in den Erwartungen an Beziehungen zu anderen Menschen nieder – das Kind trägt etwas zum gemeinsamen Leben bei. Es traut sich zu, mehr und mehr zu lernen und zu sein. In Verbindung damit wird die Phantasiewelt deutlicher von der realen Welt getrennt. Egozentrische Sichtweisen nehmen ab, unterschiedliche Perspektiven werden selbstverständlicher berücksichtigt. Kinder können jetzt über sich selbst nachdenken und sich in andere Menschen einfühlen. Dennoch bleiben diese Entwicklungen instabil. Magisches Denken und egozentrische Sichtweisen haben weiterhin Bestand, die Desillusionierung der Eltern bleibt noch reversibel – in Krisensituationen wird auf Idealisierungen regressiv zurückgegriffen. Soziale und intrapsychische Konflikte können immer wieder schnell zu regressiven Zuständen führen.
Beispiel:Ein 10-jähriger Junge ist tief unglücklich über einen verwandelten Elfmeter gegen seine Lieblingsmannschaft. Er bedrängt tränenüberströmt seine Mutter: »Das war ungerecht! Ruf da an!«
Das eigene subjektive Erleben und die Positionierung in Beziehungen wechseln rasch. Zur Regulation von Affekten und Größenvorstellungen werden die Eltern daher noch selbstverständlich in Anspruch genommen. Regeln und Normen der Familie und auch anderer Gruppen sind wenig hinterfragt. Konflikte zwischen Über-Ich und Ich spielen noch eine geringe Rolle. Treten sie auf, werden sie manchmal mit einem als »altklug« beschriebenen Verhalten moderiert – Kinder beobachten das »merkwürdige« Verhalten Erwachsener in dieser Zeit auch mit einem Gefühl unreflektierter Überlegenheit, die noch nicht von der Erfahrung einer Beschränktheit der eigenen Möglichkeiten moderiert ist. In solchen Interaktionen nimmt die Autonomie von Ich und Über-Ich zu. Es entwickelt sich ein individuelles Identitätsgefühl, mit dem die verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten und Identitätsaspekte zusammengehalten werden.
2.2 Latenz im Hinblick auf die psychosexuelle Entwicklung
Mit dem Konzept der »sexuellen Latenzperiode« wird ein Nachlassen der in den ödipalen Konflikten deutlich erkennbaren (manifesten) Sexualisierung der kindlichen Beziehungen beschrieben. Stattdessen treten jetzt Reaktionsbildungen in Form von Scham- und Ekelgefühlen auf. Kognitive, ästhetische und moralische Idealanforderungen werden bestimmend. Die Vorstellung einer Sublimierung triebhaften Erlebens ist mit der Entwicklung von kulturellem Lernen verbunden. Biologische Prozesse, familiäre Strukturen und kulturelle Einflüsse wirken sich auf diese Entwicklungen aus.
Kinder durchlaufen in dieser Zeit eine Vielzahl von Veränderungen. Freud beschreibt dies folgendermaßen (1905, S. 78):
»Während dieser Periode totaler oder bloß partieller Latenz werden die seelischen Mächte aufgebaut, die später dem Sexualtrieb als Hemmnisse in den Weg treten und gleichwie Dämme seine Richtung beengen werden (der Ekel, das Schamgefühl, die ästhetischen und moralischen Idealanforderungen). Man gewinnt beim Kulturkind den Eindruck, dass der Aufbau dieser Dämme ein Werk der Erziehung ist, und sicherlich tut die Erziehung viel dazu. In Wirklichkeit ist diese Entwicklung eine organisch bedingte, hereditär fixierte und kann sich gelegentlich ganz ohne Mithilfe der Erziehung herstellen«.
Lustquellen werden in der Auffassung Freuds hier zu Anlässen für Unlustempfindungen. Kulturelle Idealbildungen und Vorschriften überlagern lediglich einen eigenständig ablaufenden Vorgang. In dieser Auffassung steht nicht nur die Kultur der »natürlichen« Suche nach Befriedigung entgegen. Der Konflikt ist bereits innerhalb der biologisch verstandenen Entwicklung angelegt. Diese Auffassung wird kontrovers diskutiert (z. B. Mertens, 1996). In anderen Kulturen finden sich häufig sexualisierte Spiele zwischen 6- bis 10-jährigen Kindern. Die Latenzzeit kann so doch als Ausdruck eines kulturellen »Zwangs« beschrieben werden, der für das Lernen komplexer Zusammenhänge genutzt wird. Mit der vorübergehenden Aufgabe oder Verdrängung ödipaler Wünsche geht eine Entwicklung von Ich und Über-Ich einher, die im Sinne einer kulturellen Anpassung gewünscht ist. Die Fähigkeit zur Selbstregulation steigt, indem neue Befriedigungsformen und Anpassungsmöglichkeiten etabliert werden: Das lustvolle Erfahren der eigenen wachsenden Kompetenz stärkt das Selbstwertgefühl. Lernen, körperliche Aktivitäten und Phantasien dienen dann der Regulation innerer Spannungen. Kinder entwickeln sich in dieser Zeit bereits sehr unterschiedlich. Statt eines gleichförmigen Entwicklungsverlaufs können daher besser Entwicklungspfade für die verschiedenen Bereiche beschrieben werden.
Auch wenn Kinder ihre ödipal-inzestuösen Wünsche und Konflikte aufgegeben oder unterdrückt haben, sind die meisten Beziehungen zu den Eltern in dieser Zeit eng. Eltern erleben diese Entwicklungsphase oft als besonders glücklich. Der Zusammenhalt in der Familie, die »Kohäsion« ist hoch, das vielfach gemeinsame Lernen und Entdecken von Interessen fasziniert und befriedigt. Störungen in dieser Zeit führen besonders bei Jungen zu therapeutischen Kontakten, meist anlässlich von Lern- und Aufmerksamkeitsstörungen. Das Ruhen sexueller (und aggressiver) Bestrebungen wird von einigen Autoren auch als Ergebnis repressiver gesellschaftlicher und familiärer Strukturen beschrieben. Ein für das Lernen kultureller Inhalte notwendiges längeres Zusammenleben in der Familie erfordert eine vorübergehende Unterdrückung sexueller Wünsche und Impulse: die Sprengkraft von Sexualität muss hier eingeschränkt werden.
Tömmel (2014) beschreibt die Geschichte psychoanalytischer Konzepte der Latenzzeit. Mit der Sublimierung von Triebkräften (Freud, 1905) komme es zur Entwicklung von Kultur. Erfahrungen des Kindes mit seinem bereits vor im bestehenden und selbstverständlich angenommenen Umfeld – der Kultur – führen zu Identifizierungsprozessen. Sie werden im Spiel erprobt und eingeübt, das »weder eine Sache der inneren psychischen Realität, noch eine Sache der äußeren Realität« (Winnicott 1984, S. 112) sei. Diese kulturellen Erfahrungen führen auch zu einer Veränderung des Über-Ich (Kap. 3.2). Das relative Ruhen von Liebes- und sexuellen Impulsen trage auch dazu bei, nicht ausschließliche Beziehungen zu leben – und damit Gruppenzugehörigkeiten zu erproben und zu lernen. Ein Versagen dieser Sublimierungsvorgänge in der Latenzzeit ist mit Störungen des Lernverhaltens verbunden. Die Diagnose einer Aufmerksamkeitsstörung kann zu einer pharmakologischen Intervention führen, deren Auswirkungen als eine »Wiederherstellung« der Latenz beschrieben werden (Hopf, 2014; Tömmel, 2014).
Folgerungen für die Praxis: Hyperkinetisches Verhalten und ADHS
In Ergänzung eines biologischen Verstehens von hyperkinetischem Verhalten, ADS und ADHS betonen psychoanalytische Autoren soziale und psychologische Faktoren bei der Entstehung und Bewältigung dieses Syndroms. Neraal (2019) beschreibt die häufigen familiären Belastungen in Familien mit einem Kind mit ADHS – etwa heftige familiäre Konflikte, Suchterkrankungen oder das Fehlen eines Elternteils. Betroffene Kinder können als Indexpatienten eines überforderten Familiensystems gesehen werden. Ihr subjektives Erleben ist damit verbunden, sich »kein Gehör« verschaffen zu können und damit auf die Aufmerksamkeit der Umgebung zu »pochen«. Emotionale Inhalte werden gegenüber dem Lernen »priorisiert« und über eine motorische Abfuhr reguliert, so dass die Konzentration auf Lerninhalte nicht gelingt.
Mit ihrem störenden motorischen Verhalten bekommen diese Kinder dann zwar Beachtung. Die Aufmerksamkeit ist aber in der Regel von Verständnislosigkeit gegenüber ihren primären Wünschen und von Hilflosigkeit geprägt. Manchmal bekommt die Symptomatik des Kindes sekundär eine die Familie stabilisierende Funktion. Wichtige Bezugspersonen in Familie, Kita und Schule reagieren dann vorwiegend mit Eingrenzung, Bestrafung und Isolierung des Kindes – eine Affektregulation kann so nicht gelernt werden. Hyperaktivität ist so Ausdruck der Affektmotorik – z. B. bei Bedrohung des Selbstwertgefühls, Impulsivität Folge von Schwierigkeiten der Mentalisierung von Affekten. ADHS kann dann als eine Störung der interpersonellen Beziehungen betrachtet werden.
Aus sozialer Sicht müssen zu diesem Bild Veränderungen des Lebensstils von Kindern in den letzten 50 Jahren ergänzt werden. Körperliche Aktivitäten (z. B. im Arbeitsbereich) sind Kindern nicht mehr zugänglich, der Raum, der Kindern für eine selbständige motorische Aktivität zur Verfügung steht, hat sich dramatisch verkleinert, Sportunterricht an Schulen sinkt in seiner Bedeutung. Eine Affektregulation durch körperliche Aktivität und das Lernen körperlicher Kompetenzen tritt daher aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen immer mehr in den Hintergrund. Die Bestätigung des Selbstwerts über körperliche Aktivität gelingt nur noch wenigen betroffenen Kindern.
Freud beschreibt, dass es in der Latenzzeit zu einem Nachlassen sexueller Impulse komme. Er berücksichtigte aber bereits die Vielfalt der Entwicklungen in dieser Zeit – bei einigen Kindern bleibt die Sexualisierung und eine damit einhergehende sexuelle Betätigung während der Latenzzeit bestehen. Mertens (1996) diskutiert die unterschiedlichen Auffassungen zum Persistieren sexueller Betätigung in der Latenzzeit und die Infragestellung dieses Konzepts: Ist es gerechtfertigt, von einer Zeit der Latenz zu sprechen? Die Unterdrückung sexueller Aktivität bleibt unvollständig; fast alle Kinder in der Latenzzeit zeigen sexuelle Aktivitäten wie Masturbation und sexuelles Phantasieren. Auch diese Aktivitäten unterstützen die Regulation innerer Spannungen. Ein gewaltsames Verbieten oder strikte Unterbindungen können zu einer Einschränkung der Ich-Entwicklung führen.
Folgerungen für die Praxis: Sexuelle Aktivität, Schuldgefühl und Zwänge
Symptome, die hauptsächlich in der frühen Latenz aufkommen, wie Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, Konzentrationsmangel, antisoziales Verhalten, übermäßige Schuldgefühle oder Kastrationsängste, werden als eine Folge strikter Unterbindung sexueller Aktivitäten in der Latenzzeit beschrieben. Die »fast ausschließliche« Beschäftigung mit sexuellen Doktorspielen kann aber auch auf die sexuelle Überstimulation und Überforderung eines Kindes hinweisen (Mertens 1996). Inwieweit es dem Kind gelingt, seine sexuellen Aktivitäten sozial angemessen zu kontrollieren, die mit ihnen verbundenen Phantasien und Emotionen zu integrieren und ein positives Ich und Über-Ich zu entwickeln, hängt mit den Einflüssen des sozialen Umfeldes, der gesellschaftlichen und familiären Kultur zusammen (Tyson & Tyson, 2009).
2.3 Objektbeziehungen der Latenzzeit
Durch die Enttäuschung im Zusammenhang mit der Zurückweisung ödipaler Liebeswünsche und durch die wachsenden kognitiven Kompetenzen lösen sich Kinder vermehrt von ihren Eltern. Phantasien (wie die, ein adoptiertes Kind mit anderen Eltern zu sein) unterstützen Kinder in dieser Entwicklungsaufgabe. Freud hat diese Phantasien (1909) als den »Familienroman der Neurotiker« beschrieben. Bei allen – äußeren – Autonomieschritten und Lösungsversuchen bleibt das Über-Ich aber noch an eine Bestätigung elterlicher Auffassungen gebunden. Manche Psychoanalytiker sprechen von einer »Projektion« des Über-Ich auf die Familie. Diese Vorstellung ist aber auch missverständlich. Die noch geringe Distanzierung von familiären Normen kann vielleicht besser als strukturelle Einschränkung verstanden werden (Kap. 3 und Kap. 4