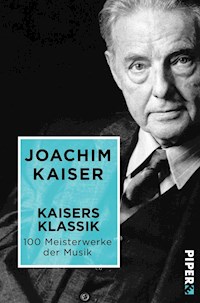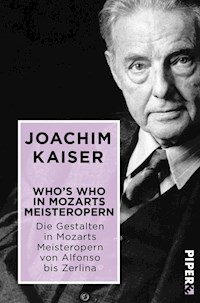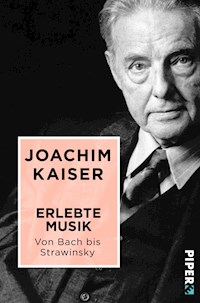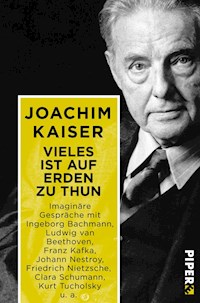14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Erlebte Literatur« ist das Ergebnis von mehr als 40 Jahren engagierter Beobachtung und kritischer Begleitung deutscher Nachkriegskriegsliteratur. Es sind Würdigungen, Analysen, Marginalien und Reaktionen zu den wichtigsten Autoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur durch Joachim Kaiser, einem der maßgeblichen Kultur-Kritiker und Mitglied der »Gruppe 47«. »Erlebte Literatur« – das ist eine unkonventionelle, persönliche Literaturgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Neuauflage einer früheren Ausgabe
ISBN 978-3-492-97733-3
August 2017
© Piper Verlag GmbH, München 2017
© der deutschsprachigen Ausgabe Piper Verlag GmbH,
München 1988
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: SZ Photo / Regina Schmeken / Bridgeman Images
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Leck
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Einleitung
Über Auswahl und Aufbau
Dieses Buch – »Erlebte Literatur« – möche ein Gegenstück sein zu meinen beiden Bänden: »Erlebte Musik«. Es enthält die Summe, die Dokumentation meiner Bemühungen um die werdende deutschsprachige Nachkriegsliteratur.
Der Titel meint nicht bloß das Leseerlebnis, sondern auch das Miterleben. Alle Autoren, von deren Büchern oder Gesamtwerken hier die Rede sein wird, habe ich persönlich kennengelernt, gesehen, gesprochen, als Vortragende oder Zelebritäten erlebt. Thomas Mann begegnete ich einst in Frankfurt, hörte seine berühmt gewordenen Reden (wagte aber als blutjunger Literat auf einer S. Fischer-Party leider nicht, ihn anzusprechen, obwohl ich ihn so bewunderte und er sich wahrscheinlich über die Verehrung eines jungen Deutschen, der ihn wirklich gelesen hatte, gefreut hätte). Bertolt Brecht sah ich im Hause Suhrkamp … »Wie geht es Ihnen, Brecht?« fragte der alte Suhrkamp den Besucher aus der DDR etwas maliziös. »Sehr gut, denn ich habe ein gutes Gewissen«, antwortete Brecht spitz und wie aus der Pistole geschossen. Auch Gottfried Benn trat während der fünfziger Jahre, freilich immer sehr leise, als Redner oder Rezitator öffentlich auf- und ich hörte ihn.
Mit Max Frisch bin ich fast befreundet, seit ich ihn, Mitte der fünfziger Jahre – ich war damals Hörspieldramaturg –, in Zürich besuchen durfte, und zwar um ihn zu bitten, er möge doch aus seiner Tagebuchparabel »Der andorranische Jude« einen Hörspieltext machen. Das tat er dann zwar nicht – wohl aber brachte ihn mein Verlangen vielleicht doch auf die Idee, sein später so berühmtes »Andorra«-Drama zu schreiben. Und daß ich mit vielen jüngeren Autoren gut bekannt oder gar befreundet war oder bin, zumal wenn sie der Gruppe 47 nahestanden, zu deren Tagungen H. W. Richter mich seit 1953 einlud, ließ eine Tuchfühlung entstehen, auf die man als Kritiker nicht verzichten sollte, falls sie nicht zur Befangenheit oder zu falscher Kameraderie fuhrt.
So behandelt dieses Buch nur Schriftsteller, die nach 1945 in der deutschsprachigen Literatur eine Rolle spielten. Selbstverständlich »wirkte« auch ein Kafka, ein Musil oder ein Rilke in die Nachkriegszeit hinein. Aber diese Großen waren 1945 bereits tot.
Für mein Bestehen auf Gegenwärtigkeit möchte ich folgenden Grund nennen: So häufig auch in einer Person literarische und musikalische Interessen vereinigt sind – nie habe ich beobachten können, daß solche Doppelt-Engagierten sich auf die gleiche Weise verhalten zu Musik und Literatur! Im Bereich der Musik reagiere ich leidenschaftlich »museal«, nämlich traditionszugewandt, der großen Klassik ergeben. Bei der Literatur ist es genau umgekehrt. Da interessierte und interessiert mich die zeitgenössische Produktion unmittelbar, ja weit heftiger als die große Vergangenheit. Natürlich habe ich bedeutender Musik, die im 20. Jahrhundert und nach 1945 komponiert worden ist, immer aufgeschlossen zu begegnen versucht. Schönberg und Strawinsky, Hindemith und Schostakowitsch, Karl Amadeus Hartmann und Benjamin Britten, Henze und Prokofjew, Kagel und Bernd-Alois Zimmermann, Nono und Ligeti (um nur Komponisten zu nennen, die nach 1945 noch lebten und produzierten) sind ja wahrlich keine Sektierer gewesen, sondern Repräsentanten unserer Welt: Sie lösten dem die Zunge, was viele Zeitgenossen erfüllt oder bedrängt … Trotzdem vermochten mich all die Werke, die sie einer schwierigen Kompositions-Situation erfolgreich abtrotzten, nie auch nur annähernd so zu bewegen, zu fesseln, wie die Musik der großen Vergangenheit zwischen Bach, Brahms und Bruckner. Doch ein neuer Roman von Frisch oder Grass, ein neues Stück von Beckett oder Ionesco, ein neuer Essay von Sartre, Hans Magnus Enzensberger oder Reinhard Baumgart waren und sind mir nach wie vor wichtiger als alle weiß Gott unbezweifelbare Größe des Weimarer Gestern oder des Elisabethanischen Vorgestern. Darum diese offenkundig inkonsequenten, einander widersprechenden Auswahlprinzipien. Ich bevorzuge einerseits die »tote« Musik (die überwältigend lebt) und andererseits die »lebendige« Literatur (die keineswegs immer überwältigt).
*
Allen hier gebotenen Einzeltexten oder Gesamtdarstellungen sind Standortbestimmungen der jeweiligen Autoren vorangestellt. Knappe Thesen, Hinweise, Interpretationshilfen, 1988 formuliert. Sie sollen dem interessierten und aufgeschlossenen Leser – damit sind weder Berufsliteraten oder Buchkritiker noch jene Germanistik-Professoren gemeint, die solcher Unterstützung nicht bedürfen, sondern vielmehr neugierige Liebhaber, Anfänger, von allzu vielem »Stoff« Überforderte – ermöglichen, sich in einen Autor hineinzudenken, hineinzufinden. Zu Beginn meiner Würdigung der Schriftstellerin Diana Kempff habe ich darzustellen versucht, in welcher (ach so unerzwingbaren) Weise literarisches Fasziniertsein sich ergibt – eine Beziehung, deren plötzliches Entstehen sich vielleicht plausibel machen, deren »Gesetzmäßigkeit« oder gar Notwendigkeit sich aber unmöglich beweisen läßt.
Alle Standortbestimmungen und auch einige der größeren, hier mitgeteilten Beiträge sind unveröffentlicht; sämtliche neueren Texte wurden im Hinblick auf dieses Buch geschrieben, wenn auch gelegentlich vorher gesendet oder gedruckt, und dann für die »Erlebte Literatur« überarbeitet. Viele der hier mitgeteilten Rezensionen standen zuerst in der »Süddeutschen Zeitung«. Die ausgewählten Texte haben den Ehrgeiz, durch geduldiges, Einzelheiten ernst nehmendes Erwägen der literarischen Qualitäten hauptsächlich moderner Romane den Zugang zu deutschsprachiger Nachkriegsliteratur zu erleichtern, ihren Rang plausibel zu machen. Da Theater-Aufführungen und Literaturerlebnisse doch sehr verschiedene Dinge sind, werden Dramen etwas seltener behandelt. Ausnahmen: Bölls zu früh erschienenes, ökologische Schicksalsfragen antizipierendes, leider vergessenes Stück »Ein Schluck Erde« sowie Dramen von Dürrenmatt und Peter Weiss. Auch auf Lyrikinterpretationen ließ ich mich nur ausnahmsweise ein.
Weil das Buch »Erlebte Literatur« heißt, enthält es keinerlei radikale Negativurteile oder Verrisse. Ganz schlechte oder hoffnungslos mißlungene Bücher »erlebt« man nicht. Selbst kritisch wirkende Analysen, wie der »Maßnahme«-Essay, den ich für die »Neue Rundschau« schrieb, oder die Nachprüfung eines Arno-Schmidt-Textes, die im »Bargfelder Boten« erschien, sollten nicht verhehlen, daß ich Brechts »Maßnahme«-Lehrstück für einen genialen Theater-Text und Arno Schmidts »Caliban über Setebos« für ein brillantes, wenn auch durchschaubares, entzauberbares Prosastück halte.
Wäre dieses Buch eine Literaturgeschichte der Nachkriegszeit, hätte auf Vollständigkeit Wert gelegt werden müssen. Literaturgeschichten geben Gesamtübersichten, fassen Entwicklungen zusammen, widmen jedem irgendwie in Frage kommenden Autor einen Hinweis und jedem Werk einen oder mehrere Absätze. Dabei erscheint das einzelne Buch meist als Beleg für eine literarische Strömung, als literarische Antwort auf eine politische, gesellschaftliche oder ästhetische Gestimmtheit. Gesamtdarstellungen können und dürfen sich beim einzelnen unmöglich so ausführlich aufhalten, wie wir hier etwa bei Thomas Manns »Doktor Faustus« oder bei Peter Handkes »Wiederholung« verweilen.
Eine Sammlung von lauter Einzelanalysen freilich läßt den Leser im Stich, läßt ihn mit der Würdigung allein, sagt ihm nicht oder zu wenig, wo und wie das einzelne Buch situiert ist in der Entwicklung des Œuvre oder gar in der Gesamtheit einer literarischen Epoche.
Um das einzelne zu entfalten, aber auch um dem berechtigten Verlangen nach der Darbietung von Zusammenhängen und Entwicklungen zu entsprechen, biete ich über die Autoren, die hier vorgestellt werden, manchmal mehrere verschiedenartige Texte an. Im Anhang stehen kurze Werkbiographien aller hier behandelten Autoren.
Über Schriftsteller, die in der DDR leben, findet der Leser nichts. Sie gehörten und gehören bedauerlicherweise nicht zu den Künstlern, deren Werden, Irren, Wirken, Existieren mir in lebendiger Tuchfühlung mitzuerleben möglich war. Daß Siegfried Lenz, Alfred Andersch und Wolfgang Koeppen auch fehlen, bedarf gewiß der Erklärung. So sehr ich die Lauterkeit, Heiterkeit und Distanz meines masurischen Landsmannes Lenz auch schätze: Zum »Leseerlebnis« wurden mir seine Romane nicht hinreichend. Ihre sprachlich-artistische Qualität betraf mich nicht derart, daß ich sie in einen Zusammenhang stellen könnte mit Thomas Mann oder auch mit Uwe Johnson, Hans Magnus Enzensberger, Diana Kempff. Bei Alfred Andersch, dessen freundliche Unterstützung mir einst sehr half, vermag ich die Fülle, die Vieldeutigkeit, das gleichsam Böllsche Unterholz nicht zu erkennen. Bei Wolfgang Koeppen hinwiederum scheinen mir artistischer Rang und phantasievolle, beziehungsreiche Assoziationskunst unleugbar, aber Koeppens Romanfiguren wirken auf mich seltsam starr, allegorisch, leblos, requisithaft. Darum überraschte mich der Erfolg von Koeppens Reisebeschreibungen wirklich nicht. Koeppens Menschen aber schienen mir – pointiert formuliert – immer nur visuelle Bestandteile einer epischen Szenerie zu sein.
Selbstverständlich wollen diese kurzen Pauschalsätze über respektable Schriftsteller nicht und niemanden zu einer Verwerfung folgenreicher deutscher Schriftsteller animieren – sie möchten vielmehr dartun, warum Andersch, Koeppen und Siegfried Lenz für mich nicht zur »Erlebten Literatur« gehören und darum hier fehlen. Weshalb sich indessen die mehr oder weniger umfänglich diskutierten Poeten hier finden – das sollen die ihnen geltenden Texte plausibel machen …
Über die kontrollierte Schizophrenie beim Lesen zeitgenössischer Werke
Will man gewisse zeitgenössische Bucherfolge oder Uraufführungs-Sensationen erklären, dann muß man einen Urteilsfaktor, ein Motiv der Anteilnahme bedenken, das mit Qualitätserwartungen teils zu tun hat, teils ihnen absichtsvoll ausweicht: Es ist die kontrollierte Schizophrenie der neugierigen, literaturversessenen Zeitgenossen.
Wie war einst die enorme Wirkung eines so begrenzten, so mühelos kritisierbaren, eines in seinem Stil so gefährlich fanatisch-pathetischen (dies alles nur eben ins Bitter-Grelle gewendet) Autors wie Wolfgang Borchert zu erklären? Die Öffentlichkeit, die Rundfunkhörer, Theaterbesucher und Leser, die sich 1947 vom Drama »Draußen vor der Tür« erschüttern ließen, sie waren doch weder so blind noch so ahnungslos, um nicht auch damals schon erkennen zu können, was sich später leichthin über des unglücklichen, tapferen Wolfgang Borchert Grenzen ausmachen ließ. Oder »belog« sich im Falle Borchert die Öffentlichkeit? Jene Öffentlichkeit, für die damals etwa Thomas Manns Spätwerk wichtig werden sollte, die in ihren wohlerhaltenen Bücherschränken Shakespeare-Ausgaben und Lesering-Lederbände stehen hatte – Paul Kellers »Ferien vom Ich« neben Gottfried Kellers »Grünem Heinrich«, Sieburg neben Carossa, Bergengruen neben Rilke, Kolbenheyer neben Ina Seidel, Deeping neben Shaw?
Sollte ein solches Publikum nicht haben spüren, ahnen, sehen können, wie schmächtig sich Wolfgang Borcherts Dichtung ausnahm? Es war ja eine sehr kulturgierige Öffentlichkeit, die begeistert Zeitungen wie die »Neue Zeitung« mit ihrem reichen Feuilleton, Zeitschriften wie den »Merkur«, die »Neue Rundschau« und die »Frankfurter Hefte« verschlang … Und trotzdem Borcherts unbezweifelbare »Wirkung«, die doch keineswegs nur mit Unterhaltungsbedürfnissen, Bequemlichkeiten, oder den damals ohnehin nicht wesentlichen Werbekampagnen zu erklären wäre …
Wenn ein Stück, ein Kunstwerk, die Probleme unmittelbar betroffener Menschen, einer bestimmten Gruppe oder eines »Kollektivs«, in der Sprache dieses Kollektivs abzuhandeln vermag, dann erscheint jedem an den Stromkreis des allgemeinen Problematisierens und Leidens angeschlossenen Betrachter jenes Stück, das von eben diesem Stromkreis gespeist wird, durchaus geschlossener, als es tatsächlich ist. »Künstlerische Schwächen« – alles Synthetische, Potpourrihafte, Paraphrasierende, Deklamatorische – nimmt man nur nebenher zur Kenntnis, weil die eigene Betroffenheit auch die schwach oder kaum verbundenen Bestandteile des Dramas zusammenzwingt. Der Kunstkosmos braucht also gar nicht nur aus eigener Konstruktionskraft zu leben. Zeitgenössische Anteilnahme, nach Antworten lechzend, fordert einem solchen Werk, einem solchen Drama, zwar transästhetisch »Lebenshilfe« ab, aber sie verhilft dem Werk auch zum Leben, schweißt es zusammen.
Wolfgang Borcherts »Draußen vor der Tür« – die Grellheit des Textes, seine erhitzte Parteilichkeit – kam einem unbewußten und tiefgefühlten Bedürfnis entgegen. So stellte sich der »Stromkreis« her, der über Brüchiges hinwegtrug. Als im November 1947 Borcherts Stück uraufgeführt wurde (der Untertitel von »Draußen vor der Tür« lautete schmerzvoll-emphatisch: »Ein Stück, das kein Theater spielen und kein Publikum sehen will«), schien die Figur des jungen, schwerkranken, fieberhaften Poeten Deutschlands »Ecce homo«-Situation zu symbolisieren, so wie es auch die Gestalt des ersten westdeutschen SPD-Parteichefs Kurt Schumacher tat: Beide verkörperten, physisch und psychisch lädiert, Deutschlands Niederlage und den Willen, aus der verbrannten Erde der bösen Vergangenheit etwas Neues entstehen zu lassen. Die Borchert-Uraufführung fand einen Tag nach dem Tod des jungen Dichters in den Hamburger Kammerspielen statt.
Zum Erfolg trugen nicht nur der alles elektrisierende Problemstromkreis und die Aktualität bei. Sondern: nach nationalen Katastrophen oder einschneidenden historischen Zäsuren wird die Gegenwart immer zum besonders strengen Gericht und Verdikt über jene Literatur, deren Formen und Schönheiten eben noch vorher mit jener schlimmen Katastrophe im Bunde war, neben ihr existierte oder gegen sie allzu wenig ausrichtete. Deshalb hat alle gerade entstehende, noch nicht Versehrte, nicht fügsam gewesene oder mitschuldig gewordene Literatur es nach geschichtlichen oder politischen Wenden relativ leicht. Außerdem (das ist kein unauflösbarer Widerspruch) wollen die Menschen laut Hofmannsthal nach verlorenen Kriegen Operetten sehen …
Die Schizophrenie des zeitgenössischen Lesers besteht darin, durchaus auch zu durchschauen, daß er dem aktuellen Werk offenbar etwas Nicht-Literarisches zugute zu halten im Begriff ist. Bei »Draußen vor der Tür«, aber auch bei Bölls frühem Roman »Wo warst du, Adam?«, bei Thornton Wilders allzu traulicher »Kleiner Stadt« ebenso wie bei Forestiers (der Autor hieß in Wahrheit Krämer) ein paar Jahre später erflunkerten, herrlich europamüden Gedichten »Ich schreibe mein Herz in den Staub der Straße« (deren Verlogenheit übrigens Hans Egon Holthusen als erster folgenreich durchschaute, bevor schließlich der ganze Schwindel lustig-ärgerlich herauskam): Bei alledem wußte man doch – halbbewußt, schuldbewußt, unbewußt – immer, daß diese Texte keine »große Literatur« darstellten – so wie man es später bei H. C. Artmann oder beim sektiererischen, genial verbiesterten Arno Schmidt auch zu ahnen begann … Alles das gehört zum durchaus lebendigen Krankheitsbild zeitgenössischer Lese-Schizophrenie. Zeitgenossen sind nie so unvernünftig, wie es den Nachgeborenen scheinen will, die schadenfroh gewisse hochgeputschte Urteile von damals, gewisse extreme Behauptungen und Diskussionsbeiträge als Ausdruck sinnverwirrter Maßstablosigkeit, Problembesoffenheit, Kritikunfahigkeit und Distanz-Armut belächeln. Nähe übertreibt. Trotzdem bleibt bei fast allen Beteiligten, auch mitten im Meinungskampf, die Hellsicht fürs tatsächlich Außerordentliche und Wichtige bewahrt. Es gibt eine Koexistenz von wildem Ernst-Nehmen – und doch Bescheid-Wissen.
*
Zeitumstände sind nie mildernde Umstände. Äußere Bedingungen können vieles erklären, aber alle diese Erklärungen ändern wenig am Gehalt, an der Kunstqualität der Werke.
Heißt das, man dürfe literarische Qualität so fordern, wie man früher von einer jungen Dame sittsame Manieren verlangt hat? Wer kann beim Kunstwerk so zynisch sein, die Schreie von Opfern auf ihre musikalische Substanz hin zu testen?
Zugegeben: Auf solche rhetorischen Fragen läßt sich theoretisch, bei einer Kunst-Diskussion, leichter und entschiedener mit radikal ästhetischen Forderungen antworten – als unmittelbar vor den Werken und Autoren. Auch des Mitleids Stimme kann fesseln, beeindrucken. Gleichwohl: weder die Triftigkeit einer gemachten Erfahrung noch die Wahrhaftigkeit einer erkämpften Entscheidung, noch auch die Darstellung der Veränderbarkeit schlimmer gegebener Verhältnisse reicht hin für literarisches Kunstgelingen. Dergleichen kann immer nur Voraussetzung solchen Gelingens sein.
Günther Weisenborn schrieb 1942 im Zuchthaus Moabit sein Gedicht »Ahnung«. Die persönliche, tief erfahrene Wahrheit des Gedichtes steht jenseits aller Diskussion. Aber die Kunstqualität?
Wer am Tisch sitzt und ißt,
hört schon vor der Tür
die Schritte derer,
die ihn hinaustragen werden …
Der die Lampe andreht, weiß,
seine Hand wird kalt
wie die Klinke sein
eh der Nächste die Lampe andreht …
Wer sich früh anzieht,
ahnt, daß er Ostern
mit diesem Anzug
unter der Wiese liegt …
Wer den Wein trinkt, weiß,
dieser Rausch wird
sein Hirn nicht mehr erreichen …
sondern auslaufen wie ein Ei …
Leicht ist der Schrei
der eiligen Schwalben,
Sie sind rasch, aber rascher
als sie ist das Ende …
Günther Weisenborn, sein »Memorial« verriet es, hat bestimmt mehr und Härteres durchgemacht als je Mörike. Doch sein Gedicht, dem Mörikeschen »Denk es, o Seele« nachgebildet, entgeht der Versuchung zum Selbstmitleid nur auf Kosten peinlicher Banalität. Aber: diese Banalität äußert sich nun leider nicht so mittelbar, als hätten irr machende Angst und Entsetzen gleichsam des Autors Worte beschädigt. »Wer den Wein trinkt, weiß, dieser Rausch … wird auslaufen wie ein Ei«: Eine solche Sequenz – zwischen Wein, auslaufen, Rausch und Ei prekär vermittelnd – hält die beklemmende Wahrheit der »Ahnung« Weisenborns nicht fest. Das Gedicht redet nur von der Todesahnung, aber seine Worte vibrieren nicht von ihr. Weniger, weil es zu »karg« wäre, wohl aber, weil Weisenborn wahllos am Eigensinn der Wörter vorbeiformuliert, zwischen frühem Sich-Anziehen und eiligen Schwalben.
Als Heinrich Böll, drei Jahre nach dem Krieg, in »Wo warst du, Adam?« die Angst vor dem so bald nahenden Ende (gewiß auch nicht besonders »kunstvoll« und »literarisch«) zu beschreiben unternahm – das »bald« ist ein Leitmotiv, ein Leidmotiv seines ersten Romans –, da vermochte der junge Autor das ängstliche, wahnhafte Kreisen um den bald bevorstehenden Tod eindringlicher in eine kanonhafte, gebetsmühlenartige Sprache hineinzuholen.
Bald. Bald. Bald. Bald. Wann ist Bald? Welch ein furchtbares Wort: Bald. Bald kann in einer Sekunde sein. Bald kann in einem Jahr sein. Bald ist ein furchtbares Wort. Dieses Bald drückt die Zukunft zusammen, es macht sie klein, und es gibt nichts Gewisses, gar nichts Gewisses, es ist die absolute Unsicherheit. Bald ist nichts und Bald ist vieles. Bald ist alles. Bald ist der Tod.
Bald bin ich tot. Ich werde sterben, bald. Du hast es selbst gesagt, und jemand in dir und jemand außerhalb von dir hat es dir gesagt, daß dieses Bald erfüllt werden wird. Jedenfalls wird dieses Bald im Kriege sein. Das ist etwas Gewisses, wenigstens etwas Festes.
Die ausweglose, an ängstliches Herzpochen gemahnende Verzweiflung des »Bald … Bald … Bald …« (man hört mit, wie der Eisenbahnzug, in dem ein junger, der Front entgegenfahrender Soldat ängstlich sinniert, monoton rhythmisch über die Schienen rattert) hat eine Empfindung fixiert, die sich bei Weisenborn nicht in Bilder umsetzen wollte, sondern – vielleicht sogar wegen allzu akuter Todesnot und Angst! – nicht zum Gedicht wurde.
Nun ist es überheblich und grausam, dergleichen vom sicheren Port gemächlich zu kritisieren – selbst Bölls spärliche Freiheit zur Angst war nach 1945 unendlich größer als das Vokabular, das Weisenborn 1942 im Zuchthaus Moabit zur Verfügung stand. Vielleicht versuchte Weisenborn in seinem Gedicht, der heroischen Nazi-Sprache zu entkommen – aber eine eigene sich zu erschaffen, erlaubte ihm sein Schicksal nicht. Im Bezirk der Kunst sind solche schrecklichen Handikaps gleichgültig. Zum Gelingen helfen mildernde Umstände nicht.
Zeitgenossenschaft heißt, Literatur als spezifische Qualität erfahren wollen – sie aber kaum ohne politisch-persönlichen Kontext verstehen können. Lese-Schizophrenie heißt, dem »Zeitgenössischen« einen Unmittelbarkeitsvorsprung, ja einen Unschuldsvorsprung einräumen wollen – und doch die großen Ansprüche und Rangordnungen nicht aus dem Auge verlieren können. »Qualitätsansprüche« mögen, als bloße im Bewußtsein sicherer Resonanz erhobene Ansprüche, recht abstrakte, unverschämte Forderungen sein. Auf lebendige Werke bezogen, können sich derartige Forderungen als hilfreiche Prinzipien erweisen. Sie meinen dann kunstsprachliche Konsequenz, Erfindungskraft, Genauigkeit und Eindringlichkeit.
I. DIE VÄTER
1. Thomas Mann
Gedanken als musikalische Ereignisse
Kein Überdruß, kein erdrückender Welterfolg, keine daraus unvermeidlich resultierende hochmütige Abwendung der jeweiligen Avantgarden hat verhindern können, daß Thomas Mann nach 1945 die leidenschaftlich interessierte Zuwendung des lesenden Publikums (der Germanisten und der Spezialisten ohnehin) unwandelbar intensiv erhalten blieb.
Sollte er gleichwohl wirklich nur gewesen sein, was ihm manchmal die gereizte »linke« – aber auch die existentiell engagierte und die christliche – Intelligenz vorwarf: nämlich ein Klassiker des deutschen Spätbürgertums, der zwar gebildet und subtil künstlerische Leidenssituationen beschrieb, aber doch keinerlei Zukunftswege wies? Also, mit Martin Walser zu reden, ein »Klassenverklärer«? Dergleichen träfe nur dann zu – und zwar in offenkundigem Gegensatz zur Position von formal fortschrittlicheren Künstlern, wie Kafka, Joyce, Faulkner –, wenn sich Thomas Manns Leser allzu ausschließlich gefangennehmen ließen von den Stoffen der Thomas Mannschen Romane und Novellen. Von den Antithesen (Bürger: Künstler). Von den schönen, allzu gut zitierbaren Fazitsätzen. Etwa aus dem »Vorspiel« zur »Joseph«-Tetralogie »Höllenfahrt«: »Fest der Erzählung, du bist des Lebensgeheimnisses Feierkleid … Aber auch der Geist sei mit dir und gehe in dich ein, damit du gesegnet seiest mit dem Segen oben vom Himmel herab und mit dem Segen von der Tiefe, die unten liegt«.
Man kann offenbar auch beim berühmtesten »Ironiker« der deutschen Literatur fündig werden, wenn man ein ausgesprochenes »Weltbild« sucht, den alles sternbildhaft zueinander ordnenden Himmel einer Anthropologie, einer sittlich-humanistischen Ordnung. Im »Schnee«-Kapitel des »Zauberbergs« heißt es sogar ausdrücklich kursiviert (und wie für emsige spätere Interpreten hineingefiigt): »Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken«.
Fast scheint es, als wollte hier Hans Carstorp, ja als wollte sein Schöpfer Thomas Mann sich selbst zu irgend etwas überreden, von irgend etwas Lebensfreundlichem überzeugen.
Doch die Lektüre Thomas Manns wird spannender, wird auf eine geheimnisvolle Weise ergiebiger, falls der Lesende es fertigbringt, solche Wahrheiten anders und weniger direkt zu verstehen: als Kunst-Wahrheiten nämlich, als Thesen und Antithesen eines epischen Parallelogramms mannigfaltiger Kräfte und Tendenzen. Es lohnt durchaus, auf handfest heimtragbare Resultate zu verzichten, zumindest solche Fazitsätze nicht als des Pudels Kern begreifen zu wollen.
Im Brief an Bruno Walter (vom 15. September 1946) macht Thomas Mann dem Musikerfreund ein Geständnis, das nicht als Schmeichelei fürs Metier des Dirigenten, sondern doch als Offenbarung einer elementaren Kunstvoraussetzung Thomas Manns gelesen werden muß: »Beim Schreiben, ich versichere dich, ist der Gedanke sehr oft das bloße Produkt eines rhythmischen Bedürfnisses: um der Kadenz und nicht um seiner selbst willen – wenn auch scheinbar um seiner selbst willen – wird er eingesetzt. Ich bin überzeugt, daß die geheimste und stärkste Anziehungskraft einer Prosa in ihrem Rhythmus liegt – dessen Gesetze so viel delikater sind, als die offenkundig metrischen …«
Sollte die wohlklingende Erweiterung einer Aufzählung, die immer feiner sich differenzierende Schilderung, die tönende Gravitation gewichtig abschließender Worte oder Silben, der gleichsam luxuriös, wie aus dem Überfluß hinauszutretende Gedanke – sollte dergleichen bei Thomas Mann wirklich (auch) die Folge eines schwer definierbaren und konkretisierbaren rhythmischen Bedürfnisses sein? Eines Bedürfnisses, das ja nicht vom Himmel fällt, nicht zu-»fällig« entsteht, sondern seinerseits zu tun haben müßte mit der Kunst-Wahrheit!
Es ist spannend, beunruhigend und wahrhaft lehrreich, Thomas Mann auch auf diese Weise zu lesen. Seine Perioden so zu begreifen, daß die Gedanken auch als musikalische Ereignisse zu respektieren sind und daß Beschreibungen in Wahrheit um des Rhythmus willen (der ja nichts »Unwahres« zu sein braucht, selbst wenn er mit logisch-begrifflichem Denken schwer in Verbindung gebracht werden kann) so dastehen, wie sie dastehen.
Als Demonstrationsbeispiel soll uns nichts besonders Manieriertes oder Routiniert-Spätes dienen, sondern ein Absatz aus dem ersten Kapitel des neunten Teils der »Buddenbrooks«. Die Konsulin, die Mutter des Senators Thomas Buddenbrook, stirbt.
Um halb sechs Uhr trat ein Augenblick der Ruhe ein. Und dann, ganz plötzlich, ging über ihre gealterten und vom Leiden zerrissenen Züge ein Zucken, eine jähe, entsetzte Freude, eine tiefe, schauernde, furchtsame Zärtlichkeit, blitzschnell breitete sie die Arme aus, und mit einer so stoßartigen und unvermittelten Schnelligkeit, daß man fühlte: zwischen dem, was sie gehört und ihrer Antwort lag nicht ein Augenblick – rief sie laut mit dem Ausdruck des unbedingtesten Gehorsams und einer grenzenlosen angst- und liebevollen Gefügigkeit und Hingebung: »Hier bin ich!« … und verschied.
Sucht man dieser Beschreibung mit dem »inneren Ohr« zu folgen, dann spürt man doch: die »entsetzte Freude«, die »schaudernde, furchtsame Zärtlichkeit«, die verdoppelnde Koppelung »Gefügigkeit und Hingebung« – alles das scheint, einerseits, grandios-wahrhaftig beobachtet und gesehen, andererseits aber unverkennbar auch rhythmisch motiviert. (Es scheint so, als seien gerade die oxymoron-artigen gleichsam dissonanten Zusammenstellungen, eben die entsetzte Freude, die schaudernde Zärtlichkeit, einem rhythmisch den Satz ausweitenden Bedürfnis des Autors entsprungen.)
Wahrscheinlich erklären solche Kunstkühnheiten Thomas Manns Faszinosum. Seiner eigentümlichen Wahrheit kommt man gewiß nur nahe, wenn man ihn nicht bloß wie einen Chronisten liest, sondern wie einen literarischen Musiker, den der Strom rhythmischer Notwendigkeiten manchmal auch zum Verfertigen von Gedanken animierte.
»Doktor Faustus«, die Musik und das deutsche Schicksal
Kein deutscher Roman ist nach dem Zweiten Weltkrieg im akademischen und im publizistischen Bereich auch nur annähernd so intensiv diskutiert, kritisiert und analysiert worden wie Thomas Manns »Doktor Faustus«. Der Freiburger Philologe Johannes Werner hat für die Zeit von 1953–1968 »450 Abhandlungen gleich 30000 Seiten allein über den ›Doktor Faustus‹« gezählt. Zwischen 1947 und 1983 müssen es, so entnehme ich erschüttert Rudolf Wolffs Dokumentation »Thomas Manns Doktor Faustus und die Wirkung«, wohl mehr als tausend Beiträge gewesen sein, mit – man kann das nur schätzen, aber wirklich nicht lesen – etwa 70000 Seiten Sekundärem.
Doch mittlerweile liegen aus Thomas Manns Hand ja nicht nur der Roman selber, sowie der »Roman eines Romans«, also »Die Entstehung des Doktor Faustus« vor – sondern auch die Briefe, die der unermüdliche Korrespondenzpartner Thomas Mann geschrieben hat, als der »Doktor Faustus« in ihm, und dann auf dem Papier, wuchs. Und erst in den achtziger Jahren ist eine weitere wichtige Quelle allgemein zugänglich geworden, nämlich die Tagebücher, die Thomas Mann führte, als er den »Faustus« konzipierte. Mithin müßte eigentlich und beängstigenderweise ein beträchtlicher Teil der 70000 Sekundärseiten entweder radikal neu geschrieben oder doch modifiziert, verbessert werden. Welch ein Spielraum für germanistische Emsigkeit …
Freilich, die Probleme, die der »Faustus«-Roman aufwirft, lassen sich nicht mit spitzfindigem, jungakademischem Bienenfleiß lösen, auch nicht mit einem wohlfeilen Gegeneinander-Ausspielen von Begriffen erledigen. Ohne den Mut zur leidenschaftlichen Anspannung ästhetischer Urteilskraft, ohne beträchtliche Lebens- und Lese-Erfahrung wird man diesem gewichtigen, erfüllten und reichen Buch schwerlich gerecht. Vier Fragen drängen sich nach wie vor auf:
Kann Adrian Leverkühns Schicksal, kann das Leben und der Zusammenbruch eines unselig-genialen, paralyse-kranken Komponisten in irgendeiner zwingenden oder plausiblen Weise den Zusammenbruch Hitler-Deutschlands symbolisieren?
Was steckt dahinter, daß zwar nahezu alle Thomas-Mann-Bewunderer kritisch-betroffen oder enthusiastisch-betroffen auf den Roman reagierten, daß aber die allermeisten nicht-professionellen, nicht-musikologischen Leser bekennen, sie hätten den komplizierten musiktheoretischen Erörterungen nicht zu folgen vermocht? Selbst Carl Friedrich von Weizsäcker, wahrlich ein spekulativer Kopf, bemerkte in seinem »Faustus«-Aufsatz von 1978 lapidar: »Die musikalische Bedeutung des Buches entzieht sich meinem Urteil«. Wie kommt das? Nichtmedizinische »Zauberberg«-Leser fühlten sich von den intensiven Tuberkulosebeschreibungen und Exkursen des Sanatoriumsromans doch offenbar keineswegs so überfordert!
War Theodor W. Adorno, an den sich Thomas Mann gewandt hatte, weil er Hilfe im Exakt-Musikalischen und beim konkreten Entwurf der Leverkühnschen Kompositionen benötigte, war dieser Theodor W. Adorno wirklich nur ein sachlicher Berater und Mitarbeiter, oder hat Adornos Kulturkritik nicht auch die Tendenz des Romans beeinflußt?
Vom 23. Kapitel bis zum Schluß bezieht sich der Roman unverkennbar auch auf viele in München lebende Verwandte und Bekannte des Dichters. Wie verträgt sich nun Thomas Manns München-Sehnsucht mit seiner München-Schelte?
*
Um alledem auf den Grund zu kommen, wollen wir nicht gleich mit dem Maisonntag des Jahres 1943 einsetzen, an dem Thomas Mann, 68jährig, in Kalifornien die Niederschrift des »Doktor Faustus« begann. Treten wir ein wenig, nämlich zehn Jahre, zurück. Am 27. April 1933, zu Beginn der Hitler-Ära, schrieb Klaus Mann aus Frankreich, wo er seit einigen Wochen als Emigrant in Hotels lebte, einen verzweifelt munteren Brief nach Amerika, an die Zeichnerin und Karikaturistin Eva Herrmann, mit der er befreundet war. Natürlich berichtet der 26jährige Jungemigrant zuerst erregt von sich, von der »Verbannung«, in der er sich befand:
»Es ist eine merkwürdige Lage. An Deutschland denkt man als an ein ekelhaftes Irrenhaus, aber man hat keine Ahnung, wie sich uns das Leben außerhalb Deutschlands gestalten wird. So hängt man schon auf eine phantastische Weise in der Luft. Am meisten werde ich mich natürlich auf Paris konzentrieren, wo ich auch bis jetzt war und wo ich ohne Frage einige Chancen habe. Aber gerade dort ist die Konkurrenz der ›Emigranten‹ untereinander so erschreckend groß; (und ich fürchte, in Prag, Zürich usw. ist es noch ärger).«
Das klingt besorgt, gespannt, keineswegs wehleidig, mehr verwirrt als verstört, und soll die liebe Eva Herrmann dazu animieren, doch in Amerika, wohin Klaus am liebsten möchte, etwas für ihn zu tun, für ihn »eine bescheidene Chance« ausfindig zu machen. Im nächsten Briefabsatz kommt der Schreiber ziemlich salopp auch auf das Schicksal der »armen Eltern« zu sprechen, die sich in Südfrankreich etwas mieten wollen. Und dann macht er, in Klammern nur, um nicht allzuviel Aufmerksamkeit wegzunehmen, eine lässige, gespenstisch treffsichere Bemerkung über den weltberühmten Papa. Nachdem Klaus Mann Deutschland eben noch als »ekelhaftes Irrenhaus« charakterisiert hat, schreibt er der Freundin über den Vater, den die Mann-Kinder »Zauberer« nannten: »(für den Zauberer ist es ja besonders scheußlich – er kann nicht umhin, sich irgendwie für Deutschland verantwortlich zu fühlen, und eigentlich kann er ja auch ohne Deutschland nicht leben).«
Klar: dem zornigen jungen Klaus Mann lag es verdammt fern, mit dem völkisch delirierenden Deutschland irgendeine Solidarität zu empfinden. Aber Klaus spürte, daß der berühmte Vater, der als 58jähriger aus seiner Heimat ausgestoßen worden war, sich für alles, was die Landsleute und zumal die Münchner verübten, »irgendwie« verantwortlich fühlte. Und daß der Vater »eigentlich« ohne Deutschland nicht leben könne – wobei die sonst immer so unangenehm vagen Flickwörter »irgendwie« und »eigentlich« hier seltsamerweise die Aussage bestärken, sie nämlich hinausheben übers präzis Faktische, Vernünftige, Juristische-in eine mystische Sphäre geistig-künstlerischer Gemeinsamkeit.
Klaus Manns Bemerkung über die scheußliche, unaufhebbare Solidaritätssituation des Vaters sollte sich ein Jahrzehnt später als prophetisch erweisen, als Thomas Mann sich schweren Herzens dem deutschen Tonsetzer Adrian Leverkühn verschrieb. Zunächst, nach 1933, hatte der Vater, in die Schweiz emigriert, ja noch mit seiner »Josephs«-Tetralogie zu tun. Da fällt eine höchst seltsame Analogie auf zwischen dem Lebensweg Thomas Manns und der Biographie seines Kunstidols Richard Wagner. Wagner hat die vier Musikdramen der »Ring«-Tetralogie noch in Deutschland begonnen, sie in der Schweiz weitergeführt, schließlich unter königlichmärchenhaften Umständen in Bayreuth beendet. Genauso hatte auch Thomas Mann seine »Josephs«-Tetralogie in Deutschland begonnen, in der Schweiz fortgesetzt. Die Analogie reicht bis ins einzelne: Wagners »Rheingold«-Vorspiel beginnt mit dem berühmten raunenden, tiefen Kontra-Es, Thomas Manns »Höllenfahrt«-Vorspiel zu den »Geschichten Jaakobs« mit dem Wort »Tief«: »Tief ist der Brunnen der Vergangenheit«. Thomas Mann schrieb also in der Schweiz an seiner Tetralogie weiter, schob freilich als verklärendes Deutschland-Intermezzo eine märchenhaft heitere Goethe-Vergegenwärtigung dazwischen: »Lotte in Weimar«. Wagner wiederum, bevor er den »Ring« zu Ende schmiedete, trug sich während hektischer Emigrations- und Reisezeit mit dem »Tristan« und den »Meistersingern von Nürnberg«, einem Traum von Deutschlands Jugend, ja er notierte die Idee zum Allerdeutschesten, zum »Wacht auf«-Chor, tatsächlich in einer Pariser Kneipe. Nach den Nürnberger »Meistersingern« kehrte Wagner wieder zum »Ring« zurück, so wie Thomas Mann nach der »Weimarer Lotte« wieder in die Patriarchenluft des »Joseph« eintauchte. 1943, unter kalifornischen Umständen, beendete er die »Josephs«-Tetralogie. Und bereits wenige Wochen später begann er den »Faustus«. Er schrieb damals dem Sohn Klaus über den »Faustus«: »Es wird mein Parsifal«. Das alles gemahnt ziemlich gespenstisch an eine Thomas Mannsche »Imitatio dei«, an eine Nachahmung seines Kunstgottes Richard Wagner, den er tief-romantisch in sich hatte und über den er hochdemokratisch hinaus wollte. So ging es mit dem »Faustus« auch. Über den geplanten Roman teilte er dem Sohn weiter mit: »eine Künstler (Musiker)- und moderne Teufelsverschreibungsgeschichte … kurzum das Thema der schlimmen Inspiration und Genialisierung, die mit dem Vom Teufel Geholt Werden, d. h. mit der Paralyse endet. Es ist aber die Idee des Rausches überhaupt und der Anti-Vernunft damit verquickt, dadurch auch das Politische, Faschistische, und damit das traurige Schicksal Deutschlands. Das Ganze sehr altdeutsch-lutherisch getönt.«
Nun hatte sich Thomas Mann während der Emigrationsjahre natürlich immer mit deutschen politischen Problemen essayistisch und propagandistisch herumschlagen müssen. Es gab den grimmig selbstkritischen Essay »Bruder Hitler« von 1939, es gab 1945 die berühmt gewordene Ansprache »Deutschland und die Deutschen«, in welcher Thomas Mann die Problematik seines »Faustus«-Romans auf sinnfällige Thesen zu bringen versuchte, die dann im Nachkriegs-Deutschland fast so heftig diskutiert wurden wie Inhalt und Gehalt des Leverkühn-Buches selber. Zumal unsere betroffenen evangelischen Theologen konnten sich nach 1945 beim besten Zerknirschungswillen überhaupt nicht abfinden mit dem Bild eines ebenso musikalischen wie brutalen, eines ebenso innigen wie an weltlicher Freiheit uninteressierten Martin Luther, das Thomas Mann in seinem Deutschland-Vortrag entworfen hatte …
Alle diese Essays, Rundfunkreden und prodemokratischen Bekenntnisse, diese Hilfeleistungen und Hilferufe, die Thomas Mann als prominentester deutscher Emigrant gleichsam hinter dem Rükken seiner dichterischen Arbeit hervorbrachte: sie kamen wahrlich müheloser und glatter zustande als der »Doktor Faustus«. In ihnen unterdrückte Thomas Mann vieles, was dann doch im Roman rumorte. Ja 1952, als der Dichter bitter enttäuscht war vom Hexenjagd-Amerika des Senators McCarthy und sanft enttäuscht wohl auch von der »größtenteils miserablen Presse«, die der »Faustus« in Amerika hatte, 1952 machte sich Thomas Mann sogar selbstironisch lustig über sein demokratisches Wanderrednertum in der Zeit von seines »demokratischen Optimismus Maienblüte«. Maienblüte? Wem aber fiele bei diesem schönen Wort »Maienblüte« nicht jener Schlegel/Tiecksche »Hamlet« ein, wo ein Sohn Klage führt, daß der Vater »in seiner Sünden Maienblüte« ermordet ward? Seltsame Thomas Mannsche Assoziationsuntertöne: »demokratischer Optimismus« und »Sünde« unversehens nebeneinander.
Aber Essays, Reden, Rundfunkvorträge, Briefe und dergleichen sind keine Romane. Keine Erzeugnisse der Einbildungskraft und Kunst. Essays stellen Behauptungen auf, widerlegen falsche oder gefährliche Thesen, sind spekulative Nachprüfungen wie die »Betrachtungen eines Unpolitischen«, kommen der »Forderung des Tages« nach, was keineswegs etwas Verächtliches sein muß. Beim Roman, bei dieser erzählten Spannungswelt aus Inhalt, Form, Spiel, Dokument, zeitgeschichtlichem Ambiente und Gehalt geht es nicht so eindeutig und eingleisig zu, zumal bei einem »Doktor Faustus« nicht, der Deutschland aus kalifornischem Exil sehnsüchtig beschwört, der sich auch als Thomas Mannsche Autobiographie lesen läßt, der ein kunstvoller Künstlerroman ist, wo die Entstehung und Verlockung archaisierender Begierden in Münchner Intellektuellenzirkeln vorgeführt wird.
Was immer man über den »Faustus« auch sagen oder klagen mag: das Buch erregte, kraft der ungeheuerlichen Fülle dessen, was es an Wahrheits- und Bekenntnisenergien enthielt, Betroffenheit. Thomas Mann selbst war so betroffen, daß er während der Arbeit immerfort ächzte und beinahe starb. Als das Buch in seiner deutschen Originalgestalt dann endlich in der Schweiz herauskam, zeigten sich die Schweizer Kritiker enthusiastisch-betroffen. Thomas Mann war, nach ärgerlichen amerikanischen Rezensionen, dankbar dafür und schrieb: »So, wie in dem kleinen Alpenlande, wird das Buch wohl nirgends gelesen werden, auch in Deutschland nicht, wo es jetzt gedruckt wird. Ich fürchte«-so Thomas Mann am 31. 12. 1947 – »der geistige Blutdruck ist einfach zu niedrig dort.«
Da irrte Thomas Mann. Er meinte, der Zusammenbruch Hitler-Deutschlands habe lauter apathische, zerstörte, triste Figuren hinterlassen – während doch in der unmittelbaren Nachkriegszeit zwischen 1945 und 1952 der geistige Blutdruck, die geistige Leidenschaft, in Deutschland enorm, ja fast krankhaft hoch war: unendlich höher als während der Nazizeit oder auch gegenwärtig. Adorno hat das 1949 in seinem schönen, dankbar überraschten Essay »Auferstehung der Kultur in Deutschland« verblüfft geschildert. Übrigens gab Thomas Mann ein paar Monate später zu, daß er den deutschen Blutdruck unterschätzt hatte: »Das Echo des Romans aus Deutschland ist stärker, als ich erwartet hatte … Ich bin recht froh, darauf gedrungen zu haben, daß eine inner-deutsche Ausgabe so bald wie möglich erscheint.«
Die Heftigkeit des Echos auf einen eigentlich doch schwierigen, mühsamen, zunächst überhaupt nur in eingeschmuggelten Exemplaren vorhandenen Roman im damaligen Deutschland läßt sich den heute Jüngeren kaum vermitteln. Ich studierte damals in Göttingen, verkehrte viel im Kreis um den Schriftsteller und Faulkner-Übersetzer Hermann Stresau, der übrigens später bei S. Fischer auch ein Buch über »Thomas Mann und sein Werk« publizierte. Wir waren – als 1945 das finstere Reich des Fanatismus zerschlagen schien und eine schöne, neue Welt des Geistes wieder im Werden – wir waren begierig, ja heißhungrig auf diesen Thomas-Mann-Roman über Deutschland, die Musik und das Schicksal. Ich erinnere mich noch, wie glühend ich meinen Freund und Studienkollegen Carl Dahlhaus, der übrigens kürzlich noch einen profunden Essay über Thomas Mann, Adorno, Schönberg und die »Fictive Zwölftonmusik« veröffentlicht hat – wie glühend ich ihn beneidete, nicht nur, weil er 1947 in die an Lebensmitteln und Süßigkeiten reiche Schweiz reisen durfte, sondern vor allem, weil er dort während seines Herbstaufenthaltes den »Doktor Faustus« lesen konnte, den es in bundesdeutschen Buchhandlungen noch nicht gab. Und er las in Zürich den ganzen Roman, mußte sich allerdings von Bertolt Brecht, dem er dort begegnete, dazu sagen lassen, der »Faustus« enthalte »seniles Altersgeschwätz«. Als Dahlhaus zurückkam, fragte ich ihn begierig nach dem »Faustus« aus und stellte den Freund empört zur Rede, weil er in der Schweiz nicht auch die »Josephs«-Tetralogie – die es bei uns gleichfalls nicht gab – gelesen hatte. Wirklich schuldbewußt gestand Dahlhaus, in dieser einen Schweizer Woche sei er leider nicht imstande und eben doch irgendwie zu schwach gewesen, neben dem »Doktor Faustus« auch noch die vier Bände der »Josephs«-Tetralogie durchzuarbeiten …
Übrigens waren wir 19- oder 20jährigen Göttinger Studenten ehrlich empört über die hierzulande allmählich erscheinenden Rezensionen. Den Unterschied zwischen akademisch-öffentlicher und publizistisch veröffentlichter Meinung empfanden wir damals als ärgerlich groß. Wie lang ist das alles her – und doch immer noch so gegenwärtig! Die in München erscheinende »Zeitschrift für Europäisches Denken« – also der »Merkur« – veröffentlichte von Walter Böhlich eine vernichtend scharfe, von Hans Egon Holthusen eine anspruchsvolle, herb theologische Kritik am »Doktor Faustus«. »Welt ohne Transzendenz« hieß Holthusens heftiger Angriff, den Hans Paeschke, der Herausgeber, dann gegen erbitterte Proteste vieler Thomas-Mann-Bewunderer verteidigen mußte.
Thomas Mann, der unter Holthusens Aufsatz litt, konnte nicht wissen, daß viele junge deutsche Intellektuelle ganz anders über ihn dachten als jene Arrivierten, die in der Öffentlichkeit das Wort führen durften. Er konnte nicht wissen, daß er andererseits vielen geschockten, älteren deutschen Intellektuellen damals als Symbol genau jener spätbürgerlich-dekadenten und selbstverliebten Vernünftelei erschien, die Ende der zwanziger Jahre das Nazi-Unheil nicht aufzuhalten vermochte. Er konnte nicht wissen, daß die deutsche Intelligenz sich nach der Katastrophe eifrig mit Seins-Fragen und Grenzsituationen beschäftigte, daß existentiell-theologisches Engagement – eine Mischung aus Eliot, Sartre, Camus, Anouilh, Langgässer, Bergengruen, Kasack, Kafka-damals herrschend war. Und er konnte schon gar nicht wissen, daß Hans Egon Holthusen seine Meinung über den »Doktor Faustus« sehr bald radikal ändern und 1963 in einem Poetikkolleg in München zwar die deutsche Nachkriegsliteratur tadeln, dafür aber einen gerührten Hymnus auf Thomas Manns »Doktor Faustus« vorbringen würde! Ich traute meinen Ohren nicht und war Holthusen für die Aufrichtigkeit seiner Kehrtwendung dankbar … Auch die katholisch engagierten, für einen radikal-demokratischen Wiederaufbau plädierenden »Frankfurter Hefte« ließen einen schwungvollen Feind Thomas Manns sein Verdammungsurteil sprechen: Ulrich Sonnemann, selber Emigrant, aus berühmter Zeitungsfamilie gebürtig, schrieb klirrend scharf über »Thomas Mann oder Maß und Anspruch«. Während also der bürgerliche »Merkur« Thomas Mann mit quasi-theologischen Argumenten attackierte: »Welt ohne Transzendenz« – räsonierten die katholischen »Frankfurter Hefte« gesellschaftskritisch fortschrittlich. Sie hatten ihre Schwierigkeiten mit diesem Klassiker des Spätbürgertums, diesem hochgebildeten Artisten, der doch keinerlei Zukunftswege wies. Natürlich erschien auch manches Begeisterte von Sieburg, Bruno E. Werner, Peter de Mendelssohn und vielen anderen. Bald ging es schon gar nicht mehr um schlechte oder gute Zensuren für ein Buch, sondern aus dem Echo wurde eben ein Betroffenheitschor. Da der Roman selber nicht widerspruchsfrei »logisch« argumentiert, gerieten unvermeidlich auch die Betrachter im Laufe der Zeit und der Kontroversen in mannigfache Widersprüche.
Wir haben das ja soeben noch staunend miterlebt. Der verehrte Hans Mayer kam in seinem Vorwort zu Kolbes schönem Thomas Mann/München-Buch »Heller Zauber« auf den »gereizten, scheinbaren Antisemitismus« Thomas Manns zu sprechen. Und er fuhr dann fort, dieser Antisemitismus sei »immerhin manifest im ›Wälsungenblut‹, wie später noch in der Teufelsfigur des jüdischen Impresarios Fitelberg« aus dem »Doktor Faustus«. Daran mag ja etwas sein. Nur als derselbe hochverehrte Hans Mayer in Ost-Deutschland lehrte und dort das Werk des großen Realisten und sozialen Humanisten Thomas Mann gebührend zu beleuchten suchte, las man es bei ihm ein wenig anders über Fitelberg: »Von jenen Polemikern soll man nicht sprechen, die behaupten, hier habe der große deutsche Autor im fernen Kalifornien ein ›antideutsches‹ Buch geschrieben«, befand Mayer. Und fuhr fort: »Das ist ebenso absurd wie der Vorwurf, die Gestalt des Konzertagenten Fitelberg, die Deutschtum und Judentum miteinander konfrontiert, besitze judenfeindliches Gepräge.« Wird also im jüdischen Impresario ein scheinbarer und gereizter Antisemitismus, den man unerfreut beurteilen muß, manifest – so Hans Mayer heute; oder ist ein solcher Vorwurf absurd? – So Hans Mayer damals … Wir haben die Wahl.
Wer sie nicht hatte, war Thomas Mann. »Ich habe es nicht gewollt und habe es doch wohl wollen müssen«, verteidigte er sich, als man ihn auf die Konsequenzen aufmerksam machte, die sich aus der Parallelisierung von Adrian Leverkühns Schicksal und deutschem Schicksal ergäben. Herbert Marcuse faßte das schon 1948 im New Yorker »Aufbau« schneidend witzig zusammen: »so schillert Adrian ein wenig faschistisch und das Dritte Reich ein wenig genialisch. Das Buch entgeht nicht ganz der Gefahr, das Dritte Reich noch nachträglich mit einem Leverkühn zu beschenken«.
Als Thomas Mann den »Doktor Faustus« 1943 in Kalifornien begann, spürte er beklommen, worauf er sich einließ. Früher waren ihm seine großen Romane erst bei der Arbeit groß oder gar riesengroß geworden. Weder die »Buddenbrooks« noch der »Zauberberg« oder die »Josephs«-Romane hatte er so umfänglich und bedeutungstief geplant, wie sie dann gleichsam aus eigenem Antrieb wurden. »Habent sua fata libelli« – Kunstwerke entwickeln sich nach ihrem eigenen Willen, nehmen ihren eigensinnigen, aus den Forderungen der Sache sich ergebenden Verlauf. So ging es sonst immer. Aber beim »Faustus« nicht. Wir ermessen von heute – nachdem wir wissen, wie die Weltgeschichte verlaufen ist – ohnehin kaum, wieviel Thomas Mann riskierte, als er am 23. Mai 1943 einen deutschen Musikerschicksalsroman begann. Serenus Zeitblom, der Chronist und Biograph, macht sich nämlich seinerseits auch genau an diesem Tage an die Arbeit.
Was für ein Wagnis! Thomas Mann verbündet sich mit dem Verlauf der Zeit und eines Krieges, lange bevor feststand, was diese Zeit zeitigen, wie dieser Krieg enden werde. Gewiß, die Alliierten hegten damals die ziemlich sichere Uberzeugung, daß Nazi-Deutschland militärisch verloren sei – aber sie wußten es wahrlich nicht genau und hatten viel zu befürchten. Thomas Mann riskierte es also, einen Erzähler im fernen, imaginierten Freising in eine ungewisse Zukunft losschreiben zu lassen. Dabei fürchtete er durchaus immer, daß die Deutschen »noch Schreckliches anrichten« werden; ahnte allerdings im August 1944, »bis zum Ende des Krieges in Europa werde ich doch nicht mehr fertig«.
Nun haben große Autoren häufig die »offene Form«, das Chronikalische gewählt, um mit ihrer Schriftstellerei den unmittelbaren Tagesereignissen auf der Spur bleiben zu können. Aber daß ein Roman, der dazu keineswegs auf ein offenes Ende, sondern auf den Tod eines Komponisten und das Überleben oder Fertigwerden seines Chronisten hin angelegt ist, sich der unbekannten Zukunft aussetzt – dafür gibt es so leicht keine Parallele.
Gewiß, als Uwe Johnson 1967 an den »Jahrestagen«, jenem großen, vierbändigen Epos zu arbeiten begann, das im August 1967 beginnt und am 20. August 1968 endet – da konnte auch der »Jahrestage«-Autor nicht wissen, daß der 20. August 1968, an dem Gesine eigentlich in Prag, im Lande des Sozialismus mit menschlichem Gesicht ihre neue Arbeit aufnehmen sollte –, daß dieser 20. August sich als ein tragisches, den Roman zwingend abschließendes historisches Datum erweisen werde. Doch in Form eines chronologischen »Jahrestage«-Buches wäre der Roman natürlich auch dann pünktlich und sinnvoll zu Ende zu bringen gewesen, wenn die Russen darauf verzichtet hätten, Prag zu besetzen.
Thomas Mann aber verbündete sich – im Vertrauen auf den Sieg der besseren Sache – mit der unbekannten Zukunft. Er baute die aktuelle Gegenwart, den spannenden Verlauf der Weltgeschichte ein, ließ seinen Zeitblom am 23. Mai 1943 losschreiben, weil er fasziniert war nicht nur vom Stoff des Künstlerromans, sondern weil ihm der schuldhafte Zusammenbruch des genialischen Einzelnen zugleich Bild und Symbol bedeutete für den schuldhaften Zusammenbruch des Deutschen Reiches. Er glaubte an die Zukunft. 1951 erschien im Kohlhammer-Verlag des englischen Autors Randolph Robbins zynischer, sehr geschickt konstruierter Roman »Wenn Deutschland gesiegt hätte«. Da gewann Adolf Hitler den Krieg, weil seine Wissenschaftler die Atombombe erfanden und seine Luftwaffe sie als erste einsetzte. In Frankreich wimmelte es also von strahlenden Kollaborateuren; Hitler, Mussolini und Hirohito waren die Herren der Welt – freilich wurden die Spannungen zwischen Berlin und Tokio immer bedrohlicher. Das Buch war eine spielerische Verwandlungskomödie, es kehrte eine historische Entscheidung um, die glücklicherweise längst gefallen war.
Thomas Mann aber spielte überhaupt nicht, sondern machte die Zukunft zum Stoff des epischen Teppichs, den er gerade zu knüpfen begann. Zeitgeschichtliche Betroffenheit ging unmittelbar in Leverkühns Biographie ein. Aber warum konnte oder sollte das Schicksal eines genialischen Komponisten für Deutschlands Schicksal stehen? Thomas Mann, als zweifle er selber in der Tiefe seines Herzens oder seines Unbewußten an der Triftigkeit dieses Symbols, behauptete es fast zwanghaft wieder und wieder. Wie jemand, der ahnt, sein Thema verfehlt zu haben, beteuert Thomas Mann unablässig, er rede von nichts anderem als eben diesem. So wie Shakespeare oft »Sympathie-Lenkung« vornimmt, betreibt Thomas Mann »Bedeutungslenkung«. Das Symbolische wirkt hier nicht nur aus sich selbst, sondern es wird zudem übereifrig beschworen. »Es war ein Künstlerleben«, so erzählt der Chronist Zeitblom einführend über seinen Freund, »und weil mir beschieden war, es aus solcher Nähe zu sehen, hat sich alles Gefühl meiner Seele für Menschenleben und Menschenlos auf diese Sonderform menschlichen Daseins versammelt … Diese Sonderform gilt mir« – und jetzt führt Thomas Mann die Parallelisierungsthese noch ganz unauffällig ein – »als das Paradigma aller Schicksalsgestaltung …« Das klingt ziemlich unverfänglich. Später geht Thomas Mann weiter. Wenn Leverkühn und Zeitblom im tiefsinnigen 22. Kapitel über die Mischung aus Altmodischem und Kühnem in der Zwölftontechnik reden, dann behauptet Leverkühn plötzlich, alle interessanteren Lebenserscheinungen seien »progressiv und regressiv in einem«. Und nun, um die Brücke vom Künstler zur Politik, vom Kompositionsprinzip zum Triumph des Faschismus bauen zu können, fragt Zeitblom, der eigentlich harmlose Studienrat, raffiniert schlau, ob diese Gleichzeitigkeit vom Regressiven und Progressiven nicht eine Verallgemeinerung von häuslichen, also deutsch-nationalen Erfahrungen sei …
Natürlich hat auch Thomas Mann gewußt, daß die Arbeiten und die Lebensumstände eines elitären, kühlen, an öffentlicher Wirkung uninteressierten, kunstehrgeizigen, paralyse-kranken Komponisten bei Licht besehen wirklich so gut wie nichts zu tun haben mit dem Zusammenbruch Deutschlands. Immerhin spricht Zeitblom von der »Biederkeit, der Gläubigkeit, dem Treue- und Ergebenheitsbedürfnis des deutschen Charakters« – was ja nun alles wirklich auf niemanden weniger zu beziehen wäre als auf Leverkühn. Gleichwohl beharrt Thomas Mann wie gebannt auf seiner Parallelaktion. Er scheut keine Kühnheit, läßt sogar aussprechen, daß die Deutschen aus Einsamkeit und Hochmutsdünkel den Durchbruch zur Welt notfalls kriegerisch erzwingen wollten. Da erinnern wir uns der gleichermaßen forcierten These Fritz Kortners über den Juden Shylock aus Shakespeares »Kaufmann von Venedig«. Shylock suche, laut Kortner, eigentlich ja die Freundschaft, suche im Grunde den Weg zum Herzen Antonios. Und weil er diesen Weg auf humane Weise nicht finden kann, wählt er das andere, blutige Mittel: er will dem Antonio die Brust aufschneiden – weniger, um sich an ihm rächend zu morden, sondern vielmehr, um so zum Herzen des heimlich Geliebten durchstoßen zu können … Was für eine aufregende schöne und absurde Konstruktion. Für ein grandioses Shakespeare-Märchen darfein Regisseur sich dergleichen einfallen lassen: aber sind Hitler-Krieg und Faschismus, diese schlimmen Konsequenzen von Arbeitslosigkeit, verhetzter Massengesellschaft, deutschem Ressentiment, falscher Politik, Versailles und Schwarzem Freitag irgendwie mit Durchbruchssehnsucht und Künstlersorgen zu erklären? Der »Doktor Faustus«-Roman besteht darauf. Er setzt gleich, was sich nicht gleicht. Und hält die These durch bis zum Schluß. Wenn man genau hinschaut, sogar noch demonstrativ im Fazit, in den letzten Worten. Sie lautet: »Ein einsamer Mann faltet seine Hände und spricht: Gott sei eurer armen Seele gnädig, mein Freud, mein Vaterland«.
Dieser symbolisierende Gleichsetzungszwang, diese Aufwertung des syphilitischen Genies Leverkühn, dem – wie Thomas Mann später forderte – »Mitleid zukomme, denn schließlich ist er ein Mensch, der das Leid der Epoche trägt«, das alles stellt keinen tragischen Tick dar, keine generalisierende Dichtermarotte – sondern eher eine Regression Thomas Manns zu seinen Anfängen. Thomas Mann warf die verhängnisvolle Mixtur aus Altertümlichkeit und Avanciertheit ja nicht nur den Deutschen und der teuflischen Zwölftontechnik vor, sondern der »Doktor Faustus« vibriert als Werk, als Parodie und als Bekenntnis, wahrlich auch selber von dieser Mischung. So wenig nämlich diese Gleichheitsbeschwörung sich ergibt, wenn man mit modernem Zeitgeschichtlerblick das Dritte Reich, den Zweiten Weltkrieg betrachtet, die Machtergreifung Hitlers und die Banalität des Bösen, sowie die Zwänge einer von Arbeitslosigkeit bedrohten proletarischen Massengesellschaft – so stimmig wird die Verbindung, wenn eine dichterisch empfindsame Wahrnehmung, wenn eine poetische und romantische Seele den Zusammenbruch von 1945 vergegenwärtigt. Der Zusammenbruch einer faschistischen Diktatur hat nichts mit Teufelspakt und genialer Leverkühnscher Tragik zu tun – doch falls 1945 jenes »ewige Deutschland«, wie es der junge Thomas Mann der »Betrachtungen eines Unpolitischen« von 1918 gegen den Geist westlicher Zivilisationsdemokratie gefeiert und zweifelsvoll-pessimistisch verteidigt hat, höllisch zugrunde gegangen wäre, dann wäre die symbolische Parallele sinnfälliger! Der »Doktor Faustus« ist schon ein vertracktes Schicksalsbuch: Betrachtet man den Leverkühn und Deutschland mit aufgeklärtem, nüchtern-demokratischem Blick, dann stimmt die Gleichung nicht. Dann wirkt sie trüb und schicksalsgläubig forciert. Nimmt man jedoch jene Haltung ein, über die Thomas Mann intellektuell hinaus war, über die er aber gefühlsmäßig nicht hinauskam, hängt man an der romantischen Idee des ewigen Deutschlands, dann stellt Leverkühn, der sich zur schöpferischen Enthemmung dem Teufel verschreibt, zwar nicht logisch, wohl aber poetisch als plausible Metapher für den scheiternden Genius unseres Volkes dar. Diese Metapher ist wahrlich mehr dichterisch als realistisch aufklärerisch. Sie war uns Deutschen freilich nach dem Zweiten Weltkrieg noch viel selbstverständlicher als heute, da ein ziemlich materialistisches Klima es nahelegt, den Staat eher mit einer GmbH zu verwechseln. Damals, 1948, schrieb Karl Krolow ein Gedicht mit dem Titel »Lied, um sein Vaterland zu vergessen«, wo das »alte herbe Wort Deutschland« mächtig durchtönt. Damals dichtete Ingeborg Bachmann im »Frühen Mittag«:
Wo Deutschlands Himmel die Erde schwärzt,
braucht sein enthaupteter Engel ein Grab für den Haß
und reicht dir die Schüssel des Herzens.
Auf solche Weise unternahm es also Thomas Mann, im zugrundegehenden Musiker seine unaustilgbare Idee des ewigen Deutschland weniger zu gestalten als zu beschwören. Damit stellte er sich als Autor die schwerste Aufgabe seines Dichterlebens: Deutschlands Untergang einerseits im Spiegel eines Komponistenlebens als rührendes Schicksal und andererseits als entsetzlich barbarisches Dummheitsschicksal zugleich erscheinen zu lassen. Logisch war das nicht lösbar. Mit logischer Rechthaberei aber kommt man dem Kunstprodukt einer solchen spannungsvollen Aporie, einer derartigen Erkenntnis- und Gefühlsnot überhaupt nicht – oder bloß triumphal-töricht bei.
Alles bisher Angedeutete läuft aufs betroffene »Aufwiegeln« eines Künstlerromans hinaus. Adrian Leverkühns Leben, das von 1885 bis 1941 dauerte, wird im Flammenschein der letzten beiden Kriegsjahre berichtet und gesteigert zum Symbol für den Zusammenbruch des ewigen, weltscheuen, stolzen, sich mit dem Hitler-Teufel verbündenden Deutschland. Was wird nun ein 68jähriger Autor zu tun versuchen, der seinen Stoff so ungeheuerlich zum deutschen Menschheitsdrama aufwiegeln wollen muß? Nun, er wird nach Mitteln Ausschau halten, die Sache auch irgendwie »abzuwiegeln«, und er wird nach Helfern suchen für seine Riesenarbeit. Die Abwiegelung hat im »Doktor Faustus« einen Namen, sie heißt: Serenus Zeitblom. Und auch der Helfer hat einen Namen: Theodor Wiesengrund Adorno.
Fangen wir mit Zeitblom an. Lange vor dem »Doktor Faustus« hat Thomas Mann, bemerkenswerterweise ohne die Zwischenschaltung eines liebenswürdig-harmlosen Erzählers, ein Künstlerschicksal beschrieben, nämlich den Tod des pflichtgetreuen, aber der platonischen Liebe zu einem Knaben und der Cholera erliegenden Gustav von Aschenbach. Es war die Geschichte der Auflösung einer Haltung, einer produktiven Selbstdisziplin. Es war die Tragödie des künstlerischen Leistungsethos. Auch Aschenbach durfte keinen wahren Freund, kein Du, keine unbeschwerte Jugend haben. Sondern nur die Kunst, und dann den Tod. Kein Wunder, daß dieser »Tod in Venedig« auch als hellsichtige Kritik an preußischer Haltung begriffen werden konnte, geschrieben zu einer Zeit, da Preußens Gloria strahlte. Im »Tod in Venedig« ergab sich das Symbolische von selbst, es war ein Schatten der Gestalt, des Gestalteten. Bei der Gegenüberstellung dieser Todeserzählung und des »Faustus«- Romans erkennen wir: die Wirkung der frühen Novelle hing mit der herben Ernsthaftigkeit der Darbietung zusammen. Gewiß, es gab auch beim »Tod in Venedig« hohen Ton und Rausch. Jede Begebenheit fügte sich fast zu gut in einen Bedeutungs- und Symbolkosmos ein, führte gleichsam ihr Maskierungsleitmotiv wie eine Lizenz, eine Visitenkarte vor. Doch dem »Tod in Venedig« fehlte die Ironie, die Durchheiterung, die gut gemachte, sei’s nachsichtige oder unnachsichtige Verspottung von Eitelkeiten, Affektiertheiten, Gebrechen. Die Novelle war das erste große Thomas-Mann-Werk ohne alles drollig Christian-hafte der »Buddenbrooks«, ohne allen Spinell-Klöterjahn-Witz, ohne Tonio-Kröger-Anekdoten, Zauberberg-Brillanz oder heitere Joseph-Gelassenheit … Also ohne jene ausführlich malende, amüsant treffsichere, behagliche Ironie, an die Thomas Mann sein Publikum gewöhnt hatte. Dafür vollzog sich Aschenbachs Schicksal als Exemplum antikisch tragischer Ironie.
Im »Doktor Faustus« fühlte sich Thomas Mann gezwungen, nach soviel Stoff-Aufwiegelung« bei der Darbietung abzuwiegeln. Darum erfand er den Serenus Zeitblom und ließ ihn erzählen. Thomas Mann beteuerte immer wieder, es wegen des heiteren Kontrastes zu tun, sonst werde die Sache zu düster. Doch diese Erklärung befriedigt nicht. Näher liegt eine andere: Thomas Mann ging es darum, den dämonischen Vorgang von einem erschrockenen Humanisten vortragen zu lassen, ihn auf diese Weise zu humanisieren, so wie Thomas Mann selber als heiterer Erzähler im »Joseph« den Mythos zu humanisieren versucht hatte. Der alte Dichter traute sich eben nicht unmittelbar an den schicksalhaft aufgewiegelten Stoff heran und wiegelte ihn nun wieder planvoll, meisterhaft, aber manchmal auch allzu nett-verharmlosend ab. Der gutmütige, gutartige Dr. phil. Serenus Zeitblom mag für die Entstehung des Romans unumgänglich gewesen sein, aber eine bildungsbeflissene Zumutung ist er halt auch. Gewiß, der sinnt erfindungsreich den Worten nach, berichtet ergreifend, wie sein Freund von der tiefen Nacht in die tiefste – nämlich vom Wahnsinn in den Tod gegangen. Aber wie reimt sich das mit Zeitbloms karikaturnah umständlichem Gerede – seine Hochzeit und Ehe beispielsweise erläutert unser Freund ein wenig seltsam: »Frühzeitig … habe ich mich vermählt. – Ordnungsbedürfnis und der Wunsch nach sittlicher Einfügung ins Menschenleben leiteten mich bei diesem Schritt. Helene, geb. Ölhafen, mein treffliches Weib …« Und in dieser Art weiter. Zugegeben, ein sanft karikierter betagter Oberlehrer mag vielleicht so reden. Doch wenn eben dieser Oberlehrer dann im Verlauf des Romans über Thomas Mannsche Differenziertheit und Psychologie verfügt, wenn er Figuren wie den Schildknapp ungeheuer sinnfällig und treffend zu durchschauen und zu charakterisieren vermag, dann scheint die Einheit der Figur nicht nur strapaziert, sondern zerstört. Dann hört die Rollenprosa, die gewiß nicht als allzu enge Verpflichtung begriffen sei, ganz auf. Die Alternative ist ärgerlich: entweder haben wir es mit einem halbwegs stimmigen, biederen Langweiler zu tun, oder mit einem brillanten Stilbruch, der schreiben kann wie Thomas Mann. In seltsame Verlegenheit gerät Thomas Mann, wenn Zeitblom, der einerseits kein Nazi, andererseits doch ein vom Luftkrieg betroffener Deutscher ist, blödsinnig manieriert über den Fortgang der Katastrophe salbadert: »Unsere zerschmetterten und zermürbten Städte fallen wie reife Pflaumen. Darmstadt, Würzburg, Frankfurt gingen dahin, Mannheim und Kassel, Münster gar, Leipzig bereits gehorchen den Fremden.« Das ist eine trotz der vielen Ortsnamen ortlose Sprechweise. Auch als pointierte Stilisierung macht diese Ausdrucksart niemanden und nichts erkennbar oder glaubhaft: weder den betroffenen Philologen noch den Anti-Nazi, noch den verwirrten Konservativen.
Man spürt nicht ohne Mitgefühl, wie Thomas Mann sich anfangs beim Zeitblom in hilfreiche, ironische Umständlichkeit flüchtet. Je weiter aber der Roman fortschreitet, desto ergriffener gibt Thomas Mann die Rollenprosa auf, desto sympathischer, herzbewegender wird Zeitbloms Leiden und Mitleiden. Die Darstellung von Schwerdtfegers Freundschaftsbetrug, von Leverkühns Ende, ist Prosa großen Stils. Übrigens: Jene Höllenschilderung, die allerdings Leverkühn selber bei seiner Aufzeichnung des Teufelsgespräches entwirft, scheint mir nicht nur im »Doktor Faustus«, sondern im Gesamt werk von Thomas Mann ohne Vergleich.
Es ist aufregend, nachzukonstruieren, wie Thomas Mann es sich möglich machte, in beträchtlichem Alter den schwersten und gewichtigsten Stoff seines Lebens zu bewältigen. Offenbar benötigte er die Abwiegelung durch einen lieben Humanisten, um sich an die hochaufgewiegelte Komponistenstaatsaktion überhaupt heranzutrauen. Weil aber der »Faustus«-Roman trotz aller kunstvollen Symbolik ein realistisches Buch ist, das von gewaltiger Lebenserfahrung, von Durchdachtem und Erlittenem vibriert, wirken die umständlichen Pretiositäten dieses Zeitblom allzu absichtsvoll und amüsierwillig. Sie sind genauso pedantisch und heiter-verspielt wie die gleichfalls nicht übermäßig komischen Parodien des groben Luther-Deutsch im Munde kraftstrotzender Theologen. Gewiß läßt sich entgegnen, auf das traditionelle Kunstziel der »Einheit des Charakters« käme es in einem solchen Endzeitroman nicht an. Doch warum eigentlich nicht? In einem Werk wie dem »Doktor Faustus« mag essayistische Fülle die Lebensäußerungen mancher Gestalten überwuchern – trotzdem müßten die wichtigen Gestalten des Romans grundsätzlich kenntlich und konsistent sein. T. S. Eliot durfte in der »Cocktail Party«, einer Komödie mystisch-surrealistischer Art, seine Hauptfiguren antinaturalistisch gespalten und verdoppelt vorführen. Doch der späte Thomas Mann hatte und äußerte im Zusammenhang mit Hatfields Realismus ein anderes Credo: »Wir mögen stilisieren und symbolisieren so viel wir wollen – ohne Realismus geht’s nicht. Er ist das Rückgrat und das, was überzeugt.« Aber an diesem Rückgrat fehlt es Zeitblom, weil er zugleich Mensch, Hilfskonstruktion und Sprachrohr sein muß.
*
Der »Doktor Faustus« ist der musikerfüllteste und intelligenteste Künstlerroman der deutschen Literatur, wenn nicht der Weltliteratur. »Das Städtchen Eschenbach liegt ganz flach in der Ebene. Es ist ein übriggebliebenes Stück Mittelalter, aber die Fremden kennen es nicht, es ist stundenweit von der Bahnlinie entfernt …« – so beginnt allerdings nicht der »Doktor Faustus«, sondern, atmosphärisch erstaunlich ähnlich, Jakob Wassermanns Musikerroman »Das Gänsemännchen«. Vergleicht man nun Wassermanns schönes, im Hinblick auf die Rolle der Musik eher verschwommenes und unkonkretes Buch, von dessen Ungenauigkeit sich Thomas Mann distanzierte, mit dem »Doktor Faustus«, dann tritt überwältigend zutage, um wie vieles näher Thomas Mann der Musik stand, um wie vieles eindringlicher er Musikverläufe zu verbalisieren wußte, wie unvergleichlich viel reicher sein dreißig Jahre nach Wassermanns Musikerroman erschienenes Spätwerk ist.
In den ersten sieben Kapiteln des »Doktor Faustus« wird eine deutsche, provinzielle Jugend geschildert: das Erwachen eines musikalischen Menschen. Rasch wird ein mächtiges Musik-Crescendo, ein vielbesagender Höhepunkt erreicht: die Vorträge des stotternden Wendeil Kretzschmar über Beethovens Opus 111, über Beißeis archaisch primitive Musik. Damit haben der Erzähler und Adrian viel Stoff, charakteristische Gespräche zu führen und Leitmotive für den ganzen Roman zu exponieren. Im elften Kapitel erfolgt der erste große Einschnitt: Adrian beginnt sein Theologiestudium in Halle an der Saale. Nun tritt die Gottesgelehrsamkeit und die mit ihr eng verknüpfte Existenz des Teuflischen beherrschend hinzu. Der junge Student Adrian holt sich im Bordell eine tödliche Infektion. Nach dem herausragend intensiven Musikgespräch im 22. Kapitel beginnt Adrians Leben in und dann bei München. Er ist ein sich langsam durchsetzender Avantgarde-Komponist. Sein ästhetischer Scharfblick, sein, wie Zeitblom es meisterhaft nennt, ästhetisches »Scharfgefühl« läßt ihn immer gewagtere Kunstabenteuer bestehen. Fürs riesige, alles entscheidende Teufelsgespräch erträumt sich Adrian in Italien einen Mephisto, der anfangs so aasig glatt spricht, als erinnere sich Thomas Mann da an seinen einstigen Schwiegersohn Gustaf Gründgens. Während des Zwölftondialoges aber verwandelt sich der theoretisierende Teufel unverkennbar in den Professor Adorno. Diesem Teufel vermacht also Adrian alles mitmenschliche Alltagsglück und sein ewiges Leben – um der radikal befreiten künstlerischen Produktionstätigkeit willen.
Adrian bleibt stets am Rande der Münchner Gesellschaft, die nach 1918 gewisse archaische, antidemokratische Faschismus-Haltungen immer anziehender und origineller zu finden als schick erachtete. Zwei unglücklich endende Liebesepisoden, die nicht eigentlich stattfinden dürfen, ein geliebtes Kind, das sterben muß, eine Reihe von bedeutenden Werken, endlich Wahnsinn und Tod: das ist – hier kurz und als oberflächliche Erinnerungshilfe zusammengefaßt – der äußere Ablauf, den Zeitblom in seiner Freisinger Klause seit 1943 chronikalisch zu Papier bringt. Daß die Musik den weitaus wichtigsten Kontrapunkt bildet zum historischen und menschlichen Geschehen in Kaisersaschern, München und Pfeiffering, macht bereits eine so knappe Rekapitulation deutlich. Warum aber beklagen sich auch die geduldigsten und gebildetsten Thomas-Mann-Leser, sie hätten bei aller Bewunderung im einzelnen die Bedeutung und Stichhaltigkeit der musiktheoretischen Erörterungen im Ganzen nicht wirklich verstehen oder nachvollziehen können?
Meine Antwort lautet: Weil die Musikphilosophie im »Doktor Faustus« in sich selbst nicht völlig stimmig ist, nicht schlüssig: weder als Theorie modernen Komponierens, noch auch als einleuchtende poetische Metapher für einen Welt- und Seelenzustand. In dem Buch stehen überwältigende Passagen über Beethoven oder über den Charakter des jungen Geigenvirtuosen Schwerdtfeger, den Thomas Mann so genial produktiv anzuschauen und so liebevoll zu durchschauen wußte, daß wir den Eindruck haben, in diesem einen Geiger habe Thomas Mann nicht nur seinen einstigen Münchner Freund, sondern auch den typischen Habitus heutiger Konzertmusiker wie Thomas Brandis oder Kurt Guntner rätselhaft getroffen. An wunderbaren Schilderungen musischer Details fehlt es nicht. Und es beeinträchtigt die Herrlichkeit der innigen Seiten über Beethovens Opus 111 kaum, daß die Begründung der Spätstil-Exegese eher stilistisch als sachlich beeindruckt. Von kahlen, stehengebliebenen, den Tod verkündenden Konventionen ist da grandios die Rede. Doch diese erbaulichen Einsichten, die Thomas Mann von Adorno geschenkt worden waren, stimmen mit dem Sachverhalt bei Beethoven eigentlich wenig überein. In der klassischen Periode, zur Zeit des Violinkonzertes, der 5. Symphonie und der Appassionata kam Beethoven wahrlich mit noch viel simplerem, kahlerem Material aus – mit noch viel konventionelleren Dreiklangsbrechungen und Akkordumspielungen als in der durchaus widerborstigen, rhythmisch und harmonisch tiefsinnig durchkalkulierten Sonate Opus in, deren Geheimnisse Heinrich Schenker so faszinierend materialnah entschlüsselt hat.
Nun ist es in einem Roman ziemlich irrelevant, ob sich Interpretationsspekulationen musikologisch anfechten lassen oder nicht. Aus den Beethoven-, Schubert- oder Wagner-Beschwörungen Thomas Manns spricht unverkennbar hellsichtiges Interesse, passionierte Liebe. Wenn dergleichen im Roman zur erkenntnisvermittelnden Huldigung umgeschmolzen wird, dann findet Musik eben ihr Echo in Dichtung …
Doch wie verhält es sich mit der modernen Musik Leverkühns? Auch da wäre zunächst einzuräumen, daß ein Roman nicht der Ort zu sein braucht, wo man sich exakte Informationen über die Entstehung und Bedeutung der Zwölftontechnik holt. Die Dodekaphonie, also die Reihentechnik, spielt im »Doktor Faustus« die Rolle eines Befreiungselixiers, gewonnen gleichsam aus der Wiener atonalen Hexenküche. Anfangs war Leverkühns Komponieren bedroht von klassizistischer und parodistischer Unfruchtbarkeit. Nach der teuflischen Infektion, nach der Entdeckung der Dodekaphonie, findet er erregende und selbständige Wege.
So war es nun bei Schönberg überhaupt nicht – aber darauf kommt es gewiß kaum an. Schönberg entwickelte die Dodekaphonie als ein formales Bewältigungsmittel des vorangehenden freien hochdramatischen Expressionismus: Er setzte also dem Überdruck und Überausdruck sein zähmendes System entgegen. Leverkühn indessen setzt dieses System einem Mangel an Druck