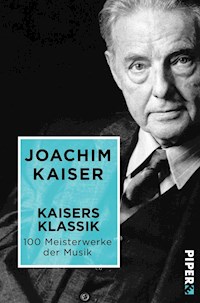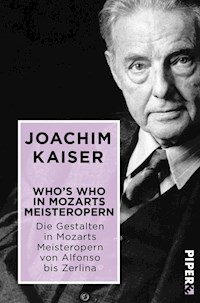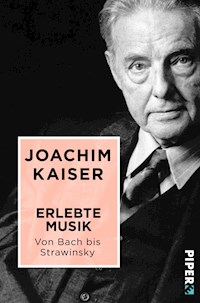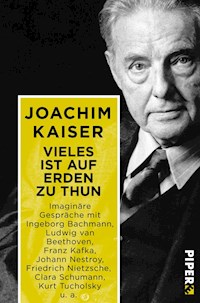14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwölf Zeitgenossen Joachim Kaisers porträtiert aus seiner Sicht: Theodor W. Adorno, Ingeborg Bachmann, Wilhelm Backhaus, Maria Callas, Pablo Casals, Wilhelm Furtwängler, Gustaf Gründgens, Walter Maria Guggenheimer, Fritz Kortner, Arthur Rubinstein, Friedrich Torberg, Wieland Wagner. Kaiser kannte sie alle, hier erfahren Sie eine persönliche Würdigung, dieser denkwürdigen Begegnungen, die ihn berührt und geprägt haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Vorbemerkung
Elf der zwölf Porträts dieses Buches entstammen einer Sende-Reihe, die ich im Auftrag und mit liebenswürdig fordernder Unterstützung von Dr. Rudolf Riedler für den Bayerischen Rundfunk gemacht habe. Das Porträt meines alten Freundes und Vorbilds Dr. Walter Maria Guggenheimer wurde eigens für diese Publikation verfaßt. Ohne die von vielen Hörern immer wieder vorgetragene Bitte nach dem Text der rasch verklungenen Porträts wäre dieses Büchlein nicht entstanden.
J. K.
Vorwort
Risiken des Sich-Erinnerns
Wenn man jung ist und wissensdurstig, schätzt man die präzise Analyse, die originelle, sorgfältig belegte These, die kluge, wissenschaftlich fundierte Theorie. Und mißtraut dem schmunzelnden Sich-Erinnern betagter Herren, die allzu gern Anekdoten zum besten geben. Der alte Hellmuth von Glasenapp zum Beispiel, der ein erschrekkend gebildeter vergleichender Religionswissenschaftler war und beschämend viele Sprachen sprach, er erzählte gegen Ende seines Lebens – selbst vom Katheder aus – eigentlich nur noch Anekdotisches, charakteristisch belustigende Geschichten, die berühmten Leuten passiert waren. Als junger Student fand ich das ein wenig sonderlich, ja senil (aber einige der Anekdoten habe ich behalten bis auf den heutigen Tag).
Ältere Akademiker mißtrauen dem rapiden Scharfsinn, der brillanten Um-Interpretation. Sie lesen’s mit Vergnügen und glauben kein Wort. Denn ein Gedanke, der nicht nur wahrhaftig sein will, sondern auch als zündend originell auffallen möchte: er nimmt immer in Kauf, übermütig oder modisch anti-modisch oder beides zugleich zu sein. Wenn man den Betrieb ein paar Jahrzehnte mitgemacht hat, weiß man, wie schnell das alles verwelken kann.
Aber es führt nicht sehr weit, die anekdotische Erzählung, die etwas übers Lebendige aussagt, und die streng analytische Bemühung, die etwas über eine intellektuelle oder künstlerische Gestalt aussagt, gegeneinander auszuspielen. Beides hat sein Daseins-Recht. Der Sich-Erinnernde und der Analysierende müssen nur eben mit-bedenken, welche Risiken sie eingehen. Sowohl die mögliche Kritik wie auch das mögliche Vergnügen am Sich-Erinnern schwingen mit in der wunderbar tiefsinnigen Wortkoppelung, jemand sei, rede oder schreibe »erinnerungsselig«.
Nun ist es aber gar nicht so leicht, den eigenen Erinnerungen gewissermaßen überlegen zu sein – sich also davor zu hüten, sentimental zu fälschen, neunundneunzig mal Erzähltes bei der hundertsten Wiederholung nicht so wiederzugeben, daß die erstarrte letzte Fassung an die Stelle der Sache selbst tritt. Skepsis und ein gutes Archiv können da vielleicht helfen.
Tückischer noch sind beim Sich-Erinnern diejenigen Gefahren, in denen man ganz gern umkommt. Die Gefahren der Verklärung. Kaum ein Mensch kann Zeiten, da er jünger war, da er hoffte, da er etwas – auch sich selbst – »werden« spürte, vergegenwärtigen ohne beschönigende Sentimentalität. Glück scheint meist nur als Vergangenes faßbar, beschreibbar, evozierbar. Wir sind kaum je glücklich, waren es nur.
Darum haftet an Vergangenem fast unvermeidlich ein Moment von Seligkeit. Das »Es war einmal«, die strenge Unumkehrbarkeit des Zeitverlaufs und ein undeutliches Gefühl des Davongekommen-Seins fügen sich zusammen zur Rückblicks-Sentimentalität. Poeten lieben es, diesem Erinnerungszauber wehmütig zu verfallen. Oft wollten sie ihn gar nicht meiden: Hugo von Hofmannsthal bannte die feste, unbetretbare Vergangenheit und die bewegte Gegenwartszeit, an die man – wie Odysseus gegenüber den Sirenen – gefesselt ist, in ein schönes, archaisch üppiges Traumbild:
Ein namenloses Heimweh weinte lautlos
In meiner Seele nach dem Leben, weinte,
Wie einer weint, wenn er auf großem Seeschiff
Mit gelben Riesensegeln gegen Abend
Auf dunkelblauem Wasser an der Stadt,
Der Vaterstadt vorüberfährt. Da sieht er
Die Gassen, hört die Brunnen rauschen, riecht
Den Duft der Fliederbüsche, sieht sich selber,
Ein Kind am Ufer stehn…
Berühmt sind die großen Wehmuts-Sätze, mit denen Ernst Jüngers Erzählung Auf den Marmorklippen beginnt, trotz des vielleicht etwas zu bewußt drapierten epischen Faltenwurfs, trotz der unübersehbaren Proust/Benjamin-Nachfolge:
»Ihr alle kennt die wilde Schwermut, die uns bei der Erinnerung an Zeiten des Glückes ergreift. Wie unwiderruflich sind sie doch dahin, und unbarmherziger sind wir von ihnen getrennt als durch alle Entfernungen. Auch treten im Nachglanz die Bilder lockender hervor; wir denken an sie wie an den Körper einer toten Geliebten zurück, der tief in der Erde ruht und der uns nun gleich einer Wüstenspiegelung in einer höheren und geistigeren Pracht erschauern läßt…«
Nun läßt sich die Verklärung einer vergangenen Zeit radikal vermeiden, indem man sich aus der hochspielenden Sentimentalität in herunterspielende Ironie rettet. Indem man also aus der Ironie eine Haltung macht, die vor Gefühlsduselei bewahren soll.
Wer sich so – ironisch – an die Jahre, die er kennt, zurückerinnert, an Künstler, die er bewundernd sah und hörte, an Autoren, deren öffentliches Berühmtwerden oder geheimes Scheitern er miterlebte, der gibt aber der Versuchung nach, sich mit Hilfe späterer Einsichten von seinem einstigen Ich zu distanzieren, von mittlerweile naiv oder falsch wirkenden einstigen Ansichten vorsichtig und elegant abzurücken. Doch auch Ironie verzerrt. Wer vergangene Gedanken, Begeisterungen oder Entrüstungen lässig-maliziös als längst durchschaute Irrtümer preisgibt, betont im Bewußtsein sicherer Resonanz, wie fabelhaft schonungslos ehrlich er mit sich umgeht, und wie richtig er nunmehr auf der Höhe der Zeit steht.
Kein Wort gegen die Möglichkeit neuer Erfahrungen und Korrekturen – sie gehören zum Lebendig-Sein. Aber Zeichen des Lebendig-Seins sind sie doch wohl nur dann, wenn es sich um eigene Erfahrungen handelt, wenn sie wirklich einer neuen Überprüfung, einer neuen Nachdenkmühe entspringen. Wenn sie also nicht nur das wären, als was sich die späteren »Korrekturen« so oft durchschauen lassen: Nämlich sanft opportunistische, unauffällig-tonfallschwindelnde Angleichungen an die opinio communis, die machtvoll vorschreibt, was im jeweiligen Zirkel über welchen Künstler zu denken sei. Ich habe schon zu oft berühmte und andere Leute (auch mich selbst) von enthusiastischen Bekenntnissen unauffällig abrücken oder wütende Abweisungen in respektvolle Anmerkungen umbiegen sehen – falls eben nur der Zeitgeist oder eine geachtete Sperrminorität andere Qualitätsmarken festlegte, neu festlegte –, um nicht zu wissen, was für ein entscheidender Unterschied besteht zwischen dem taktisch klugen und einsichtsvollen Benützen vorhandener Argumente und der Evidenz einer neuen eigenen Erfahrung. Diesen Unterschied läßt Ironie hübsch unmerklich verschwinden, falls sie vergangene Euphorie mit gegenwärtiger Informiertheit und schlauer Rückversicherung in die Zukunft geschickt zu verbinden versteht.
Jeder Sich-Erinnernde läuft also Gefahr, unvorsichtig sentimental oder vorsichtig ironisch zu sein. Vielleicht sind Erinnerungen in gewisser Weise sogar nur subjektive, pointierte Erfahrungen, Relikte gelebten Lebens, die man weiterreicht, damit andere sie, falls sie überhaupt etwas damit anfangen wollen, belustigt oder belästigt in ihrem eigenen Denken, Fühlen, Wissen zum Material objektivieren können.
München, im Dezember 1984
Joachim Kaiser
Theodor W. Adorno
Theodor Wiesengrund, der sich lieber nach dem Namen seiner Mutter, der Tochter eines französisch-korsischen Offiziers, Adorno nannte, wurde 1903 in Frankfurt geboren, und er wuchs in höchst kultivierter, großbürgerlicher Umgebung auf. Daß er im Frankfurter Gymnasium der primus omnium, also immer der beste Schüler von allen war, wird niemand bezweifeln, der Adorno auch nur ein einziges Mal beim Sprechen und Denken erlebt hat. Und daß seine weniger intelligenten Mitschüler sich über ihn gelegentlich lustig machten, ihm ein Spott-Schild anhängten, welches er gar nicht bemerkte, während er im Pausengespräch mit dem Lehrer über den Schulhof schritt – auch das glaubt man sofort. Warum sollte der genialisch intelligente Junge, wenn es etwas Interessantes zu bereden gab, Sinn haben für dummen Firlefanz. In der »Süddeutschen Zeitung« antwortete er, ein paar Jahrzehnte später, gelegentlich einer Silvester-Umfrage an Prominente, auf meine etwas läppische Provokation: »Wann hört für Sie die Gemütlichkeit auf?« – sehr einleuchtend: »Beim Prosit auf ebendieselbe …«
Dann studierte der junge Mann Musik, Philosophie, dann befreundete er sich mit Walter Benjamin, dann wuchs seine Intelligenz so enorm, daß der berühmte Frankfurter Internist Vollhard, mit dem Adorno zusammenkam und in dessen Haus kluge Leute wie der Ethnologe Prinzhorn oder der Germanist und George-Schüler Friedrich Gundolf verkehrten, daß also der alte Vollhard entmutigt, aber lächelnd zu Adorno sagte: »Junger Mann, Sie sind für mich zu schlau. Ich verstehe Sie nicht.«
Adorno war Jude. 1933 machte er wohl noch einen einzigen verängstigten Versuch, welchen seine Kritiker ihm später oft vorhielten, sich dem Geist der Zeit irgendwie anzupassen. Aber das Schicksal des Alban-Berg-Schülers und Schönberg-Bewunderers, der über den Philosophen Husserl promoviert und der – über Kierkegaards in sich kreisende Philosophie – eine wunderbar eindringliche Habilitationsschrift geschrieben hatte, stand fest. Er mußte emigrieren.
Zuerst Oxford, dann, nach 1938, das Institut für Sozialforschung in New York. Kunstsoziologische Tätigkeit auch in Princeton und Los Angeles. Frederick Pollock, Herbert Marcuse und viele andere Intellektuelle der linksakademischen Szene waren damals seine Freunde.
Aber 1949 zog es ihn, der viel »deutscher« war, dachte und fühlte als die allermeisten nie-emigrierten Deutschen, zurück in die alte Heimat. Er ging nach Frankfurt an die Universität, ans Institut für Sozialforschung. Das war übrigens damals gar nicht so leicht. Und wie stolz Adornos lebenslanger Freund und Kollege, der etwas ältere Max Horkheimer, darüber war, daß Präsident Truman, Horkheimers längerer Rückkehr wegen, die sich juristisch für einen jungen amerikanischen Staatsbürger gar nicht so einfach bewerkstelligen ließ, daß also Truman eigens eine »Lex Horkheimer« unterschrieb, die es dem Professor Horkheimer gestattete, auch ohne Rückkehr-Unterbrechungen für die Dauer nach Frankfurt zu gehen und dort Universitäts-Rektor zu sein – nur die können den Stolz auf diese Lex Horkheimer ermessen, die den alten Horkheimer und den etwas jüngeren Adorno darüber schwärmen hörten…
So begann in Frankfurt 1949 die Wirkung eines Mannes, eines Denkens, eines künstlerischen Empfindens und eines Lehrens, von deren phantastischem Ausmaß man sich heute gar kein hinreichendes Bild mehr machen kann.
Für diejenigen, die das alles sozusagen nur von außen miterlebten, die den Adorno und seine Schüler nur an ihren Aktivitäten, an ihrer etwas manieriert scheinenden Sprechweise erkannten, muß das Ganze ziemlich verwirrend gewesen sein. Alfred Andersch nannte Adorno – seiner Originalität und seines Ranges wegen – eine »Jahrhundert-Figur«. Aber wie wirkte diese Jahrhundertfigur wohl auf Menschen, die damals keine Studenten mehr waren, die nur gelegentlich mit soziologisierenden jungen Leuten, Diskussionsrunden, Adorno-hörigen Studenten zusammenkamen, deren Dialektik sie nicht ganz kapierten, deren theoretischer Überlegenheit sie kaum gewachsen waren und deren negativ-kritischer Besserwisserei sie sicherlich irgendwie und nicht ganz zu Unrecht mißtrauten?
Von Adorno wußte man, daß er furchtbar intelligent sei. Als enorm scharfsinnig zu gelten, ist hierzulande kein Lob – wobei ich, offen gesagt, nie begriffen habe, warum man jemandem aus Intelligenz oder gar sehr großer Intelligenz einen Vorwurf machen kann, wenn der Betreffende seinen Scharfsinn ohne Tricks und ohne rattenfängerischverführerische Manipulation benutzt. Solange es um Gedanken geht, um Wahrheit, um Kritik am falschen Bestehenden und richtigen Wünschbaren – ist hohe Intelligenz doch zweifellos besser als niedrige. Adorno galt also, nach außen, als höchst intelligent – obwohl er sehr viel naiver, ungeschickter, begeisterungsfähiger, unmittelbarer und freundschafts-, ja liebesbedürftiger gewesen ist, als die dachten, die ihn nur obenhin kannten.
Was wußte man sonst noch so allgemein von Adorno? Daß er zusammen mit Horkheimer ein schwieriges Buch über die »Dialektik der Aufklärung« verfaßt hat. Daß er eine »Philosophie der Neuen Musik« geschrieben hat, die überhaupt bloß musikalischen Fachleuten zugänglich war – und wahrscheinlich selbst diesen nicht. Daß er ein Buch über, wenn nicht gegen Richard Wagner verfaßt, daß er über Gustav Mahler und über seinen Lehrer Berg sowie über Schönberg geschrieben hat.
Er sprach auch viel im Rundfunk, später im Fernsehen, hielt Vorträge, brillierte. In der Soziologie wandte er sich gegen den statistik-gläubigen Positivismus, trat er für inhaltliche, qualifiziert interpretierte Aussagen ein. Die »Negative Dialektik« war sein kritisches Hauptwerk: darin – aber das ging über den Horizont der Öffentlichkeit weit hinaus – begründete er, knapp gesagt, warum der Geist heutzutage sich selbst keine positiven Normen setzen, wohl aber falsche Wahrheiten durchschauen könne. Dann kam noch eine großangelegte ästhetische Theorie – und dann, bevor sie ganz fertig war, kam im Jahre 1969 der Tod.
Die große Öffentlichkeit nahm damals gewiß weniger die Bücher oder ihre Inhalte wahr als den Kampf, der Adorno von der APO-Generation aufgezwungen wurde. Halbnackte Studentinnen stürmten auf ihn ein und machten den kleinen, ungeschickten, ältlichen Professor ängstlichverlegen. Sein Schüler Krahl donnerte auf einer öffentlichen Veranstaltung mit Schaum vor dem Mund gegen ihn und entschuldigte sich, das Megaphon weglegend, leise bei seinem Lehrer Adorno, er habe das natürlich nicht persönlich gemeint. Sprechchöre unterbrachen Adornos Vorlesungen. Man habe bei ihm schließlich die Kritik am Bestehenden gelernt, nun wolle man das Bestehende gewaltsam ändern, nun müsse Adorno aber auch mitmachen. Er sei doch kein Praktiker, antwortete er leise und defensiv; er lasse sich nicht von der Wirklichkeit vorschreiben, blind aktionistisch zu werden, er sei kein Mann der Rezepte und der Gewalt. Aber damit kam er bei seinen Leuten, die von ihm Dialektik gelernt hatten und die ihn nun heftigen Aktionismus lehren wollten, nicht durch. Sie schrien ihn nieder; in Berlin, wo er einen – übrigens wunderschönen – Vortrag über Goethes »Iphigenie« halten wollte, von dem er stolz sagte: »Das ist selbst für meine Begriffe ein dichter Text.« Und sie schrien ihn nieder in Frankfurt, wo sie ihn endlich so weit brachten, mit dem Meister Anton aus Hebbels »Maria Magdalena«, den er eigentlich nie hatte leiden können, zu resignieren: »Ich verstehe die Welt nicht mehr.«
Mitten in diesen Auseinandersetzungen, während derer er immer und immer wieder versuchte, sich von den radikalen Linken, mit denen er über allen Streit hinweg eine unauslöschliche Solidarität empfand, nicht in eine rechte oder konservative Ecke drängen zu lassen, während dieser Auseinandersetzungen also starb er. Die Öffentlichkeit sah nicht ohne Betroffenheit und nicht ohne Schadenfreude, wie Adorno von den Studenten, und zwar von »seinen Studenten«, fertiggemacht wurde. Lukács spottete über das gesellschaftskritische »Grand Hotel am Abgrund«. Ernst Blochs Einwürfe erbitterten Adorno auch. Dabei wußten die meisten Außenstehenden gar nicht genau, worum es ging: sie konstatierten nur, wie leicht linke Überzeugungen sich gegen die Väter solcher Überzeugungen wenden können. Adorno starb, während eines Urlaubs in den Semesterferien, 65jährig am Herzinfarkt. Es war am 6. August 1969.
Wahrscheinlich ist er der letzte große Professor der deutschen Universität gewesen. Aber sogar ihm, der er jahrzehntelang auf einer Woge der Erfolge, der Beliebtheit und der fast modischen Berühmtheit zu schwimmen schien, blieb nicht erspart, nach überstandener Emigration und Remigration eben nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz zu sterben im herben Gefühl, verfolgt und verkannt zu sein…
Dies also war das äußere Bild: Ein Philosoph, ein Soziologe, ein genial origineller Musikschriftsteller, ein Kenner der Dichtung des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, wächst weit über den akademischen Bezirk hinaus. Sein Schatten fiel über alles, was in Deutschland, Europa und der Welt mit Soziologie, mit Feuilleton, mit Musikkritik, Literaturkritik und Kunst überhaupt zu tun hatte. Gegenwärtig werden in Italien Adorno-Kongresse abgehalten, kluge Adorno-Essays geschrieben. Ja, man entdeckt mittlerweile sogar seine Kompositionen, über die Schönberg sich noch spöttisch geäußert hatte, und findet an ihnen Bemerkenswertes, Eigenständiges, zu Unrecht Vernachlässigtes…
Wer sich diesen Adorno nun, nach allem bisher Gesagten, irgendwie als respektheischenden, gar autoritären, von hoher Warte hohe Gedankengänge äußernden Über-Vater, Über-Professor vorstellen möchte, irrt heftig.
Adorno war als Privatperson liebenswert, liebes- und lobesbedürftig. Nie drängte sich bei ihm das Bewußtsein der eigenen Zelebrität ins Gespräch, wenn er mit Schülern oder jungen Frauen oder Künstlern redete. Am wenigsten konnte er wohl die Professoren als Gattung leiden. Und noch weniger die Professoren-Frauen: sie sähen alle gleich, ununterscheidbar gleich aus, befand er – wenn er die Germanistik-Professoren mit ihren etwas härenen Damen auftreten sah, deren strenger Haartracht man anmerkte, daß da jemand in früher Studentinnenjugend als Bratkartoffelverhältnis geheiratet worden und nun im Schatten der mühseligen Karriere des Herrn Gemahls zur Professoren-Gattin geworden war. Er selbst hatte eine junge jüdische Frau Dr., eine Fabrikantin geheiratet, Gretel, die mit strengem Gesicht und spöttischen Bemerkungen über die Kollegen stets dabei saß. Und zu sagen pflegte: »wir haben Vorlesung«, womit sie Adornos Kolleg und ihre selbstverständliche Anwesenheit meinte.
Adorno hatte große, wunderschöne, hell in die Welt blikkende und dabei tief verängstigte Augen. Die vergesse ich nie. »Den Frauen und den Juden«, so fand er, »merkt man es an, daß sie jahrhundertelang unterdrückt wurden.« Die Freiheit seines Denkens war groß, aber der spontanen Angst seiner Augen sah man an, was das 20. Jahrhundert den Juden angetan hatte – und anzutun nicht aufhörte.