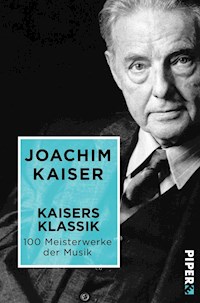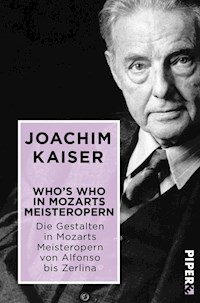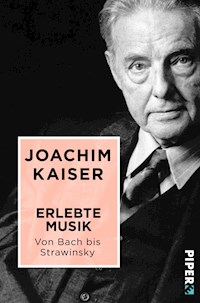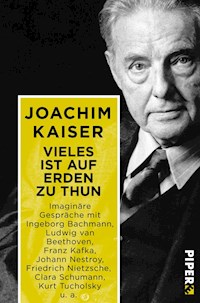11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der »Klavier-Michelin« von Joachim Kaiser, Kritikerinstitution in Sachen Musik, ist als Standardwerk zeitgenössischer Klaviermusik unentbehrlich. Neben wegweisenden Pianisten wie Arthur Rubinstein oder Friedrich Gulda, werden junge Interpreten vorgestellt und Entwicklungen in der Klavierkunst erläutert. »Noch niemals habe ich erlebt, daß musikalische Interpretation mit derartiger Genauigkeit und Liebe zum Detail analysiert und beschrieben wurde.« (Arthur Rubinstein)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Mit zahlreichen Notenbeispielen
ISBN 978-3-492-97735-7
Juli 2017
© Piper Verlag GmbH, München 1972, 1996
Covergestaltung: Büro Hamburg
Stefanie Oberbeck, Isabel Bünermann
Covermotiv: Stone/Getty Images
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Vorbemerkung zur Neuausgabe 1996
Es ist für den Autor ein zugleich erfreulicher und beklemmender Vorgang, wenn er miterlebt, wie ein Buch, das er vor mehr als 30 Jahren schrieb, sich gewissermaßen von ihm ablöst und weiterwirkt.
Die »Großen Pianisten in unserer Zeit« erschienen erstmals im Jahre 1965, damals noch im Rütten + Loening Verlag, nachdem mich mein alter Freund aus Göttinger Studentenzeiten, Ivo Frenzel, zu der abenteuerlichen Unternehmung ermuntert hatte. Nun kann ein Buch, das immer ein wenig schwankt zwischen Pianisten-Guide-Michelin und Klaviermusik-Führer, natürlich nie abgeschlossen sein. Die großen Pianisten von Arrau über Backhaus bis hin zu Horowitz und Rubinstein erwiesen sich zwar als erstaunlich langlebig (sie alle konzertierten noch, als sie weit über achtzig waren) –, aber eben leider doch nicht als unsterblich.
Nachwuchs drängte hinzu. Immer mehr Tondokumente gelangten und gelangen (bis zur mittlerweile nahezu erreichten, aberwitzigen Unübersehbarkeit auch wegen des fortwährenden Neuerscheinens derselben Aufnahmen unter verschiedenen CD-Labeln) an die Öffentlichkeit, fügen unserem Bild von den großen Alten, wie von den aktiven Jungen, weitere Facetten hinzu.
Das aber heißt: die Situation auf dem Klavierkontinent verändert sich fortwährend und heischt darum in einem Lese- und Nachschlagtext immer neue Reflexion, falls das Publikum sich bereit zeigt, einem solchen Buch die Treue zu halten, was es in einer mich überwältigenden Weise getan hat und hoffentlich weiterhin tut… Nach besten Kräften versuchte ich also in den vergangenen Jahrzehnten, für die immer neuen Auflagen die nötigen Ergänzungen und Korrekturen vorzunehmen. Dabei mußte das Konzept behutsam geändert werden. Als dieses Buch 1965 zum erstenmal erschien, widmete es sich strikt der Gegenwart. Es wollte ja keine Geschichte des Klavierspiels im 20. Jahrhundert geben, sondern so präzis wie möglich das Momentane beschreiben: Wie spielten zu Beginn der sechziger Jahre die Pianisten, die damals lebten, öffentlich auftraten, Schallplatten produzierten?
Mir ging es also emphatisch um das Gegenwärtige und Lebendige. Hätte ich nun bei jeder neuen Auflage strikt logisch nach dem ursprünglich gewählten Prinzip verfahren wollen, dann wäre es nötig gewesen, um der grundsätzlich angestrebten Gegenwärtigkeit willen die nicht mehr Lebenden auch nicht mehr zu erörtern. Diese Konsequenz schien mir einerseits zu brutal – und andererseits nicht einmal wirklich konsequent. Denn alle jene großen Pianisten, deren Kunst meine Zeitgenossen und mich beeindruckt hatte: sie verschwanden bei ihrem Tode doch nicht auf Nimmerwiederhören! Sie spielen nach wie vor mit, sind weiterhin gegenwärtig. Schallplatten, Tonbänder, Fernsehfilme, Kassetten bewahren auf, was sie einst vollbrachten.
Das heißt, allmählich mußte ich mein Prinzip lockern, mich in diesem Pianistenbuch strikt auf Lebendige zu beziehen. Auch das Jüngstvergangene ist noch gegenwärtig. Ein wenig erleichtert, die starre Grenze nicht mehr einhalten zu müssen, blicke ich nun, da das Jahr 1965 längst Vergangenheit ist, hin auf Lebende, die älter wurden, auf Tote, die immer noch präsent zu sein scheinen – und auch hinter die Grenze des Jahres 1965 zurück.
Freilich gibt es auch Künstler, die einst im hellen Licht öffentlicher Aufmerksamkeit und Erwartung standen, sich dann aber nicht so produktiv weiterentwickelten, wie ihre Bewunderer es erhofft hatten: Van Cliburn, Byron Janis, Fou Ts’ong, Ludwig Hoffmann oder Adam Harasiewicz. Selbst so bedeutende Interpreten wie John Ogdon, Jean-Bernard Pommier oder Vladimir Ashkenazy entfalteten sich nicht ganz so glänzend und reich, wie es damals zu hoffen war und wie es natürlich im Einzelfall immer noch möglich sein mag.
So offenkundig Schillers »Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen« gilt, sein im Gedicht darauf folgendes »Ewig still steht die Vergangenheit« ließe sich anzweifeln. Fest fixiert ist das Bild beispielsweise von Glenn Gould oder von Arthur Rubinstein wohl doch nicht. Von diesen beiden Künstlern kommen immer neue »alte« Aufnahmen ans Licht. Seit die EMI hochbetagte Rubinstein-Aufnahmen publizierte – von 1929 (Brahms’ B-Dur-Konzert), 1931 (Mozarts A-Dur-Konzert), 1932 (Tschaikowskis b-Moll-Konzert) –, seitdem ein Soloalbum mit dem Allerfrühesten aus Rubinsteins Händen erschienen ist – Chopins Barcarolle, Schubert-Aufnahmen von 1928 und 1934 –, zeigt sich, daß wir alle, leider auch ich, dem alten Schwadroneur Rubinstein allzu naiv geglaubt haben, was er so gern berichtete. Nämlich, daß er erst um 1932 ernsthaft zu üben anfing und darum erst seit seinem Durchbruch von 1937 als Pianist wirklich zählte. Die alten Aufnahmen demonstrieren, was wir eigentlich hätten wissen müssen: Der konnte natürlich immer wunderbar schön und souverän Klavier spielen, nicht erst seit der für ihn als Juden, wie er sagte, »so wichtigen« Eheschließung mit Aniela Mlynarski. Mag sein, daß Rubinsteins frühe Kammermusik-Aufnahmen in der Tat beiläufig wirken. So reicht seine Einspielung von Brahms’ g-Moll-Klavierquartett (1932, mit Mitgliedern des Pro-Arte-Quartetts) tatsächlich nicht an die gehaltvolle Interpretation heran, die Edwin Fischer und Mitglieder des Breronel-Quartetts um 1939 diesem Werk zuteil werden ließen.
Sollten indes manche Leser mittlerweile ihrer einstigen Rubinstein-Verehrung mißtrauen, nicht mehr ganz sicher sein, ob ihre Liebe eine neue Begegnung mit Rubinstein-Aufnahmen heil überstehen würde, so seien diese Zweifler gebeten, sich nicht nur an die berühmten, aber vielleicht allzuoft gehörten Aufnahmen zu halten, sondern statt dessen zu versuchen, etwa an die wunderbare Grieg-CD Rubinsteins heranzukommen. Edvard Griegs Ballade op. 24 muß staunende Bewunderung auslösen wegen des schier überwältigenden, spontanen Reichtums an Klangfarben, Nuancen, tönenden Übergängen und Stimmungen, den Rubinstein da zu geben vermag. Auch die endlich vollständig bei Melodia herausgekommene Dokumentation von Rubinsteins legendärem Klavierabend in Moskau vom 1. Oktober 1965 enthält einzigartig poetische und vitale Chopin-Interpretationen: fis-Moll-Polonaise, Barcarolle, Etüden op. 10,4 und 5, op. 25,1 und 5. Da hat und hört man Rubinstein so, wie er leibhaftig war – nämlich ohne jenen herben Persönlichkeits- und Spontaneitätsverlust, den die Schallplatte bei so vielen Künstlern, auch bei Rubinstein, fast immer bedeutete…
Mein Hinweis darauf, daß es für den Verfasser auch beklemmend sei, wenn ein Buch sich ablöse und weiterwirke, entsprang keiner Autorenkoketterie. Ich weiß nur zu gut, wie sehr es manche Pianisten – sie müssen ein empfindliches Ego haben, wie überhaupt alle, die sich der Öffentlichkeit als Künstler oder Publizisten aussetzen – ärgert, schmerzt, wütend macht, wenn sie sich hier falsch beurteilt oder gar schnöde übersehen glauben. Mein letzter Versuch, dieses Buch auf den, falls es ihn gibt, »aktuellen« Stand der Dinge zu bringen, war 1989 in der 7. Auflage der »Rückblick auf eine Tendenzwende«. Da bemühte ich mich, nachzutragen, was im Jahrzehnt zwischen 1978 und 1989 auf Klaviererden geschehen war. Mein damaliger Überblick reicht bis zu Afanassiev, Bunin, Schukow, Lucchesini, Schiff und Zimerman.
Doch meine Leidenschaft, jungen Pianisten auf die Finger zu sehen, Interpreten zu wägen und zu vergleichen, das Klavier für den Mittelpunkt der Welt oder wenigstens der Musikwelt zu halten, ist gegenwärtig nicht mehr so feurig, monoman und ausschließlich wie früher. Daher habe ich meinen hochgeschätzten jüngeren Kollegen Klaus Bennert – an dessen passionierter Kompetenz in allen Klavierdingen kein Zweifel bestehen kann – gebeten, für diese Neuausgabe ein umfangreiches Kapitel hinzuzufügen, das dem letzten Jahrzehnt, aber auch manchen Beleuchtungswechseln im Hinblick auf Früheres gewidmet sein soll.
Bennert hat es getan unter dem Titel »Verlust und neue Fülle«. Daß Bennert dabei gelegentlich andere Akzente setzt, Widersprüche anmeldet, Urteile modifiziert: es versteht sich von selbst und wirkt bei der Lektüre hoffentlich auch als Spannungsmoment. So danke ich Klaus Bennert herzlich für seine große, wahrlich nicht leichte Mühe. Und gern füge ich hinzu, daß dieses Buch nicht hätte vorgelegt werden können ohne die Hilfe von Inge Kühl oder den Beistand des Verlags (Dr. Klaus Stadler, Uwe Steffen) und ohne die freundschaftliche, selbstlose Findigkeit von Robert Purkyt aus Wien, der mir über die Jahre hin entlegene Klavierplatten zu verschaffen wußte.
München, im September 1996
Joachim Kaiser
Unsere Klavierwelt seit 1945
Für die Bundesrepublik bedeutete das Jahr 1945 – auch musikalisch – den Augenblick einer Öffnung zunächst nach dem Westen, allmählich auch nach dem Osten. Vorher, zumal während des zweiten Weltkrieges, hatte man sich nolens volens sehr auf die deutschen Interpreten konzentriert. Oder auf Gäste aus jenen Ländern, die sich mit Deutschland nicht im Kriegszustand befänden. Alfred Cortot kam 1942 zu den »Berliner Kunstwochen« aus Paris nach Berlin und spielte am 31. Mai und am 1. Juni 1942, zusammen mit Wilhelm Furtwängler und den Berliner Philharmonikern, Schumanns a-Moll-Konzert. Ich hörte es und werde es nie vergessen. Vergessen hat das seinem einstigen Kammermusikpartner Cortot übrigens auch der gestrenge Cellist Pablo Casals nicht: Der stolze Spanier machte dem Franzosen nach Kriegsende darum die heftigsten Kollaborationsvorwürfe und duldete keine Ausflüchte.
Es kam damals auch der junge Arturo Benedetti Michelangeli nach Berlin und verblüffte mit der Wiedergabe der Paganini-Variationen von Brahms. Auch Géza Anda kam, als Wunderjüngling. Claudio Arrau, als Berliner Wahlbürger, konzertierte dort ohnehin – und Fischer, Gieseking, Kempff, Erdmann, Backhaus hatte man sowieso…
Das heißt: in den dreißiger Jahren besaß das Musikleben von Berlin immer noch ein beträchtliches Niveau. Zudem fühlte man damals gewiß »eurozentrischer«. Natürlich war es ein Aderlaß, ein beträchtlicher Blut- und Kunstverlust, daß die jüdischen Pianisten ausblieben. Wie oft hatte Furtwängler – dessen späterer »Star« Edwin Fischer wurde – noch in den zwanziger Jahren mit Ossip Gabrilovich, mit Mischa Levitzki und natürlich mit Artur Schnabel musiziert. Im Oktober 1926 sogar mit dem 21 jährigen Wladimir Horowitz (Programm: Bruckner, neunte Symphonie, Liszt, Klavierkonzert A-Dur, Tschaikowski, »Romeo und Julia« – daß es kein Band, keine Platte gibt, wie gern wäre man dabeigewesen!). Übrigens hatte Horowitz offenbar einen solchen Erfolg, daß er im Oktober 1929 immerhin das B-Dur-Konzert von Brahms mit Furtwängler spielen durfte! Sicherlich vermißte, doch das ist eine kaum beweisbare Vermutung, die Berliner Kunstöffentlichkeit während der dreißiger und vierziger Jahre die großen emigrierten jüdischen oder nichtjüdischen Geiger noch schmerzlicher als die Pianisten. Bronislaw Huberman, Fritz Kreisler, Adolf Busch, Nathan Milstein, Mischa Elman: für deren Kunst gab und gibt es keinerlei »Ersatz«, keinerlei Äquivalent.
Das war beim Klavier, wie gesagt, nicht so augenfällig. Eurozentrismus, das traditionsreiche »deutsche« Beethoven-Spiel der Elly Ney, des Wilhelm Kempff, des Edwin Fischer, des Wilhelm Backhaus, auch des Frederic Lamond, die Romantiker und Impressionisten des überwältigend musikalischen Alfred Cortot, des manuell so unheimlich sicheren Walter Gieseking, des Claudio Arrau: das war Anlaß für ein keineswegs unberechtigt traditionsstolzes Kulturselbstbewußtsein.
Nach 1945 fiel die Grenze, die nazistischer Rassismus und Krieg gezogen hatten. Abgesehen von denen, die überhaupt nicht mehr kommen wollten (Rubinstein) oder die zögerten (Schnabel, Horowitz), hörte man nun die neue Weltelite allmählich wieder in Deutschland. Und wer in den fünfziger Jahren, in Paris oder Luzern, Rubinsteins betörend schöner Kunst begegnete – der erschrak vor so viel Herrlichkeit…
Demgegenüber wirkte nun die »deutsche« Schule plötzlich etwas pedantisch, unfrei, provinziell. Pianisten wie Conrad Hansen, wie Detlef Kraus oder Rosl Schmid konnten sich international gegen die Weltelite schwerlich durchsetzen. Vielleicht machten sie auch, von vornherein entmutigt, gar nicht den Versuch dazu. So hat ja damals ein Meisterpianist wie Hans-Erich Riebensahm, dessen philosophisches und schönes Spiel mit der Kunst von Alfred Brendel durchaus zu vergleichen wäre, resigniert auf die Weiterführung seiner Karriere verzichtet. Er hatte, berichten seine Freunde, das Gefühl, die Leute wollten ihn nicht mehr hören – so wurde er Klavierprofessor. Schwer zu entscheiden, ob nach 1945 die subjektiven Grenzen deutscher Klaviertalente oder die gegebene objektive Situation dazu führten, daß die Klavierwelt nicht mehr auf den (alt gewordenen) Typus Edwin Fischer hören wollte, sondern lieber auf Rubinsteins Fülle.
Ein wenig später, Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre, sagte mir ein Freund und Kammermusikpartner von Elly Ney, die greise Pianistin habe lächelnd Beschwerde geführt, »der Herr Kaiser interessiert sich so sehr für die jungen Russen«. Diese »jungen Russen«, das waren 1960 der 45 jährige Swjatoslaw Richter und der 44 jährige Emil Gilels. Für eine 78 jährige Klavierdame mögen das »junge Russen« sein – einem 32 jährigen Musikkritiker fällt die grelle Jugendlichkeit dieser bereits im fünften Jahrzehnt ihres Lebens stehenden Pianisten nicht so sehr ins Auge. Statt dessen eher die Pranke, das Temperament, die orchestrale »Fülle« dieser Spieler aus der russischen Schule – die ja bis heute in der Sowjetunion noch keine gleichermaßen musikalisch-pianistisch beeindruckenden Nachfolger fanden.
Gewiß fühlten sich damals manche deutschen Künstler (zumal die des »guten Durchschnitts«) von der umerzogenen öffentlichen Meinung »den Russen gegenüber« modisch zurückgesetzt. Darauf ließe sich freilich antworten, daß »unsere« unanfechtbar großen Meister – wie Wilhelm Kempff, wie der späte Wilhelm Backhaus, wie der »deutscheste« von allen, nämlich der Chilene Claudio Arrau, wie der Wiener Friedrich Gulda, wie später Alfred Brendel – von solcher Zurücksetzung weder innerhalb noch gar außerhalb der Grenzen unserer Bundesrepublik etwas gespürt haben dürften. Gewiß, hin und wieder, aus Verdruß oder Übermut, flickte man diesen »Großen« in deutschen Feuilletons, Schallplattenzeitschriften oder bei Rundfunk-Interpretationsvergleichen ein wenig am Zeuge. Kempff ärgerte sich über schlechte Kritiken, die er tatsächlich in Tübingen oder Frankfurt eher bekam als in Paris oder Tokio. Backhaus’ männlich gemessenes Brahms-Spiel galt gegenüber dem flammenden Rubinstein-Pathos als etwas zu kühl. Doch das waren modische Kleinigkeiten. Gerade die Autorität der heimischen »Großen« pflegt vor allem junge Musikkritiker zu dergleichen zu provozieren…
Ähnliches mußten also eine Zeitlang Kempff, Fischer, sogar Backhaus aushalten – und es hat die Betroffenen gewiß mehr geärgert als irritiert. Doch mittlerweile begreift die Welt wieder das Gewicht, den geistigen Rang der einstigen deutschen Klavierschule. Auch Artur Schnabel, über dessen Beethoven-Spiel sich nicht ein junger Musikkritiker, sondern vielmehr der alte Rubinstein in seiner Autobiographie mokant-abfällig äußerte (»hat mich mit seiner intellektuellen, ja fast pedantischen Konzeption nie überzeugt«), steht – zumal seine in den dreißiger Jahren eingespielte (erste) Gesamtaufnahme der Beethoven-Sonaten leicht zugänglich ist – als feuriger, die Grenze des Möglichen riskierender Analytiker Beethovenscher Formprozesse an hoher Stelle. Edwin Fischers ekstatische Reinheit, die Magie seiner Übergänge, seiner langsamen Crescendi, wird mittlerweile wieder so geschätzt und gewürdigt wie zu Fischers größter Zeit, die sicherlich nicht erst 1931 begann, als Fischer – 1886 in Basel geboren, später in Berlin Schüler jenes Martin Krause, der auch Rubinstein, Arrau und Kempff unterrichtet hat, also eigentlich der erfolgreichste Lehrer unseres Jahrhunderts war – 45 jährig die nach wie vor herzbewegendste, kühnste und schönste Schallplatteninterpretation der »Chromatischen Fantasie und Fuge« von Bach gelang, die je eingespielt wurde.
Das Jahr 1945 rückte also manches in den Vordergrund, was vorher wenig beachtet oder ausgeschlossen war, und ließ langsam manches zurücktreten, was man bis dahin selbstzufrieden patriotisch gefeiert hatte.
Die zweite Zäsur in der Geschichte der musikalischen Interpretation, etwa zehn Jahre nach 1945, war mindestens ebenso einschneidend. Da setzte sich die Langspielplatte durch. Was vorher seltenes und riesiges Wagnis gewesen: die Einspielung großer Werkzyklen auf Schellackplatten mit 78 Umdrehungen pro Minute, das wurde nun schiere Selbstverständlichkeit. Mittlerweile ist der Markt idiotisch verstopft, hat sich die Industrie tollkühn selbst gefährdet: aber daß eine zwölf Langspielplatten enthaltende Kassette wie beispielsweise Daniel Barenboims Einspielung sämtlicher Mozart-Klavierkonzerte (neben mehreren anderen Gesamteinspielungen dieser Werke) überhaupt angeboten wurde, und zwar zeitweise für unter 50 Mark!, signalisiert eine folgenreiche Veränderung. Es existieren mittlerweile für Interpreten und Musikfreunde Möglichkeiten der Information und der Selbstdarstellung, von denen früher niemand zu träumen wagte, mögen diese Chancen auch infolge unbesonnener Massenproduktion sich zum Alptraum derjenigen verdichtet haben, die verzweifelt fragen, warum die Produzenten Hunderter von Bruckner-, Wagner-, Mahler-, Bach-, Beethoven-Kassetten nicht auch die Lebenszeit produzieren und feilbieten, die nötig wäre, sich durch diese Tonberge hindurchzuarbeiten.
Die Chance der Langspielplatte existiert erst seit Mitte der fünfziger Jahre. Daß, beispielsweise, der Ruhm von Furtwängler und Solomon sich so relativ langsam herstellen, wiederherstellen ließ, hängt mit diesem Datum und dem Datum zusammen, an welchem diese beiden Genies aufhören mußten zu produzieren. Furtwängler starb 1954: Die Möglichkeiten der Langspielplatte kamen für ihn – alles in allem – zu spät. Solomon mußte krankheitshalber 1956 aufhören: Die meisten mittlerweile so geschätzten Solomon-Aufnahmen sind Umschnitte von Einspielungen, die Solomon noch für Schellack gemacht hat.
Mitteleuropäischer, nämlich »jüdisch-deutscher« Interpretationstiefsinn und wunderbar geistige, aber bemerkenswert anders geartete Klavierkunst stießen zusammen, als Walter Legge, der große britische Schallplattenproduzent, kurz nach dem zweiten Weltkrieg den berühmten Artur Schnabel (der noch Brahms vorgespielt hat) mit den ersten Aufnahmen von Dinu Lipatti konfrontierte. Schnabel mußte sich Lipattis Interpretation des a-Moll-Konzerts von Grieg anhören – und den scharfsinnigen Beethoven-Exegeten interessierte Grieg herzlich wenig. Aber für junge Pianisten interessierte er sich. Schnabel hörte drei Minuten des Kopfsatzes, ließ sich lieber gleich die »Kadenz« vorführen, erbat sich zwei, drei Wiederholungen. Dann aber sagte er: »Das ist nicht nur wunderbares Klavierspiel, sondern ein ganz neuer Weg, Klavier zu spielen.«
Als der junge Lipatti ein wenig später Schnabel vorgestellt wurde, kam der Alte gleich auf Beethoven. Es zeigte sich nämlich: des jungen Lipatti Respekt vor Beethoven war so groß, daß er überhaupt nur die Waldstein-Sonate (immerhin) öffentlich gespielt hatte. (Was gäbe man um einen Mitschnitt davon!) Schnabels erste Frage an den noch nicht einmal 30 jährigen Künstler, der schon als 33 jähriger an Leukämie sterben mußte: »Wie viele Beethoven-Sonaten spielen Sie? Sie müssen innerhalb der nächsten drei Jahre alle spielen.« Doch dazu kam es nicht.
Lipatti ist ein Genie von vollkommener Natürlichkeit gewesen. 1917 war er in Bukarest geboren worden. 16 jährig, im Jahre 1933, nahm er an einem internationalen Wettbewerb in Wien teil. Dort wurde er, zum Arger des Jurymitglieds Alfred Cortot, nur zweiter. Cortot wollte aber Lipatti den ersten Preis zukommen lassen. Und so wie, ein paar Jahrzehnte später, Martha Argerich wütend die Jury des Warschauer Chopin-Preises verließ, weil ihr Schützling Ivo Pogorelich nicht in die Endrunde gelangte, so fuhr 1933 Cortot nach Hause. Und er nahm Lipatti, als seinen Schüler, mit! Das heißt: der junge Lipatti geriet in den Bann der Pariser Musik. Er studierte bei Paul Dukas Komposition, wurde zum Vertrauten der großen, ihn herzlich bemutternden Pädagogin Nadia Boulanger, komponierte sehr geschickt im Idiom Ravels und des neoklassizistischen Strawinsky. So wuchs Lipatti zunächst in rumänischem, dann in französischem »Klima« auf. 1936 gab er allerdings auch Konzerte in Deutschland und Italien. Als er 26 Jahre alt war, ging er nach Genf. Alle, die ihn dort – den so früh zum Tode Verurteilten – gehört haben, berichten von ihm wie von einem Engel. Francis Poulenc schrieb seinem Spiel »göttliche Spiritualität« zu.
Glücklicherweise liegt eine Kassette sämtlicher Einspielungen von Lipatti vor; dazu gibt es noch Mitschnitte seines letzten Klavierabends und Aufnahmen seiner Kompositionen. Diese Platten evozieren unmittelbar und überwältigend den Eindruck, den Lipatti damals auf Ansermet, Backhaus, Karajan, Carl Jacob Burckhardt, Maja und Paul Sacher machte: Lipatti »konnte«, so schien es damals, fließender, strahlender, schwungvoller Klavier spielen als – man muß nur die jeweiligen Einspielungen des Schumann-Konzerts miteinander vergleichen – Kempff, als selbst Gieseking, als seine Freundin Clara Haskil. Und was er aus diesem Können machte – »es war nicht mehr Klavierspiel, es war Musik, losgelöst von jeder Erdenschwere«, schwärmte Herbert von Karajan –, das wurde zur Mischung aus vollkommener seelischer Lauterkeit und vollkommener manueller Ausgeglichenheit. In den letzten fünf Jahren seines Lebens hat dieser rührend geniale Mensch alle die Platten eingespielt, die heute so einsam dastehen. Etwa die Aufnahme der B-Dur-Partita von Bach, wo er in reinstem Gleichmaß mehrere Bewegungsenergien – das zart Fließende, das Synkopische, das Thematisch-Feste – miteinander verbindet. Eleganz gerät diesem Pianisten tiefsinnig, der Tiefsinn elegant. Jede Stimme sagt lebendig das Ihre. Dabei klingt Lipattis Fülle zwar deutlich und kräftig, aber nie kompakt, dick, aufgedonnert. Niemals kommt es zu Unsauberkeiten, ungewollten Obertönen, Verunklärungen: Die Musik bleibt immer durchhörbar, ist immer klar und nie geheimnislos. Ob Schnabel das gemeint hat mit Lipattis »neuer Art, Klavier zu spielen«? Diesen Weg zur »Tiefe« fand Lipatti bei seiner Beschäftigung mit Chopin, Mozart, Bach, Ravel. Als er sein letztes Konzert abbrechen mußte, wenige Wochen vor seinem Tod, entkräftet, da spielte er, statt eines Chopin-Walzers, die schöne Transkription von Bachs »Jesus bleibet meine Freude«. Man kann das heute, Jahrzehnte später, nicht ohne Bewegtheit hören, obwohl die Töne, weltenfern von aller Sentimentalität, sich tief in ihr Geheimnis verschließen. Zu solchem Bach- und Mozart-Verständnis war Lipatti gekommen, auch ohne, wie es für Schnabel, Fischer, Kempff, Gulda, Brendel selbstverständlich gewesen war, Beethovens 32 Sonaten studiert zu haben.
Klaviertalent so außerordentlichen Ranges, das immer nur zum musikalisch »Wahren« zielt und nie vorschnell zum bloß »Wirkungsvollen«, ist in der Geschichte des Instruments Ausnahme. Der junge Carl Tausig hat vielleicht so gespielt. Edwin Fischer und Artur Schnabel, auf deren »deutschen« (von Nikisch, d’Albert, Furtwängler geprägten) beethovennahen Klavierstil ein Dinu Lipatti seine Antwort gab, sind wohl nicht manuelle Talente von so selbstverständlicher und reicher Leichtigkeit gewesen.
Was bei Artur Schnabel fesselte, war die Schärfe und Herbheit der Auffassung. Ich habe ihn nur einmal als Solisten im »Live« Konzert gehört: Da fehlte mir – man war damals an dergleichen gewöhnt – sogar ein wenig das Maestoso, die Größe. Statt dessen: Sinn für den Vorrang der Dissonanz, für die Bedeutung der Abwandlung (Schnabel hob Varianten hervor, nicht das Identische). Statt dessen: der unerhörte Mut, sich zu Beethovens Zeitmaßen zu bekennen, auch wenn die pianistischen Kräfte dafür nicht ausreichen! Schnabel hatte das Selbstbewußtsein und die Courage, lieber »Fehler« auf sich zu nehmen, wenn er in Beethovens Sonaten op. 101, op. 106 oder op. 109 das »richtige« Tempo nicht souverän schaffte, als um der pianistischen Korrektheit willen geringere Schnelligkeitsgrade zu wählen, die ihm musikalisch inkorrekt schienen.
Edwin Fischer spielte nicht um solcher ans Mystische reichenden rationalen Vorstellungen willen Klavier, sondern dieser Großmeister deutscher Kunst und Furtwängler-Intimus war bezwingend unbefangen musikalisch und musikantisch. Der schonte sich nicht, der machte überall – mit Freunden, bei Freunden – gern Musik. Der verlor sich in die Welt der großen Komponisten, um sich zu gewinnen. Die Wahrheit seines Spiels, seiner herrlichen Bach-Interpretationen (Brendel hat im ernsten Scherz behauptet, die Einspielungen des »Wohltemperierten Klaviers« durch Fischer seien eigentlich die einzigen aufbewahrenswerten Platten, die es gäbe) läßt sich erkennen an der Wahrhaftigkeit der Übergänge. Wenn Fischer das Tempo bei der abgründigen Arpeggienstelle aus Bachs »Chromatischer Fantasie« ändert – die er als Choralstelle versteht, so daß er also zunächst den ganzen Akkord spielt und erst danach zart bricht –, dann wirken die Verzögerungen nie forciert, die Beschleunigungen nie aufgesetzt. Mit rätselvollster Natürlichkeit ändern sich das Tempo, das Licht, die Gestimmtheit.
Fischers (spätere) Aufnahmen sind nicht alle gleichermaßen stark. Seltsam der überschnelle Mozart, die technische Ungenauigkeit mancher Beethoven-Platten. Dafür ist seine Darstellung des zweiten Brahms-Konzerts mit Furtwängler ein Mysterium. Das ungarisch getönte Finale können Rubinstein, Gilels, Kempff besser, gewiß. Aber im langsamen Satz erreichen Furtwängler und Fischer Un-Erhörtes. Die rezitativischen Wendungen des Klaviers und das Thema im Orchester: sie bilden ein wunderbares, melancholisches Nebeneinander. Dem Klavier gelingt es nie, in die melodische Sphäre des Orchesters zu geraten. Eine erhabene, unselige Unrast bleibt. Die Versöhnung, Verschmelzung, der etwas völlig Imaginäres anhaftet, sie geschieht – streng nach dem Notentext – erst in der später folgenden Adagio-Episode Fis-Dur, wo Solist und Orchester endlich eins werden miteinander. Verstandener, unvergleichlicher Brahms!
Zwischen Fischers und Schnabels Ausdrucksextremen und Walter Giesekings perlendem »Spiel« war stets eine Kluft. Gieseking ist immer ein Pianist für Pianisten gewesen. Gilels hat ihn (sein »Fingerpedal« zum Beispiel) bewundert; manchmal gelang diesem mit Duft und Subtilität musizierenden Künstler, diesem Debussy- und Ravel-Spezialisten, eine Mozart-Leichtigkeit, die etwas betörend Blitzendes und Zauberisches hatte. Giesekings Spiel war den Konflikten fern. Aber mit kleinen Barockstücken, mit Schumann, mit einem Beethoven ohne Erdenschwere verbreitete dieser Künstler, der in Frankreich geboren und in Deutschland berühmt geworden war, manchmal ein delikates, berauschendes Glück. Selbst Beethovens Es-Dur-Konzert klang unter seinen Händen gleichsam sonnenüberflutet, heiter, hell. Umfangreiche Kassetten bewahren die Kunst dieses Meisters auf, der als klavieristische Muttersprache die Sprache Debussys und Ravels sprach – in ihr aber auch die große Tradition der Klaviermusik sich spiegeln ließ. Und Giesekings elegante, spirituell mozartnahe Interpretation des dritten Rachmaninow-Konzerts ist gewiß die einzige, die sich – völlig anders geartet, aber gleichwertig! – mit Horowitz’ berühmten Einspielungen des Stückes messen kann!
Wenn wir hier jene Pianisten zu beschreiben versuchen, die wegen ihres zu frühen Todes in diesem Buch nicht mehr vorkommen, die aber in den vierziger und fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts nicht nur gute oder außerordentliche Künstler gewesen sind, sondern maßstabsetzende, also solche, die ein wichtiges »Extrem« erreichten, dann müssen (neben denen, die in Deutschland noch der Entdeckung harren, wie Myra Hess, Yves Nat, Frederic Lamond, Ernst von Dohnányi) vor allen zwei Künstler genannt werden, die hierzulande, und nicht nur hier, geradezu eine »Ära« verkörperten: nämlich Alfred Cortot und Eduard Erdmann.
Bei der Charakterisierung Erdmanns sei eine gewisse Verlegenheit eingestanden. Denn das, was diesen Künstler, der ein kauziger Philosoph, ein Intellektueller, nicht nur ein Original, sondern ein in der Programmzusammenstellung und Darbietung wahrhaft origineller Pianist war, so heftig und anekdotenproduzierend auszeichnete, ist den Tondokumenten schwerlich ohne hinzufügende Anstrengung zu entnehmen.
Erdmann war ein Pianist radikaler, sinnvoller Herbheit. Er spielte in seinen Klavierabenden Antonio de Cabezons strenge Musik aus dem frühen 16. Jahrhundert Spaniens neben Modest Mussorgskis nichts weniger als strengen »Bildern einer Ausstellung«, er nahm Felix Mendelssohn-Bartholdy ernst, als man ihn vergessen hatte, unterschätzte oder falsch sentimental-wiedergutmachungsbereit als schwächeren Schumann mißzuverstehen begann. Er, Eduard Erdmann, der unkonventionelle Balte, war es aber auch, der vorwegnahm, was erst in den sechziger Jahren selbstverständlich werden sollte: nämlich die Rehabilitation des Sonatenkomponisten Schubert. Diejenigen, die jetzt so tun, als bereiteten Schuberts Sonaten überhaupt keine Probleme, als seien sie auf ihre Weise genauso durchkalkulierte Organismen wie die großen Beethovenschen Konzertsonaten, sie machen sich doch etwas vor: berauscht von intimen Herrlichkeiten, wie es sie überhaupt nur bei Schubert und sonst nirgendwo zu geben scheint. Aber die Problematik gewisser Schubert-Finale (G-Dur-Fantasie-Sonate, c-Moll-Sonate) steht über aller Beschönigung. Sie bedarf liebender und verständnisvoller Interpretation. Erdmann hat sich wegbereitend eingesetzt für Werke, von denen man im späten 19. und beginnenden 20. Jahrhundert annahm, sie gehörten »eigentlich« nicht in den Konzertsaal. Das ist Erdmanns Aufnahmen nicht mehr, wie mir scheint, so unmittelbar anzumerken. Vielleicht auch, weil wir verwöhnt sind von den herrlichen Schubert-Interpretationen, die vor allem Alfred Brendel, aber auch Wilhelm Kempff, Daniel Barenboim und einige große Kammermusikvereinigungen unserer Zeit hervorgebracht und zur schönen Selbstverständlichkeit für unsere zweite Jahrhunderthälfte gemacht haben.
Läßt sich – wenn man nicht unaufrichtig oder übertreibend »loben« will – das Eigentümliche der Kunst Erdmanns, von dem ganze Generationen bemerkenswerter Pianisten und Musikologen viel gelernt und beherzigt haben, schwer wiedergeben, so fällt es um so leichter, auch heute noch den vielen Platten und Büchern Alfred Cortots anzumerken, warum dieser französische Meisterpianist nicht nur ein herrlich nobler Klavierspieler, sondern ein großes Ereignis in der Geschichte der Interpretationskunst gewesen ist.
Deutsche Musikfreunde bringen mit dem vielberufenen »Französischen« ja immer fast automatisch Vokabeln wie »Nuance«, »Delikatesse«, »Sensibilität« in Verbindung. Und wenn Cortot – der bereits 25 jährig in Paris (nachdem er vorher in Bayreuth korrepetiert hatte) Aufführungen von »Tristan und Isolde« und der »Götterdämmerung« dirigierte – als Pianist auch gewiß alle diese feinen französischen Tugenden besaß, so war er beim Spiel eben nicht nur feinsinnig und delikat, sondern darüber hinaus stürmisch und frei. Er hat gewettert, daß die übliche Rubatoverzerrung sich gegen die »Königswürde der Chopinschen Musik« vergehe; er hat Chopins h-Moll-Sonate mit erhitztem, stürmischem Schwung erfüllt, er hat die Etüden männlicher, kräftiger empfunden und gestaltet als sonst üblich. Rubinsteins Lebensleistung – der Nachweis, daß Chopin kein Damenkomponist, kein Komtessenspielzeug war – ist auch von Cortot intellektuell und pianistisch angestrebt worden.
Dies fiel vielleicht darum nicht so auf, weil Cortot alles eher war als ein harter, gar motorischer »Rhythmiker«. Wenn ihm etwas zu Gebote stand, dann Freiheit. Die Freiheit, bei Wiederholungen oder gar Sequenzen einer Phrase alles sofort entschieden neu und anders zu beleuchten. Die Freiheit, Ostinati zu entdecken, niemals geistlos oder sentimental zu sein. Eine solche Reaktionsschnelligkeit ist für jede Interpretation vor allem von Chopins Préludes entscheidende Voraussetzung. Kein Wunder, daß Cortots Wiedergabe dieser Préludes noch heute, beispielsweise von Friedrich Guida (der Cortots »Gegentyp« zu sein scheint, aber trotzdem, wenn nicht deshalb, den großen Franzosen glühend bewundert) allen anderen Einspielungen vorgezogen wird. Überhaupt: Guida von seinen Begegnungen, die er als junger Mensch mit Cortot hatte, schwärmen zu hören (und schwärmerisch zu sein ist nicht gerade Guidas Haupteigenschaft), das zählt zu den schönsten Momenten, die man in Gesprächen mit Künstlern erleben kann…
Dabei haben wir Heutigen, zumindest alle nach 1925 Geborenen, es mit Cortot keineswegs leicht gehabt. Als wir Cortot begegneten, da war er ein alter Herr. Nicht nur alt, auch körperlich zerrüttet. Die Gedächtnisfehler, auf die schon in Cortots mittleren Jahren das gewitzte Paris schadenfroh lauerte, nahmen zu. Manche Ritardandi, bei denen er sich ein paar Jahrzehnte früher etwas gedacht haben mochte, führte er manchmal nur noch mechanisch aus, so daß sie dann angeklebt, unorganisch wirkten; und bei der schweren Oktavstelle in Chopins f-Moll-Fantasie stimmte manchmal wirklich überhaupt nichts. Aber dann ereigneten sich in seinen Klavierabenden eben doch einige Wendungen und Sekunden, die Cortot als tief erfahrenen, freien und stolzen Geist erscheinen ließen. Und wann im durchschnittlichen Klavierabend, wo es ja an langweiligen falschen Tönen ohnehin kaum je mangelt, begegnet man schon solchen richtigen? Ein Glück, daß einige Cortot-Platten, denen Unsterblichkeit sicher sein müßte (wie die Aufnahme von Schuberts B-Dur-Trio mit Jacques Thibaud und Pablo Casais aus dem Jahr 1928, wie die hinreißende, feurige, farbige Einspielung von Schumanns »Carnaval«, wie eben Chopins Préludes), dafür bürgen, daß der Ton dieses Künstlers nie verhallt…
Entwicklungsphasen und Fixierungsprobleme
Worauf Konzerte antworten
Wie spielen sie eigentlich Klavier – alle die großen Pianisten, die alten Herren, die 50 jährigen Männer und die hochbegabten jungen Leute, die hier und heute auf den Konzertpodien erscheinen, die jetzt ihre Schallplatten herausbringen? Das ist, auf den ersten Blick, ein herrliches, unausschöpfliches Debattierthema für Musikfreunde und späte Stunden. Man darf, inmitten einer Welt, die uns wahrlich mit schlimmeren und darum leider wohl auch »wichtigeren« Themen konfrontiert, über unpolitische Kunstdinge nachsinnen, unkriegerische Heroen miteinander vergleichen, von Sonaten und Variationen reden. Doch auf den zweiten Blick stellt sich heraus, daß selbst die so ungefährlich klingende Frage danach, wer die großen Pianisten unserer Zeit sind und wie sie spielen, vermessen ist.
Denn jeder Pianist, der Bach oder Schönberg oder Beethoven spielt – gut oder schlecht, eigenwillig oder zurückhaltend, risikofreudig oder routiniert –, gibt damit, ob er will oder nicht, eine Antwort auf die Herausforderung, die in den großen Werken der Klavierliteratur beschlossen liegt. Keine Komposition ist je gesicherter Besitz. In jedem Konzert fällt eine, manchmal leise, manchmal aber auch laute, vernehmliche Antwort darauf, wie wir mit dem »großen Bestand« fertig werden, ob dieser Bestand noch weiterlebt. Diese Antwort erteilt nicht nur der Pianist, sondern auch das Publikum. Je nachdem, wem es zujubelt, von wem es sich abkehrt, was es sich gefallen läßt oder nicht gefallen läßt, entscheidet es mit. Dabei geht es oft nur um winzige Energien, die aber in ihrer Gesamtheit einen Teil unserer Kultur bedeuten.
Nie wird die Frage zuverlässig zu beantworten sein, ob Wladimir Horowitz Liszts h-Moll-Sonate besser oder schlechter spielt, als Liszt selbst sie spielte. Heutzutage neigen viele Musiker zu der Annahme, »damals« sei längst nicht so perfekt und präzis musiziert worden. Man weiß, daß Clara Schumann die Händel-Variationen von Brahms für unausführbar zu halten schien und daß Werke, die heute jeder Konservatoriumsabsolvent »drauf« haben muß, zur Zeit ihrer Entstehung für unspielbar galten. Allein wenn man die ungeheuer getürmten Schwierigkeiten ermißt, die ein Franz Liszt wohl auch nicht gerade in der Überzeugung in seine Kompositionen hineinbaute, daß niemand sie einigermaßen auszuführen vermöge, dann fragt man sich wieder, ob nicht doch ein Tausig mehr konnte, als ein Cherkassky kann.
Wir wollen sowohl die öffentlichen Konzerte berücksichtigen als auch die Schallplatteneinspielungen. Die Schallplattenübersetzung der künstlerischen Leistung soll dabei nach Möglichkeit am Original des lebendigen Konzerteindrucks geprüft werden. Heute ist es gewiß keineswegs mehr statthaft, ohne Mithilfe der Schallplatte einen Atlas der Klavierwelt herzustellen. Doch die meisten Schallplatteneinspielungen lassen sich nur dann gerecht würdigen und begreifen, wenn man den betreffenden Pianisten auch »in Natur« gehört, seinen Anschlag erlebt hat. Oft täuscht die Platte. Edwin Fischer spielte doch fesselnder und schöner, als seine Platten klingen. Der späte Wilhelm Backhaus hat auf dem Konzertpodium eine linde Bewegtheit, eine männliche Innigkeit, von der die Platten kaum etwas verraten.
Immer wieder habe ich mir die Frage gestellt, ob ein solches Pianistenbuch nicht spontan-flüchtige Eindrücke ungerecht verfestigt und falsche Schlüsse daraus zieht, daß Herr X die Appassionata am Freitag, dem 13., besonders langsam spielte, weil er sie im vorausgehenden Konzert am Mittwoch, dem 11., allzu rasch genommen hatte und dabei an die Grenzen seiner Technik gestoßen war (was aber der Freitagszuhörer keineswegs weiß). Ein solcher Einwand ist unabweisbar. Auch läßt sich nicht verkennen, daß der späte Rubinstein mit dem »frühen« Rubinstein wenig zu tun hat, daß gerade den erstklassigen, wagemutigen Pianisten eher einmal ein schlechter Abend unterläuft als denen, die immer nur sichergehen wollen, die sich nie verirren – aber darum auch kaum je ein lohnendes Ziel erreichen.
Doch wer sich an diesem unvermeidlichen Zufallsmoment stößt und die Gefahr falscher Fixierung junger Talente nicht in Kauf nehmen möchte, der hadert in unserem Pianisten-Spezialfall mit Unvollkommenheiten, die sich immer einstellen, wenn Lebendiges und Widerrufliches und Wachsendes ins feste Schriftbild geholt werden soll. Zwei Biographien stoßen zusammen, wenn ein 37 jähriger kritischer Musikfreund hört, wie der 50 jährige Swjatoslaw Richter Brahms’ B-Dur-Konzert spielt. Richter hat sich verändert und wird auch beim nächsten Mal ein wenig anders spielen – und der Hörer dürfte in 20 Jahren seinerseits andere Einsichten und Sehnsüchte haben. Doch was besagt das? Nichts anderes, als daß im Bezirk der Kunst Wahrheit ohne den Einsatz von Subjektivität und ohne spezifische Situation kaum gedacht werden kann.
In dem Augenblick, da es um Schauspieler, Dirigenten oder Pianisten geht, da Menschen charakterisiert werden sollen und nicht nur Werke, die sich von den Menschen ablösten, um ihren eigenen Schicksalen entgegenzuharren – in dem Augenblick wird der Moment als ein Symbol verstanden. Das kann niemand ändern oder umgehen. (Und selbst über die Werke läßt sich wenig »Objektives« sagen, wenn die Sphäre des ästhetischen Urteils erreicht und die des Meßbaren verlassen ist.) Immerhin scheint ein allzu herber Triumph des Zufalls doch ausgeschlossen, wenn man einen Künstler über Jahre hin immer wieder hört, wenn man die Konzerteindrücke, die trügerisch sein mögen, mit den Schallplatten vergleicht, die der Künstler eingespielt und freigegeben hat, so daß sie zumindest verraten, was er will, wennschon nicht, was er kann. Und schließlich stellt ja ein Konzert auch mehr dar als eine Summe aus richtigen und falschen Tönen: Dahinter steht ein Mensch, der sich treu bleibt, die Identität einer Künstlerpersönlichkeit, die auch in den Extremen nicht ihrem eigenen Gesetz entrinnen kann, selbst wenn sie es möchte.
Das alles klingt vielleicht verstiegen – läßt sich aber sogar technisch konkretisieren. Auch ein erstklassiger Pianist zum Beispiel kann einen rabenschwarzen Abend haben, kann haarsträubend falsch und unmusikalisch spielen. Doch selbst dann wird die rhythmische Gespanntheit da sein. Die Linke wird vielleicht scheußlich, aber nicht dilettantisch begleiten. Und die Rechte wird vielleicht grell oder tot oder besinnungslos phrasieren – aber nicht kitschig, nicht trivial. Der Typus bleibt trotz aller Anfechtungen erhalten.
Felix Mendelssohn-Bartholdy hat die Bemerkung gemacht, daß Musik keineswegs immer undeutlicher sei als das präzisierende Wort, sondern daß sie manchmal auch viel differenzierter über seelische Zustände rede, als Worte es vermöchten. Es gibt Zwischentöne, an die reicht kein Adjektiv heran.
Wer über Musik und Musiker schreibt, kann entweder versuchen, mit der Sprache doch das Unmögliche zu leisten, oder er kann darauf hoffen, daß zwar nicht ein einziger Satz das Un-Sagbare einfängt, aber vielleicht eine Fülle von Sätzen es einkreist. Der zweite Weg scheint mir gangbarer. Denn allzu leicht gerät man ins Geschraubte, Überdifferenzierte und Nuancenselige, wenn man für jeden Sachverhalt ein neues Vokabular ersinnen will. Nicht auf den einzelnen Feststellungen, Lob- oder Tadelsprüchen liegt das Gewicht, sondern auf dem Zusámmenhang, den sie bilden. Natürlich ist manchen unter den besten lebenden Pianisten unserer Zeit manches gemeinsam – Souveränität, die Tendenz zur Neutralität oder zur Manier. Dergleichen darf nicht verschwiegen werden, nur weil es für den Nachbarn auch gilt. Wer ein Buch über Chirurgen schreibt, kommt um den Hinweis, daß A und B eine sichere Hand besitzen, kaum herum; wer über Heilige berichtet, muß davon reden, ob es fromme und wahrheitsliebende Leute waren. Es mag schriftstellerisch ergiebiger und amüsanter sein, wenn sie es nicht waren. Doch in der Regel sind sie es.
So lasse man sich nicht von dem Sachverhalt überraschen, daß auch den großen Pianisten vieles gemeinsam ist. Natürlich wollen wir die Unterschiede genauer ins Auge fassen als die Gemeinsamkeiten. Doch wäre es, wie ich glaube, unredlich, um der Überdeutlichkeit willen zu verschweigen, was die Besten verbindet – und daß es mehr Arten des Pianissimos gibt als Adjektive, sie zu benennen.
(Aus dem Vorwort zur 1. Auflage, 1965)
Zwischen Verunsicherung und passionierter Anteilnahme
In den sieben Jahren, die seit dem ersten Erscheinen meines Buches »Große Pianisten in unserer Zeit« vergangen sind, hat sich viel ereignet: Vorhersehbares, Erwartbares, Überraschendes, völlig Neues. Aber nicht nur die persönlichen Entwicklungen, die Repertoires der großen Pianisten und die Schallplattenverzeichnisse veränderten sich, es kamen nicht nur einige sehr gewichtige junge Interpreten hinzu, sondern im Zusammenhang mit der intellektuellen Kulturrevolution, die über die westliche Welt hinwegrollte, wurde der gesamte Konzertbetrieb so grundsätzlich und massiv wie wohl noch nie in Frage gestellt. Was Anfang der sechziger Jahre nur als individuelle Schwierigkeit etwa von Glenn Gould und Friedrich Gulda verstehbar war, das erweiterte sich zur objektiven Fragestellung.
Alle diese vielfältigen Entwicklungen lassen sich keineswegs, genausowenig wie das Leben selbst, auf nur einen Nenner bringen. So ist hier, neben allem möglichen Krisenhaften, auch über eine staunenswerte und noch unabsehbare Erweiterung in der Beziehung zwischen Künstler, Werken, öffentlichem Auftreten und Schallplattenobjektivierung zu berichten: Ich meine damit die zunächst belächelte und gerade von den Fachleuten verspottete, langsam aber doch unübersehbar und wichtig gewordene Rolle der Musikaufzeichnungen und Musikdarbietungen des Fernsehens. Von Martha Argerich, Stephen Bishop, Friedrich Gulda, Wladimir Horowitz und Arturo Benedetti Michelangeli gibt es – um nur einige Namen zu nennen – mittlerweile Fernsehaufzeichnungen, denen interpretationsgeschichtlicher Rang zukommt. Martha Argerich hat etwa vor den Kameras des Westdeutschen Fernsehens und auch im Zusammenhang mit einem Berliner Galaauftritt Chopins Mazurken und Liszts Es-Dur-Konzert unvergleichlich besser gespielt als auf ihren DGG-Schallplatten; Stephen Bishops Interpretation von Beethovens Diabelli-Variationen scheint, ganz abgesehen von ihrer erlauchten Qualität, ein noch sehr gewagt anmutender Schritt auf dem Wege zu einer phantasievollen, halbwegs adäquaten Musikaufzeichnungs-Kultur des Fernsehens zu sein. Friedrich Gulda spielt, gleichfalls im Fernsehen, Beethovens G-Dur- und Es-Dur-Konzert durchaus vehementer und spontaner als bei seinen etwas unbeteiligt wirkenden Schallplattenaufnahmen mit Horst Stein. Die berühmt gewordene und berüchtigt teure Fernsehaufzeichnung eines »Recitals« von Wladimir Horowitz (mit einer sensationellen Interpretation von Chopins fis-Moll-Polonaise, einer sublimen Darstellung von Schumanns »Arabeske« und einer niederschmetternd virtuosen, geradezu kauzig überlegenen Wiedergabe seiner »Carmen«-Variationen) machte es dem Klaviergott möglich, in unsere Wohnzimmer hinabzusteigen: Ein Mythos konnte besichtigt werden, Klavierlehrerinnen aller Länder waren sich darüber einig, daß Horowitz zwar eigentlich eine falsche Handhaltung praktiziere, unerlaubterweise aber trotzdem besser spiele als alle Musterschüler mit korrekter Fingerstellung. Und Arturo Benedetti Michelangeli holte vor der Kamera die Eisblumen-Zerbrechlichkeit später, erinnerungssüchtiger Chopin-Mazurken ins sozusagen zeitlose Museum großen Klavierspiels heim.
Der meist politisch oder radikal-soziologisch vorgetragene, kulturkritisch motivierte Zweifel an der »Konzertkultur«, am Sinn der Vermittlung von großer Musik, ja an großer Musik selbst, hat nicht nur eine unbezweifelbare Verunsicherung der klavierspielenden Welt zur Folge gehabt, sondern offenbar auch das genaue Gegenteil einer solchen Verunsicherung: nämlich leidenschaftliche, manchmal geradezu fluchtartige, manchmal aber auch sehr bewußt auf den spezifischen Qualitäten großer Musik und großer Interpretation beharrende Spezialisierung. In einer Zeit allgemeiner Verunsicherung wurde nicht nur von den Protestierenden (lauthals und vorübergehend) gegen das oft wirklich abscheuliche, tatsächlich mittlerweile legerer gewordene bürgerliche Frackritual des Konzertbetriebs geschimpft, sondern diese Verunsicherung führte auch dazu, daß viele Verstörte, zumal solche, die mit der modernen Literatur, ihrer ideologisch-propagandistischen Einseitigkeit oder ihrer abstraktionistischen Abseitigkeit, nichts mehr anfangen konnten oder wollten, im Bezirk bedeutender Musik noch ein Refugium erspürten. Schallplattensammelei, Diskophilie, Interesse für Musik und vergleichende Interpretationssendungen wurden in den letzten Jahren zur weitverbreiteten Sucht, zum »Hobby«, wenn nicht »Kult« einer erstaunlich großen Minderheit! Man kann Chopins Terzenetüde eben nicht kommunistisch oder spätkapitalistisch interpretieren. (Als Werk kann man sie vielleicht gesellschaftspolitisch interpretieren, aber man kann sie nicht politisch links oder rechts spielen, sondern nur mit linker und rechter Hand.) So führte die allgemeine Verunsicherung, die auch den Konzertsaal attackierte, gleichfalls dazu, daß Musik und Klaviermusik als heißgeliebte und unpolitisierbare Reservate individueller und objektiver humaner Äußerung mit leidenschaftlicher Anteilnahme »verfolgt« wurden und werden. Auch mein Buch hat von dieser für mich sehr erfreulichen Anteilnahme erheblich profitiert.
Kein Zweifel: gegenwärtig ist manches große Talent im Begriff, sich vom Klavier abzuwenden. So wehrt sich beispielsweise der glänzende Wiener Pianist Otto M. Zykan dagegen, in Konzerten »klassische Musik« zu spielen, obwohl er sie, privat und schizophren, liebt; seine klare, technisch und geistig gleichermaßen fesselnde Schönberg-Gesamteinspielung beweist darüber hinaus, daß Zykan Schönbergs Klavierwerk moderner, brahmsferner, klarer und vehementer versteht als etwa der große Schönberg-Schüler Eduard Steuermann und daß dieser unbekannte Otto M. Zykan Schönbergs Opus 11 engagierter und pianistisch »richtiger« zu spielen weiß als der weltberühmte Glenn Gould. Auch der differenzierte und souveräne Komponist und Liedbegleiter Aribert Reimann hält öffentliches Auftreten für »nicht mehr möglich«; glücklicherweise hält er sich nicht immer daran, was er für richtig hält. Wenn solche Köpfe feiern, welch ein Verlust für unseren Staat, könnte man, im Hinblick aufs Klavierimperium, mit Schillers König Philipp sagen…
Doch diese Grundsatzkrise hat, ich deutete es schon an, auch eine offensichtliche Stärkung des musikalischen Widerstands, also der Interpretationsseriosität, zur Folge gehabt. Daniel Barenboims hier noch ausführlich zu analysierender Welterfolg in den letzten Jahren war ein Welterfolg reiner Musikalität. Der Pianist Alfred Brendel gewann eine neue Qualitätsdimension hinzu, die er als 30 jähriger wohl noch nicht hatte und jetzt besitzt: In seinem Falle geschah das seltene Wunder, daß jemand nicht ein Leben lang (trotz mannigfachem Hin und Her) dem »Gesetz, nach dem er angetreten«, verhaftet blieb, sondern wirklich über sich hinauszuwachsen wußte. Auch Martha Argerich und Maurizio Pollini eroberten Neuland.
(Aus dem Vorwort zur 2. Auflage, 1972)
Damen, die sich nicht vordrängten
Jede Auswahl schließt Ungerechtigkeiten ein. Gewiß, es entspringt wohlerwogener, wenn natürlich auch irrtumsbedrohter Absicht, wenn in diesem Buch manche Pianisten überhaupt nicht (oder: nicht mehr) auftauchen. Manchmal aber sind diese Lücken auch nur Folgen von Zufall (weil ich die betreffenden Pianisten nie persönlich hörte, nie Schallplatten von ihnen begegnete) oder von lokaler beziehungsweise persönlicher Begrenztheit. Man kann leider nicht immer gleichermaßen aufgeschlossen sein. Außerdem gibt es große Künstler, die nicht oder fast nicht reisen und sich deshalb nur eines lokalen Ruhmes erfreuen.
So hat ein schweres persönliches Schicksal die Pianistin Youra Guller – sie ist Jüdin, jetzt eine alte Dame, führte schon während des ersten Weltkrieges unter Ernest Ansermet Beethovens G-Dur-Konzert auf, steht bereits in Walter Niemanns Klavierbuch von 1921, war Freundin und in einem Wettbewerb sogar siegende Gegenspielerin von Clara Haskil – hierzulande vollkommen unbekannt bleiben lassen, obwohl die Londoner »Times« sie einst eine »legendäre Pianistin« nannte. Youra Guller nimmt immer wieder Anlauf, noch zu konzertieren, aber sie wagt es dann doch nicht mehr. Immerhin gibt es von ihr eine großartig spirituelle Einspielung der vorletzten und der letzten Beethoven-Sonate, immerhin liegen bezwingend beredte Chopin-Schallplatten vor, immerhin hat sie – von ähnlicher Musikalität wie Clara Haskil, nur mit wohl virtuoserem technischen Rüstzeug – Lisztsche Bach-Bearbeitungen, Mozartsche Klavierkonzerte und anderes auf Platten oder in mitgeschnittenen Konzerten beziehungsweise in Rundfunkstudios gespielt. Sie verfügt über einen sonoren Ton und brahmssche Klassizität der Auffassung. Kein Wunder, daß Casals, Milhaud, Ravel, Busoni, Szigeti und sogar Albert Einstein Youra Guller huldigten. Sie gehört zu den geheimen, aber bedeutenden Pianisten unserer Zeit.
Bachs Goldberg-Variationen, fünf seiner Klaviertoccaten sowie eine Prokofjew-Sonate sind die einzigen Einspielungen, welche die Amerikanerin Zola Mae Shaulis bisher in Europa herausgebracht hat. Diese wenigen Platten genügen indessen schon, ein vollkommen natürliches und originelles Talent zu bestätigen. Die Künstlerin versteht es, ohne jeden Manierismus zu faszinieren. Sie forciert weder das Motorische noch überhaupt das »Pianistische«, am ehesten ließe sich ihr Bach-Spiel dem von (immerhin!) Wilhelm Kempff vergleichen. Und bei einer solchen Gegenüberstellung würde sich die Jüngere sogar als weniger manieristisch erweisen.
Als letzte bisher von mir vernachlässigte Klavierdame sei auf Alicia de Larrocha hingewiesen. Ihr Spiel ist von einer großartigen rhythmischen Plastizität. Ob Bachs Chaconne in der Busoni-Bearbeitung, ob Mozart, Chopin oder Mendelssohn: jedesmal läßt Alicia de Larrocha – sie ist Professorin in Barcelona, gehört seit langem zu den gefeiertsten Künstlern der New Yorker Klavierszene – pianistische Ausnahmeereignisse entstehen. Vollends unschlagbar wird sie, wenn sie Albéniz, de Falla oder Granados interpretiert. So gehört der (glücklicherweise mitgeschnittene) Liederabend, den Alicia de Larrocha zusammen mit Victoria de los Angeles gestaltete, zu den bedeutenden Konzertdokumenten in der Geschichte der Schallplatte.
(Aus dem Nachwort zur 3. Auflage, 1978)
Konzertkultur, Schallplatte und Fernsehen
In Mitteleuropa wundert man sich nicht darüber, in einer Schule, einem Gemeindesaal, einem Wirtshaus, an Bord eines Personendampfers oder in einer bürgerlichen Wohnung – auf ein Klavier zu stoßen. Man kann hier keine Rundfunkzeitung aufschlagen, keine Litfaßsäule überfliegen, keine Konzertvorschau studieren, ohne auf Klaviermusik und Pianisten gelenkt zu werden. Die Zeit, da Klavierstunden für höhere Töchter ein »Muß« waren wie die Tanzstunde, ist zwar mitsamt den höheren Töchtern dahin, aber sie wirkt noch nach. Auch heute hat das Klavier – trotz unserer Dreizimmerwohnungs-Zivilisation, die alles Üben und Klimpern zur beinahe unzumutbaren Belastung für Familienangehörige und Nachbarn macht – seine große, interessierte Gemeinde. Klavierlehrer sind nicht brotlos, Nachwuchs drängt auf die Podien, Klaviernoten und Klavierplatten sind gut verkäufliche Ware. Niemand findet etwas dabei, wenn in den Tageszeitungen spaltenlange Berichte über die jüngste Interpretation der Wanderer-Fantasie durch Herrn X stehen.
Abend für Abend kommen in den kleinen und erst recht den großen Städten unseres Kulturkreises festlich gekleidete Menschen in Konzertsälen zusammen – nicht so viele wie zu einem Fußballspiel, aber manchmal doch 2000 und mehr –, um einen Pianisten zu hören. Gewiß: daß man sich festlich kleidet, wenn man ein Konzert hören will, ist dem Mitteleuropäer selbstverständlicher als etwa dem Engländer – obschon die freie bürgerliche Konzertkultur sich in Großbritannien bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts etablierte, während sich in Deutschland und Österreich erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die »regulären« Konzertveranstaltungen einbürgerten.
Es gibt also eine mehr als 200 Jahre alte Konzertkultur. So kommt es, daß heute in Wien oder München ein halbes Dutzend mehr oder minder brauchbarer Konzertsäle zur Verfügung steht, während beispielsweise in Athen, von wo immerhin die Kultur des Abendlandes ausging, selbst namhafte Künstler in Kinos spielen müssen. Nichts versteht sich von selbst, wo die uns selbstverständliche traditionelle Konzertkultur fehlt. Ich hörte in Athen einmal die treffliche Rena Kyriakou Beethovens c-Moll-Sonate op. 111 in einem Kino darbieten. Technisch einwandfrei, aber die Künstlerin hatte offenbar nicht den Schatten einer Ahnung, woran sie gerade die Hand legte. Die Rückungen der Maestoso-Einleitung, die ekstatischen Akzente, die langen Atempausen: alles das sagte der Dame mit den schwer arbeitenden Fingern nichts. Doch die wenigen Zuhörer im Kinoparkett (es waren nur die vordersten Reihen besetzt mit meist Auswärtigen und Botschaftsmitgliedern, hinten im Saal verteilten sich ein paar Einheimische) schienen nichts zu vermissen. Bei der Zweiunddreißigstelvariation der Arietta kam die Künstlerin in Feuer: Die schwarzen Haare flogen, die Technik glänzte, aus einer wohlvorbereiteten Pianistin wurde eine Athena Promachos, eine siegende südliche Göttin. Es ist beunruhigend, sich vorzustellen, daß wir vielleicht die klassischen griechischen Tragödien genauso verfehlen.
Kehren wir von dieser athenischen Modulation wieder zurück zu unserem Thema: zur mitteleuropäischen Konzertkultur, die sich mittlerweile über einen großen Teil der Welt ausgebreitet hat. Diese Konzertkultur ist kein Geschenk; sie will erworben, bewahrt und verteidigt sein. Denn manchmal scheint es auch hierzulande, als gehöre die noble, individuelle, gesellige Lust am Klavier und seinem einzelgängerischen Ausdruck einer versinkenden Epoche an. Man braucht sich dabei gar nicht die immer besonders exaltiert und anachronistisch wirkende Zuhörerschaft etwa von Chopin-Abenden zu vergegenwärtigen, wo erlesene Toiletten, rhetorisch rote Haare und flammend verfallene Augen den Ästheten an Dekadenz, den Mediziner eher an Morphium denken lassen. Man könnte auch argwöhnen, daß im Zeitalter der zwar noch verbreiteten, aber eben doch bedrohten Hausmusik, der Schallplattenkultur und der Massenmedien das notwendige Interesse für etwas lockerer gespielte Oktaven oder etwas sensibler begriffene Pralltriller im Schwinden, gewissermaßen die Marotte einer aussterbenden Kaste sei. Auch das Konzert selbst stellt eine vielgeliebte, notwendig anachronistische Form öffentlicher Kunstübung dar. Diese Form dürfte erhalten bleiben, solange Bachs Fugen, Beethovens Sonaten, Chopins Etüden und Brahms’ Intermezzi noch Bestandteile unseres geistigmusischen Seins sind und persönlich-spontane Auslegungen provozieren.
Während die Arbeitsteilung in weitester Form, das Prinzip des Teamworks, nicht nur in die technischen, sondern auch in die geisteswissenschaftlichen Fächer drängt, ist der Pianist – wie der Dirigent – großer einzelner geblieben. Immer, wenn ein einsamer Interpret am Flügel gegen ein Werk, ein Orchester und ein Publikum antritt, umgibt ihn darum eine Aura – so wie der Dirigent oft genug etwas vom beschwörenden Medizinmann hat. Das ist kein Zufall. In welcher Reproduktionssparte noch hängt alles so sehr vom einzelnen, seinem Empfindungs-, Gestaltungsund Dispositionsvermögen ab wie beim Klavierspiel? Selbst der Sologeiger, selbst die Primadonna brauchen im allgemeinen einen Begleiter oder ein Begleitorchester. Auch die Dirigenten, so einsam und groß sie manchmal scheinen wollen, wären ohne den Widerhall eines lebendigen Orchesters tot. Nur der Pianist- und natürlich in entscheidend anderer, viel weniger sichtbarer, konzertanter und individueller Weise auch der Organist – ist ganz auf sich gestellt, bietet im Zeitalter des Teamworks, der Arbeitsteilung und vielfacher Absicherung das Bild des heroischen, großen, auf sich selbst gestellten Subjekts. Er hat etwas vom einsamen Helden, vom Gladiator. Solange dieses »Subjekt« noch für sich zu interessieren vermag, solange man seinen Jubel und seine heimliche, das heißt bis zur letzten Reihe hin hörbare Träne noch vernehmen will, so lange wird es Klavierabende geben.
Mit dieser einsamen Selbständigkeit des Klaviers mag zusammenhängen, daß die Tasteninstrumente seit den Tagen von Johann Sebastian Bach den Intimbereich vieler großer Komponisten darstellen. Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms und Reger traten als Klavierspieler hervor. Sie schrieben alle mithin »für sich selbst«, machten das Pianoforte zum Ort ihrer persönlichen Experimente. Beethoven war auf dem Klavier seinem Komponieren gleichsam voraus; er hat bestimmte formale und dynamische Bezirke in der Pathétique, der Mondschein-Sonate und der d-Moll-Sonate op. 31,2, also zuerst auf dem Klavier, ausprobiert. Die mit diesen Klavierentdeckungen zusammenhängenden überwältigenden Neuerungen des symphonischen Ausdrucks oder der Streichquartett-Polyphonie kamen jeweils später. Bei Brahms war es nicht anders. Seit Chopin, Liszt, d’Albert und Rachmaninow gibt es zudem den Typus des großen und geistvollen Komponisten und Virtuosen. Es war höchst folgerichtig, daß der berühmteste aller Pianisten, nämlich Franz Liszt, auch die Form des Soloabends einführte, nachdem man vorher (allzu) bunte Programme bevorzugt hatte, die Sänger, Orchester und Instrumentalsolisten nacheinander auftreten ließen. Der Klavierabend, gar der einem einzigen Komponisten gewidmete Klavierabend, mußte »erkämpft« werden. Heute macht mitunter ein (allzu) braver Stilwille aus dem Programm manchmal ein Exerzitium. Abwechslung braucht nicht immer gleich Stillosigkeit zu sein. 1835 war es allerdings noch möglich, daß Liszt den Parisern zum erstenmal Beethovens Mondschein-Sonate vorführte, dabei aber nur den zweiten und dritten Satz auf dem Flügel spielte. Das einleitende Adagio, dem die cis-Moll-Sonate wohl ihren Namen verdankt, wurde damals von einem Orchester vorgetragen. Das Liszt-Zeitalter ist versunken. Wenn man die große Rolle erwägt, die das Klavier für Komponisten und Virtuosen des 19. Jahrhunderts spielte, dann ist auffallend, wie entschieden die Komponisten des 20. Jahrhunderts vom Klavier abrückten. Mahler, Strawinsky, Strauss, Webern und Berg haben nur wenige Klavierwerke hinterlassen. Oft, zumal bei Strawinsky, nehmen die spärlichen Klavierwerke den Charakter von Pflichtstücken an. Auch bei Hindemith spielen die Tasten keine zentrale Rolle, bei Schönberg gleichfalls nicht. Nur Prokofjew und Bartók – die ohnehin eher der »gemäßigten Moderne« zuzurechnen sind – schrieben zahlreiche effektvolle Sonaten, Stücke und Konzerte für ihr Lieblingsinstrument.
Für manche modernen Komponisten klebt möglicherweise am Klavierton zuviel »Salon«, zuviel spätromantischer Titanismus. Die Bevorzugung des Orchesters oder des kleinen Bläserbeziehungsweise Streicherensembles mag auch damit zu tun haben, daß selbst begabte Amateure heutzutage nicht imstande sind, Klavierkompositionen des 20. Jahrhunderts – seien sie nun von Schönberg, Křenek oder Boulez – sinnvoll zu spielen. Die zeitgenössische Klaviermusik kann also nicht mehr mit jenem Unterbau von talentierten und interessierten Laien rechnen, der für Mozart oder Brahms selbstverständlich gewesen sein muß. Der Anreiz, Klaviermusik mit dem Ziel zu komponieren, daß sie »populär« werde (so wie einst Chopins Es-Dur-Nocturne op. 9,2 zum Schlager wurde), existiert nicht mehr. Nur Hindemiths Sonaten und ein paar Arbeiten von Debussy, Ravel und Bartok sind in beträchtlicherem Umfang über den Zirkel der Fachleute hinausgedrungen.
Man muß also folgendes für gegeben nehmen: Die manchmal anachronistisch wirkende öffentliche Konzertkultur bietet in unserer Gegenwart nach wie vor die Auseinandersetzung des großen »einzelnen« mit dem Riesenstoff überkommener Klaviermusik. Moderne Kompositionen werden in durchschnittliche, mittlere Klavierabendprogramme nur ausnahmsweise hineingenommen. Das Renommee eines Pianisten hängt davon ab, wie er das 18. und vor allem das 19. Jahrhundert bewältigt. Für Modernes gibt es einige vorzügliche Spezialisten. Von jenen Werken abgesehen, die mit eindeutig pädagogischer Tendenz geschrieben wurden, gehört die Klaviermusik des 20. Jahrhunderts nicht zum eisernen Bestand der Hausmusik. Das kann sich ändern. Doch da die Bereitschaft, viel Zeit und Energie an Hausmusik zu wenden, eher nachläßt, ist fraglich, ob die schwierigen Stücke der letzten Jahrzehnte je integriert werden.
Mögen aber alle an der Konzertkultur Beteiligten noch so »willig«, die pädagogischen Tricks noch so ausgeklügelt, die Techniken des Zusammenschneidens und Manipulierens von Tonbändern noch so fein, die allgemeinen Voraussetzungen noch so günstig sein: der ganze Musikbetrieb hat eine leere Stelle, auf die alles blickt. Es ist die optimale Interpretationsleistung, von einem einzelnen zu bestimmter Zeit vollbracht. Nichts kann diesen einzelnen ersetzen, sein Fehlen bemänteln.
Die Virtuosen, die großen interpretierenden Virtuosen unserer Zeit füllen ebendiese leere Stelle aus. Es ist unter feinsinnigen Kunstfreunden üblich, vom »Virtuosen« abfällig zu sprechen, so als ob man auch nur einem einzigen derjenigen, die über ein oder mehrere Jahrzehnte tonangebend zu spielen wissen, vorwerfen könnte, er wäre nichts als »rein virtuos«. In Wahrheit besitzen die Großen, die nicht nur von einer Mode hochgetragen wurden, einem wohlgefälligen Äußeren oder einem anekdotischen Umstand, sämtlich auch interpretatorische Originalität. Jedes Publikum ist ja zugleich naiv begeisterungsfähig und naiv grausam. Es neigt zur mechanischen Bewunderung ebenso wie zum mutwilligen Verrat: »X hat nicht gehalten, was sein Anfang versprach«, »früher hatte Ys Spiel mehr Glanz«, »Z ist steril geworden«. In solchen Sätzen schwingt eine oft unbewußte Zerstörungslust mit. Beständiger Ruhm festigt sich nur, wenn er diese Zerstörungslust übersteht. Die Gladiatoren müssen nicht nur spielen, sondern auch kämpfen. Sie setzen sich, so will es das Raubtier Publikum, ein.
Die Virtuosen erfüllen ein elementares Bedürfnis. In ihnen muß sich Sensibilität mit grob-gesunder Konstitution verbinden. Sie bereisen die Kontinente und sollen-hundertmal im Jahr oder mehr, und das über Jahrzehnte hin – zugleich den objektiven Stand höchster Interpretationskultur und darüber hinaus etwas ganz Persönliches, Unverwechselbares bieten. Was für ein Leben! Sie alle können viele Sprachen, kennen die Manager, die Mächtigen, die Hotels und die guten Restaurants, sind Bewunderung gewohnt. Rubinstein hat gestanden, er beginne sich zu langweilen, wenn er sich zu lange an einem Ort aufhalte – offenbar brauchte er die Abwechslung des ständig neuen (neu zu erobernden) Publikums. Arrau, der innerhalb weniger Wochen in Japan, wo angeblich das Beethoven-Publikum so gut ist, in Amerika, London, München und dann wieder in London konzertiert, findet, nur ständige Luftveränderung sei erfrischend, sie halte die Physis spannkräftig und gesund. Zwar können die Weltberühmten nicht mit blinder Begeisterung rechnen. Aber die Bereitschaft, sich begeistern zu lassen, dürfen sie bei ihrem Publikum voraussetzen. Sie müssen dafür den ganzen, absoluten Einsatz leisten. Es gibt dafür kein diskreteres, weniger knalliges Wort. Schon »Hingabe« klänge zu passiv. Rubinstein hat gesagt, wenn der Pianist im Konzert nicht ein paar Tropfen Blut und ein paar Pfund verlor, dann war das Konzert nicht gut. Das ist kaum eine Übertreibung: Ich habe erlebt, wie Gieseking sich in Frankfurt gleich am Anfang von Tschaikowskis b-Moll-Konzert verletzte und auf allmählich rot werdenden Tasten das Fortissimo-Stück zu Ende brachte. Der alte Cortot stand derartige Strapazen nicht mehr durch. In London verlor er bei Chopins f-Moll-Konzert (das er tausendmal gespielt hatte) den Faden, es kam zum sogenannten »Schmiß«. Aber Cortot deutete mit generösen Gesten an, daß er schuld habe, daß nicht die begleitenden Orchestermusiker versagt hätten, sondern er selbst.
Vorbemerkung zur Neuausgabe 1996
Unsere Klavierwelt seit 1945
Entwicklungsphasen und Fixierungsprobleme
Worauf Konzerte antworten
Zwischen Verunsicherung und passionierter Anteilnahme
Damen, die sich nicht vordrängten
Konzertkultur, Schallplatte und Fernsehen
Arthur Rubinstein
Wilhelm Backhaus
Wladimir Horowitz
Wilhelm Kempff
Claudio Arrau
Rudolf Serkin, Solomon und Clifford Curzon
Swjatoslaw Richter
Emil Gilels
Benedetti Michelangeli und Casadesus
Glenn Gould und Friedrich Gulda
Daniel Barenboim, Stephen Bishop, Alfred Brendel
Martha Argerich, Bruno Leonardo Gelber, André Watts
Vladimir Ashkenazy, Maurizio Pollini, Jean-Bernard Pommier
Géza Anda – und andere Mozart-Interpreten
Zwischen Intellektualität und Virtuosität
Rückblick auf eine Tendenzwende. Wie sich die Kunst des Klavierspiels seit den 1970er Jahren entwickelte
Klaus Bennert
Verlust und neue Fülle. Der Wandel der Klavierwelt in den frühen 1990er Jahren
Die großen Toten
Neuer Pluralismus
Medien zwischen Kult und Kommerz
Reiz der Entwicklung
Junge Meister
Exzentrische Bahnen