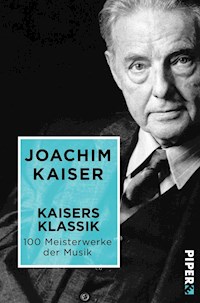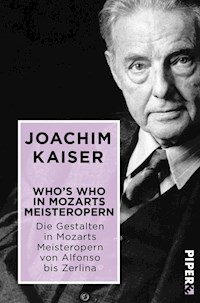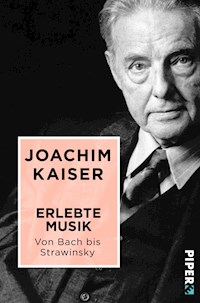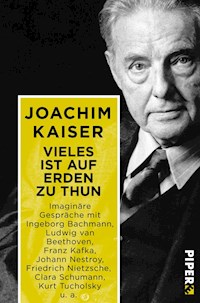5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der bekannteste Musikkritiker unserer Zeit über einen der größten Komponisten
Richard Wagner, dem Titanen der Opernkunst, gilt Joachim Kaisers besondere Vorliebe. Der bekannte und beliebte Musik- und Theaterkritiker gibt in seinem Buch eine überaus kenntnisreiche, anregende Einführung in das Leben und Schaffen dieses Komponisten. Und er vermittelt zugleich etwas von der Faszination, die von Wagners Bühnenwelt ausgeht.
Im Jahr 1951 rezensierte Joachim Kaiser zum ersten Mal eine Wagner- Oper – und war sofort von diesem Komponisten und seinem Werk fasziniert. Seitdem hat er sich immer wieder mit der »Riesengestalt« Richard Wagner und seiner widersprüchlichen Bedeutung auseinandergesetzt. Einführendes über Wagner, den Künstler, das verfemte Frühwerk, »Lohengrin«, die »Meistersinger«, bis hin zu der Frage: Was geschieht eigentlich im Ring? Mit diesen und weiteren Themen erschließt Joachim Kaiser den kulturhistorischen und mythologischen Hintergrund und führt den Leser an das komplexe Werk heran. Ein Buch, das überzeugende und unterhaltsame Antworten gibt auf die Frage, warum Wagners Musik das Publikum bis heute fasziniert und begeistert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I
Leben mit Wagner meint in diesem Buch ein Doppeltes: zum einen ausführliche Hilfestellung für solche, die gern Wagners Musikdramen in ihr Leben hineinnähmen. Zum anderen komme ich auch immer wieder auf wichtige Momente meines eigenen Lebens mit Richard Wagner zu sprechen.
Keineswegs hatte ich vor, mit Eingeweihten oder Spezialisten einen Dialog zu führen, der die genaue Kenntnis aller Werke und vieler Bücher vornehm voraussetzt. So groß ist weder mein Ehrgeiz noch auch mein Wagner-Wissen. Ich bemühte mich vielmehr, die Werke, ihren Gehalt, ihre Herrlichkeiten, ihre Schwierigkeiten so zu erläutern, dass jedem Interessierten, jedem gegenüber der Riesengestalt Wagner und der Unmenge von Wagner-Literatur hilfsbedürftigen potenziellen Wagnerianer, jedem zögernden oder begeisterten Wagner-Anfänger einleuchtend werde, um was es in den Musikdramen geht. Welche Beziehung oder Nicht-Beziehung zwischen Text und Musik, zwischen Wagners Kunst und Wagners Antisemitismus besteht. Oder: welche Erfahrungen in die Wälsungen-Tragödie eingingen, was alles das Frageverbot bedeutet, das in den Feen wie im Lohengrin eine so große Rolle spielt. Übrigens ist es mühevoller, kurz und bündig »Isoldes Wandlungen« mitzuteilen oder zusammenfassend die Frage zu beantworten: Was passiert eigentlich im Ring? – als grandiose Spekulationen zu äußern oder subtile Analogien zu suchen.
II
Ich will nicht leugnen: Manchmal erfüllt mich ein Überdruss gegenüber Wagner-Inszenierungen. Es kann kein Zufall sein, dass mich der Parsifal nie so bewegte wie in Daniel Barenboims konzertanter Darbietung; dass heute noch Furtwänglers konzertante Ring-Interpretationen aus Mailand und Rom berühmt sind; dass Bernsteins konzertanter Münchner Tristan gleichfalls eine große Erinnerung darstellt. Sowenig Opern Museumsexponaten gleichen, so gefährlich scheint mir jene Schere im Kopf mancher Regisseure, die ihnen zwanghaft alles das verbietet, was sie für Konvention halten, für dienendes »Vom-Blatt-Spiel«, für unoriginell. Ein Glück, dass die Partituren, die Klavierauszüge, auch Einspielungen es möglich machen, zwar nicht die Sache selbst wahrzunehmen (auch beim Notenlesen, bei höchster Objektivität interpretiert man unvermeidlich, weil man ein Tempo wählt, sich das Alter und die Artikulation der Singenden vorstellt), wohl aber die fixierte, unverstellte Absicht des Dichter-Komponisten.
III
Ich möchte die Aufmerksamkeit des Lesers mit Nachdruck auf »Das verfemte Frühwerk« lenken, einen Text, den er wahrscheinlich überblättern wird, weil da von Stücken die Rede ist, die kaum jemand kennt oder schätzt: von den Feen, dem Liebesverbot, dem Rienzi. Als ich ihn schrieb, stieß ich auf so viele entlegene Schriften Wagners, dass mir schien, es müsse bald einmal ein Wagner-Buch vorgelegt werden, welches eben keine bloße Biographie ist, keine Analyse seiner Werke, sondern von Neuem der Entwicklung des Wagnerschen Denkens nachgeht, dem wandlungsvollen Zustandekommen seiner Weltanschauung und seiner Urteile. So wie Wagners spätere Opernreform zurücknimmt, was er selber als junger Opernkomponist bis zum Exzess sich erlaubte, so hat sich der spätere Antisemit feurig für Heine und Meyerbeer eingesetzt. Da stößt man auf Rätsel, die sich mit Begriffen wie »Überkompensation« oder auch »Konvertiteneifer« und »Opportunismus« nicht befriedigend lösen lassen. Im 4. Pariser Bericht vom 6. Juli 1841 schreibt der 28-jährige Wagner beispielsweise über Heinrich Heine:
Wir sehen aus unserer Mitte ein Talent hervorgehen, wie Deutschland wenige aufzuweisen hat; wir freuen uns der frischen, kecken Entfaltung desselben, – wir rufen ihm Triumph und Vivat zu, als es unsre jungen Geister aus einer vollständigen Lethargie aufweckt, ihnen mit dem Opfer seiner eigenen Fülle den Weg bricht und zeigt, wohin die neuzugebärenden Kräfte unserer Literatur sich richten sollen … Nicht genug aber, daß wir nachher geduldig zusehen, wie unsre Polizei dies herrliche Talent von seinem vaterländischen Boden verjagt … daß wir demzufolge mit schläfrigem Gähnen bemerken, Freund Heine hätte in Paris das Reisebilderschreiben verlernt, daß wir ihn durch unsre Indifferenz endlich gegen sich selbst blasieren, daß wir ihn zwingen, aufzuhören, Deutscher zu sein, während er doch nimmermehr Pariser werden kann … – nein! wir freuen uns auch und klatschen in die Hände, wenn diesem Heine endlich eine Behandlung widerfährt, wie wir sie bei uns gegen Sechzehngroschenrezensenten anzuwenden die Gewohnheit haben!
Diese Verteidigung Heines wird hin und wieder zitiert. Aber bedarf ihr Mitleid mit dem Todkranken, für den, laut Wagner, weder die (deutschen) Offiziere noch die deutschen Universitäten Aufmerksamkeit übrig hätten, nicht eindringlicher Deutung? Oder: Dass Wagner in Oper und Drama die Relation zwischen dem Text (im weitesten Sinne) und der Musik anders umriss als später, im Aufsatz Über die Benennung »Musikdrama« von 1872, liegt offen zutage, ist ein Gemeinplatz der Wagner-Philologie. Im späteren Aufsatz steht die berühmte Formel, der Komponist möchte seine Dramen gern bezeichnen als ersichtlich gewordene Taten der Musik.
Wie aber passt das zum zwischen 1837 und 1840 geschriebenen Aufsatz Über Meyerbeers »Hugenotten«, wo Wagner Meyerbeer zubilligt: »er schrieb Taten der Musik«? Im Zusammenhang heißt es:
Meyerbeer schrieb Weltgeschichte, Geschichte der Herzen und Empfindungen, er zerschlug die Schranken der Nationalvorurteile, vernichtete die beengenden Grenzen der Sprachidiome, er schrieb Taten der Musik – Musik, wie sie vor ihm Händel, Gluck und Mozart geschrieben –, und diese waren Deutsche und Meyerbeer ist ein Deutscher …
Und noch ein Paradox: Im ersten Absatz des ersten Aufsatzes, den der junge Wagner publizierte, findet sich eine Formel, die alle Wagner-Verächter bis auf den heutigen Tag gegen die Musikdramen verwenden könnten!
Der 21-jährige Wagner lobt Bellini. Eine schöne Kantilene hatte es ihm offenbar angetan:
Wohl haben die Italiener in den letzten Dezennien mit dieser zweiten Natursprache einen ähnlichen Unfug getrieben als die Deutschen mit ihrer Gelehrtheit, – und doch werde ich nie den Eindruck vergessen, den in neuester Zeit eine Bellinische Oper auf mich machte, nachdem ich des ewig allegorisierenden Orchestergewühls herzlich satt war und sich endlich wieder edler Gesang zeigte.
»Ewig allegorisierendes Orchestergewühl«? Ja – ist das nicht eine boshaft treffende Formel für jene unaufhörlich klug andeutenden Belehrungen, mit denen einem das Ring-Orchester ganz hübsch auf die Nerven gehen kann, falls man (oder auch der Dirigent) schlecht disponiert ist? Wagner wusste eben alle Rollen mit trefflichen Argumenten zu spielen – sogar die des prophetischen Wagner-Verächters.
J. K.
KAPITEL 1
Einführendes über Wagner, den Künstler
Unsere Wagner-Liebe krankt an einer Amfortas-Wunde. Niemand bezweifelt: Er war ein Genie. Aber als Mensch hatte er doch schlimme Schwächen. Egozentrik, beredte Selbstvergötzung, eine schreckliche Tendenz zur Selbstreklame, verbunden freilich mit beträchtlicher Selbstironie. Wagner als Gott seiner Gemeinde. Wer den Meister nicht anbetet, ist des Teufels. Der Bayreuthianismus wurde zur Sekte, so wie ja auch die Psychoanalytiker um Freud, die intellektuellen Kommunisten um Lenin und Trotzki, die Komponisten um den eifernden Schönberg durchaus etwas Sektenartiges erkennen ließen mit Klüngelei und Eifersucht und plötzlichem Verrat. Wo derartige Religionen herrschen, wird nämlich immer verraten, gibt es immer »Abtrünnige« – man denke an Nietzsche und Bülow bei Wagner, an C. G. Jung oder Alfred Adler bei den Freudianern, an Trotzki oder Koestler bei den Kommunisten …
Was nun Richard Wagner betrifft, so versuchen manche deutschen Bewunderer mit dieser Amfortas-Wunde, die ihre Liebe kränkt, fertig zu werden, indem sie unterscheiden zwischen dem großen, visionären Künstler und dem Menschen mit seinen Schwächen. Den einen müsse man – den anderen brauche man nicht zu – lieben. Nun kann, das sagt in der Zauberflöte schon Sarastro baritonal-salbungsvoll zur Pamina, kein Mensch zur Liebe gezwungen werden. Aber doch zur Logik. Und lässt es die Logik zu, einen Künstler zu bewundern, der Menschen schafft, ihn selbst aber als Menschen abzulehnen? Richard Wagner hat dies Problem gespürt. Es bedrängte ihn offenbar. Darum schrieb er in der Mitteilung an meine Freunde, einer Kunstschrift aus dem Zürcher Exil von 1851: Er wünsche, verstanden zu werden. Nur seine Freunde könnten Neigung und Bedürfnis verspüren, ihn zu verstehen: »Für solche kann ich aber nicht die halten, welche vorgeben, mich als Künstler zu lieben, als Mensch jedoch mir ihre Sympathie versagen zu müssen glauben. Ist diese Absonderung des Künstlers vom Menschen nicht eine ebenso gedankenlose, wie die Scheidung der Seele vom Leibe …«, fragt Wagner scharfsinnig. Und dann stellt er fest, »daß nie ein Künstler geliebt, nie seine Kunst begriffen werden konnte, ohne daß er – mindestens unbewußt und unwillkürlich – auch als Mensch geliebt, und mit seiner Kunst auch sein Leben verstanden wurde …«
Nun heißt jemanden lieben gewiss nicht, ihn wer weiß wie perfekt, fehlerlos, unanfechtbar zu finden. Leidenschaft hat ein wenig auch mit Zweifel zu tun. »Das bloß Vollkommene mit Begeisterung zu würdigen, bedarf es einer Ergebenheit fürs Gedachte und Vorbildliche, die Schulmeistersache ist«, behauptet Thomas Mann im zweiten Roman der Josephs-Tetralogie Der junge Joseph. Denn: »Wirklich will das Gefühl etwas zu verzeihen haben, sonst wendet sich’s gähnend ab.«
Schön und gut. Manche Schwächen des großen Richard Wagner mögen verzeihlich sein. Aber ist nicht Richard Wagners erbitterter Antisemitismus wirklich schlimm, verächtlich, entsetzlich gewesen? Auch wenn der Antisemitismus des 19. Jahrhunderts, wo sich auch von Chopin, Liszt, Goethe, Marx und manchen anderen Großen antisemitische Äußerungen oder gar Theorien auftreiben lassen, etwas historisch unvergleichbar anderes darstellte als Antisemitismus nach Auschwitz.
Mir erscheint Wagners unleugbarer Antisemitismus als eine Form erstens seiner Kritik am bürgerlich-positivistischen und zugleich materialistischen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts, den er vornehmlich durch intelligente geschäftstüchtige Juden repräsentiert sah, und zweitens als die Abwehr von Kritik und Widerstand, womit viele jüdische Publizisten ihn behelligten.
Gegen Juden, die sich begeistert für ihn einsetzten, wie Carl Tausig oder Hermann Levi oder Josef Rubinstein oder Angelo Neumann, hatte er höchst begreiflicherweise, außer ein paar hämischen Vorbehalten, falls es irgendwelche Meinungsverschiedenheiten gab, gar nichts. Ihm ging es vordringlich darum, das eigene »Wunderwerk«, die eigene Wunderleistung durchzusetzen. Wer dabei schadete, wurde verdammt, wer dabei half, durfte auf Gnade hoffen. Eifrige Götter und Künstler sind so. Diese Erklärung von Wagners rassistisch-germanischer Obsession bleibt aber zu simpel und leichtgewichtig. Da gibt es mörderische Gesichtspunkte und Perspektiven. Ein unzimperliches Zitat möge folgen:
Er erholt sich hier von der Hetzjagd seiner ewigen (…) Reisen. Die Neigung zu den Kindern, die er um diese Zeit noch besitzt und die, bevor sie später verschüttet wird, auch echt ist, äußert sich in seinem Verhältnis zu den vier ungebunden aufwachsenden Kindern. Wieland, Mausi, Wolfi und die Jüngste, Verena. Er spricht von ihrer Zukunft und immer klingt der Gedanke auf, daß er einmal, wenn er an der Macht sein wird, woran er keinen Augenblick in diesen acht Jahren zweifelt, für sie da sein werde. (…) Das Band zur Familie, zu den Kindern, wird immer enger. Alle haben ihn gern, ja lieben ihn.
Wen? Das bliebe allerdings noch mitzuteilen: Adolf Hitler! So berichtet Erich Ebermayers 1951 erschienenes Buch Magisches Bayreuth über die Geschichte Bayreuths in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Über Siegfried Wagner, Winifred Wagner und ihre vier Kinder Verena, Friedelind, Wieland und Wolfgang Wagner.
Wieland Wagner hatte 1943 und 1944 für Hitlers Kriegs-Bayreuth die Meistersinger ausgestattet. Nach 1951 wurde er dann der mutige und geniale Inspirator des Neuen Bayreuth. Er hat die Bühne entrümpelt, er hat mit der völkisch-affirmativen Tradition des alten Bayreuth – 1924 kam Ludendorff zur Eröffnungspremiere nach dem Ersten Weltkrieg: Das Publikum sang nach dem Ende der Vorstellung stehend die deutsche Nationalhymne – und des Nazi-Bayreuth gebrochen. Er hat nicht realistisch, sondern mythologisch, psychologisch, ja »sexistisch« inszeniert. Und sein Bruder Wolfgang, als Regisseur nicht so revolutionär, wurde nach Wielands Tod (1966) Chef der Bayreuther Festspiele. Man kann ihn als genial mutigen Theaterleiter, Organisator bezeichnen. Denn er wagte es, Patrice Chéreau und Pierre Boulez für den Jahrhundert-Ring zu verpflichten; er holte Harry Kupfer für einen brillant tiefenpsychologisch gemachten Fliegenden Holländer und den Ring nach Bayreuth. Er traute sich auch die Verpflichtung von Georg Solti und dem konservativen Peter Hall zu – die so viel kritischen Wirbel machte. Wolfgang Wagner war eben nicht dogmatisch, sondern frei.
Die Weltöffentlichkeit hat es nun aber auffälligerweise den jungen Wieland Wagner nie entgelten lassen, dass Adolf Hitler in Wieland Wagner und in Albert Speer gewissermaßen das schätzte und vielleicht sogar liebte, was er offenbar selber gern im bürgerlichen Leben betrieben hätte: In Albert Speer glaubte er seine eigene, schiefgegangene Architektenkarriere kultivieren zu können, im blutjungen Wagner-Enkel seinen eigenen Wagner-Ehrgeiz. Noch in den vierziger Jahren, als der Diktator an der russischen Front eigentlich Wichtigeres hätte zu tun haben sollen, prüfte er, so erzählte mir Wieland einst, Wielands Bühnenbildentwürfe. Nach 1945 hat die Weltöffentlichkeit, die bei einem Furtwängler oder einem Franz Schmidt Kompromisse oder Opportunismen überhaupt nicht zu verzeihen geneigt war, es aber Künstlern wie Strawinsky oder Ansermet keineswegs übel nahm, während der Nazizeit in Berlin musiziert, Platten eingespielt zu haben – nach 1945 also hat die Weltöffentlichkeit es Wieland und Wolfgang, die sich einst mit Adolf Hitler, dem »Onkel Wolf«, duzen durften, überhaupt nicht entgelten lassen, dass sie Hitlers Schützlinge gewesen waren.
Umso mehr verübelte diese Weltöffentlichkeit es Richard Wagner, der sechs Jahre vor Hitlers Geburt gestorben war, dass Hitler für ihn schwärmte und sich auf ihn berief. Darius Milhaud stellte fest: »Wagner ist eine Art Hitler. Die Geistesart ist die gleiche.« Und der britische Staatsminister Hynd dekretierte 1946, als Deutschland noch von den Alliierten besetzt war: »Wir erlauben keine militaristische und nazistische Musik. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein allgemeines Verbot für Wagner-Opern besteht.« Bekanntlich wird der Wagner-Boykott immer noch in Israel verteidigt – obwohl die musikalischen Juden oft besonders heftige Wagnerianer waren und sind und dazu neigten, ihre Söhne Siegfried zu nennen. Siegfried Kracauer, Siegfried Jacobsohn.
Dass Wagner mit seiner ganzen, liberal-flachen Gegenwart haderte, dass er den geldgierigen Bürgerstand als riesigen Missstand ansah und mehr als einmal befand, eine Reinigung, ein Untergang, ein Feuer müsse die bürgerlich-kapitalistische, die deutsche, die jüdische, die »ganze« Welt vernichten und eine neue schaffen, dass Wagner die intellektuellen Juden als gleichsam ausführende Agenten des schlimmen, positivistischen, verhängnisvoll wissenschaftsgläubigen Zeitgeistes betrachtete und darum antisemitische Überzeugungen hegte: Es ist schlimm, und es ist bekannt. Seit Jahren wird nun darüber diskutiert, ob diese Überzeugungen auch Wagners Werk beflecken. Das aber tun sie nicht! Ja, wir haben es als befreiendes, hohe Genugtuung schaffendes Wunder hinzunehmen, als Beleg dafür, wie anständig und edel sich Richard Wagner als Künstler verhielt, dass er es schlechthin nicht fertigbrachte, wo es ihm existenziell wichtig war, nämlich im Kunstwerk selber, auch nur den Schatten von Antisemitismus zu gestalten! Was immer man gegen Wagner, »den kleinen Sachsen mit dem Bombentalent«, auch vorbringen kann: Feige ist er wirklich nicht gewesen. Wenn also irgendetwas ihn dazu getrieben hätte, antisemitische Haltungen oder Überzeugungen in Kunst umzusetzen, dann hätte er es getan. Doch er konnte es nicht. Jetzt sollen wir, so fordern es weltanschaulich strenge Wagner-Kritiker, die Schlusswendung des Parsifal – »Erlösung dem Erlöser« –, die im Kunstkontext des Bühnenweihfestspiels auch beim bösesten Willen nicht als irgendwie antisemitisch erkennbar wird, als heftigsten sogenannten Beweis für Antisemitismus in Wagners Tondramen anerkennen! Also: Wenn das alles oder das Schlimmste ist, dann kann es wirklich gar nichts Antisemitisches gegeben haben zwischen Feen, Liebesverbot, Rienzi, Fliegendem Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, Nibelungen-Ring, Tristan, Meistersingern und Parsifal.
Obwohl sich Wagner nämlich immerfort erklärte, obwohl ihm nichts dringlicher war, als verstanden zu werden – findet sich kein einziges gezielt antisemitisches Wort in seinen Dramen und erst recht kein irgendwie antisemitischer Takt. Auch hat Wagner nie stolz oder aggressiv oder verlegen auf irgendeine judenfeindliche Passage in seinen Tondramen hingewiesen. Da wird nun mühselig interpretiert und gefragt, ob nicht Negativfiguren wie der Beckmesser oder der Mime oder die Kundry vielleicht doch irgendwie Judenkarikaturen seien … Aber konkret belegen lässt sich der Verdacht schwerlich: Als Künstler arbeitete Wagner wirklich völlig anders denn als konservativer Zeitkritiker. Ja, seinen Negativfiguren gab er bemerkenswerterweise eine hochinteressante Musik, sie sind reicher und seltsamerweise meist sogar avancierter bedacht als die positiven Helden. Oft genug singt und spielt der Beckmesser – wer hätte es nicht erlebt – den Stolzing an die Wand und bekommt viel mehr Applaus. Die Beckmesser-Pantomime, Kundrys wunderbare Klagen, Verzweiflung und Hysterie, Mimes Erzählung des Wälsungenschicksals oder seine Beschreibung, wie die Vögel im Walde leben: Alles das ist innige, große Kunst. Und es liegt auch offen zutage, dass Wagners Antihelden, wie die Politikerin Ortrud aus dem Lohengrin oder den Alberich aus dem Ring, eine gezacktere, chromatischere, interessantere und fortschrittlichere Musik umgibt als die positiveren Figuren – die so eindeutig positiv denn wieder auch nicht sind. Ein Künstler aber wie Wagner, der beim schöpferischen Produzieren über alle antisemitischen Ressentiments hinauswuchs, der vielschichtig empfand, der allen recht zu geben vermochte, der in den Helden das Verräterische erspürte und in den Widersachern die Qual, der des Mitleids fähig und »Orpheus allen heimlichen Elends« war: Der soll die Geistesart Hitlers besessen haben? Das ist absurd, ist eine idiotische und unzulässige Aufwertung Hitlers.
Was nun die Wagner-Diskussion unserer Gegenwart betrifft, so hängen viele Positionen, die gewiss nicht ohne Grund vertreten, angefochten, widerlegt und erhitzt neu aufgestellt werden, mit der politischen Geschichte Deutschlands, des Nazismus und der Welt zusammen. Die Auseinandersetzung, wie antisemitisch ein Künstler sein dürfe, kann, nach Auschwitz, von keinem Wagnerianer als bloße Belästigung weggewischt werden. Nur haben die Schmähungen und Verteidigungen, zu denen in diesem Streit die Kritiker, Professoren, Literaten, Publizisten, Wagnerianer, Wagner-Verdammer sich herausgefordert fühlen, erschreckend wenig mit der ja auch nicht ganz beiläufigen Frage zu tun, warum die Welt Wagners Werke offenbar braucht, offenbar liebt, offenbar immer wieder hören, sehen, erleben, enträtseln will. Zwischen dem öffentlichen Gezänk über Wagner und der menschenverbindenden Kraft, die Wagners Werke heute noch bei jeder einigermaßen anständigen Aufführung bewähren, besteht nahezu kein Zusammenhang mehr. Der berühmte Literat, Professor und Wagner-Exeget Hans Mayer erzählte, wie er als junger Mensch mit Alban Berg zusammen war und wie er – aus politischen, postexpressionistischen, ideologischen Gründen – auf Wagner schimpfte. Berg nahm sich nicht mal die Mühe, den jungen Intellektuellen zu widerlegen. Sondern: »Alban Berg – unvergeßlich – sah von oben auf mich herab und sagte: ›Ja, so können Sie reden, Sie sind ja nicht Musiker.‹«
Über Fragen des Antisemitismus, des Donner-Pathos, des Rauschhaft-Deutschtümelnden kann in der Tat jeder aufgeklärte Zeitgenosse mitreden. Da genügen ein paar Zitate, ein paar Abneigungen, ein paar gute moralistische Gefühle. Geduldige Versenkung in die Werke, in Wagners Künstlertum bereitet entschieden mehr Mühe! Aber es fesselt auch, allmählich erkennen zu lernen, wie viel Lebenserfahrung und Schmerz in Wagners Werke eingingen. Er war wirklich ein Genie des Zu-Ende-Bringens. Die Kunstsprache machte sich selbstständig in ihm, verbündete sich mit allen seinen Figuren. Jedem gab er gute Argumente. Jede These lockte ihren Widerspruch herbei, und das vermeintlich Eindeutige steigerte sich zum Unabsehbaren.
Wie ging das zu? Blicken wir einmal in des Künstlers Bewusstsein, Vorbewusstsein, Unterbewusstsein. Aus welchen Schichten seiner Seele und seiner Erinnerung entstanden die Werke? Welche Rolle spielen die Träume? Wie baute Wagner Charaktere auf? Wie doppeldeutig sind seine Helden, wie eindeutig seine Frauen? Und welches sind die Grenzen seiner Kunst?
Der Junge erschrak jedes Mal und geriet in mystische Aufregung, wenn die Geiger des Zillmannschen Stadtmusikkorps im Dresdner »Großen Garten« ihre Instrumente stimmten. »Ich entsinne mich«, berichtet Wagner, »daß namentlich das Anstreichen der Quinten auf der Violine mir wie eine Begrüßung aus der Geisterwelt dünkte.« Wagner schrieb weiter: Schon »als kleinstes Kind fiel der Klang dieser Quinten mit dem Gespensterhaften, welches mich von jeher aufregte, genau zusammen«.
Von jeher? In Wagners Autobiographie Mein Leben heißt es:
Von zartester Kindheit an übten gewisse unerklärliche und unheimliche Vorgänge auf mich einen übermäßigen Eindruck aus; ich entsinne mich, vor leblosen Gegenständen als Möbeln, wenn ich länger im Zimmer allein war und meine Aufmerksamkeit darauf heftete, plötzlich aus Furcht laut aufgeschrien zu haben, weil sie mir belebt schienen. Keine Nacht verging bis in meine spätesten Knabenjahre, ohne daß ich aus irgend einem Gespenstertraum mit fürchterlichem Geschrei erwachte, welches nie eher endete, als bis mir eine Menschenstimme Ruhe gebot. Das heftigste Schelten, ja selbst körperliche Züchtigung erschienen mir dann als erlösende Wohltaten. Keines meiner Geschwister wollte mehr in meiner Nähe schlafen …
Ein übermäßig beeindruckbares Kind – er sagt es ja selbst. Und macht es Psychoanalytikern oder Literaten gefährlich leicht, alles Mögliche aus dieses krankhaft sensiblen Kindes Schreckhaftigkeit, Gespensterverfallenheit (oder Gespensterphobie) herauszudeuten.
Doch Wagner interessiert uns nicht als genialer Patient, sondern als genialer Produzent. Wie wurden Eindrücke, die des Künstlers Seele von Jugend auf erfüllten, später zum Werk? Wie gestaltete er? Wählen wir als simples Beispiel den Anfang des Fliegenden Holländers. Dass Wagner im Fliegenden Holländer literarische Erlebnisse – zum Beispiel Heine-Lektüre – verwertete, ist bekannt. Dass er sich beim Entwurf dieser Gespensteroper auch an Heinrich Marschners Vampyr erinnerte, lässt sich ohne Weiteres belegen. Schließlich hatte der 20-jährige Wagner in seiner Funktion als Choreinstudierer am Würzburger Theater diese Oper Marschners kennengelernt, wo die Heldin Emmy im zweiten Akt ihre Romanze singt: »Sieh, Mutter, dort den bleichen Mann mit seelenlosem Blick.« Diese Romanze stellt eine dramaturgische und musikalische Vorform von Sentas Ballade aus dem Holländer dar. Der Vampyr war dem jungen Wagner immerhin so wichtig, dass er den Verzweiflungsschluss einer Arie neu komponierte. (Er tat es für seinen Bruder, der in Würzburg Sänger war.)
Auch die Eindrücke einer stürmischen Seefahrt von Pillau über Norwegen nach London, bei der übrigens Wagners Gattin Minna eine Fehlgeburt erlitt, sind, wie Wagner selbst ausführlich mitteilte, in den Holländer eingegangen. Lauter nachprüfbare Voraussetzungen also. Aber wie setzt der Künstler Wagner die um?
Die ersten Takte der Ouvertüre – samt ihrem gespenstischen Holländer-Thema – bestehen aus heftigstem Tremolo, aus leeren Quinten und Oktaven. So kehrt die Schauerquinte der Kindheit im Werk wieder! Die Quinte erscheint als charakteristisch hohles Intervall auch in Sentas balladesker Beschwörung der Holländer-Gestalt. Sie prägt sich dem hörenden Bewusstsein oder Unterbewusstsein bereits während der Ouvertüre ein.
Die szenische Handlung der romantischen Oper beginnt nicht gleich mit einem Auftritt des verfluchten Holländers, sondern zunächst mit dem Auftauchen des bieder-bürgerlichen, sturmgeschüttelten Daland-Schiffes. Die Seeleute suchen Schutz, rappeln sich auf, bekämpfen Erschöpfung. Endlich geborgen, zieht sich die Mannschaft zurück, singt der Steuermann ein schwungvolles Lied und hält die Wacht. Aber er wird immer müder, sein Lied immer kurzatmiger, er schläft zum Schluss ein – zu Tode entkräftet (in einer Bayreuther Inszenierung einst, zu alledem auch noch, sinnlos besoffen). Jetzt naht mit blutroten Segeln der Gespenstersegler, während Dalands christliche Seefahrt pennt. Leicht modifiziert tönt die Quinte im Horn.
Mittlerweile ist der Holländer-Kapitän an Land geschritten, um seine Vorgeschichte auszubreiten (»Wie oft in Meeres tiefsten Schlund stürzt’ ich voll Sehnsucht mich hinab«). Was wir da hören, aber nicht sogleich wiedererkennen, ist nun wiederum das aus dem Vorspiel bekannte Holländer-Thema mit der Quinte – nur eben in Sechzehntelpassagen aufgelöst, verflüssigt. Also symbolisch-naturalistisch in Bezug zum Meer gebracht (dabei aber keineswegs verwässert).
Doch die todmüden Daland-Matrosen schlafen bei alledem sehr fest. Sowenig der mithilfe eines Schlaftrunks vorsorglich außer Gefecht gesetzte archaische Ehemann Hunding durch die Liebesszene aufgeweckt wird, die in seinem Hause und unter bedenkenlos aktiver Teilnahme seiner Gattin Sieglinde zwecks Siegfried-Erzeugung stattfindet, so wenig erwachen hier die übernächtigten Daland-Matrosen. Der Fliegende Holländer kann im Fortissimo und mit Trompetenquinten ewige Vernichtung erfluchen und erflehen: Die Daland-Matrosen ahnen nichts von der Nähe des Übernatürlichen. Endlich stapft der Kapitän selbst an Deck und sieht die Bescherung: das riesige, unheimlich fremde Schiff und seinen eingeschlafenen Steuermann, der keineswegs die Wacht hält! Nun aber – und das ist in allem Wirbel witzig – singt der von seinem Kapitän wach gerüttelte Steuermann verlegen schlaftrunken abwiegelnd sein Liedchen weiter – als wolle er dartun, dass er sein Singen eigentlich gar nicht unterbrochen hätte und dass deshalb auch nichts Besonderes passiert sein könnte. Dieser durch schlichten Augenschein sogleich widerlegte und darum komische Beschwichtigungsversuch des Steuermanns rundet heiter ab, was hier zusammengesetzt, also »komponiert« ist als wunderbar ineinandergefügte szenische Sequenz aus der Begegnung von Normalen und Verfluchten, von Leitmotiven und Abwandlungen, von Lebenserfahrung und Kunstgeschicklichkeiten, aus Vorgeschichte und menschlichem Steuermannsversagen …
Wenn nun aber bereits diese knapp andeutende, in vielfacher Richtung ergänzbare Schilderung einer einzigen, keineswegs besonders tiefsinnigen Wagnerschen Szene so viel Platz erheischt – dann schwant uns auch, was jeder Wagner-Exeget vom anderen übernimmt. Nämlich: dass über keine Großen der Weltgeschichte so viel reflektiert werden konnte wie über Christus, Napoleon, Shakespeare, Marx und eben – Wagner.
Wagner ist ein Meister der Szene gewesen. Aber er war darum kein bloßer Realist. Ohne Träume und Albträume können seine Geschöpfe nicht leben und lieben. Im Traum, das wussten die alten Griechen, kommuniziert der Mensch oft mit dem Übergeordneten, den Göttern. Jokaste, im Ödipus des Sophokles, ist frevelhaft genug, dergleichen einmal aufgeklärt-ungläubig in den Wind schlagen zu wollen: »So fürcht auch du dich nicht«, sagt sie zum Gatten, der, wie sich später zeigt, ihr Sohn ist, »vor deiner Mutter Bette. Denn viele sahen schon in ihren Träumen sich der Mutter zugesellt. Wer aber dies für nichts erachtet, trägt das Leben leicht.« In ein paar Sophokles-Zeilen begegnen wir also gleich mehreren Freudianischen Existenzialen: ödipaler Konflikt und Verdrängung. Auch in Wagners Musikdramen stehen Träume zentral. (Entsprechendes gibt es in unserer Literatur sonst wohl überhaupt nur bei Kleist.)
Wagners Holländer hat von Senta »geträumt« (seit bangen Ewigkeiten). Sentas Ballade wiederum erscheint als fast hysterischer Ausdruck der Träume eines jungen Mädchens von einem Bild. Aber auch die Elsa, aus dem Lohengrin, hat vom rettenden Ritter geträumt; Tannhäuser wiederum will aus dem ihm unerträglich gewordenen Venusberg-Traum-Kunst-Paradies in die Realität der Welt zurück-erwachen. (Erste Regieanweisung für den Titelhelden: »zuckt mit dem Haupt empor, als wache er aus einem Traume auf«.) Dass Walther von Stolzing durch Sachs dazu gebracht wird, seinen Traum zu deuten und umzusetzen in Morgentraumdeutweise, ins Preislied, stellt die Voraussetzung des Meistersinger-Happy-Ends dar. Und wem, außer Wagner, hätte die entsetzliche Wachtraumszene einfallen können zu Beginn des zweiten Götterdämmerungs-Aktes, wo Alberich den finsteren Hagen – »Schläfst du, Hagen, mein Sohn?« – zur Rache indoktriniert, den Bewusstlosen aufstachelt – so wie es heutzutage die »hidden persuaders« aller aktivierenden Werbung tun? Dabei bedient sich unsere Werbung – die Techniken aller avancierten Künste pflegen einige Zeit später zum Kunstgewerbe abzusinken – sogar absichtsvoll einhämmernder Leitmotive, die nur eben entsprechend banaler sind als Wagners Eingebungen.
Alle diese Momente des Träumens, Sich-selig-Erinnerns, Beschwörens und Verweilens haben beim Künstler Wagner vielfältige Funktion. Sie sind einerseits Keimzellen, nämlich weiterwirkende Verdichtungen der Handlung, darüber hinaus aber auch Augenblicke des Innehaltens, des Aktionsstillstandes, Leitmotiv-Reservoire. Die Helden kommen produktiv zu sich, wenn sie außer sich sind.
Verkennen wir diesen Sachverhalt, wenn wir aus ihm ablesen, dass er sich eigentlich nicht auf Wagners viel zitierten »Pessimismus« reime? Woher nehmen bei Wagner die Unterdrückten, die Reinen, die Schwachen den Mut, wenn nicht aus solchen Traumgewissheiten? Hier sei der Satz gewagt: Nichts an Wagner war größer als seine mitleidsvolle Menschlichkeit, sein Erbarmen zwar nicht mit den Mittelmäßigen, wohl aber mit den Kranken, Fallenden, Unmäßigen, Verlorenen. Wie todesbang und ergreifend nehmen sich die letzten Akte des Tannhäuser, Tristan, Parsifal aus und die ganze Götterdämmerung als sozusagen letzter Akt der Ring-Tragödie!
Wir haben schon vom Beckmesser gesprochen, der angeblich eine Judenkarikatur sei, weil Wagner den Kritiker Hanslick nicht leiden konnte und darum in einem Frühstadium der Meistersinger den Beckmesser Hanslich nannte. Der berühmte Kritiker Hanslick war übrigens keineswegs Jude – was aber Wagner vielleicht nicht wusste oder wahrhaben wollte. Wie baut nun Wagner, der Künstler, einen großen komischen Charakter auf? Dass im alten Nürnberg jemand hochgeehrter und hochgelehrter Stadtschreiber sei und dabei eine Judenkarikatur darstellen soll, ist – auf den ersten Blick, auch auf den zweiten noch – denkbar unwahrscheinlich. Beckmesser steht vor uns als Einzelgänger, Hagestolz, dürrer Schlaukopf. Triumphiert irgendwo furchterregend derb die allzu gute, überschäumend kollektive Laune, dann fällt mir immer ein, was Kollege Beckmesser singt, wenn die Lage sich zuspitzt:
Heimlich mir graut, weil es hier munter will hergeh’n.
Wunderbar treffend ist dabei vor allem das »heimlich mir graut«. Wer wagt schon, laut und offen zu bekennen, dass er sich leider gar nicht wohlfühlt, wo alle anderen so fabelhaft munter bei der Sache scheinen … Beckmesser ist jener betagte intellektuelle Nürnberger Stadtschreiber, der fühlt, dass er die Popularität des poetischen Schusters Hans Sachs nie erreichen kann, der aber beim Wettsingen einen Text vorzutragen versucht, den Sachs auf Stolzings Diktat eilig niederschrieb. Beckmesser hat diesen Text eifersüchtig entwendet, weil er glauben musste, dieses Gedicht stamme von Sachs und der heuchlerische Schuster wolle damit womöglich auch um Evchens Hand konkurrieren.
Mit dem, was er nicht versteht, blamiert sich dann Beckmesser beim Festakt enorm. Es ist ein vollkommener Zusammenbruch. Beckmesser verlässt wütend die Szene, auf der er versang und vertat – während die anderen doppelt froh weiterfeiern. Noch in den Schlusstakten der Meistersinger wird das Motiv des Spottes des Nürnberger Volkes auf Beckmesser – »Scheint mir nicht der Rechte« – munter zitiert. Man kennt die Lustspielsituation: Ein alter, eingebildeter, gehässig witziger Hagestolz, der sich um ein hübsches Mädchen bemüht, wird blamiert, niedergelacht, niedergemacht – und das junge Ding kriegt seinen jungen Helden.
So will es seit Jahrhunderten die Mathematik der Lustspielform, die Logik des Schwanks, das Gesetz des Happy Ends. So soll es sein – die natürliche Ordnung gebietet es! Die alten, komisch unglücklichen Liebhaber sind übrigens, tröstlicherweise, meist die besseren, beifallsträchtigeren Rollen, während es den sieghaften jungen Leuten oft genug schwerer fällt zu interessieren. Gleichviel: Dass der verspätet geile Hagestolz sich blamiert, neben Beifall und Schadenfreude vielleicht auch ein wenig Mitleid provozierend – es gehört zum Lustspiel. Wagner tut das Seine, damit wir mit Herrn Beckmesser nicht allzu sentimental sympathisieren können: Dieser Stadtschreiber ist ein ziemlich giftiger, kreischender, pedantischer Oberlehrer- und Zensorentyp, der sich in albtraumartige Situationen verstrickt, wo er sich mit missgünstiger Ironie zu wehren versucht und am Ende heillos unter die Räder des Happy Ends gerät.
So viel zu Beckmesser in der ersten Dimension, sozusagen in seiner realen spielerisch-konventionellen Lustspielhaftigkeit.
Eine zweite, abgründigere Dimension existiert aber auch. Der Mann ist nicht nur Verlierer – einer muss ja verlieren beim Nürnberger Sängerkrieg wie bei dem auf der Wartburg –, sondern zugleich Opfer. Opfer im mythologischen Sinn. Man spürt förmlich, wie die schmähliche Auslöschung des intellektuellen Widersachers hier sozusagen die gute Laune, die Stimmung, das Glück des Volkes steigert. Beckmesser wird ja auch nicht – oder nur in sentimentalen Inszenierungen, gegen den Willen des Wagnerschen Textes – versöhnlich zurückgeholt. Sein Fall steigert die allgemeine Zufriedenheit: Ein bisschen Brutalität macht die Kirmes, macht das Volksfest erst richtig lustig. Beckmessers Zusammenbruch steigert den Triumph der Gesunden und Vernünftigen. Wenn jemand gerade daran scheitert, dass er so besonders schlau zu sein versucht – dann schäumt der lustige Spott.
So war unser Beckmesser also zunächst, in erster Dimension, ein Lustspiel-Geschlagener, in zweiter Dimension ein Opfer. Doch längst nicht genug auch damit. Es gibt noch eine progressive dritte Dimension. Beckmessers Ständchenmusik erscheint in der chromatisch entwickelten Meistersinger-Tonwelt als Parodie auf eine fiktive Altertümlichkeit. Doch während der sogenannten Beckmesser-Pantomime – wenn der Stadtschreiber in der Schusterstube den Albtraum der Prügelnacht mimisch rekonstruiert – ereignet sich modernes Musiktheater. Und was endlich Beckmessers verlachtes, irrendes Preislied betrifft, in dem ursprünglich, weithin aber auch noch in der Endfassung, enorm surrealistische Wendungen vorkamen wie: »bitterlich gar/gellte mein Auge«, oder: »Goldene Wagen,/auf den Bergen ritten sie;/… und mich Toren zog man ein, tünchte mich; ach, ich brenne nieder! Braut mir kalten Flieder!« – so darf man fragen: Wirken solche und ähnliche Verse aus Beckmessers Ständchenverzerrung nicht moderner, gewagter, kühner als Stolzings relativ brav gewordenes Preislied?
Das Zusammenspiel aller dieser Dimensionen aber – hier demonstriert an einer einzigen Figur – erklärt schlagend, was Wagners Kunst so gewichtig und unerschöpflich macht. Es ist die osmotische Durchdringung von Erkenntnis und Mitteilung einerseits sowie von Spiel, Komödien-Märchen und Formzwang andererseits!
Wagners Kunst ist – wer daran zweifelt, hat fast gar nichts begriffen – ungemein anspruchsvoll. Der Meister der riesigen Tetralogie und des großen Orchesters war außerdem ein Miniaturist differenziertester Wirkungen, Halbschatten und Heimlichkeiten.
Wagners Künstlerinteresse am germanischen Sagenschatz, an deutscher Mythologie hat ihm den Vorwurf des Deutschtümelnden eingetragen. Aber klingt Wagners nervöse, klangfarbenreiche Musik wirklich so ungeheuer »deutsch«? Falls das Wort überhaupt einen Sinn hat im Zusammenhang der Töne, dann wären Bach oder Schumann, Brahms oder Pfitzner bestimmt viel eher »typisch« deutsche Komponisten als der klangfarbendifferenzierte, nervöse und psychologische Orchesterkolorist Richard Wagner.
Und Wagners siegende Helden? Stolzing, der nach genialem Anfang es den Meistern recht machen kann; Lohengrin, der scheiternd davonmuss; Wotan, der stoisch verbrennt? Siegfried, dem wegen Verrats nicht nur Hagen, sondern auch seine Geliebte Brünnhilde nach dem Leben trachtet? Tristan, der einst Isolde verstieß und nun die Liebe verflucht … Waltrautes Erzählung vom Ende der Götter um Wotan hört sich an wie eine Beschreibung des fahlen, starren, verrückten Untergangs von Hitler im Reichskanzlei-Führerbunker von 1945. Aber das hatte Onkel Wolf, alias Adolf Hitler, gewiss nicht einkalkuliert bei seiner von einer Rienzi-Aufführung entfachten Wagner-Verehrung. Kein Wunder, dass man sich in den letzten Kriegswochen lieber an Friedrich den Großen hielt, dem am Ende des Siebenjährigen Krieges keine Götterdämmerung passiert war …
Und die Frauen? Auffällig, dass die großen Opernmeister der Kunstgeschichte den Damen stets einen bevorzugten Platz einräumten. Denken wir an Richard Strauss: Die rein instrumentalen symphonischen Dichtungen, vom Macbeth über den Eulenspiegel, den Don Quixote, das Heldenleben, haben noch sämtlich Männer oder Heroen zur Hauptfigur. Aber die Opern von der Salome über die Elektra, den Rosenkavalier mit der Marschallin und der Hosenrolle des Octavian, über die Arabella, die Schweigsame Frau, die Frau ohne Schatten, Daphne, die Liebe der Danae und das Capriccio mit der beherrschenden Gräfin scheinen sich, geradezu kränkend Männer-uninteressiert, fast nur mit Frauenseelen zu befassen. Wem fällt rasch eine Tenorrolle von Strauss ein – außer dem Bacchus und dem italienischen Tenor im Rosenkavalier? Als ich an meinem »Who is who« über die Figuren der Mozart-Meisteropern arbeitete, wurde mir klar, dass auch bei Mozart, trotz Don Giovanni und Sarastro, die Partien der Damen spannender, differenzierter sind als die Herren der Schöpfung.