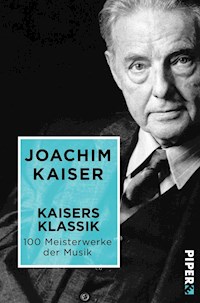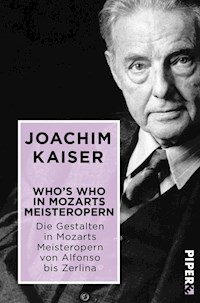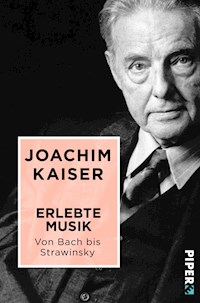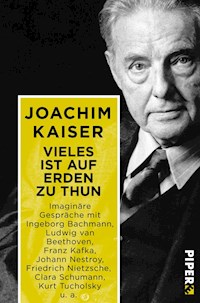10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Joachim Kaiser schreibt über wichtige Inszenierungen des 20. Jahrhunderts, unter anderem über: Wieland Wagners Bayreuth-Inszenierungen. Fritz Kortner in Becketts «Das letzte Band». Maria Wimmer als Medea. Fritz Kortners Inszenierungen von «König Richard der Dritte», «Leonce und Lena» und «Der eingebildete Kranke». Jean-Louis Barrault als Hamlet. Herbert von Karajan dirigiert «Fidelio» und «Elektra». Gustaf Gründgens als Wallenstein. «Katerina Ismailova» von Dmitrij Schostakowitsch. Louis Seigner als Tartuffe. Harry Buckwitz inszeniert Brechts «Heilige Johanna der Schlachthöfe». Joan Plowright als «Heilige Johanna». Bertolt Brechts «Die Tragödie des Coriolan» im Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm. Boleslaw Barlog inszeniert Edward Albees «Wer hat Angst vor Virginia Woolf …?». Franco Zeffirellis Opern-Inszenierungen. Uraufführung von Eugène Ionescos «Hunger und Durst» in der Inszenierung von Karl Heinz Stroux. Konrad Swinarski inszeniert den «Marat» von Peter Weiss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Joachim Kaiser
Über Joachim Kaiser
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Vorwort
Kritik als Beruf
1
«Vorne auf den Sesseln die Kritiker, entstellt von Eitelkeit», notierte Gottfried Benn, als er 1928 die «Saison» beschrieb, jener Gottfried Benn, der sich andernorts für radikale Kritiken aussprach, weil im Kunstbereich Schwammigkeit mehr schade als Schärfe.
Beim Blick auf die Eitelkeit der Kritiker hat Benns scharfes Auge etwas Wesentliches gesehen: Eitelkeit ist bei Kritikern fast eine deformation professionelle, eine Berufskrankheit. Einige, und wahrlich nicht die schlechtesten Kritiker, haben sich hochmütig zu ihrer Eitelkeit bekannt. Um uns Lebende zu schonen, seien nur Karl Kraus und Friedrich Sieburg genannt, die kaum verbargen, wieviel sie von sich hielten.
Nun gilt Eitelkeit, die übrigens auch oder gerade bei klugen Männern sich keineswegs nur auf die eigene Intelligenz, Bildung, den Ruhm und Charme bezieht, sondern erst recht auf die vermeintlich gewinnenden Gesichtszüge, die hohe Gestalt, die lässigen Gebärden, als liebenswerte Sünde. Lächelnd und fraulich-überlegen wird die Dame des Hauses den so rührend weltfremden, aber doch höchst eitlen und geldgierigen Gelehrten in Schutz nehmen, wenn das Gespräch seine Schrullen ereilt: das tut auch ihrem Selbstbewußtsein gut, zumal sie Mühe hat, mitzukommen, wenn der Eitle etwas erläutert. Und erst recht diejenigen rufen unisono, Eitelkeit sei doch eine sehr humane Eigenschaft, die ihren nützlichen Spaß daran haben, Zelebritäten zu manipulieren, indem sie deren Eitelkeits-Schwächen ausnutzen. Es ist wahr: Eitle scheinen verführbar, sogar zum Guten.
Doch bei solchen Erwägungen, die ohnehin viel Effekt aus dem Umstand beziehen, daß jeder den anderen meinen darf, wollen wir nicht stehenbleiben. Wo Eitelkeit branchenüblich ist, muß sie etwas über die Branche verraten. Zunächst fällt ja auf, daß überhaupt in allen, grob gesprochen, intellektuellen und künstlerischen Berufen weder an Eitelkeit noch an selbstverliebter und selbstbewußter Affigkeit Mangel herrscht. Keineswegs gebärden sich da übrigens die Frauen schlimmer als die Männer, die Naiven haltloser als die Bewußten. Im Gegenteil … Es wäre mehr als nur amüsant, etwa im Stile der modernen Verallgemeinerungs-Wissenschaft, der Bindestrich-Soziologie, die jeweilige Sparteneitelkeit zu beschreiben und zu deuten. Man denke an die Pastoren, die aus ihrem Sündenbewußtsein eine milde Überlegenheit destilliert haben. Oder an die Professoren, die heutzutage zwar selbst Journalisten hofieren, weil sie Weltläufigkeit, Vorurteilsfreiheit und Liberalität demonstrieren wollen, gleichwohl aber das «gewiß notwendige» Schreiben für den Tag als ephemeres und ordinäres Aufdringlichsein verachten – während sie statt dessen vornehm für die Ewigkeit schweigen, da ihnen Seminarüberlastung, Fakultätsverpflichtungen und Vortragstätigkeit leider keine Zeit lassen für jenes wissenschaftlich fundierte Hauptwerk, das in ihnen reift. Professoren-Eitelkeit, ein Produkt aus tradiertem Elitebewußtsein und unanfechtbarer Macht über Akademiker-Karrieren, tritt keineswegs harmloser, nur eben anders in Erscheinung als die (relativ) gebrochene, notwendige Eitelkeit von Schauspielern und die noch reinere Eitelkeit von Sängern. Denn bei Bühnenschaffenden gibt es fast keine Grenze mehr zwischen dem Ich und der Leistung. Während ein Autor sich von einem schwachen Produkt distanzieren kann – das Buch sei mißlungen, nur eine Vorarbeit, ein Nebenwerk, ein Irrtum, eine Jugendsünde –, setzt der Schauspieler und Sänger ja nicht nur seine Leistung ein, sondern sich selbst. Wird er für ungeschickt, zu alt, bar aller Faszination oder abstoßend häßlich befunden, dann kann er nicht kopfschüttelnd und vorwurfsvoll auf sein Instrument blicken wie ein Tenniscrack nach mißlungenem Schmetterball auf den Schläger: er ist es ja selbst. Der Schauspieler findet sich – bombastisch formuliert – als psychophysische Ganzheit ausgesetzt. Um überhaupt auftreten zu können, benötigt er die Schutzschicht der Eitelkeit. Kafka hat dafür in einem Brief die liebevolle Formel von der göttlichen Frechheit des «Angeschaut-werden-Könnens» geprägt.
Und die Kritiker?
Kritiker sind weder eitel, weil sie sich ihr Hinfälligkeitsbewußtsein als Erwähltheits-Signum anrechnen dürfen oder weil sie vom Akademiker-Prestige beseelt sind, noch auch, weil ihre Leiblichkeit Gegenstand öffentlichen Interesses wäre. Sie sind eitel, weil ihr Tun sie dazu bringt und zwingt, wohlerworbenen Geschmacksurteilen ein Moment von objektiver Vernunft zuzuschreiben. Martin Walser hat sich in seinem «Brief an einen ganz jungen Autor» darüber amüsiert, daß die Kritiker den Autor für alles das verantwortlich machen, was ihnen zu ihm, dem Autor, so einfalle. Das liest sich wie eine brillante Übertreibung, ist aber im Kern nicht nur richtig, sondern sogar unvermeidlich. Die Eitelkeit des Kritikers hängt zusammen mit der meinungsbildenden Übertriebenheit seiner Funktion, der Nötigung, für Produkte subjektiver Urteilskraft zwar nicht objektive Wahrheit, wohl aber verbindliches Mitspracherecht zu beanspruchen, mit der Not, ohne allgemein anerkannte und bestätigte Gesetzestafeln zu «richten», und mit dem Umstand, daß die Zeit, da Öffentlichkeit und Kritik aufeinander angewiesen waren, einander benötigten und produzierten, allmählich vorbei scheint. Wer kritisiert, setzt – ob er will oder nicht – voraus, daß seine Subjektivität am objektiv Gültigen teilhabe und darum zähle. Weil es keine verbindlichen Regeln gibt außer denjenigen, die ein guter Kritiker von Begegnung zu Begegnung, von Objekt zu Objekt, von Begründung zu Begründung in sich erspürt (wie ein vermeintliches ästhetisches Naturrecht, oft genug gegen seine «eigentliche Überzeugung»): darum muß der Kritiker seine eigene Reaktion wichtig nehmen und ihre Verbindlichkeit dartun, während es ihm zu dämmern beginnt, daß der große Betrieb und die kleinen Bequemlichkeiten sowohl die Produzenten als auch die Leser kritikmüde zu machen drohen. Gerade weil Kritiken nicht so unentbehrlich sind wie Mineralöle oder Tenöre, muß das Gewicht und die Bedeutung kritischer Subjektivität für sich selber und zur Sache sprechen. Der Vorzug solcher kritischen Subjektivität besteht darin, nicht als nützliches und darum neutralisiertes Glied des Produktionsvorgangs von der Maschinerie zugleich legitimiert und entmachtet (das heißt: zum Schweigen gebracht) zu sein. Die anderen müssen produzieren, ob sie wollen und können oder nicht. Der Kritiker muß sagen, wann – um der Betätigung und Sättigung des Apparates willen – Überflüssiges gesagt wurde. Das fünfte Rad am Wagen fühlt sich einerseits überflüssig, andererseits wichtig. Das macht eitel. Kritiker sind es.
2
Für den Kritiker sind Bildung und Kunst-Erfahrung Arbeitszeug. Nicht mehr als das. Er lebt, wenn er überhaupt lebt und nicht bloß automatisch irgendwelche Betulichkeiten produziert, vom Sensorium und vom Charakter. Charakter braucht man weniger dazu, Zorn zu wagen und Entrüstung zu provozieren, als zum Kampf gegen die Versuchung, die «Nöte» der Kritiker-Situation mit den Bequemlichkeiten einer Kulturkampf-Position zu vertauschen.
Doch ist der Umstand, daß jeder Kritiker, der nach «Höherem» strebt, seine Privat-Ästhetik aus sich herauslauschen muß, weil die akzeptierten und zweifelsfrei befolgten Normen dahin oder unverbindliche Privatsache derer sind, die sich daran halten – ist diese Unsicherheit wirklich eine Not?
Nur insofern, als jetzt das – von Goethe in Kunstdingen ohnehin als nutzlos verpönte – «Beweisen» erschwert scheint; nur insofern, als jetzt nicht so ohne weiteres jenes selbstbewußte quod erat demonstrandum samt Schuldspruch vom Richterstuhl herabgedonnert werden kann. Das Gegenteil dieser Not, auf kein Gesetzbuch schwören zu dürfen, wäre aber noch längst keine Tugend. Immer dann, wenn heute die Urheber von Kunst-Produkten, und sei es auch nur im Hinblick auf technische Verfahrensweisen, sich im Besitz zwingender Vorschriften wähnen (was ja die Konsequenz hätte, daß eine Verletzung dieser Vorschriften sich zweifelsfrei erkennen und beschreiben ließe), dann existieren zwar endlich wieder einmal Norm und Sicherheit, aber im gleichen Augenblick droht auch die Frage, ob nicht der schwer definierbare Kunstbezirk verlassen sei. Dafür zwei konträre Beispiele.
Die Propheten eines sozialistischen Realismus hatten fast das Klassenziel erreicht. Linientreue Künstler und Rezensenten konnten sich auf etwas vermeintlich «Festes» stützen. Mittlerweile ist an den Tag gekommen, daß kaum jemand mit den so sorgfältig und normbewußt erarbeiteten Produkten zufrieden war und daß man, um die Behauptungen von den Vorzügen realistischer Schreibweise wahrzumachen, auch Ionesco und vor allem Beckett, die «Wirkliches» erkannt und gestaltet hätten, fürs realistische Lager reklamieren mußte. Doch wenn Beckett unter den gleichen Realitätshut paßt wie Traktorenkunst und Aufbauwille, dann muß dieser Hut so groß sein wie das Himmelszelt. Und die Schwierigkeiten westlicher Beckett-Exegese beginnen von neuem.
Ein Analogon dazu bot das von Schönberg entwickelte Verfahren, zwölf Töne aufeinander zu beziehen. In dem Augenblick, da eine Technik daraus wurde, Regeln und Handbücher sich verfertigen ließen, da zweifelsfrei schien, was richtig oder falsch sei, in diesem Augenblick mußte doch wieder das goldene Zeitalter für die Beckmesser aller Bildungsgrade anbrechen. Wiederum entwich jedoch das begriffsferne Phantom des Kunstschönen dem Gesetzes-Gefängnis. Heute gilt selbst bei Avantgardisten eine Musik, deren Stimmigkeit nur als Folge von Errechenbarem zutage tritt, nicht mehr viel.
Alle diese Überlegungen drängen zu folgender Konklusion: wer die Künstler wegen der offenbaren Unsicherheitsfaktoren bedauert und alle Kunstkritik eben deshalb für unmöglich («subjektiv») hält, der hat ein entweder an den Gegebenheiten der Naturwissenschaften oder von den strikt isolierenden Verfahrensweisen der Jurisprudenz beeinflußtes Bild sowohl vom «Wahren», als auch von der «Wahrheitsfindung» im Kunstbereich. Doch weder der naturwissenschaftliche noch auch der legalistische Schlüssel passen hier. Und wenn man mit Hilfe eines solchen Schlüssels doch das Tor zum Musentempel aufbricht, dann sind die Musen verscheucht. Es ist vielleicht ein übertriebener Argwohn, anzunehmen, daß diejenigen, die dem Kritiker so beflissen irgendwelche Hilfskonstruktionen vorschlagen, damit sein Gewerbe erlernbar werde und einen handfesten goldenen Boden von Regeln umfassender Gewißheiten habe, entweder die Sache nicht zu Ende denken oder die Wirkung von Kritiken reduzieren wollen. Soll das fünfte Rad am Wagen, um nur einen «Sinn» zu haben, dem Auto(r) vorausrollen, Wege erschließen, Richtungen propagieren, vor Sackgassen warnen?
Ein so intelligenter Dramatiker wie Peter Hacks zum Beispiel verachtet die standpunktlose Kritik. Er will die Ecke kennenlernen, aus welcher der Kritiker kommt und urteilt. Das klingt einleuchtend. Aber es hat, wie beinahe alles, was den Kritiker aus seiner Not-Situation in eine produktive Position befördern soll, bedenkliche Konsequenzen. Der eisern feste weltanschauliche Ort kann den Kritiker lähmen. Wir werden noch darüber nachzudenken haben, auf welche Weise der Kritiker Überzeugungen gewinnt, variiert und zur Geltung bringt, wie er entdeckt oder verwirft. Was indessen die «eindeutige geistige Position» betrifft, so sollte sie für den Kritiker immer nur ein Ausgangspunkt, ein verwandelbarer Impuls, ja sogar ein Objekt bestimmter Negation sein. Sonst entwertet der weltanschaulich fixierte und wohlgerüstete Kritiker seinen Tadel an allen Gegenständen jenseits seiner Überzeugung und sein Lob für alle vielgeliebten Produkte diesseits seiner Überzeugungsgrenzen. Er kann dann zwar noch produktiver Inside-Kritiker sein – was gewiß besser ist als gar nichts. Doch besagt es noch viel, wenn ein antiklerikales Stück im Neuen Deutschland gelobt und im Rheinischen Merkur verrissen würde? Sorgfältige Leser hätten vielleicht die Möglichkeit, aus eventuellen selbstkritischen Einschränkungen oder liberalen Zugeständnissen der einen oder anderen Seite feinsinnig Schlüsse zu ziehen. Doch ganz zuletzt muß das Engagement von Schreibern guten Glaubens die geäußerte Meinung in genau dem Maße zur Bekundung weltanschaulicher Loyalität machen und neutralisieren, in dem diese Meinung, paradoxerweise, parteiisch ist. Wieder stoßen wir auf die Schaukel, die den kritischen Standpunkt ersetzt: der Kritiker muß soviel wie nur möglich über Ästhetik, Dramaturgie, über «Richtig» oder «Falsch» nachgedacht haben und wissen. Doch dieses Wissen darf nicht wie eine Rüstung oder eine Optik zwischen ihm und dem Gegenstand stehen. Die «Begegnung» mit dem neuen Objekt muß dem Kritiker eigene Einsichten zugleich bringen und entreißen. Wer nicht ein Leben lang mitdenkt, wird schwerlich etwas Erlebenswertes erfahren. Doch wer im Einzelfall von vornherein weiß, was er erfahren wird, hat keine Distanz mehr zu den eigenen Voraussetzungen und kann objektblind werden. Es gibt Malbücher, deren Seiten so imprägniert sind, daß die lustigen Bilder, obzwar vorhanden, erst erscheinen, wenn ein Kind oder ein Künstler auf den Seiten herummalt. Der gute Kritiker gleicht einem solchen Malbuch. Mit einem Unterschied: er darf das Bild, das entsteht, selbst nicht genau kennen. Es sollte etwas da sein, aber etwas Veränderbares. Eine Mischung aus Prinzip, Leere und Erfahrung.
So wünschenswert es ist, daß ein Kritiker mit den kleinen und großen Gestalten der Weltliteratur über die Jahre hin umgeht, und nicht nur, wenn ein Aufführungszufall ihn in die Arme Racines oder Marlowes wirft: selbst hier darf das Engagement nicht die Grenze zum Kulturkampf überschreiten. Was die Beziehung zwischen einem Kritiker und seinen geliebten Gestalten betrifft, so sind wilde Ehen den festen vorzuziehen. (Wobei man sich freilich darüber klar sein muß, daß manche wilden Ehen schwerer auseinandergehen, weil es da nicht die Möglichkeit der Scheidung gibt, sondern nur die radikale Gemeinheit, zu der ein harter Entschluß nötig ist.) Natürlich, es gehört zur Aufgabe des Kritikers, denen, die ihn respektieren, vorzudenken, wie man an einen Beckett herankommt, oder von einem Wittlinger weg: wenn aber der Kulturpolitiker und Spielplanarchitekt im Kritiker dominiert, so daß seine Wünsche seine Gesetze werden und seine Reaktionen vorhersehbar, dann sollte er versuchen, irgendwo als Kulturdezernent oder als Dramaturg ehrenhaft auf die Seite der Überzeugungstäter hinüberzuwechseln.
3
Ein Kritiker, der das Talent besitzt, freischwebend und doch entschieden zu reagieren, wirkt natürlich irritierend. Die Temperamentsausbrüche eines weltanschaulich festgelegten Wüterichs können die Betroffenen und Interessierten keineswegs darüber hinwegtäuschen, daß da ein Amt vertreten wird, nicht nur eine Meinung. Doch kritischer Einspruch, dem solche weltanschauliche Steuerung nicht anzumerken ist, kann die Wucht eines niederschmetternd evidenten Geschmacksurteils haben. Dagegen gibt es nur die Berufung auf ein anderes, gleichermaßen zwingend formuliertes Geschmacksurteil. Es mag nicht leicht sein, im Schatten solcher Geschmacksurteile, die ja immer auch Qualitätszensuren enthalten, als Betroffener leben oder gar auftreten zu müssen. Und es ist auch lästig, sie zu fällen, es verdirbt die Beziehungen und die gute Laune. Darum suchen beide Parteien, sowohl Kritiker als auch Kritisierte, begreiflicherweise nach Ausflüchten.
Daß viele Kritiker ihrer Urteilspflicht nicht nachkommen wollen, hat gute Gründe. Zunächst ist es ja einfach nicht fein, nicht gentlemanlike, sich in der Öffentlichkeit fortwährend als Zensierer, Abschmecker, Oberlehrer, als Voyeur aufzuspielen. Viele Kritiker wissen oder ahnen das. Selbst Sartre hat in seinem Essay «Was ist Literatur?» erlaucht-gehässig darüber gespottet, daß der Buchkritiker nicht einmal in seiner Familie so geachtet werde, wie es wünschenswert wäre. Wer sich den Folgen der unfein pedantischen Urteilspflicht entziehen will, muß sich feige unter seinem Richter-Stuhl hinwegzustehlen versuchen. Zum Beispiel in die höheren Sphären der Kunstbetrachtung.
Das gilt als taktvoll. Denn im mehr oder weniger massiven Urteil über künstlerische Leistungen liegt zweifellos auch ein Element von Klatsch, von Unverschämtheit beschlossen. Die Einsicht, Gründgens sei noch kein Wallenstein, Käthe Gold keine Ophelia mehr, Windgassen bleibe dem Siegfried das Schmiedelieder-Forte, die Callas der Nil-Arie das zweigestrichene C schuldig, mag zwar selbst für den reinsten Gedankenzusammenhang, der sich auf Schiller-, Goethe-, Wagner- oder Verdi-Interpretationen richtet, unentbehrlich sein, aber sie nährt zugleich die kaum verhohlene branchenübliche Schadenfreude, erhebt sie sich wenig über Kulissentratsch. Man kann niemanden daran hindern, derartige Mängelrügen zu lesen und auszustreuen, als ob es sich dabei um die meist amüsanteren Boulevardmitteilungen über die neue ständige Begleiterin des Tenors X handle, der nur infolge des unverständlichen Starrsinns seiner Frau an einem weiteren Ehevollzug gehindert wird. Ein Theaterkritiker, und sei er noch so vornehm, noch so eitel, noch so distinguiert, setzt die Objekte seiner Kritik, wo er derb und verständlich urteilt, genau derselben Schadenfreude und Neugier aus. In dieser Not gibt es für einen Kritiker die Ausflucht, sich quasi-konkret anzubiedern, indem er, notwendig metiererfahren, im Jargon intelligenter Theaterleute stets nur das niederschreibt, was die communis opinio bedächtiger Bühnen-Professionals ist. Dann wirkt der Kritiker nicht mehr als Gegner, sondern wie ein Mann «vom Bau», er kann viele Unfreundlichkeiten sagen, man wird es ihm nicht (allzu lange) übelnehmen.
Allein, nützt er der Sache und den Lesern viel, wenn er das Theater reproduziert, ohne daß die ärgerniserregende Spannung der anderen, literarischeren, passiveren Kritiker-Position hinzukommt? Es ist charakterlos, wenn ein Kritiker sich die Ausflucht-Möglichkeiten seiner Position vornehm zunutze macht und Urteile ganz ausspart. In der Nötigung, Zensuren zu erteilen, liegt trotz allem die Beglaubigung, die kleine Charakterprobe von Kritik. Wer so gut oder klug oder verworren schreibt, daß sich überhaupt nicht mehr erkennen läßt, ob eine Aufführung anständig oder schlecht, sehenswürdig oder versäumniswert war, ein Buch spannend oder langweilig, der hat den Kritiker-Beruf und die Forderung der Sache verfehlt. Soviel über die Ausflüchte der Kritiker.
Begreiflicher und näherliegend noch sind die Ausflüchte der Kritisierten. Alle finden zwar, seriöse Kritiken seien notwendig, wünschen sich ernsthafte Auseinandersetzungen, scheuen den Tadel nicht. Beim jeweiligen Einzelfall aber zeigt sich: man kann doch nicht ruhig darüber sprechen. Und zwar deshalb nicht, weil der Kritiker ständig – in aller Öffentlichkeit – Interessen verletzen muß. Wenn er eine negative Kritik schreibt, so läuft das auf Schädigung hinaus. Nicht immer auf materielle («Verrisse» machen ein Buch oder eine Aufführung oft erst interessant), aber doch auf moralische, künstlerische Schädigung. Jemandes Ansehen wird, zumindest, auf eine Probe gestellt. Kann das reibungslos ablaufen? Ist ein Betroffener denkbar, der nicht irgendwie versucht, versuchen muß, sich zu schützen? Kann er weiterproduzieren, mit seiner Arbeit fortfahren in dem Bewußtsein: «Du bist also nicht gut!»?
Nein, es läuft anders ab. Der Betroffene wird zwar, wenn er sich im ganzen akzeptiert und nur im einzelnen kritisiert findet, Interesse, Loyalität, ein Achselzucken oder vielleicht sogar Freundschaft aufbringen für den Kritiker – aber er kann dazu höchst begreiflicherweise nicht mehr imstande sein, wenn die Kritik ihm die künstlerische Existenzberechtigung abspricht. Dann wehrt er sich. «Sich wehren», das heißt aber nur in Grenzfällen einen Prozeß anstrengen. Im Alltag bedeutet es, die kritische Meinung nach besten Kräften belanglos machen. Also: Die Kompetenz bestreiten. Der Kritiker sei seinerseits als Autor gescheitert und voller Ressentiments, er sei zu jung, zu alt, er habe nicht verstanden, worauf man hinauswollte, habe etwas kritisiert, was gar nicht beabsichtigt war; habe sich schon im Falle X geirrt, was beweist, daß er gar nicht … Und so weiter. Oder die Redlichkeit wird bestritten: der Kritiker gehöre einer Clique an, sei beeinflußt, dürfte in seinem Blatt nichts anderes schreiben, obwohl er privat eine ganz andere Meinung geäußert habe … Und so weiter.
Natürlich können alle diese Vorwürfe sogar zutreffen. Wie ernst wären sie zu nehmen, wenn ein Dritter, offenbar Unbeteiligter, Neutraler sie erhöbe. Doch die Unnatur der Sache will, daß Verdächtigungen dieser Art meist dann ausgesprochen werden, wenn sie offenkundig mehr dem Schutz (un)berechtigter Interessen dienen als der Lust an reiner Wahrheitsfindung. Darum ist die Situation einigermaßen heillos. Im übrigen sollte man sich darüber nicht wundern, sondern die relative Verträglichkeit von Theaterleuten, Künstlern und Schriftstellern bestaunen. Man stelle sich vor: Ärzte, die privatim herzlich schlecht übereinander sprechen, oder Professoren, oder Ladenbesitzer, oder Schneider, oder Beamte müßten hinnehmen, daß ihre Leistungen öffentlich zensiert werden. Bereits streng geheimgehaltene Gutachten erzeugen bekanntlich in den Kreisen der für nüchterne Sachlichkeit berühmten Wissenschaftler Haß und Lebensfeindschaft. Was aber würde passieren, wenn der Dentist A die Arbeit seines Kollegen B öffentlich rezensiert, so wie der Schriftsteller Baumgart den Schriftsteller Hildesheimer rezensiert? Man müßte Ian Flemings Phantasie haben, um sich das auszumalen …
4
Leute, die den Frieden, die Freiheit des Wortes und ihren Arbeitsplatz lieben, sind übereingekommen, daß Kritik produktiv sein müsse. Diese höchst liberal und vernünftig klingende Forderung ist von einem menschenfreundlichen Heiligenschein umgeben. Deshalb sei ihre branchenfreundliche Scheinheiligkeit hier dargetan. Kein Wunder, daß die Forderung nach «produktiver Kritik» erhoben wird: der Kritisierende hat die Welt, wie sie ist, hinzunehmen. Dafür wird ihm erlaubt, unverbindlich an ihr herumzukorrigieren. Aber: jede Behörde, jeder Intendant, jeder Autor muß todernst genommen werden.
Der Kritik vorschreiben, sie solle «produktiv» sein, bedeutet, daß niemand und nichts radikal verneint werden darf. Der Betrieb ist heilig, er soll nur verbessert, aber nicht geschlossen werden. Da aber mittlerweile der Umfang des Betriebes, beispielsweise der Etat des Ressorts, die Kapazität des Unternehmens, eine bestimmte Seiten- bzw. Minutenzahl, die ausgefüllt werden muß, an die Stelle der Sache getreten ist, bedeutet der Wunsch nach produktiver Kritik nichts anderes, als daß ein Veto gegen die Monomanie des Kultur-, Theater- oder Verwaltungslebens verhindert werden soll. Nur nichts zerstören, nur niemandem die Existenzberechtigung absprechen … im übrigen aber ruhig kritisieren. Deshalb passiert so wenig. An den Voraussetzungen des Betriebes – von dem zahllose Familienväter abhängen – darf die auf Bestätigung dressierte, «produktive Kritik» nichts ändern. Dazu ein Goethe-Zitat: «So ist das Hervorbringen freilich immer das Beste, aber auch das Zerstören ist nicht ohne glückliche Folge.»
Aber nicht alle Kritik braucht glücklicherweise dem kritisierten Objekt gleich nach dem Leben zu trachten. Manchmal will sie wirklich nur «korrigieren», «Gut und Böse» abwägen, Maßstäbe anlegen, klassifizieren, verbessern. Bemerkenswerterweise gibt es da die meisten Mißverständnisse, den meisten Ärger mit der Kritik. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist leider sehr einleuchtend: wenn es von Herrn A heißt, er sei ein freundlicher Kollege, ein pünktlicher Arbeiter, nur vielleicht etwas langsam, dann wird beinahe jeder, der diese Auskunft erhält, davon überzeugt sein, daß Herr A ein langsamer, unbegabter Mensch sei. Ob er wirklich freundlich und pünktlich ist, steht dahin, aber daß er im Schneckentempo arbeitet, leidet wohl keinen Zweifel. Die positiven Aussagen dürften freundliche Verbrämungen des Negativen gewesen sein: das Negative jedoch trifft bestimmt zu. So zu reagieren, ist leider üblich. Der Tadel wird ernster genommen als das Lob. Was immer ein Kritisierender über einen Schauspieler oder einen Sänger an Anerkennung äußert, es wiegt in der Öffentlichkeit viel leichter als auch nur der Schatten einer Bemängelung. Natürlich wissen oder fühlen dies viele Kritiker. Sie werden darum im Lob geradezu überschwenglich und im Tadel höchst vorsichtig – die öffentliche Neugier aber spürt dem Tadel bis tief in die Mauselöcher der Vorsicht nach und läßt das Lob achselzuckend auf sich beruhen.
Und womit hängt dies Mißtrauen gegen das Lob und dies Vertrauen in den Tadel zusammen? Zunächst natürlich mit der Lust am fremden Schaden, die uns auch die tollsten Gerüchte glauben und boshaftesten Magazine verschlingen läßt. Hinzu tritt noch eine schwer ausrottbare Gewohnheit aus den Tagen der befohlenen Kunstbetrachtung. Unter Goebbels war Kritik verpönt. Sie kroch darum zwischen die Zeilen, lauerte hinter den flüchtigsten Andeutungen, war als ehrliche Stecknadel inmitten eines Heuhaufens verlogenen Lobes versteckt. Mag sein, daß seither die Neigung besteht, das Lob als beschönigende Flause zu entwerten und den Tadel als eigentliche Meinung zu begreifen. Wenn die Aufrichtigkeit aller Beteiligten da nicht Abhilfe schafft, wird kein vernünftiges Gespräch geführt werden können. Womit allerdings noch längst nicht gesagt ist, daß alle Beteiligten solch ein vernünftiges Gespräch überhaupt wünschen, daß es Verbände, Organisationen und Vetogruppen nicht immer nur darum geht, ungestört zu funktionieren.
Die Lobredner der «produktiven Kritik» sind indessen ihrer Sache so sicher, wissen die Bedeutungslosigkeit von hilfreichen Anmerkungen, nach denen sich kein Mensch zu richten braucht, so sehr zu schätzen, daß sie noch ein weiteres Rezept in Reserve haben. Sie raten dem Kritiker zum temperamentvollen Erguß. Da sie den Betrieb ohnehin für sakrosankt halten, dem Verdikt sein Gewicht, dem Lob sein Auszeichnendes, Maßstabsetzendes (und darum Deklassierendes) nehmen möchten, empfehlen sie ein unbefangenes «Drauflos». Morgen ist’s ja doch vergessen.
Wie klingt das lebensnah und menschenfreundlich, wenn einer sagt, er wolle keine langwierigen Spekulationen hören, sondern temperamentvoll vorgetragene Meinungen, die ruhig subjektiv sein dürfen, ja müssen. Kein müdes Zwar-Aber, sondern ein frisch gewagter, entschiedener Vorstoß! Manche Kritiker folgen dieser Devise und merken nicht, daß sie damit zu manisch-depressiven Literaturclowns werden. Man liest sie gern, gewiß: doch was sie sagen, zielt weniger auf Wahrheit als eben auf Extremismus mit Schaum vor dem Mund. Temperament, Feuer, Subjektivität haben jedoch nur Wert, wenn sie sich aus der Sache entwickeln. Manche Bücher, die meisten Inszenierungen sind nun einmal «zwar-aber», rechtfertigen nur ein zögerndes J-ein. Wer dem ausweicht, übt – wie manchmal Hermann Kesten – strotzende Selbstdarstellung. Doch die notwendige Personalität kritischer Urteilssuche darf nicht zum Alibi gemacht werden für die Lust an schwungvoller Selbstinszenierung. Die Form der Kritik erheischt zunächst Nüchternheit. Ein Kritiker muß sich zur Sache etwas einfallen lassen, muß einen möglichst zentralen, vernünftigen, originellen, «tragenden» Gedanken fassen. (Es können auch mehrere sein.) Diese These(n) muß er so darlegen, daß die Fakten, die er mitzuteilen hat, wenn er der Informationspflicht genügen will, als Glieder eines für sich genommen verständlichen Gedankenzusammenhangs erscheinen. Das muß man lernen, üben, können. Eine Aneinanderreihung zusammenhangloser Einzelbeobachtungen, wirrer Aphorismen ist genauso wenig eine Kritik wie irgendeine temperamentvolle Herzensergießung, die ihr Objekt bereits im ersten Absatz aus dem Auge verliert.
Um die Gerechtigkeit nicht zu übertreiben: wenn man ein Produkt für vollkommen töricht oder nichtssagend hält, dann sind feinsinnige Erörterungen verfehlt, die das Objekt – wie es oft geht – auf die Höhe eines Begriffs-Instrumentariums heben, in der es plötzlich interessant wird. In äußerster Not darf man Quatsch als Quatsch bezeichnen (danach bitte mit dem Anwalt telefonieren). Widerspricht man jedoch der communis opinio, so muß man die Beweislast tragen; hat ein Autor sich bereits legitimiert, so besitzt er zumindest den Kredit, ernst genommen werden zu müssen. Schlechter kritischer Stil ist es wohl auch, keine Namen zu nennen, wenn man Namen meint, und Bücher nicht zu Ende zu lesen. Manche Bücher sind so unausstehlich, daß man nicht durchkommt. Dann empfehle ich die Formel: «Aus Gründen, die noch darzulegen sind, las ich nur Seite 1 bis 140. Mag sein, daß das Buch ab Seite 141 hölderlinsches Niveau erreicht.»
5
Man hat sich daran gewöhnt, im Kritiker einen Angreifer zu erblicken. Hilflos, wenn auch von der Sonne des Publikumsbeifalls vergoldet, vom guten Willen der Akteure belebt, liegt die Theateraufführung am Tage nach der Premiere (oder das Buch am Tage nach seinem Erscheinen) da wie ein freundliches Städtchen. Dann aber kreuzen die Schiffe mit mindestens 50 Kanonen auf und beschießen die Stadt, die sich nicht wehren, nicht antworten kann, oder (wenn sie es doch tut) meist beklagenswert schlecht antwortet. So lyrisch und melancholisch stellt sich ja wohl für die meisten Beteiligten das Verhältnis zwischen Kritisierten und Kritikern dar. Um weiterleben und weitermachen zu können, haben die Betroffenen sich eine Reihe von Rationalisierungen, von Ersatzreligionen ausgedacht. Kritik müsse sein und spiele sich auf einem ganz anderen, nämlich dem publizistischen Planeten ab, sagen sie. Und was die Kritiker sagen, das treffe zwar, aber es treffe nicht zu. Man könne von Außenstehenden, die Bomben werfen, nicht erwarten, daß sie die Kathedralen auch kennen, denen ihr Angriff gilt.
So wird denn die Frage nach der Zuständigkeit zum eigentlichen Fetisch aller Diskussionen über Kunst und Kritik. Die Antwort lautet: zwar dürfen natürlich alle ihre Meinung sagen, aber zuständig ist trotzdem keiner. Bei dieser schönen Aporie verharren bis in alle Ewigkeit die meisten Streitgespräche über die Beurteilung von Kunstwerken und Kunstleistungen. Wer Kritiken schreibt, geht sogleich in die Defensive. Zwar mag er nicht direkt sagen, daß er sich über die Zuständigkeit einiger Kollegen – er könnte Namen nennen – gewiß auch so seine Gedanken macht. Und er mag trotz aller Eitelkeit nicht ausführen, daß er selbst eigentlich zuständig sei, weil er die Kunst liebt, schon soviel gesehen und überdies einen festen Publikationsort hat. Liegt aber nicht bereits in der Sehnsucht nach Beglaubigung – so wie man in Bonn «akkreditiert» wird – jener Fehlschluß, jene falsche Wahrheitserwartung, von der in unserem Zusammenhang immer wieder die Rede sein muß? Wie stellt man sich das vor: Ein Kritiker soll älter als 30 Jahre, soll möglichst Dr. phil. oder besser noch Professor sein, soll vom Staat auf Lebenszeit oder auf Bewährung ernannt werden? Wäre damit Entscheidendes gewonnen? Auch die gelehrte historische Begründung hilft nicht viel: Ein Kritiker äußert, so wie es die Zeitungen taten, als sie auf den Plan traten, die freie Stimme des Bürgers gegen feudale und klerikale Setzung. Versteigt man sich zu dieser historischen Begründung, dann gerät man in Verlegenheit, die Rolle des Schreibenden jetzt zu begründen, da Kunststile und Bürgerwünsche sich weit auseinander entwickelt haben. Also bleibt es dabei: Ein Kritiker soll dem atemlos lauschenden Publikum mitteilen, was es sich gestern abend beim neuesten Beckett hätte denken sollen, wenn es so klug gewesen wäre wie die Orakel in der siebenten Reihe. Damit hat man sich unauffällig wieder zum Anfangspunkt der Diskussion zurückgedreht, die ja eben von der Frage ausging, woher die Orakel in der siebenten Reihe die Wahrheit und nichts als die Wahrheit wissen.
Alle diese vielleicht nicht immer formulierten, gleichwohl gehegten, recht künstlich wirkenden Begründungen des kritischen Tuns verraten, daß man sich nicht dazu entschließen kann, einen Beruf für menschenmöglich zu halten, der paradox scheinende Voraussetzungen hat. Ist es nicht schwer, sich vorzustellen, grenzt es nicht sogar an seltene und schlimme Fälle von Perversion, von Algolagnie, daß jemand ohne Not den Wunsch haben soll, zwischen dem Theaterschluß am Abend um elf und der fordernden Geste eines diensttuenden Redakteurs am nächsten Spätvormittag fünf Seiten über den Ödipus und seine gestrige Interpretation zu liefern? Das ist doch eine fast verrückte, zumindest außerordentlich spezifische Situation – wie sollte die Fertigkeit, sich ihr anzupassen, verknüpfbar sein mit der reinen Freude an griechischer Klassik und wohlgefälligem Interesse an ihrer Darbietung? Nun, die oft von verärgertem Ächzen begleitete Schamlosigkeit einer so pünktlich gelieferten Reaktion auf Begeisterndes oder Gleichgültiges oder Widerliches sei nicht geleugnet. Adorno hat in seinem Hymnus auf Balzacs Musterfeuilleton darauf aufmerksam gemacht. Aber worin unterscheidet diese spezifische, herbe Situation sich eigentlich von der noch viel ungeheureren Zumutung, die darin besteht, daß ein Pianist all seine Liebe zur Musik und viele Jahrzehnte eisernen Fleißes auf den Sekundenbruchteil genau in jener halben Minute zusammenfassend demonstrieren soll, die ihm für das erste, nach ein paar Horntönen heranrückende große Solo aus dem B-Dur-Klavierkonzert von Brahms bleibt? Oder von der noch weit prekäreren Lage des Augenarztes; auch er liebt die Medizin und hat sein Handwerk gelernt. Doch ergibt sich daraus schon, daß er am Morgen um sieben Uhr bei der Star-Operation innerhalb kürzesten Zeitraums keinen Fehler machen wird, nur weil er keinen Fehler machen darf?
Nein, die speziellen Zumutungen eines Metiers mögen unerfüllbar sein für viele, die das Metier zwar lieben, es aber nur dann zuverlässig ausüben können, wenn sie «in Form» sind. Doch prinzipiell besteht zwischen dem Zwang und der Fähigkeit zur Terminerfüllung einerseits und musischem oder eben medizinischem Engagement andererseits kein notwendiger Widerspruch.
Hinkt unser Vergleich? Star-Operationen müssen, Konzerte sollen stattfinden. Kritiken aber sind ungedeckt vom Funktionszwang. Wir haben schon gesehen, daß gerade darin ihre Rechtfertigung liegen kann, woran eine funktionierende Welt sich schwer genug gewöhnt … Fazit: Immer noch wird in Deutschland, aber sicherlich nicht nur hier, der Rezensentenberuf als eine Art Übergangsposition verstanden. Wenn sich etwas Besseres findet, etwas Konkreteres, Gesünderes, dann hört der Kritiker natürlich auf, und er wird Verleger oder Professor oder auch nur Redakteur. Manchmal findet sich scheint’s nichts.
Nun könnte man das ohnehin stets rein polemisch gemeinte Gerede über Zuständigkeit und Unzuständigkeit eines Kritikers mit dem Hinweis ersticken, der kritische Text spräche doch für oder gegen sich selbst. Die Einleitung verrate doch rasch, wes Geistes Kind der Kritiker sei, die Urteilsbegründungen ließen ersehen, welche Ideale dem Kunstrichter im Augenblick vorschwebten. Jede Kritik enthalte eben nicht nur ein Urteil über ihren Gegenstand, sondern auch über den, der sie schrieb.
Das ist richtig – aber unvollständig. So reizvoll und unerläßlich es auch wäre, das «hic Rhodos, hic salta» fürs A und O zu nehmen, sich auf Stilmerkmale, intellektuelles Niveau, Urteilssicherheit und dergleichen zu verlassen, so wenig genügen alle diese gewiß unerläßlichen Kriterien doch zur Beurteilung eines kritischen Anspruchs, zur Beantwortung der Frage, ob denn der betreffende Kritik-Autor in der Tat zuständig sei. Man muß auch wissen, wer hinter einem Elaborat steht. Ob die Einzelkritik als in sich geschlossene schriftstellerische Arbeit gelungen ist oder nicht, läßt sich natürlich beurteilen. Doch über das Gewicht der Forderung, über die Gewichtigkeit der Einwände, kurz: über das Format der Kritiker-Persönlichkeit sagt eine einzelne Kritik wenig. Man muß auch wissen, ob die Kritik für ein Weltblatt oder eine Fachzeitschrift bestimmt war, ob sie von jemandem geschrieben wurde, der beharrlich auf Qualität zielt oder der blitzenden Auges neuen Entwicklungen nachspürt, von jemandem, der sich im Einverständnis mit dem Geschmack seiner Kunden befindet oder der allen Konformismus verachtet. Das kann man schwerlich aus den Zeilen einer einzelnen Besprechung lesen, höchstens zwischen ihnen. Wer Kritik als Beruf versteht und ausübt, dem muß es gelingen, allen unabweisbaren Unsicherheiten zum Trotz den Eindruck eines durchgehaltenen Niveaus zu vermitteln, eines sorgfältig abgewogenen Anspruchs, reiner Unbestechlichkeit – was Vorliegen und Idiosynkrasien nicht unbedingt ausschließt. So ergibt sich Zuständigkeit.
Sie läßt sich kaum herstellen, wenn der Kritiker nicht seinen eigenen Weg zu den großen Werken und Künstlern findet. Da er einerseits zum prompten Urteilen gehalten ist, diese Urteile aber weder in Spielplanpolitik noch in widerspruchsfreie ästhetische Gesetzeszusammenhänge aufzubauschen braucht, andererseits jedoch auch nicht seinen Frieden mit dem Praktischen und Realisierbaren schließen muß wie jeder Regisseur und Intendant, darum kann der Kritiker sich zum reinen, von jeder Empfindung, Kraft, Zartheit und Wahrheit überzeugbaren Widerstand steigern. Weil seine Reaktionen nicht Kulturgeschichte machen, wenn sie auch manches beschleunigen oder hemmen mögen, weil er mehr ein Symptom ist als ein Synthetiker, darf er sich darauf beschränken, dem einzelnen zu erliegen oder zu widerstehen und unverdrossen auf die Überzeugbarkeit seines Sensoriums zu setzen. Kein Dogma braucht ihn zu binden; immer wieder kann er sich abwenden, immer von neuem sich zuwenden: kein Vorwurf sollte ihn weniger schrecken als der des Wankelmutes. Denn hinter seiner unheimlich-freundschaftsgefährdenden und feindschaftsentgiftenden Offenheit, die nicht prinzipielle Liberalität ist, sondern eher die Leidenschaft, immer wieder Versuchsperson für Kunstwirkungen verschiedenster Art und Absicht zu sein – hinter dieser Offenheit des Kritikers, vielmehr: um sie herum bleibt die Einheit der Kritikerperson mit sich selbst bestehen. Ist der Kritiker für die Finsternis von Becketts unbewohnter Welt empfänglich, bewegt ihn deren Größe und beinahe indiskrete Bescheidenheit, dann wird diese Bewegung sich wieder herstellen, falls Beckett seiner Gewalt und der Kritiker sich selber treu blieb. Und sollte der Kritiker – weiterlebend, sich verändernd – dem Faszinosum Becketts entwachsen, dann muß er so redlich wie unbefangen sagen, warum aus dem Paulus ein Saulus geworden ist. Den Vorwurf der Urteilsunsicherheit muß er zu ertragen lernen. Wenn er nicht Moden folgt, sondern seinem stetigen, diskursiv Ton für Ton, Wort für Wort, Impuls für Impuls, Gestalt für Gestalt ernst nehmenden Ich, dann hat er auch beim sogenannten «Verrat» die Gewißheit, sich selbst, nicht einem Dogma, treu geblieben zu sein.
Das klingt so allgemein, wie es gemeint ist. Denn «Kritiker» wird der Kritiker erst beim Schreiben, beim objektivierenden Vergegenwärtigen. Vorher ist er, wie alle anderen, denen es Spaß macht, «nur» Interessent, Liebhaber, vielleicht Kenner. Musikalität läßt sich ja auch nicht so bestimmen, als ob sie ein definierbares Privileg von Berufsmusikern wäre.
Wenn wir hier das Besondere des Kritiker-Berufes aus dem Allgemeinen der vielfachen Beschäftigung mit sogenannten schönen Gegenständen herauszudestillieren trachten, dann wird sogar jene letzte Unterscheidung ein wenig undeutlich, die zur petitio principii des kritischen Tuns zu gehören schien. Nämlich die Unterscheidung zwischen produktiver Aktivität und passiver Kontemplation (merkwürdig, daß gerade solche «typisch» deutschen Kunstbetrachtungen auf so viele Fremdwörter hinauslaufen). Wer produziert denn aus dem Nichts? Antworten nicht alle auf ihre Weise einem Riesenbestand von Werken, Gesamtausgaben, Moden, verdrängten Wünschen und verstohlenen Träumen? Ich habe schon einmal darzustellen versucht, daß Musik über Musik entsteht[*], weil die Tonsprache für den Musiker etwa das darstellt, was die sogenannte Wirklichkeit für den Schreibenden oder Malenden ist. So gesehen, wäre für alle Schreibenden das Blatt Papier immer gleich weiß und der Bestand an Überliefertem immer gleich groß. Schöpferisch ist der Kritiker dabei insofern nicht, als ihm nicht einmal die Freiheit des ersten Wortes bleibt. Ein Kritiker, der diese Enge nicht aushalten zu können meint, der die Nötigung, immer nur antworten zu dürfen und zu müssen, nicht erträgt (es gibt mannigfaltige Fluchtmöglichkeiten auf Kosten der kritisierten Objekte), ist der herbsten Versuchung seines Metiers erlegen. Er will Shakespeares Löwen spielen, nicht nur beschreiben.
Viel Ressentiment schmölze dahin, wenn ein paar Kritiker ihre Eitelkeit mit Selbstbewußtsein zu durchsetzen suchten und demonstrierten, daß der Beruf des Literaten lebenswert sein kann, nicht nur Abstellplatz für Blindgänger oder Rohrkrepierer. Wenn jemand hierzulande sagt, er sei Geiger oder Klavierstimmer oder Solofagottist, dann findet das jedermann in Ordnung. Töne darf man verkaufen. Meinungen nicht. Wir glauben noch immer nicht recht daran, daß Schriftstellerei ein Lebensinhalt und Kritik ein Beruf sein könne.
6
Es ist kein Wunder, daß hier soviel von Wirkungen, Ausflüchten, Unterstellungen die Rede ist und so wenig von der Kritik selbst. Denn die «Kritik selbst» ist sogar da, wo sie Eigenwert beanspruchen darf (wo sie in Gesamtausgaben erscheint, zum Dokument geworden ist), Funktion von Taten und Ereignissen. Bei ihrer Geburt wirkt sie wie ein Katalysator, indem sie das noch nicht zu sich selbst gekommene Urteil anderer zur Erscheinung bringt und der Öffentlichkeit Sprichworte liefert.
Naheliegend ist es, Kritiken gegeneinander auszuspielen. 48 Stunden nach der Premiere kommen die Kritiken heraus. Siehe da, sie widersprechen sich mitunter aufs Wort. Selbst der Beifall wird verwirrenderweise verschieden gewertet. Dem einen Kritiker, der begeistert mitging, schienen sieben Minuten Klatschen eine «Ovation», der andere hatte sich dreieinhalb Stunden tödlich gelangweilt; nach dieser Ewigkeit meint er, knappe sieben Minuten höflichen Dankes an die Beteiligten seien eine doch ziemlich «kühle Reaktion».
Was hat es nun mit diesen Widersprüchen auf sich? Zunächst: sie sind nicht total. Daß Fritz Kortner ein anderes «Format» besitzt als der wackere Herr X vom Boulevard, werden selbst diejenigen sogleich zugeben, die keineswegs mit allen Kortner-Inszenierungen einverstanden sind. Daraus, daß verschiedene Gesichtspunkte möglich sind, läßt sich keine Folgerung ableiten. Besagt es etwas gegen die Justiz, falls die zweite Instanz aufhebt, was die erste befand? Jedesmal wurde sogar nach gleichem geltendem Recht geurteilt – das es für die Kunstkritik nicht gibt –, und doch liegt zwischen den Urteilen die Spanne zwischen lebenslänglichem Zuchthaus und Freispruch. Oder: man wechsle einmal den Zahnarzt. Es wäre ein Wunder, falls der Nachfolger nicht kopfschüttelnd das Gehege der Zähne beäugte, irgend etwas von «total verjaucht, schlimm verkommen» murmelte, und nur mit äußerster Charakteranstrengung die Frage vermiede: «Bei wem waren Sie eigentlich bisher?» Spricht das gegen den Sinn der Zahnheilkunde? Ich kenne Pianisten, die viermal nacheinander mit ganz einfachen Klavierübungen beginnen mußten, weil der jeweils neue Lehrer die bisherige Anschlagstechnik verwerflich und einen Rückzug auf leichtesten Clementi («damit Sie endlich entkrampft spielen!») für unumgänglich hielt.
Mit anderen Worten: wo die «Physika» aufhören und die «Metaphysika» anfangen, will die Wahrheit erworben sein. Man kann nichts «nach Hause tragen». Man muß mitdenken, bestimmte Voraussetzungen mitmachen, bestimmte Aspekte begreifen oder verwerfen lernen. Dann erst schließt sich die unbezifferbare Wahrheit dessen auf, was da von jemandem gut oder schlecht, klug oder dumm bedacht ward. Nach zehn Jahren sind die Tagesdifferenzen vorbei und ein Nebel von Übereinstimmung liegt über dem Vergangenen. Aber für den Augenblick darf man nur nach der Glaubhaftigkeit, Sachkunde und Phantasie des Schreibenden fragen, nach dem, was er will und was er verabscheut, woran er mißt und wieviel er verlangt. Und wenn sein Kollege dann etwas ganz anderes schreibt, dann kann der beispielsweise irren, nicht begriffen haben oder auch im Recht sein (nur anderes fordernd). Vielleicht irren auch beide, nur Herr A tut es amüsanter. Niemand kann es entscheiden. Man ist also auf die eigene Subjektivität zurückverwiesen. Nur fällt die Verschiedenheit, der Gleichzeitigkeit wegen, bei den Theaterkritiken mehr auf. Darum suche man bessere Argumente gegen die Kritiker aus als das dumme und subalterne: Sie widersprechen sich, deshalb sind sie nichts wert. Wer so argumentiert, ahnt weder, was ein Argument ist, noch welche Mühe er damit auf sich genommen hat, daß er erwachsen, ein freier Mensch und mündig ist. Glaubenssätze werden in anderen Fakultäten verkündet.
Aber nehmen wir einmal das Unwahrscheinliche für gegeben: ein Kritiker fühlt sich relativ wohl bei seiner hochbezahlten Qual. Er kann punktuell reagieren, ohne daß sein Tabletten- oder Mokka-Konsum bedenklich steigt; er muß sich dogmatisch nicht «festlegen», um auf Werke und Künstler eine Antwort zu haben, er ist weder geheimer Dramaturg noch verhinderter Regisseur, weder «wertfrei» assoziierender Professor noch schadenfroher Sprühteufel, weder ahnungsloser Kunst-Fremdling noch betriebsblinder Professional. Nehmen wir bei dieser Schilderung des Idealtypus weiter an, der Kritiker lasse sich weder vom Wunsch nach Effekt zu manisch-depressiver Temperaments-Clownerie verleiten noch von unstatthafter Friedensliebe zu bloßer Schönrednerei.
Was tut ein solcher Kritiker?
Nun, er wird der beinahe grenzenlosen Freiheit seines Urteilen-Könnens nur gerecht, wenn er es versteht, sich selbst zu überzeugen und ausnahmslos nur von seinen eigenen Überzeugungen zu leben. Man ahnt nicht, wie wenig selbstverständlich das ist. Die Welt der Kunst ist angefüllt mit Moden, Wertungen, Überlieferungen und Rangordnungen, die alle keineswegs deshalb schon falsch sein müssen, weil sie sich zu zwingenden Vorurteilen verfestigt haben. Es gibt gewiß ein paar kleine Freiheiten, die man dem Kritiker gern zugesteht – mag er ruhig übers Ziel hinausschießen, in drei Tagen ist ohnehin alles vergessen. Aber gegen die Fülle der auf ihn einstürzenden Eindrücke, Meinungen und Ismen kann ein Kritiker sich nur wehren, wenn er stetig (das heißt nicht unbedingt: konservativ) allein zu dem hält, was ihn überzeugt, was er findet und empfindet. Er soll lieber auf eigene Kosten mittelmäßig, als auf Adornos Kosten intelligent oder auf seines akademischen Lehrers Kosten gebildet sein. Er soll im Zweifelsfall lieber eine schmale eigene Einsicht mitteilen, als riesige Zusammenhänge ausbreiten, die ihm aus zweiter oder zehnter Hand zugänglich geworden sind.
In der Welt der schönen Täuschungen gibt es jene allermeisten, die überhaupt kein Urteil haben – und deshalb keineswegs besonders hart zu verklagen sind. Da existieren auch noch ein paar andere, die beneidenswert genau wissen, was sie (durchsetzen) wollen. Am bedenklichsten ist die Funktion jener dritten Gruppe, die zu halben Überzeugungen halb steht, die sich lieber currenten Meinungen anschließt, als sich selber glaubt. Es sind die Zeitgenossen, die sich bei Beckett langweilen, das aber nicht zu gestehen wagen, sondern mit Nihilismus-Gerede demonstrieren, inwiefern sie auch bei avancierter Kunst mitzukommen imstande sind.
Was diese Leute über Beckett sagen, wird begreiflicherweise der Klarheit entbehren, wofür Beckett dann allerdings nichts kann. Das allzu große Gewicht einiger Kritiker-Meinungen kommt offenbar dadurch zustande, daß jene, die kein Urteil haben oder ihrem Urteil nicht trauen, sich den Kritikern und Meinungsbildnern vorsichtshalber anschließen. Das ist die ärgerliche Macht von Kritik.
Ein Kritiker, der sich nicht berauschen läßt von dieser Macht, muß folglich in seinem Zusammenleben mit Kunst gar nicht so sehr darauf achten, alles zu verstehen, allem voraus zu sein, immer die Glocke zu läuten, sondern er muß bei den Einsichten, zu denen er gelangt, zu denkbar reinster Klarheit und Eindeutigkeit kommen. Niemand fordert, wir haben schon davon gesprochen, ein System von ihm, einen schlüssigen ästhetischen Zusammenhang, eine Lösung sämtlicher Kunsträtsel. Desto reiner muß er seine Einsichten, «Funde» und Überzeugungen für sich selbst erkämpfen, auf daß er sie anderen wirklich plausibel machen kann. Klarer Stil ist ja nicht nur eine Folge sogenannten «Schreiben-Könnens», sondern auch die Konsequenz des Umstandes, daß jemand Klarheit in seine Gedanken und Gefühle gebracht hat. Manchmal allerdings, Churchill hielt es einem politischen Gegner einst vor, wird ein klarer Stil auch zum regelrechten Nachteil: man sieht, wie wenig der Betreffende zu sagen hat.
Nun sind reine Einsichten über Kunstwerke, die gerade nicht dem allgemeinen Gerede oder der Überlieferung entspringen (also: Schillers Frauengestalten lassen sich nicht spielen, es gäbe keinen großen deutschen Roman, Brahms’ zweites Klavierkonzert sei undankbar), wahrhaftig nicht leicht zu haben. Ein Kritiker jedoch, der seine Freiheit von aller Funktion dazu benutzt, Erfahrungen zu machen und das Talent besitzt, diese Erfahrungen dann auch klarzumachen, kann im öffentlichen Gespräch eben jenen Nutzen stiften, den die versierten Platitüden eines Fachmanns höchst selten hervorbringen. Er kann nämlich seine Leser davon überzeugen, daß es sogar im Bezirk der Kunst Gewißheiten über Zusammenhänge, Schönheiten und Antinomien gibt. Es muß nicht nur weich geschwafelt werden, obschon harte Beweisbarkeit kaum zu erlangen ist.
7
Antwortet jedoch der Kritiker auf die Forderung des Tages, dann werden Fragen solchen Ranges meist verdeckt von Rangfragen. Denn ein Geschmacksurteil muß immer mit mindestens drei Größen rechnen: was war – was wäre möglich gewesen – was wäre wünschenswert gewesen. Wenn ein Stadttheater ‹Hamlet› spielt, steht sowohl die abstrakte Hamlet-Forderung da, als auch das Old Vic-Vorbild, als auch die natürliche Begrenzung des Stadttheaters (und des Kritikers). Darum ist es sogar meist leichter, sich mit dem Allergrößten auseinanderzusetzen, wie mit den Wechselfällen des Durchschnitts. Zu Gründgens oder zu Arthur Schnabel muß jedem wachen Menschen etwas einfallen. Wenn jedoch in Mannheim auf anständige Weise Somerset Maughams Konversationsstück-Frage beantwortet wird, ob Constanze sich richtig verhält, dann kann ein Kritiker dazu meist nicht allzuviel vorbringen. Dann muß er jeder einzelnen Schauspielerleistung solange nachgehen, bis die Umrisse der dargestellten Figur, die Talente der Schauspieler und die Anforderungen des Stückes einigermaßen deutlich geworden sind. Das ist mühsam, macht wenig Spaß und führt darum zu jenem Plauderei-Typus, der kaum «Kritik» genannt werden kann. Übrigens ist dieser Typus im Zusammenhang mit einem auf Unterhaltung zielenden Abend nicht einmal die schlechteste Lösung.
Vergreift man sich bei der Beurteilung einer mittleren Leistung im Ton, so hat man den unauffälligsten und darum schwersten Fehler gemacht, der in diesem Metier denkbar ist: denn verfänglicher als die falschen Antworten sind nun einmal die Antworten auf falscher Ebene.