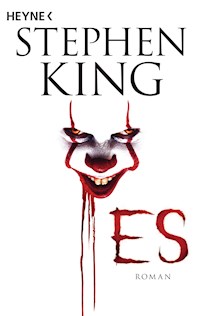
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Böse in Gestalt eines namenlosen Grauens
In Derry, Maine, schlummert das Böse in der Kanalisation: Alle 28 Jahre wacht es auf und muss fressen. Jetzt taucht »Es« wieder empor. Sieben Freunde entschließen sich, dem Grauen entgegenzutreten und ein Ende zu setzen.
Stephen Kings Meisterwerk über die Mysterien der Kindheit und den Horror des Erwachsenseins.
»Ein Meilenstein der amerikanischen Literatur.« Chicago Sun-Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2194
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Das Buch
1957 hat alles begonnen: Der kleine Georgie ist das erste Opfer. Und dann bricht Es wie die Pest über die Stadt Derry herein, eine Gräueltat folgt der anderen … Über 25 Jahre später: Mike Hanlon ruft sechs Freunde zusammen und erinnert sie an den Schwur, den sie einst geleistet haben. Sollte Es, sollte das namenlose Böse noch einmal auftauchen, wollen sie sich wieder in Derry treffen. Damals sind die Freunde in die Abwasserkanäle gestiegen, als Kinder haben sie Es gejagt und zu töten versucht. Aber Es wurde nur verletzt. Und jetzt geht das Grauen wieder um, daran besteht kein Zweifel. Einer der Freunde kann zu dem Treffen nicht mehr kommen. Er liegt blutverschmiert in seiner Badewanne. Offensichtlich Selbstmord …
Der Autor
Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, veröffentlichte schon als Student Kurzgeschichten. Sein erster Romanerfolg, Carrie, erlaubte ihm, sich nur noch dem Schreiben zu widmen. Seitdem hat er weltweit über 400 Millionen Bücher in mehr als 40 Sprachen verkauft. Im November 2003 erhielt er den Sonderpreis der National Book Foundation für sein Lebenswerk. Die großen Werke des Autors erscheinen im Heyne Verlag.
Es
Roman
Aus dem Amerikanischen von Alexandra von Reinhardt und Joachim Körber
Bearbeitet und teilweise neu übersetzt von Anja Weiligmann
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe IT erschien bei Viking, New York
Copyright © 1986 by Stephen King
Copyright © 1990, 2011 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Nele Schütz Design
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-05357-4V023
www.heyne.de
Dieses Buch widme ich voll Dankbarkeit meinen Kindern.
Meine Mutter und meine Frau haben mich gelehrt, ein Mann zu sein. Meine Kinder haben mich gelehrt, frei zu sein.
NAOMI RACHEL KING, vierzehn;
JOSEPH HILLSTROM KING, zwölf;
OWEN PHILIP KING, sieben.
Kinder, Bücher sind Wahrheit inmitten von Lügen, und die Wahrheit dieses Buches ist schlicht und einfach: Die Magie existiert.
S.K.
»This old town been home as long as I remember. This town gonna be here long after I’m gone.
East side west side take a close look ’round her You been down but you’re still in my bones.«
THE MICHAEL STANLEY BAND
»Alter Freund, wonach hältst du Ausschau?
Nach so vielen Jahren kehrst du heim
Mit Bildern, die du hegtest
Unter fremden Himmeln
Fern von deinem eigenen Land.«
GIORGIOS SEFERIS
»Out of the blue and into the black.«
NEIL YOUNG
Teil einsErste Schatten
»Sie beginnen!
Die Perfektionen werden geschärft
Die Blume öffnet die bunten Blumenblätter
weit in der Sonne
Doch die Zunge der Biene
verfehlt sie
Sie sinken zurück in den Lehm
schreien auf
– man könnte es einen Schrei nennen
der über sie hinwegstreicht, ein Schaudern
während sie welken und verschwinden …«
WILLIAM CARLOS WILLIAMS
Paterson
»Born down in a dead man’s town.«
Bruce Springsteen
Kapitel eins Nach der Überschwemmung (1957)
1
Der Schrecken, der weitere achtundzwanzig Jahre kein Ende nehmen sollte – wenn er überhaupt je ein Ende nahm –, begann, soviel ich weiß und sagen kann, mit einem Boot aus Zeitungspapier, das einen vom Regen überfluteten Rinnstein entlangtrieb.
Das Boot schwankte, hatte Schlagseite und richtete sich wieder auf, brachte heldenhaft manch bedrohlichen Strudel hinter sich und schwamm immer weiter die Witcham Road hinab, auf die Verkehrsampel an der Kreuzung Witcham und Jackson Street zu. Die drei vertikalen Linsen an allen Seiten der Ampel waren an diesem Nachmittag im Herbst des Jahres 1957 dunkel, und die Häuser waren ebenfalls allesamt dunkel. Es regnete nun seit einer Woche ununterbrochen, und vor zwei Tagen war auch noch Wind aufgekommen. In den meisten Teilen von Derry war der Strom ausgefallen und noch nicht wieder eingeschaltet worden.
Ein kleiner Junge in gelbem Regenmantel und roten Gummistiefeln rannte fröhlich neben dem Papierboot her. Der Regen hatte noch nicht aufgehört, ließ aber allmählich nach. Er trommelte auf die gelbe Kapuze, und das hörte sich in seinen Ohren wie Regen auf einem Giebeldach an … ein angenehmes, fast schon beruhigendes Geräusch. Der Junge im gelben Regenmantel hieß George Denbrough und war sechs Jahre alt. Sein Bruder William, der in der Derry-Elementary-Schule allgemein nur unter dem Namen Stotter-Bill bekannt war (sogar bei den Lehrern, die ihn natürlich nie so anredeten), war zu Hause und erholte sich gerade von einer schweren Grippe. In jenem Herbst 1957 – acht Monate bevor der wahre Schrecken begann und achtundzwanzig Jahre vor der letzten Konfrontation – war Stotter-Bill zehn Jahre alt.
Bill hatte das Boot gefaltet, neben dem George jetzt lief. Er hatte es im Bett gefaltet, den Rücken an einen Stapel Kissen gelehnt, während ihre Mutter auf dem Klavier im Salon Für Elise gespielt hatte und Regen unablässig gegen sein Kinderzimmerfenster prasselte.
Etwa drei Viertel des Weges den Block entlang in Richtung Kreuzung und ausgefallener Ampel war die Witcham Road mit Warnlichtern und orangefarbenen Sägeböcken für den Verkehr gesperrt. Auf jedem Sägebock stand die Aufschrift des Tiefbauamtes DERRYDEPT.OFPUBLICWORKS. Dahinter war der Regen aus Gullys gequollen, die mit Ästen und Steinen und großen, pappigen Klumpen Herbstlaub verstopft waren. Das Wasser hatte zuerst Griffmulden in den Asphalt gebohrt und dann gierig ganze Hände voll weggerissen – das alles am dritten Tag des Regens. Am Mittag des vierten Tages trieben große Bruchstücke der Straße über die Kreuzung Witcham und Jackson und erinnerten dabei an Miniaturflöße. Zu dem Zeitpunkt machten schon viele Leute in Derry nervöse Witze über Archen. Es war dem Tiefbauamt gelungen, die Jackson Street offen zu halten, die Witcham war allerdings ab den Sägeböcken bis in die Innenstadt unpassierbar.
Aber nun war nach allgemeiner Meinung das Schlimmste überstanden. Der Pegel des Kenduskeag River war knapp unterhalb der Höhe der natürlichen Ufer in den Barrens und der betonierten Kanalmauern in der Innenstadt stehen geblieben, und im Augenblick war eine Gruppe von Männern – darunter auch Zack Denbrough, Georges und Bills Vater – damit beschäftigt, die Sandsäcke wegzuräumen, die sie am Vortag angsterfüllt entlang des Flusses aufgestapelt hatten, als es so aussah, als würde er unweigerlich über die Ufer treten und die Stadt überfluten. Das war schon öfter vorgekommen, und es gab noch genügend Menschen, die sich an die Überschwemmung von 1931 erinnern konnten und die übrigen Bewohner von Derry mit ihren Erzählungen in Angst und Schrecken versetzten. Damals waren bei der Hochwasserkatastrophe über zwanzig Menschen ums Leben gekommen. Einer davon war später vierzig Kilometer stromabwärts in Bucksport aufgefunden worden. Die Fische hatten diesem Ärmsten die Augen, drei Finger, den Penis und den größten Teil des linken Fußes abgefressen. Seine Hände – oder was davon noch übrig gewesen war – hatten das Lenkrad eines Fords umklammert.
Aber jetzt ging der Fluss zurück, und wenn weiter oben der neue Damm von Bangor Hydro fertig war, würde der Fluss keine Bedrohung mehr sein. Sagte jedenfalls Zack Denbrough, der für Bangor Hydroelectric arbeitete. Was die anderen betraf – nun, zukünftige Sturmfluten konnten sich um sich selbst kümmern. Das Entscheidende war, diese hier zu überstehen, den Strom wieder einzuschalten und sie zu vergessen. In Derry war das Vergessen solcher Katastrophen und Tragödien beinahe eine Kunstform, wie Bill Denbrough im Verlauf der Ereignisse noch herausfinden sollte.
George blieb hinter den Sägeböcken am Rande eines tiefen Risses stehen, der sich gut zehn Meter diagonal durch den Teer der Witcham Road bis zur anderen Straßenseite zog, und er lachte laut auf – der Klang der kindlichen ausgelassenen Fröhlichkeit erhellte einen Augenblick lang diesen grauen Nachmittag –, als das Wasser sein Papierboot nach rechts in die Miniatur-Stromschnellen der schmalen Vertiefung riss. Es trieb so schnell auf die andere Seite der Witcham Road zu, dass George rennen musste, um auf gleicher Höhe zu bleiben. Unter seinen Gummistiefeln spritzte Wasser hervor, und ihre Schnallen klapperten fröhlich, während George Denbrough in seinen absonderlichen Tod rannte. Er war in diesem Moment ganz erfüllt von Liebe zu seinem Bruder Bill … von Liebe und leichtem Bedauern, dass Bill nicht bei ihm war und dies hier nicht sehen konnte. Natürlich konnte er ihm alles erzählen, wenn er nach Hause kam, aber er konnte es ihm nicht bildhaft vor Augen führen, so wie Bill das fertigbringen würde, wenn er an seiner Stelle wäre. Bill konnte so etwas ganz fantastisch – deshalb bekam er in seinen Zeugnissen im Lesen und Schreiben auch immer die besten Noten, deshalb waren die Lehrer so begeistert von seinen Aufsätzen. Aber selbst der kleine George wusste, das Erzählen war nicht alles. Bill konnte auch sehen.
Das Boot schnellte durch die Vertiefung, und obwohl es in Wirklichkeit nur aus der Anzeigenseite der Derry News bestand, stellte George sich vor, es wäre ein Torpedoboot wie die in den Kriegsfilmen, die er manchmal in Samstagsvorstellungen mit Bill sah. Ein Kriegsfilm mit John Wayne, der gegen die Japsen kämpfte. Schmutziges Wasser schäumte um den Bug, während das Boot durch den Riss im Teer trieb, und dann erreichte es den Rinnstein auf der anderen Straßenseite. Einen Augenblick sah es so aus, als ob die neue starke Strömung, die gegen seine rechte Seite prallte, es zum Kentern bringen würde, aber es richtete sich wieder auf und drehte nach links – und erneut rannte George lachend nebenher, während unter seinen Gummistiefeln hervor das Wasser hochspritzte und der heftige Oktoberwind an den fast kahlen Bäumen rüttelte, die durch den furchtbaren Sturm der Vortage ihr buntes Blätterkleid verloren hatten.
2
Im Bett sitzend, die Wangen noch immer vor Hitze gerötet (aber das Fieber sank jetzt wie der Kenduskeag), hatte Bill das Boot gefaltet und dann zu George, der schon danach greifen wollte, gesagt: »U-und jetzt h-h-hol mir das P-P-Paraffin.«
»Was ist das? Und wo ist es?«
»Es steht auf dem Regal im Keller«, hatte Bill gesagt. »In einer Schachtel mit der A-Aufschrift G-G-hulf … Gulf. Und bring auch ein Messer und eine Sch-Sch-Schüssel mit. Und St-St-Streichhölzer.«
George hatte sich gehorsam auf den Weg gemacht, um diese Sachen zu holen. Er hörte seine Mutter Klavier spielen, nicht mehr Für Elise, sondern etwas anderes, das ihm nicht so gut gefiel, weil es sich trocken und hektisch anhörte, während der Regen an diesem verhangenen Vormittag beharrlich gegen die Küchenfenster klopfte – es waren beruhigende Geräusche, wohingegen der Gedanke an den Keller alles andere als beruhigend war. Er ging nicht gern die schmale Kellertreppe hinunter, weil er sich immer vorstellte, dass da unten im Dunkeln etwas lauerte. Natürlich war das dumm und kindisch, das hatten ihm seine Eltern ja schon gesagt, und was noch viel wichtiger war, auch Bill hatte ihm das gesagt, aber dennoch …
Er öffnete nicht einmal gern die Tür, weil er immer das Gefühl hatte – und das war so furchtbar dumm, dass er es niemandem zu erzählen wagte –, dass in dem Moment, in dem er seine Hand nach dem Lichtschalter ausstreckte, etwas nach ihm greifen würde … irgendeine schreckliche Kralle mit Klauen … und ihn in die Dunkelheit hinabzerren würde, die nach Schmutz, Moder und verschimmeltem Gemüse roch.
Dumm! Es gab keine haarigen, mordlustigen Krallen. Ab und zu drehte jemand durch und brachte einen Haufen Leute um – manchmal berichtete Chet Huntley über so etwas in den Abendnachrichten –, und natürlich waren da die Kommies. Aber es gab kein unheimliches Monster, das unten im Keller hauste. Trotzdem wurde er die Vorstellung nicht los. In jenen endlos scheinenden Sekunden, wenn er mit der rechten Hand (der linke Arm war dabei immer panisch um den Türknauf geschlungen) nach dem Lichtschalter tastete, glaubte er immer wieder, der Kellergeruch – jener säuerlich bittere Geruch von Moder, Fäule und verschimmeltem Gemüse – sei der Eigengeruch des Ungeheuers, des Monsters aller Monster. Es war der Geruch von etwas, für das er keinen Namen hatte – Es lauerte dort unten hungrig im Dunkeln und verschlang mit Vorliebe das Fleisch kleiner Jungen.
An diesem Vormittag hatte er die Tür geöffnet, den Kellergeruch wahrgenommen und wie immer nur einen Arm in die Dunkelheit hinein ausgestreckt, um das Licht einzuschalten, während der andere Arm um den Knauf geschlungen war und er mit fest zusammengekniffenen Augen, verzerrtem Mund und hervorstehender Zungenspitze vor der Türschwelle stand. Komisch? Natürlich! Und wie! Schau dich doch nur mal an, Georgie! Georgie hat Angst vor der Dunkelheit! So ein Baby!
Die Klänge des Klaviers aus dem Salon – wie seine Mutter es nannte, sein Vater nannte es Wohnzimmer – schienen aus weiter Ferne zu kommen, so wie das Stimmengewirr und Gelächter an einem überfüllten Strand im Sommer einem erschöpften Schwimmer, der verzweifelt gegen die Strömung ankämpft, weit entfernt und völlig fremd und sinnlos vorkommen mussten.
Seine Finger ertasteten den Schalter. Ah!
Sie drückten darauf …
… und nichts. Kein Licht.
O Mann! Der Strom!
George zog seinen Arm so schnell zurück, als hätte er in einen Korb voller Schlangen gegriffen. Er wich einige Schritte von der geöffneten Kellertür zurück und blieb mit laut pochendem Herzen stehen. Klar, kein Strom, er hatte ganz vergessen, dass der Strom ausgefallen war. So ein Mist aber auch! Was nun? Sollte er Bill erklären, er könne das Paraffin nicht holen, weil kein Strom da sei und er Angst habe, dass etwas ihn auf der Kellertreppe schnappen könnte, dass etwas ihn unter der Treppe hervor am Knöchel packen könnte, kein Kommie oder Massenmörder, sondern ein viel, viel schlimmeres Wesen? Dass es einfach mit einem Teil seines verrotteten Leibs die Treppe heraufgekrochen kam und ihn am Knöchel packte? Das wäre wohl etwas dick aufgetragen, oder? Andere mochten über so ein Hirngespinst lachen, aber Bill nicht. Bill würde wütend werden. Bill würde sagen: »Werd erwachsen, Georgie … Willst du das Boot oder nicht?«
Als hätte Bill seine Gedanken gelesen, rief er genau in diesem Augenblick: »B-B-Bist du da d-draußen g-g-gestorben, Georgie?«
»Nein, ich hol’s gerade!«, rief George zurück. Er rieb sich die Arme und hoffte, dass dadurch die Gänsehaut verschwinden würde. »Ich hab nur schnell einen Schluck Wasser getrunken.«
»Los, b-b-beeil dich!«
Also ging er die vier Stufen zum Kellerregal hinunter; sein Herz war ein warmer, pochender Klumpen in seiner Kehle, seine Nackenhaare sträubten sich, seine Augen brannten, seine Hände waren eiskalt. Er war überzeugt davon, dass die Kellertür gleich zufallen und damit auch das Licht aus der Küche verschwinden würde und dass er es dann hören würde, etwas Schlimmeres als alle Kommies und Mörder der Welt zusammen, schlimmer als die Japsen, schlimmer als Attila der Hunne, schlimmer als die schlimmsten Sachen in hundert Horrorfilmen. Es war da, gleich würde er sein tiefes kehliges Knurren in den albtraumhaften Sekunden hören, bevor es sich auf ihn stürzen und ihm die Gedärme aus dem Leib reißen würde.
Wegen der Überschwemmung war der Geruch heute schlimmer denn je. Ihr Haus stand ziemlich weit oben an der Witcham Road, und deshalb waren sie verhältnismäßig gut davongekommen, aber durch die alten Steinfundamente war Wasser in den Keller gesickert. Der Gestank war so unangenehm, dass George versuchte, möglichst flach zu atmen.
George wühlte das Zeug auf dem Regal so schnell er konnte durch – alte Dosen Kiwi-Schuhcreme und Schuhputzlappen, eine kaputte Petroleumlampe, zwei fast leere Flaschen Windex, eine alte flache Dose Turtle-Wachs. Aus irgendeinem Grund fiel ihm diese Dose auf, und wie hypnotisiert betrachtete er fast eine Minute lang die Schildkröte auf dem Deckel. Dann legte er sie zurück … und da war endlich die eckige Schachtel mit der Aufschrift GULF.
George packte sie und rannte so schnell er konnte die Treppe hinauf. Ihm war plötzlich eingefallen, dass sein Hemdzipfel heraushing, und er war überzeugt davon, dass ihm das zum Verhängnis werden würde; das Ding im Keller würde ihn daran packen, wenn er schon fast draußen war, es würde ihn zurückzerren und …
Oben angekommen, knallte er die Tür hinter sich zu und lehnte sich mit geschlossenen Augen dagegen, die Paraffinschachtel mit der Hand umklammernd, Stirn und Unterarme schweißbedeckt.
Das Klavier verstummte, und die Stimme seiner Mutter ertönte: »Georgie, kannst du die Tür nicht noch etwas lauter zuschlagen? Vielleicht schaffst du es, im Esszimmerschrank einige Teller zu zerbrechen.«
»Entschuldige, Mama!«, rief George.
»Georgie, du lahme Ente!«, sagte Bill aus seinem Kinderzimmer. Er flüsterte, damit ihre Mutter es nicht hören konnte.
George kicherte leise. Seine Angst war schon wieder fort; sie war so mühelos verschwunden, wie ein Albtraum einem Mann entgleitet, der mit kaltem Schweiß bedeckt und keuchend daraus erwacht, der seinen Körper und seine Umgebung wahrnimmt und sich vergewissert, dass alles nicht passiert ist – und im gleichen Moment setzt schon das Vergessen ein. Die Hälfte ist weg, wenn seine Füße den Boden berühren, drei Viertel sind weg, wenn er aus der Dusche kommt und sich abzutrocknen beginnt, und bis er mit dem Frühstück fertig ist, ist nichts mehr da. Alles weg … bis zum nächsten Mal, wenn er sich im Griff eines Albtraums an alle Ängste erinnert.
Die Schildkröte, dachte Georgie und ging zur Schubladenkommode, wo die Streichhölzer aufbewahrt wurden. Wo habe ich so eine Schildkröte schon einmal gesehen?
Aber er kam nicht darauf und vergaß die Frage.
Er holte eine Schachtel Streichhölzer aus der Schublade, ein Messer aus dem Besteckkasten (die scharfe Messerkante hielt er von sich weg, wie sein Vater es ihn gelehrt hatte) und eine kleine Schüssel aus dem Geschirrschrank im Esszimmer. Dann kehrte er in Bills Zimmer zurück.
»D-Du bist doch ein A-loch, G-Georgie«, sagte Bill freundschaftlich und räumte einen Teil der Krankenutensilien auf seinem Nachttischchen beiseite: ein leeres Glas, einen Wasserkrug, Kleenex, Bücher, eine kleine blaue Flasche Wick VapoRub – dessen Geruch Bill sein halbes Leben lang mit verschleimten Bronchien und laufender Nase assoziieren sollte. Auch das alte Philco-Radio stand da; es spielte leise irgendein Lied von Little Richard, nichts von Bach oder Chopin … so leise, dass Little Richard einen Großteil seines mitreißenden Elans einbüßte. Aber ihre Mutter, die auf dem Juilliard-Musikkonservatorium klassische Musik – Hauptfach Klavier – studiert hatte, hasste Rock ’n’ Roll: Sie war nicht einfach nur dagegen, sie hasste ihn regelrecht.
»Ich bin kein A-loch«, sagte George, setzte sich auf die Bettkante und stellte seine Sachen auf dem Nachttisch ab.
»Aber sicher bist du eins«, sagte Bill. »Nichts weiter als ein großes braunes A-loch.«
Georgie versuchte sich ein Kind vorzustellen, das nur ein großes rundes A-loch auf zwei Beinen war, und fing an zu kichern.
»Dein A-loch ist größer als Augusta«, sagte Bill und fing auch an zu kichern.
»Dein A-loch ist größer als der ganze Staat«, antwortete George. Darauf kicherten beide Jungs fast zwei Minuten lang.
Es folgte eine Unterhaltung im Flüsterton, von jener Art, wie nur kleine Jungen sie so sehr lieben: Wer das größte A-loch war, wer das größte A-loch hatte, wer das braunste A-loch war und so weiter. Schließlich verwendete Bill eines der verbotenen Wörter; er erklärte, George sei ein großes braunes, verschissenes A-loch, und dann mussten beide so heftig lachen, dass Bills Gelächter in einen Hustenanfall überging. Als er allmählich abklang (Bills Gesicht war so dunkelrot angelaufen, dass George ihn besorgt betrachtete), verstummte das Klavier wieder, und beide Jungen blickten in Richtung des Salons und warteten ab, ob sie das Zurückschieben der Klavierbank und die ungeduldigen Schritte ihrer Mutter hören würden. Bill erstickte den Husten, indem er den Mund in seiner Armbeuge vergrub, und deutete gleichzeitig auf den Wasserkrug. George schenkte ihm ein Glas Wasser ein, das er dann auch in einem Zug austrank.
Wieder erklang das Klavier – noch einmal Für Elise. Stotter-Bill vergaß dieses Stück nie, und noch nach Jahren überzogen sich seine Arme und sein Rücken mit einer Gänsehaut, wenn er es zufällig hörte; er bekam lautes Herzklopfen und erinnerte sich: Meine Mutter spielte dieses Stück an dem Tag, als Georgie starb.
»Musst du wieder husten, Bill?«
»Nein.«
Bill zog ein Kleenex aus dem Karton, erzeugte ein grollendes Geräusch in der Brust, spie Schleim in das Papiertuch, knüllte es zusammen und warf es in den Mülleimer neben dem Bett, der mit ähnlichen Papiertuchbällchen gefüllt war. Dann öffnete er die Paraffinschachtel, zog einen wachsartigen Würfel heraus und legte ihn auf seine Handfläche. George sah ihm interessiert zu, schwieg aber. Bill mochte es nicht, wenn er auf ihn einredete, während er mit etwas beschäftigt war, aber George wusste aus Erfahrung, dass Bill ihm meistens ganz von allein erklärte, was er machte, wenn er den Mund hielt.
Bill schnitt ein kleines Stück von dem Paraffinwürfel ab, warf es in die Schüssel, zündete ein Streichholz an und legte es auf das Paraffin. Die beiden Jungen betrachteten die kleine gelbe Flamme, während der schwächer werdende Wind vereinzelte Regenböen gegen die Fensterscheibe wehte.
»Ich muss das Boot wasserdicht machen, sonst wird es sofort nass und sinkt«, sagte Bill. Wenn er mit George zusammen war, stotterte er nur ganz leicht oder überhaupt nicht, aber in der Schule war es manchmal so schlimm, dass er nicht mehr reden konnte und seine Mitschüler verlegen zur Seite schauten, während er sich an seiner Bank festhielt, sein Gesicht rot anlief, bis es fast die Farbe seiner Haare hatte, und er die Augen zudrückte und sich abmühte, seiner störrischen Kehle ein paar Worte abzuringen. Manchmal – meistens – gelang ihm das auch tatsächlich, aber eben nicht immer. Seine Mutter sagte, der Unfall sei schuld an dem Stottern; mit drei Jahren war Bill von einem Auto angefahren und gegen eine Hauswand geschleudert worden; die folgenden sieben Stunden war er bewusstlos gewesen. George hatte aber manchmal das Gefühl, dass sein Vater – und auch Bill selbst – von dieser Erklärung nicht hundertprozentig überzeugt war.
Das Stückchen Paraffin in der Schüssel war inzwischen fast völlig geschmolzen. Die Streichholzflamme wurde bläulich, versank in der Flüssigkeit und erlosch. Bill tauchte seinen Finger ein, stieß einen leisen Zischlaut aus und lächelte George zu. »Heiß«, sagte er und begann das Paraffin auf die Seiten des Papierboots zu streichen, wo es rasch zu einem hauchdünnen milchigen Überzug erstarrte.
»Darf ich auch mal?«, fragte George.
»Okay. Pass nur auf, dass nichts auf die Bettwäsche kommt, sonst bringt Mama dich um.«
George tauchte seinen Finger in das Paraffin, das jetzt zwar noch sehr warm, aber nicht mehr heiß war, und verteilte es auf der anderen Bootseite.
»Nicht so viel, du A-loch!«, rief Bill. »Willst du, dass es auf der J-Jungfernfahrt sinkt?«
»Tut mir leid.«
»Schon gut. Du darfst nur g-ganz leicht drüberfahren.«
George beendete seine Seite und nahm das Boot dann vorsichtig in die Hand. Es fühlte sich ein bisschen schwerer an als zuvor, aber nicht viel. »Ich werd jetzt rausgehen und es schwimmen lassen«, sagte er.
»Ja, mach das.« Bill sah plötzlich ziemlich müde aus – müde und immer noch sehr angeschlagen.
»Ich wollte, du könntest mitkommen«, sagte George. Das wünschte er wirklich. Bill konnte manchmal richtig herrisch werden, aber er hatte immer die tollsten Einfälle und schlug einen fast nie. »Eigentlich ist es dein Boot.«
»Sie«, sagte Bill. »Boote sind immer w-weiblich.«
»Gut, dann ist sie eigentlich dein Boot.«
»Ich würde auch gern mitkommen«, sagte Bill mürrisch.
»Tja …« George trat mit dem Boot in der Hand von einem Bein aufs andere.
»Zieh deine Regenklamotten an«, erwiderte Bill. »Sonst wirst du noch kra-hank wie ich. Aber vermutlich hast du dich ohnehin sch-schon bei mir angesteckt.«
»Danke, Bill. Es ist ein tolles Boot.« Und dann tat er etwas, was er seit Jahren nicht mehr getan hatte und was Bill nie vergessen sollte: Er beugte sich vor und küsste seinen Bruder auf die Wange.
»Jetzt hast du dich hundertprozentig angesteckt, du A-loch«, sagte Bill, aber er schien sich trotzdem zu freuen. Er lächelte George zu. »Und räum das ganze Zeug wieder weg, sonst kriegt Mama einen Anfall.«
»Klar.« Er durchquerte das Zimmer mit der Schüssel, dem Messer und der Paraffinschachtel, auf die er behutsam und etwas schräg sein Boot gelegt hatte.
»G-G-Georgie?«
George drehte sich nach seinem Bruder um.
»Sei v-vorsichtig.«
»Na klar«, sagte George und runzelte ein wenig die Stirn. So etwas sagt normalerweise eine Mutter, nicht aber ein großer Bruder. Es war ebenso seltsam wie der Kuss, den er Bill gegeben hatte. »Klar bin ich vorsichtig.«
Er ging hinaus. Bill sah ihn nie wieder.
3
Hier war er nun und folgte auf der linken Seite der Witcham Road seinem Boot. Er rannte schnell, aber das Wasser floss noch schneller, und sein Boot gewann einen Vorsprung. Er hörte, wie das Plätschern des Wassers in ein leichtes Brausen überging, und plötzlich sah er, dass das Wasser im Rinnstein, das jetzt zu einem schmalen Sturzbach geworden war, auf dem sein Boot tanzte und vorwärtsschnellte, etwa fünfzig Meter hügelabwärts einen Strudel bildete und in einen Gully hineinströmte. Gerade verschwand ein ziemlich großer Ast mit nasser schwarzer, glänzender Rinde im Rachen dieses Gullys. Und dorthin trieb auch sein Boot.
»Scheiße und Schuhcreme!«, schrie er aufgeregt.
Er rannte noch schneller, und um ein Haar hätte er das Boot eingeholt. Aber dann glitt er aus und fiel hin; er schürfte sich ein Knie auf und schrie kurz vor Schmerz. Aus seiner neuen Perspektive – auf dem Pflaster kniend – sah er, wie sein Boot in einen Strudel geriet, sich zweimal um die eigene Achse drehte und dann im Gully verschwand.
»Scheiße und Schuhcreme!«, schrie er wieder und schlug mit der Faust aufs Pflaster. Auch das tat weh, und er weinte leise vor sich hin. Wie dumm von ihm, das Boot auf diese Weise zu verlieren!
Er stand auf, ging zum Gully, kniete sich hin und blickte in das dunkle Loch im Rinnstein hinab. Das Wasser stürzte mit dumpfem Geräusch in jene Dunkelheit hinunter, einem irgendwie unheimlichen Geräusch, das ihn erinnerte an …
»Hä!«, entfuhr es ihm plötzlich, und er wich wie von einer Tarantel gestochen zurück.
Da drinnen waren gelbe Augen: Augen wie jene, vor denen er sich im Keller immer gefürchtet, die er in Wirklichkeit aber nie gesehen hatte. Ein Tier, schoss es ihm völlig zusammenhanglos durch den Kopf, das ist alles, irgendein Tier, vielleicht eine Katze, die da unten gefangen ist…
Er wollte wegrennen – in ein, zwei Sekunden, sobald sein Gehirn den plötzlichen Schock dieser gelben leuchtenden Augen verarbeitet hatte, würde er wegrennen. Er spürte den groben Schotterbelag unter seinen Fingern und die Kälte des Wassers. Er wollte gerade aufstehen und weggehen, als eine Stimme, eine ganz vernünftige und sehr angenehme Stimme, ihn aus dem Gully heraus ansprach.
»Hallo, Georgie«, sagte diese Stimme.
George blinzelte und schaute dann wieder hin. Er konnte zuerst nicht so recht glauben, was er sah; es war wie im Märchen oder wie in Filmen, wo Tiere reden und tanzen konnten. Wäre er zehn Jahre älter gewesen, so hätte er es auf keinen Fall geglaubt, aber er war nicht sechzehn; er war erst sechs.
In dem Abflussrohr war ein Clown. Das Licht da drinnen war alles andere als gut, aber es reichte aus, dass George Denbrough sich sicher sein konnte, was er sah. Es war ein Clown wie im Zirkus oder Fernsehen. Er sah tatsächlich sogar wie eine Kreuzung zwischen Bozo und Clarabell aus, der dadurch redete, dass er seine (oder war es ihre? – George war sich nie sicher, was für ein Geschlecht es war) Hupe samstags morgens in Howdy Doody drückte – Buffalo Bob war der Einzige, der Clarabell verstehen konnte, und darüber musste George sich jedes Mal kaputtlachen. Das Gesicht des Clowns im Abflussschacht war weiß, er hatte komische rote Haarpuschel auf beiden Seiten des kahlen Kopfes und ein breites Clownslächeln über den Mund gemalt. Hätte George zu einem späteren Zeitpunkt gelebt, hätte er ganz bestimmt als Erstes an Ronald McDonald gedacht und nicht an Bozo oder Clarabell.
In einer Hand hielt er eine Traube bunter Luftballons wie prächtiges reifes Obst.
In der anderen Hand hatte er Georges Zeitungsboot.
»Möchtest du dein Boot wiederhaben, Georgie?«, fragte der Clown und lächelte.
George erwiderte das Lächeln. Er konnte einfach nicht anders; es war unwiderstehlich. »Ja gern«, rief er.
Der Clown lachte. »›Ja gern‹. Das ist gut! Das ist sehr gut! Und wie wär’s mit einem Ballon?«
»Na ja … das wär schon toll.« Er streckte die Hand aus, zog sie aber widerwillig wieder zurück. »Ich soll aber von Fremden nichts annehmen«, erklärte er. »Das sagt mein Dad immer.«
»Sehr vernünftig«, lobte der Clown im Gully lächelnd. Wie konnte ich nur glauben, dass seine Augen gelb sind?, fragte sich George. Sie waren strahlend blau wie Mutters Augen … und Bills. »Wirklich sehr vernünftig. Ich stelle mich also vor: Bob Gray, auch bekannt als Pennywise, der tanzende Clown. Und du bist George Denbrough. So, jetzt kennen wir einander. Ich bin für dich kein Fremder mehr, und du bist für mich kein Fremder mehr. Stimmt’s, oder hab ich recht?«
George kicherte. »Ich glaube schon.« Er streckte wieder die Hand aus … und zog sie wieder zurück. »Wie bist du denn da runtergekommen?«
»Der Sturm hat mich einfach weggeblaaaaasen«, sagte Pennywise, der tanzende Clown. »Er hat den ganzen Zirkus weggeblasen. Kannst du den Zirkus riechen, Georgie?«
Georgie beugte sich vor. Plötzlich konnte er Erdnüsse riechen! Heiße geröstete Erdnüsse! Und Mayonnaise. Die aus der Tube, die man auf seine Pommes drücken konnte! Er konnte Zuckerwatte und frisch gebackene Krapfen riechen und ganz schwach den beißenden Geruch der Scheiße wilder Tiere. Er roch den angenehmen Duft von Sägemehl. Und doch …
Und doch lag unter alledem der Geruch verfaulender Blätter und dunkler Abwasserkanalschatten. Der Geruch war feucht und faulig. Der Kellergeruch.
Aber die anderen Gerüche waren stärker.
»Jede Wette, dass ich ihn riechen kann«, sagte er.
»Möchtest du dein Boot, Georgie?«, fragte Pennywise. »Ich wiederhole mich nur, weil du gar nicht so scharf darauf zu sein scheinst.« Er hielt es lächelnd hoch. Er trug einen weiten Seidenanzug mit großen, orangefarbenen Knöpfen. Und eine helle, leuchtend blaue Krawatte flatterte an ihm herunter; an den Händen hatte er große weiße Handschuhe, wie sie Micky Maus und Donald Duck immer trugen.
»Na klar«, sagte George und blickte in den Gully hinab.
»Willst du auch einen Ballon? Ich habe rote und grüne und gelbe und blaue …«
»Können sie fliegen?«
»Ob sie fliegen können?« Das Lächeln des Clowns wurde noch breiter. »O ja, sie können fliegen, und wie sie fliegen können! Und es gibt Zuckerwatte …«
George streckte seinen Arm aus.
Der Clown packte ihn am Arm.
Und George sah, wie das Gesicht des Clowns sich veränderte.
Was er dann sah, war so fürchterlich, dass seine schlimmsten Fantasievorstellungen von dem Ding im Keller dagegen nur süße Träume waren; was er sah, brachte ihn schlagartig um den Verstand.
»Sie fliegen«, kreischte das Etwas im Gully mit kichernder Stimme. Es hielt Georges Arm fest, und George wurde in Richtung jener schrecklichen Dunkelheit gezogen, wo das Wasser schäumte und toste und heulte, während es seine Fracht aus Sturmunrat in Richtung Meer beförderte. George verdrehte den Hals, drehte das Gesicht weg von dieser endgültigen Schwärze und begann, panisch in den Regen, in den weißen Himmel emporzubrüllen, der sich an diesem Herbsttag 1957 über Derry erstreckte. Seine Schreie waren schrill und ohrenbetäubend, und überall auf der Witcham Road stürzten die Leute ans Fenster oder auf ihre Veranden.
»Sie fliegen, Georgie, und du wirst hier unten mit mir fliegen, wir werden zusammen fliegen …«
Georges Schulter prallte gegen den zementierten Bordstein, und Dave Gardener, der an diesem Tag wegen der Überschwemmung nicht zur Arbeit in The Shoeboat gegangen war, sah nur einen kleinen Jungen in gelbem Regenmantel, der schreiend und zuckend im Rinnstein lag; das schmutzige Wasser rann ihm über das Gesicht und ließ seine Schreie wie ein Gurgeln klingen.
»Alles hier unten fliegt«, flüsterte die kichernde, böse Stimme, und plötzlich war da ein Geräusch, als würde etwas reißen, und ein rasender Schmerz – und dann schwanden George Denbrough die Sinne.
Dave Gardener war als Erster dort, aber obwohl seit dem ersten gellenden Schrei nur fünfundvierzig Sekunden verstrichen waren, war George Denbrough schon tot. Gardener packte ihn hinten am Regenmantel und zog ihn auf die Straße, drehte ihn um … und dann begann er selbst laut zu schreien. Die linke Seite von Georgies gelbem Regenmantel war jetzt grellrot. Blut floss aus dem zerfledderten Loch, wo der linke Arm gewesen war, die Witcham Road hinab. Ein fürchterlich helles Knochenstück ragte an der Schulter zwischen den zerrissenen blutigen Fetzen des Regenmantels hervor.
Die leblosen Augen des kleinen Jungen starrten in den weißen Himmel, und während Dave auf die anderen Menschen zutaumelte, die jetzt angerannt kamen, sammelte sich Regen darin.
4
Irgendwo in der Tiefe der Kanalisation, deren Fassungsvermögen fast erschöpft war (niemand hätte sich dort unten aufhalten können, erklärte später der zuständige Sheriff einem Reporter der Derry News mit einer solchen Frustration und Wut, dass sie schon an Schmerz grenzte; selbst Herkules in höchsteigener Person wäre von der heftigen Strömung mitgerissen worden), raste Georges Boot aus Zeitungspapier durch dunkle Gewölbe und Betonkanäle, in denen das Wasser toste. Eine Zeit lang schwamm es neben einem toten Küken dahin, dessen gelbliche, reptilienartige Krallen zur tropfenden Decke hin zeigten; dann, an einer Gabelung östlich der Stadt, wurde das Küken nach links geschwemmt, während Georges Boot weiter geradeaus trieb.
Eine Stunde später, als Georges Mutter in der Notaufnahme des Derry Home Hospital eine Beruhigungsspritze bekam, als Stotter-Bill leichenblass und wie betäubt in seinem Bett saß und seinen Vater im Wohnzimmer heiser schluchzen hörte, wo seine Mutter Für Elise gespielt hatte, als George nach draußen gegangen war, schoss das Boot aus einem Betonrohr hervor und raste mit hoher Geschwindigkeit einen namenlosen Bach hinab. Als es zwanzig Minuten später in den tosenden, angeschwollenen Penobscot River überging, zeigten sich am Himmel die ersten blauen Streifen. Der Sturm war vorüber.
Das Boot schwankte und neigte sich zur Seite, und ab und zu schwappte Wasser hinein, aber es sank nicht; die beiden Brüder hatten es wirklich ausgezeichnet abgedichtet. Ich weiß nicht, wo es schließlich strandete; vielleicht strandete es auch überhaupt nicht; vielleicht erreichte es das Meer wie ein Zauberboot im Märchen und segelt heute noch. Mit Sicherheit kann ich nur sagen, dass es noch auf den Wellen tanzte, als es die Stadtgrenze von Derry im Bundesstaat Maine passierte, und dort entschwindet es für immer aus dieser Geschichte.
Kapitel zwei Nach dem Festival (1984)
1
Adrian hatte – so berichtete sein schluchzender Freund später der Polizei – den Hut aufgehabt, weil er ihn in der Wurfbude auf dem Jahrmarktsgelände im Bassey Park gewonnen hatte, genau sechs Tage vor seinem Tod, und weil er stolz darauf gewesen war.
»Er trug ihn, weil er diese beschissene kleine Stadt liebte!«, schrie dieser Freund, Don Hagarty, die Polizeibeamten an.
»Na, na – mäßigen Sie Ihre Ausdrucksweise«, sagte Officer Harold Gardener, einer der vier Söhne von Dave Gardener. Als sein Vater den leblosen einarmigen Körper von George Denbrough entdeckt hatte, war Harold fünf Jahre alt gewesen. An diesem Tag nun, knapp siebenundzwanzig Jahre später, war er zweiunddreißig, und seine Haare lichteten sich bereits. Harold Gardener hatte keinen Zweifel an der Echtheit von Don Hagartys Kummer und Schmerz, aber es war ihm dennoch unmöglich, sie ernst zu nehmen. Dieser Mann – wenn man ihn überhaupt einen Mann nennen konnte – trug Lippenstift und Satinhosen, die so eng waren, dass man praktisch sämtliche Runzeln seines Schwanzes sehen konnte. Kummer hin oder her, Schmerz hin oder her – er war schließlich doch nur eine Tunte. Ebenso wie sein Freund, der verstorbene Adrian Mellon.
»Gehen wir alles noch einmal von vorn durch«, sagte Harolds Kollege Jeffrey Reeves. »Sie beide sind also aus dem Falcon gekommen und in Richtung Kanal gegangen. Und was dann?«
»Wie oft soll ich es euch Idioten denn noch erzählen?«, schrie Hagarty. »Sie haben ihn umgebracht! Sie haben ihn in den Kanal geworfen! Ein ganz gewöhnlicher Tag in Macho City!« Don Hagarty begann wieder zu weinen.
»Noch einmal von vorn«, wiederholte Reeves geduldig. »Sie sind aus dem Falcon gekommen. Und was dann?«
2
In einem Zimmer etwas weiter den Korridor entlang verhörten zwei andere Polizeibeamte den siebzehnjährigen Steve Dubay; eine Etage höher im Büro des Gerichtsschreibers wurde John »Webby« Garton, achtzehn Jahre alt, von zwei weiteren Polizeibeamten vernommen; und im Büro des Polizeichefs im fünften Stock beschäftigten sich Chief Andrew Rademacher und Tom Boutillier, der Assistent des Staatsanwalts, mit dem fünfzehnjährigen Christopher Unwin. Unwin, der verblichene Jeans, ein schmutziges T-Shirt und klobige Schnürstiefel trug, weinte vor sich hin. Rademacher und Boutillier hatten sich ihn vorgenommen, weil er – wie sie sofort richtig erkannt hatten – das schwächste Glied in der Kette war.
»Gehen wir alles noch einmal von vorn durch«, sagte Boutillier in diesem Büro genau zur selben Zeit wie Jeffrey Reeves zwei Stockwerke tiefer.
»Wir hatten nicht vor, ihn umzubringen«, plärrte Unwin. »Es war der Hut … Wir konnten einfach nicht glauben, dass er diesen Hut immer noch aufhatte, wissen Sie, nach allem, was Webby ihm beim ersten Mal gesagt hatte. Und wir wollten ihm wohl Angst einjagen.«
»Für das, was er gesagt hat«, unterbrach ihn Chief Rademacher.
»Ja.«
»Zu John Garton, am Nachmittag des siebzehnten.«
»Ja, zu Webby.« Unwin brach wieder in Tränen aus. »Aber wir versuchten, ihn zu retten, als wir sahen, dass er in ernsthaften Schwierigkeiten war … zumindest ich und Stevie Dubay versuchten es … wir hatten nicht die Absicht, ihn umzubringen!«
»Nun komm schon, Chris, verarsch uns nicht«, sagte Boutillier. »Ihr habt die kleine Tunte in den Kanal geworfen.«
»Ja, aber …«
»Und ihr drei seid hergekommen, um ein Geständnis abzulegen. Chief Rademacher und ich wissen das zu schätzen, nicht wahr, Andy?«
»Na klar. Man muss schon ein ganzer Mann sein, um für eine solche Tat einzustehen, Chris.«
»Also reiß dich jetzt nicht mit Lügen in die Scheiße! Ihr habt doch beschlossen, ihn in den Kanal zu werfen, sobald ihr ihn und seinen schwuchteligen Freund aus dem Falcon kommen saht, stimmt’s?«
»Nein!«, protestierte Chris Unwin heftig.
Boutillier holte eine Schachtel Marlboro aus seiner Hemdtasche und schob sich eine Zigarette in den Mund. Dann hielt er Unwin die Packung hin. »Zigarette?«
Unwin nahm eine. Sein Mund zitterte so stark, dass Boutillier lange mit dem Streichholz vor seinem Mund herumfuchteln musste, um sie ihm anzustecken.
»Aber sobald ihr gesehen habt, dass er diesen Hut aufhatte?«, fragte Rademacher.
Unwin zog heftig an der Zigarette, senkte den Kopf, sodass ihm sein fettiges Haar über die Augen fiel, und stieß den Rauch durch die Nase aus, die mit Mitessern übersät war.
»Ja«, flüsterte er kaum hörbar.
Boutillier beugte sich vor. Seine braunen Augen funkelten. Sein Gesicht glich dem eines Raubtiers, aber seine Stimme war sanft und freundlich. »Was, Chris?«
»Ich habe ›ja‹ gesagt. Ich glaub schon, dass wir ihn reinwerfen wollten. Aber wir wollten ihn nicht umbringen.« Er hob den Kopf und sah sie mit angstverzerrtem Gesicht an, offensichtlich noch immer völlig außerstande, die dramatische Veränderung zu begreifen, die sein Leben erfahren hatte, seit er am Vorabend um halb acht von daheim weggegangen war, um mit zwei Freunden den letzten Abend des Kanal-Festivals von Derry zu feiern. »Wir wollten ihn wirklich nicht umbringen!«, wiederholte er. »Und dieser Kerl unter der Brücke … ich weiß immer noch nicht, wer das war.«
»Was war das für ein Kerl?«, fragte Rademacher, doch ohne großes Interesse. Sie hatten auch diesen Teil der Geschichte schon gehört, aber keiner von beiden glaubte daran – Männer, die unter Mordanklage standen, tischten fast immer früher oder später einen mysteriösen Unbekannten auf. Boutillier hatte sogar einen Namen für dieses Phänomen: Er bezeichnete es als »Das Einarmiger-Mann-Syndrom«, nach der alten Fernsehserie Auf der Flucht.
»Der Kerl im Clownskostüm«, sagte Chris Unwin und schauderte. »Der Kerl mit den Ballons.«
3
Das Kanal-Festival vom 15. bis 21. Juli war ein Riesenerfolg; darin stimmten die meisten Einwohner Derrys überein. Es verbesserte die allgemeine Stimmung und das Image der Stadt … und das städtische Bankkonto. Das eine Woche dauernde Festival wurde zum hundertsten Jahrestag der Eröffnung des Kanals abgehalten, der durch die Mitte der Innenstadt führte. Es war der Kanal gewesen, der den Holzhandel in Derry in den Jahren 1884 bis 1910 erst so richtig lukrativ gemacht hatte; es war der Kanal gewesen, der zu Derrys Aufschwung geführt hatte.
Die Stadt wurde von Ost nach West und von Nord nach Süd herausgeputzt. Schlaglöcher, die nach Aussage mancher Einwohner zehn Jahre lang nicht ausgebessert worden waren, wurden sorgfältig mit Teer gefüllt und glatt gewalzt. Die städtischen Gebäude wurden im Innern aufpoliert und außen neu gestrichen. Die schlimmsten Schmierereien im Bassey Park – darunter sehr viele wohldurchdachte und kaltblütige Diskriminierungen von Homosexuellen, wie BRINGTALLESCHWULENUM und AIDSISTDIESTRAFEGOTTES,IHRVERDAMMTENHOMOS! – wurden von den Bänken und von den Holzwänden der schmalen, überdachten Überführung über den Kanal – der sogenannten »Kussbrücke« – entfernt.
Ein Stadtmuseum wurde in drei leer stehenden Ladenlokalen der Innenstadt eingerichtet, und Michael Hanlon, ein ortsansässiger Bibliothekar und Amateurhistoriker, besorgte die Exponate. Die ältesten Familien der Stadt stellten großzügig ihre Schätze zur Verfügung, und im Laufe der Festwoche bezahlten fast 40 000 Besucher bereitwillig einen Vierteldollar, um Speisekarten der Speisehäuser um 1890, Äxte und andere Utensilien der Holzfäller um 1880, Kinderspielzeug aus den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts sowie über 2000 Fotos und neun Filmrollen über das Leben der letzten hundert Jahre in Derry zu sehen.
Das Museum stand unter der Schirmherrschaft des Frauenvereins von Derry, der gegen einige der von Hanlon vorgeschlagenen Exponate (wie den berüchtigten »Landstreicher-Stuhl« aus den Dreißigerjahren) und Fotos (beispielsweise jene von der Bradley-Bande nach der berüchtigten Schießerei) sein Veto einlegte. Aber alle stimmten darin überein, dass es ein großer Erfolg war, und an jenen blutrünstigen alten Geschichten hatte ohnehin niemand Interesse. Es war doch viel besser, das Positive zu betonen und das Negative unter den Teppich zu kehren.
Es gab ein riesiges gestreiftes Bierzelt im Derry Park, und jeden Abend wurde dort Musik gespielt. Im Bassey Park gab es einen Rummelplatz mit Karussells und Buden. Ein Sonderstraßenbahnwagen machte jede volle Stunde eine Rundfahrt durch die historischen Stadtteile und endete bei diesem liebenswerten und einträglichen Vergnügungspark.
Und hier gewann Adrian Mellon jenen Hut, der zu seinem Tod führte – einen Pappzylinder mit Blume und der Aufschrift ICHDERRY auf dem Band.
4
»Ich bin müde«, sagte John »Webby« Garton. Wie seine beiden Freunde, so imitierte auch er in seiner Kleidung unbewusst Bruce Springsteen, obwohl er, wenn man ihn gefragt hätte, Springsteen vermutlich als »Schwuchtel« bezeichnet und sich selbst eher als Fan härterer Gruppen wie Def Leppard, Twisted Sister oder Judas Priest gesehen hätte. Die Ärmel seines blauen T-Shirts waren herausgerissen und enthüllten seine muskulösen Arme. Sein dichtes braunes Haar fiel ihm über ein Auge – nicht in Anlehnung an Springsteen, sondern eher an John Cougar Mellencamp. Er hatte blaue Tätowierungen auf den Armen – geheimnisvolle Symbole, die aussahen wie von einem Kind gemalt. »Ich will nicht mehr reden.«
»Erzähl uns nur noch mal, was am Dienstagnachmittag auf dem Rummelplatz passiert ist«, sagte Paul Hughes. Hughes war müde und empört und angewidert von dieser ganzen schmutzigen Geschichte. Er dachte immer und immer wieder, dass das Kanal-Festival mit einem Finale ausgeklungen war, über das jeder irgendwie Bescheid wusste, welches aber niemand auf das Tagesprogramm zu setzen gewagt hatte, das dann folgendermaßen ausgesehen hätte:
Samstag, 21 Uhr: Letztes Konzert. Ausführende: Derry Highschool-Band und Barber Shop Mello-Men
Samstag, 22 Uhr: Riesenfeuerwerk
Samstag, 22 Uhr 35: Der Ritualmord an Adrian Mellon beendet offiziell das Kanal-Festival.
»Zum Teufel mit dem Rummelplatz!«, erwiderte Webby.
»Wir wollen nur wissen, was du zu ihm gesagt hast und was er zu dir gesagt hat.«
»O Gott!« Webby verdrehte die Augen.
»Nun mach schon, Webby«, sagte Hughes’ Kollege.
Webby Garton rollte mit den Augen und fing noch einmal von vorn an.
5
Garton sah die beiden, Mellon und Hagarty, dahinschlendern. Sie hatten einander die Arme um die Taillen gelegt und kicherten wie zwei junge Mädchen. Zuerst dachte Garton, es wären Mädchen. Dann erkannte er Mellon, über den er schon Bescheid wusste. Gerade als er hinschaute, wandte Mellon sein Gesicht Hagarty zu … und sie küssten sich flüchtig.
»O Mann, ich muss gleich reihern!«, rief Webby angewidert.
Chris Unwin und Steve Dubay waren bei ihm. Als Webby sie auf Mellon aufmerksam machte, sagte Steve, er glaube, der andere Schwule sei Don Sowieso; er habe gehört, dass der Kerl einmal einen trampenden Jungen von der Highschool in seinem Auto mitgenommen und dann versucht hätte, sich an ihn ranzumachen.
Mellon und Hagarty kamen den drei Jungen entgegen; sie waren auf dem Weg von der Wurfbude zum Ausgang des Rummelplatzes. Webby Garton würde den Polizeibeamten Hughes und Conley später erklären, er habe sich in seiner »Bürgerehre« verletzt gefühlt, weil die gottverdammte Tunte einen Hut mit der Aufschrift ICHDERRY getragen habe. Dieser Hut war ein albernes Ding – eine Zylinderimitation aus Pappe, auf der eine große Blume befestigt war, die in alle Richtungen wippte. Die Albernheit des Hutes verletzte Webbys Bürgerehre noch mehr.
Als Mellon und Hagarty, die Arme immer noch umeinandergelegt, an den Jungs vorbeikamen, brüllte Webby Garton plötzlich: »Ich sollte dir deinen Hut ins Maul stopfen, du verdammter Arschficker!«
Mellon drehte sich nach Garton um, klimperte kokett mit den Augen und sagte: »Wenn du mir etwas ins Maul stopfen möchtest, Süßer, kann ich etwas viel Besseres als meinen Hut vorschlagen.«
Daraufhin beschloss Webby Garton, dem Homo die Fresse zu polieren, seiner Visage ein völlig neues Aussehen zu verpassen. In der Geografie von Mellons Gesicht würden Berge entstehen und Kontinente wandern. Niemand durfte ungestraft andeuten, er wäre ein Schwanzlutscher. Niemand.
Er ging drohend auf Mellon zu. Hagarty versuchte beunruhigt, seinen Freund Mellon weiterzuziehen, aber dieser blieb lächelnd stehen. Garton erzählte den Polizeibeamten später, er sei sich ziemlich sicher, dass Mellon von irgendwas ganz schön high gewesen sei. Das stimme, gab Hagarty zu, als die Polizeibeamten Gardener und Reeves ihm diese Frage stellten. Mellon sei high gewesen von zwei gebackenen Honigpfannkuchen, von der Rummelplatzatmosphäre, vom Gewinn des Hutes gleich beim ersten Wurf, vom ganzen Tag. Und deshalb habe er auch überhaupt nicht begriffen, dass Webby Garton eine echte Gefahr darstellte.
»Aber so war Adrian nun einmal«, sagte Don und wischte sich mit einem Papiertuch die Augen ab, wobei er seinen glitzernden Lidschatten verschmierte. »Von Schutz und Tarnung verstand er nichts. Er war einer jener naiven Menschen, die glauben, dass letztlich alles wirklich ein gutes Ende nimmt.«
Vermutlich wäre Mellon schon zu diesem Zeitpunkt schwer verletzt worden, wenn Garton nicht plötzlich eine leichte Berührung am Ellbogen gespürt hätte. Es war ein Polizeiknüppel. Er drehte sich um und sah Officer Frank Machen, auch einer von Derrys Besten.
»Immer mit der Ruhe, Kleiner«, sagte Machen zu Garton. »Lass diese Homos in Ruhe und kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Mach dir hier auf dem Rummelplatz ein paar schöne Stunden.«
»Haben Sie gehört, wie er mich genannt hat?«, fragte Garton hitzig. Unwin und Dubay sahen Ärger voraus und versuchten, ihn zum Weitergehen zu bewegen, aber er schüttelte sie wütend ab, und sie begriffen, dass sie seine Fäuste zu spüren bekommen würden, wenn sie ihn nicht in Ruhe ließen. Seine Männlichkeit war beleidigt worden, und das schrie nach Rache. Niemand durfte ihn ungestraft einen Schwanzlutscher nennen. Niemand.
»Ich glaube nicht, dass er dich irgendwas genannt hat«, erwiderte Machen. »Und außerdem hast du ihn, wenn ich mich nicht irre, zuerst angequatscht. Und jetzt mach, dass du weiterkommst, Junge. Ich habe keine Lust, es noch einmal zu wiederholen.«
»Er hat mich einen Schwulen genannt!«
»Na und – hast du Angst, du könntest wirklich einer sein?«, fragte Machen, scheinbar aufrichtig interessiert, und Garton bekam vor Wut einen hochroten Kopf.
Während dieses Wortwechsels versuchte Hagarty verzweifelt, Adrian Mellon vom Schauplatz des Geschehens wegzuziehen. Endlich bewegte sich Mellon von der Stelle.
»Wiedersehn, Süßer!«, rief er keck über die Schulter.
»Halt die Klappe, Zuckerarsch«, sagte Machen. »Verschwinde von hier.«
Garton wollte sich auf Mellon stürzen, aber Machen hielt ihn fest.
»Ich kann dich einlochen, mein Freund«, sagte er. »Und so, wie du dich hier aufführst, wäre das vielleicht gar keine schlechte Idee.«
»Wenn ich dich das nächste Mal sehe, geht’s dir an den Kragen!«, brüllte Garton dem sich entfernenden Paar nach, und Köpfe drehten sich verwundert um und starrten ihn an. »Und wenn du dann wieder diesen Hut aufhast, bring ich dich um! Diese Stadt braucht keine Tunten wie dich!«
Ohne sich umzudrehen, winkte Mellon mit den Fingern seiner linken Hand – die Nägel waren kirschrot lackiert – und wackelte beim Gehen besonders mit den Hüften. Garton versuchte wieder, ihm nachzustürzen.
»Noch ein Wort oder eine Bewegung, und ich sperr dich ein«, sagte Machen ruhig. »Verlass dich drauf, mein Freund. Ich meine, was ich sage.«
»Nun komm schon, Webby!«, rief Chris Unwin unbehaglich. »Beruhige dich.«
»Mögen Sie etwa solche Kerle?«, fragte Webby den Polizisten und ignorierte Chris und Steve vollständig. »Hä?«
»Was die Hinterlader angeht, so bin ich neutral«, erwiderte Machen. »Woran mir wirklich was liegt, ist Ruhe und Ordnung, und du verstößt gegen das, was ich mag, Pizzagesicht. Willst du dich jetzt etwa mit mir anlegen, oder was ist?«
»Komm endlich, Webby«, sagte Steve Dubay ruhig. »Holen wir uns lieber ein paar Hotdogs.«
Webby zog mit übertriebenem Kraftaufwand sein Hemd zurecht, strich sich die Haare aus der Stirn und entfernte sich. Machen, der am Morgen nach Adrian Mellons Tod ebenfalls eine Aussage machte, erklärte: Als er mit seinen Freunden endlich abzog, hörte ich ihn sagen: »Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, wird’s ihm ordentlich an den Kragen gehen!«
6
»Bitte, ich muss noch einmal mit meiner Mutter reden«, sagte Steve Dubay zum dritten Mal. »Ich muss sie dazu bringen, dass sie meinen Stiefvater beruhigt, sonst ist die Hölle los, wenn ich heimkomme.«
»Bald kannst du anrufen«, erklärte Officer Charles Avarino. Er wusste genauso gut wie sein Kollege Barney Morrison, dass Steve Dubay zumindest in dieser Nacht – vermutlich auch in vielen folgenden Nächten – nicht nach Hause gehen konnte. Dem Jungen schien noch immer nicht klar zu sein, in welchen Schwierigkeiten er steckte, und Avarino war keineswegs überrascht, als er später erfuhr, dass Dubay mit sechzehn Jahren die Schule verlassen hatte. Zu dieser Zeit war er immer noch auf der Water Street Junior Highschool gewesen. Er hatte einen IQ von 68, wie bei einem Test festgestellt worden war, als er zum dritten Mal die siebte Klasse besuchte.
»Erzähl uns vorher, was passiert ist, als ihr gesehen habt, wie Mellon aus dem Falcon kam«, forderte Morrison ihn auf.
»Nein, lieber nicht.«
»Und warum nicht?«, fragte Avarino.
»Ich hab vermutlich ohnehin schon zu viel gequatscht.«
»Dazu bist du doch hergekommen«, sagte Avarino. »Oder etwa nicht?«
»Na ja … doch … aber …«
»Hör zu«, erklärte Morrison freundlich, setzte sich neben Dubay und gab ihm eine Zigarette. »Glaubst du, dass ich und Chick Schwule mögen?«
»Ich weiß nicht …«
»Sehen wir etwa so aus, als würden wir Schwule mögen?«
»Nein, aber …«
»Wir sind deine Freunde, Steve«, sagte Morrison feierlich. »Glaub mir, du und Chris und Webby, ihr braucht jetzt dringend alle Freunde, die ihr nur kriegen könnt. Morgen wird nämlich jeder in der Stadt eure Köpfe fordern.«
Steve Dubays Gesicht nahm einen leicht beunruhigten Ausdruck an. Avarino, der die Gedanken dieses feigen Schwachkopfs fast lesen konnte, ahnte, dass er wieder an seinen Stiefvater dachte. Und obwohl Avarino alles andere als ein Freund von Derrys kleiner Homo-Gemeinde war – wie jedem anderen Polizeibeamten dieser Stadt, so wäre es auch ihm am liebsten gewesen, wenn das Falcon für immer geschlossen worden wäre –, hätte er doch liebend gern Dubay heimgefahren und ihm höchstpersönlich die Arme festgehalten, während Dubays Stiefvater ihn grün und blau schlug. Avarino mochte Schwule nicht, aber das bedeutete noch lange nicht, dass er der Meinung war, man sollte sie quälen und umbringen. Mellon war einem brutalen Mord zum Opfer gefallen. Als man ihn unter der Kanalbrücke hervorgeholt hatte, stand in seinen glasigen Augen ein Ausdruck grenzenlosen Entsetzens. Und dieser Bursche hier hatte absolut keine Ahnung, wozu er Beihilfe geleistet hatte.
»Wir wollten ihm nichts tun«, wiederholte Steve. Dieser Floskel bediente er sich jedes Mal, sobald er etwas verwirrt oder beunruhigt war.
»Genau deshalb solltest du uns reinen Wein einschenken«, sagte Avarino eifrig. »Erzähl uns die ganze Wahrheit, dann wird die Sache vielleicht nur halb so schlimm ausgehen. Hab ich recht, Barney?«
»Na klar doch«, stimmte Morrison mit Nachdruck zu.
»Also noch einmal, wie war das?«, redete Avarino freundschaftlich auf Steve ein.
»Na ja …«, murmelte Steve und begann langsam zu erzählen.
7
Als das Falcon im Jahre 1973 eröffnet wurde, dachte Elmer Curtie, dass seine Kundschaft hauptsächlich aus Leuten bestehen würde, die mit dem Bus unterwegs waren – der Busbahnhof war gleich nebenan und wurde von drei Linien angesteuert: Trailways, Greyhound und Aroostook County. Er hatte allerdings nicht bedacht, dass ein hoher Prozentsatz der Busreisenden aus Frauen oder Familien mit kleinen Kindern bestand. Von den anderen führten viele ihre Flaschen in braunen Tüten mit sich und stiegen überhaupt nie aus dem Bus aus. Und jene, die ausstiegen – meistens Soldaten oder Seeleute –, wollten auch nur auf die Schnelle ein oder zwei Bier trinken – zu mehr war bei einem Zwischenaufenthalt von zehn Minuten auch gar keine Zeit.
Als Curtie dies Anfang 1977 endlich erkannte, war es schon zu spät: Er steckte bis zum Hals in Schulden, und er sah auch keine Möglichkeit, aus den roten Zahlen wieder herauszukommen. In seiner Verzweiflung dachte er sogar daran, das Falcon niederzubrennen, um die Versicherungssumme zu kassieren, aber er befürchtete, geschnappt zu werden, wenn er nicht einen Profi dazu anheuerte … und er hatte keine Ahnung, wo man einen professionellen Brandstifter auftreiben konnte.
Im Februar jenes Jahres beschloss er, noch bis zum 4. Juli durchzuhalten. Wenn die Lage sich bis dahin nicht gebessert haben würde, wollte er einfach nebenan einen Greyhound besteigen und sehen, wie es unten in Florida bestellt war.
Aber in den folgenden fünf Monaten begann zu seiner großen Überraschung der geschäftliche Aufschwung der Bar, die im Innern schwarz und goldfarben gestrichen und mit ausgestopften Vögeln dekoriert war (Elmer Curties Bruder hatte als Hobby Tiere – und speziell Vögel – ausgestopft, und nach seinem Tod hatte Elmer das ganze Zeug geerbt). Anstatt wie bisher pro Nacht etwa sechzig Biere zu zapfen und höchstens zwanzig Drinks einzuschenken, kam Elmer nun auf achtzig Biere und hundert Drinks … auf hundertzwanzig … manchmal sogar auf hundertsechzig.
Seine Kundschaft war jung, höflich und fast ausschließlich männlich. Viele kleideten sich auffallend, aber in jenen Jahren gehörte auffallende Kleidung noch fast zur Norm, und Elmer Curtie begriff erst so gegen 1981, dass die überwältigende Mehrzahl seiner Gäste homosexuell war. Wenn er das den Einwohnern Derrys erklärt hätte, hätten sie gelacht und gesagt, er halte sie wohl für von gestern – aber es stimmte tatsächlich. Wie der betrogene Ehemann, so wusste auch er praktisch erst als Letzter Bescheid … und als er es dann endlich erkannte, war es ihm egal. Die Bar florierte, und obwohl es in Derry noch vier weitere Bars gab, die Gewinne machten, so war das Falcon doch die einzige, die nicht regelmäßig von randalierenden Gästen verwüstet wurde. Zum einen gab es hier keine Kämpfe um Frauen, und außerdem schienen diese homosexuellen Männer irgendwie gelernt zu haben, miteinander auszukommen, was ihre heterosexuellen Geschlechtsgenossen nicht fertigbrachten.
Sobald Curtie die sexuellen Neigungen seiner Stammkunden erst einmal durchschaut hatte, schnappte er überall Gruselgeschichten über das Falcon auf – diese Gerüchte kursierten schon seit Jahren, aber bis 1981 hatte Curtie sie einfach nicht gehört. Er stellte fest, dass diese Gruselmärchen am begierigsten von Männern erzählt wurden, die keine zehn Pferde in die Bar bringen könnten, aus Angst, dass ihnen dort alle Armmuskeln verdorren würden oder so was Ähnliches. Aber sie schienen über sämtliche dunklen Vergnügungen bestens informiert zu sein.
Den Gerüchten zufolge konnte man dort jede Nacht Männer eng aneinandergeschmiegt tanzen und direkt auf dem Tanzboden ihre Schwänze aneinanderreihen sehen; man konnte Männer sehen, die sich an der Bar leidenschaftlich küssten und sich gegenseitig in den Toiletten einen bliesen. Und angeblich sollte es auch ein Hinterzimmer geben, wohin man gehen konnte, wenn man masochistische Gelüste hatte – dort sollte sich ein großer alter Kerl in Naziuniform aufhalten, dessen Arm fast bis zum Schultergelenk eingeölt war und der überglücklich war, jemandem eine entsprechende Behandlung angedeihen zu lassen.
In Wirklichkeit stimmte nichts von alldem. Wenn durstige Reisende vom Busbahnhof auf ein Bier oder einen Highball hereinkamen, fiel ihnen im Falcon überhaupt nichts Ungewöhnliches auf – sicher, es waren sehr viele Männer anwesend, aber das war in Tausenden von Arbeiterkneipen und Bars im ganzen Lande nicht anders. Die Stammgäste waren homosexuell, aber das war kein Synonym für dumm. Wenn sie Lust auf kleinere Ausschweifungen verspürten, fuhren sie nach Portland. Wenn sie Lust auf ausgefallene Ausschweifungen verspürten, fuhren sie nach Boston oder New York. Aber Derry war klein, Derry war provinziell, und Derrys kleine Gemeinschaft von Homosexuellen wusste genau, dass sie ständig von Adleraugen beobachtet und beschattet wurde.
Don Hagarty war schon seit zwei oder drei Jahren Stammgast im Falcon, als er sich eines Abends im März 1984 erstmals mit Adrian Mellon dort sehen ließ. Bis dahin hatte Hagarty eher Abwechslung gesucht und war seltener als ein halbes Dutzend Mal mit demselben Partner aufgetaucht. Aber Ende April war es sogar Elmer Curtie, der sich sehr wenig um solche Dinge scherte, klar, dass Hagarty und Mellon fest miteinander befreundet waren.
Hagarty war technischer Zeichner in einem Ingenieurbüro in Bangor. Adrian Mellon war freischaffender Schriftsteller, der überall, wo es nur möglich war, veröffentlichte – in Fluglinien-Zeitschriften, Sexmagazinen, Zeitschriften mit »Bekenntnissen«, in regionalen Zeitungen und Sonntagsbeilagen. Er arbeitete an einem Roman, aber vermutlich nicht allzu ernsthaft – er arbeitete schon seit seinem dritten College-Jahr daran, und das war immerhin schon zwölf Jahre her.
Er war nach Derry gekommen, um einen Artikel über den Kanal zu schreiben – auf Bestellung der New England Byways, einer in Concord zweimal im Monat erscheinenden Zeitschrift. Adrian Mellon hatte diesen Auftrag übernommen, weil Byways ihm sämtliche Spesen – einschließlich eines hübschen Zimmers im Derry Town House – für drei Wochen genehmigte, er aber das gesamte benötigte Material in höchstens fünf Tagen beschaffen konnte. In der übrigen Zeit konnte er genügend Material für vier weitere Artikel sammeln.
Doch während dieser drei Wochen lernte er Don Hagarty kennen, und anstatt danach nach Portland zurückzukehren, suchte er sich ein kleines Apartment in der Kossuth Lane. Er wohnte dort aber nur sechs Wochen. Dann zog er bei seinem Freund Don Hagarty ein.
8
Dieser Sommer – so erzählte Hagarty Harold Gardener und Jeff Reeves – war der glücklichste seines Lebens gewesen; er hätte auf der Hut sein sollen, sagte er; er hätte wissen müssen, dass Gott Menschen wie ihm einen Teppich nur unter die Füße lege, um ihn dann wieder wegreißen zu können.
Der einzige Schatten, so sagte er, war Adrians ungewöhnliche Vorliebe für Derry. Er hatte ein T-Shirt mit der Aufschrift: MAINEISTNICHTÜBEL,ABERDERRYISTEINFACHSPITZE! Er besaß eine Derry-Tigers-Highschool-Jacke. Und dann war da natürlich noch der Hut. Adrian behauptete, die Atmosphäre dieser Stadt wirke auf ihn belebend und schöpferisch anregend. Vielleicht war diese Behauptung nicht ganz aus der Luft gegriffen, denn er hatte zum ersten Mal seit fast einem Jahr seinen dahinsiechenden Roman aus dem Koffer hervorgeholt.
»Arbeitete er wirklich daran?«, fragte Gardener, nicht weil es ihn wirklich interessierte, sondern weil er wollte, dass Hagarty bereitwillig weitererzählte.
»Ja – er schrieb Seite um Seite. Er sagte, es würde vielleicht ein schrecklicher Roman sein, aber jedenfalls würde es kein schrecklicher unvollendeter Roman bleiben. Er wollte ihn bis zu seinem Geburtstag im Oktober abschließen. Natürlich wusste er nicht, wie Derry wirklich ist. Er glaubte es zu wissen, aber er ist nicht lange genug hier gewesen, um auch nur eine Ahnung vom echten Derry zu bekommen. Ich habe versucht, ihn aufzuklären, aber er wollte nicht zuhören.«
»Und wie ist Derry in Wirklichkeit?«, fragte Reeves.
»Es gleicht einer toten Hure, aus deren Fotze Würmer rauskriechen«, sagte Don Hagarty.
Die beiden Polizeibeamten starrten ihn in fassungslosem Schweigen an.
»Es ist ein schlechter Ort«, fuhr Hagarty fort. »Es ist eine einzige Kloake. Wollen Sie etwa sagen, dass Sie das nicht wissen? Sie haben Ihr ganzes Leben hier verbracht, und Sie wissen das nicht?«
Keiner von beiden antwortete. Nach kurzem Schweigen fuhr Hagarty in seinem Bericht fort.
9
Bevor Adrian Mellon in sein Leben getreten war, hatte Don vorgehabt, Derry zu verlassen. Er wohnte dort seit drei Jahren, hauptsächlich weil er einen längerfristigen Mietvertrag für ein Apartment mit fantastischer Aussicht auf den Fluss unterschrieben hatte. Aber nun war der Vertrag fast abgelaufen, und darüber war Don sehr froh. Kein langes Hin-und-her-Pendeln nach Bangor mehr. Keine bad vibrations





























