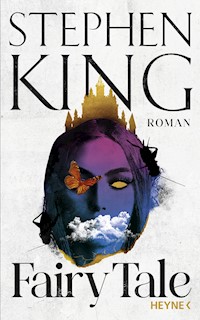
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der siebzehnjährige Charlie Reade hat kein leichtes Leben. Seine Mutter starb, als er sieben war, und sein Vater ist dem Alkohol verfallen. Eines Tages offenbart ihm der von allen gemiedene mysteriöse Nachbar auf dem Sterbebett ein Geheimnis, das Charlie schließlich auf eine abenteuerliche Reise in eine andere, fremde Welt führt. Dort treiben mächtige Kreaturen ihr Unwesen. Die unterdrückten Einwohner sehen in Charlie ihren Retter. Aber dazu muss er erst die Prinzessin, die rechtmäßige Gebieterin des fantastischen Märchenreichs, von ihrem grausamen Leiden befreien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1129
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
Der siebzehnjährige Charlie Reade hat kein leichtes Leben. Seine Mutter starb, als er sieben war, und sein Vater ist dem Alkohol verfallen. Eines Tages offenbart ihm der von allen gemiedene mysteriöse Nachbar auf dem Sterbebett ein Geheimnis, das Charlie schließlich auf eine abenteuerliche Reise in eine andere, fremde Welt führt. Dort treiben mächtige Kreaturen ihr Unwesen. Die unterdrückten Einwohner sehen in Charlie ihren Retter. Aber dazu muss er erst die Prinzessin, die rechtmäßige Gebieterin des fantastischen Märchenreichs, von ihrem grausamen Leiden befreien.
Der Autor
Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, ist einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. Bislang haben sich seine Bücher weltweit über 400 Millionen Mal in mehr als 50 Sprachen verkauft. Für sein Werk bekam er zahlreiche Preise, darunter 2003 den Sonderpreis der National Book Foundation für sein Lebenswerk. 2015 ehrte Präsident Barack Obama ihn zudem mit der National Medal of Arts. 2018 erhielt er den PEN America Literary Service Award für sein Wirken, gegen jedwede Art von Unterdrückung aufzubegehren und die hohen Werte der Humanität zu verteidigen.
Seine Werke erscheinen im Heyne-Verlag, zuletzt der Spiegel-Bestseller Billy Summers (Platz eins auf der Bestsellerliste).
STEPHEN KING
Fairy Tale
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Bernhard Kleinschmidt
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
FAIRYTALE
bei Scribner, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 by Stephen King
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Lothar Strüh
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung von Motiven von © shutterstock.com(Ironika, MarkOfShell, Eric Isselee, cynoclub,Marina Sun, Butterfly Hunter, dwph)
Herstellung: Mariam En Nazer
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-29548-6V006
Zum Gedenken an REH, ERB und natürlich HPL
»Halte das Gewissen rein, wo du auch bist.«
BLAUE FEE
Kapitel eins
Die verfluchte Brücke. Das Wunder. Das Geheul.
1
Ich bin mir sicher, dass ich diese Geschichte erzählen kann. Sicher bin ich mir allerdings auch, dass niemand sie glauben wird. Das macht nichts. Es reicht mir, sie zu erzählen. Das Problem – das bestimmt viele Schriftsteller haben, nicht nur Frischlinge wie ich – ist nur: Wo anfangen?
Zuerst habe ich an den Schuppen gedacht, weil meine Abenteuer da richtig angefangen haben, aber dann wurde mir klar, dass ich zuerst von Mr. Bowditch erzählen muss und davon, wie wir uns angefreundet haben. Allerdings wäre es ohne das Wunder, das meinem Vater widerfahren ist, nie dazu gekommen. Ein sehr gewöhnliches Wunder, könnte man sagen, eines, das seit 1935 viele Tausend Männer und Frauen erlebt haben, aber als Kind kam es mir wie ein einzigartiges Wunder vor.
Nur ist das auch nicht der richtige Startpunkt, weil mein Vater ohne die verfluchte Brücke wohl kein Wunder gebraucht hätte. Deshalb muss ich dort anfangen, bei der verfluchten Sycamore Street Bridge. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, sehe ich deutlich einen roten Faden, der durch die Jahre zu Mr. Bowditch und dem mit einem Vorhängeschloss gesicherten Schuppen hinter seiner maroden viktorianischen Villa führt.
Ein Faden aber ist leicht zu zerreißen. Also ist es kein Faden, sondern eine Kette. Eine starke. Und ich war der Junge mit der Fessel ums Handgelenk.
2
Der Little Rumple River fließt durch das Nordende von Sentry’s Rest (für Einheimische einfach nur Sentry), und bis 1996, dem Jahr meiner Geburt, wurde er von einer Holzbrücke überspannt. Das war das Jahr, in dem die Inspektoren von der staatlichen Straßenbaubehörde sie begutachtet und für baufällig befunden haben. Die Leute in unserem Teil von Sentry hätten das schon seit 1982 gewusst, meinte mein Vater. Offiziell war die Brücke für ein Gewicht von viereinhalb Tonnen zugelassen, aber wenn die Einheimischen mit einem voll beladenen Pick-up unterwegs waren, mieden sie sie im Normalfall und nahmen stattdessen die Schnellstraße, was ein ebenso nerviger wie zeitraubender Umweg war. Mein Dad sagte, selbst in einem Pkw habe man spüren können, wie die Bohlen unter den Rädern zitterten, bebten und rumpelten. Das Ding war gefährlich, da hatten die Inspektoren durchaus recht, aber genau das ist die Ironie des Schicksals. Wenn man die alte Holzbrücke nämlich nicht durch eine aus Stahl ersetzt hätte, wäre meine Mutter womöglich noch am Leben.
Der Little Rumple River ist tatsächlich klein, weshalb der Bau der neuen Brücke nicht lange dauerte. Nachdem man die hölzerne Struktur abgebrochen hatte, wurde das neue Bauwerk schon im April 1997 für den Verkehr freigegeben.
»Der Bürgermeister hat ein Band durchgeschnitten, Pfarrer Coughlin hat das verfluchte Ding gesegnet, und das war’s«, sagte mein Vater eines Abends. Damals war er ziemlich betrunken. »Für uns war das kein großer Segen, Charlie, was?«
Nach einem Lokalhelden, der in Vietnam gestorben war, erhielt das Ding den Namen Frank Ellsworth Bridge, aber die Einheimischen sprachen einfach nur von der Sycamore Street Bridge. Die Sycamore Street war auf beiden Seiten davon sauber und glatt asphaltiert, aber die Oberfläche der Brücke – zweiundvierzig Meter lang – bestand aus einem stählernen Gitterrost, der summte, wenn Personenwagen darüberfuhren, und rumpelte, wenn Lastwagen ihn überquerten. Die durften das jetzt, weil die Brücke nun für fünfundzwanzig Tonnen ausgelegt war. Nicht stabil genug für einen voll beladenen Sattelzug, aber Fernfahrer nutzten die Sycamore Street ohnehin nie.
Im Stadtrat diskutierte man jedes Jahr darüber, ob man die Oberfläche asphaltieren und wenigstens einen Gehweg abtrennen sollte, aber es hatte jedes Jahr den Anschein, an anderen Stellen würde das Geld dringender gebraucht. Ich glaube nicht, dass ein Gehweg meine Mutter gerettet hätte, eine Asphaltierung aber vielleicht schon. Sicher kann man das allerdings nicht wissen, nicht wahr?
Diese verfluchte Brücke.
3
Wir wohnten auf halber Höhe vom langen Sycamore Street Hill, etwa eine Viertelmeile von der Brücke entfernt. Auf der anderen Seite des Flusses war ein kleiner Laden mit Tankstelle, der sich Zip Mart nannte. Dort bekam man alle üblichen Sachen, von Motoröl über Wonder Bread bis hin zu Törtchen Marke Little Debbie, aber auch Brathähnchen, persönlich zubereitet von Mr. Eliades, dem Ladenbesitzer (in der Nachbarschaft als Mr. Zippy bekannt). Die Hähnchen waren genau das, was das Schild im Fenster behauptete: DIEBESTENIMLAND. Ich erinnere mich noch, wie lecker sie waren, aber nach dem Tod meiner Mutter habe ich nie wieder einen Bissen davon gegessen. Hätte ich es versucht, so hätte ich ihn gleich wieder rausgewürgt.
An einem Samstag im November 2003 – der Stadtrat diskutierte immer noch darüber, ob man die Brücke asphaltieren solle, und war immer noch der Meinung, damit könne man ein weiteres Jahr warten – sagte meine Mutter, sie wolle zum Zippy runtergehen, um uns fürs Abendessen Hähnchenteile zu besorgen. Mein Vater und ich sahen uns gerade ein Footballspiel an.
»Du solltest den Wagen nehmen«, sagte mein Vater. »Es ist Regen vorhergesagt.«
»Ich brauche ein bisschen Bewegung«, sagte meine Mutter. »Und außerdem ziehe ich meinen Rotkäppchenmantel über.«
Und den trug sie, als ich sie zum letzten Mal sah. Die Kapuze hatte sie nicht hochgezogen, weil es noch nicht regnete, sodass ihr die Haare über die Schultern fielen. Ich war sieben Jahre alt und fand, dass meine Mutter die schönsten roten Haare auf der Welt hatte. Als sie sah, wie ich sie durchs Fenster hindurch beobachtete, winkte sie. Ich winkte zurück, dann wandte ich die Aufmerksamkeit wieder dem Fernseher zu, wo das Team der Louisiana State University einen Angriff startete. Bekanntlich weiß man im Leben nie, wann die nächste Falltür kommt, oder?
Es war nicht meine Schuld und die von Dad auch nicht, obwohl ich weiß, dass er sich Vorwürfe gemacht hat und dachte: Wenn ich bloß meinen Arsch hochgekriegt und sie zu dem verfluchten Laden gefahren hätte. Wahrscheinlich war es nicht einmal die Schuld des Mannes in dem Klempnerwagen. Die Cops sagten, er sei nüchtern gewesen, und er schwor, dass er sich ans Tempolimit gehalten habe, das in unserem Wohngebiet fünfundzwanzig Meilen betrug. Selbst wenn das stimmte, sagte Dad, hatte der Mann sicher den Blick von der Straße abgewandt, wenn auch nur ein paar Sekunden lang. Damit hatte Dad wohl recht. Er war Schadenregulierer bei einer Versicherung und hat mir einmal erzählt, bei dem einzigen reinrassigen Unfall, von dem er je gehört habe, sei ein Mann in Arizona durch einen Meteoriteneinschlag auf den Kopf ums Leben gekommen.
»Irgendjemand hat immer einen Fehler gemacht«, sagte Dad. »Was nicht dasselbe ist wie die Schuld haben.«
»Gibst du dem Mann, der Mama überfahren hat, denn die Schuld?«, fragte ich.
Darüber dachte er nach. Hob sein Glas an die Lippen und trank. Das war, sechs bis acht Monate nachdem Mama gestorben war, und inzwischen verzichtete er weitgehend auf Bier. Er hielt sich hauptsächlich an Gilbey’s Gin.
»Ich versuch, das nicht zu tun. Meistens schaffe ich das auch. Es sei denn, ich wache nachts um zwei auf, und im Bett liegt niemand außer mir. Dann gebe ich ihm die Schuld.«
4
Mama ging den Hügel hinab. Da, wo der Gehweg endete, stand ein Schild. Sie ging an dem Schild vorbei und überquerte die Brücke. Inzwischen dämmerte es, und es fing an zu nieseln. Sie betrat den Laden, wo Irina Eliades (natürlich als Mrs. Zippy bekannt) ihr erklärte, in drei, höchstens fünf Minuten sei wieder etwas fertig. Irgendwo in der Pine Street, nicht weit von unserem Haus entfernt, hatte der Klempner gerade seinen letzten Auftrag für diesen Samstag erledigt und stellte den Werkzeugkasten auf die Ladefläche seines Kastenwagens.
Die Hähnchenteile kamen aus dem Grill, heiß, knusprig und goldbraun. Mrs. Zippy packte acht Stück in eine Schachtel und schenkte Mama einen Flügel extra für den Heimweg. Mama bedankte sich, zahlte und blieb dann kurz stehen, um einen Blick auf den Zeitschriftenständer zu werfen. Hätte sie das nicht getan, dann hätte sie es eventuell ganz über die Brücke geschafft – wer weiß? Inzwischen bog der Klempnerwagen in die Sycamore Street ein und rollte den langen Hügel hinunter, während Mama sich die neueste Ausgabe von People anschaute.
Sie legte die Zeitschrift zurück, zog die Tür auf und sagte über die Schulter hinweg zu Mrs. Zippy: »Einen schönen Abend noch!« Vielleicht hat sie aufgeschrien, als sie sah, dass sie gleich von einem Wagen überfahren würde, und nur Gott weiß, was sie in dem Moment dachte, aber das waren jedenfalls die letzten Worte, die sie je gesprochen hat. Sie trat hinaus. Nun strömte der Regen kalt und stetig herab, Silberschnüre im Schein der einzigen Straßenlaterne, die auf dieser Seite der Brücke stand.
An ihrem Hähnchenflügel knabbernd, trat meine Mutter auf den stählernen Gitterrost. Scheinwerfer erfassten sie und warfen ihren langen Schatten hinter sie. Der Klempner kam an dem Schild auf der anderen Seite vorüber, auf dem stand: VORSICHT! BEIFROSTGLATTEISGEFAHR! Ob er wohl in den Rückspiegel geblickt hat? Oder sein Handy auf Nachrichten überprüft? Später hat er beides verneint, aber wenn ich über das nachdenke, was meiner Mutter an jenem Abend zugestoßen ist, fällt mir immer der Spruch meines Vaters ein, der einzige reinrassige Unfall, von dem er je gehört habe, sei der mit dem Meteoriteneinschlag auf jemandes Kopf gewesen.
Platz war eigentlich genug, weil die Stahlbrücke ein ganzes Stück breiter als die hölzerne Ausführung war. Das Problem war der Metallrost. Der Klempner sah meine Mutter und trat mitten auf der Brücke auf die Bremse, nicht weil er zu schnell gefahren wäre (behauptete er jedenfalls), sondern rein instinktiv. Auf der stählernen Oberfläche hatte sich Eis gebildet. Der Kastenwagen geriet ins Schlittern und drehte sich langsam seitwärts. Meine Mutter presste sich geduckt ans Geländer und ließ das Hähnchenteil fallen. Der Kastenwagen drehte sich weiter, prallte gegen sie und ließ sie am Geländer entlangwirbeln wie einen Kreisel. Ich will mir nicht vorstellen, welche von ihren Körperteilen bei diesem Todeswirbel abgerissen wurden, aber manchmal kann ich nicht anders. Sicher weiß ich nur, dass die Schnauze des Kastenwagens sie schließlich an eine Strebe auf der dem Zip Mart zugewandten Brückenseite presste. Ein Teil von ihr fiel in den Fluss, das meiste blieb auf der Brücke.
In meinem Geldbeutel steckt ein Bild von uns beiden. Als es aufgenommen wurde, war ich etwa drei Jahre alt. Sie trägt mich auf der Hüfte, eine meiner Hände ist in ihrem Haar vergraben. Sie hatte wunderschöne Haare.
5
War ein Scheißweihnachten in dem Jahr, das kann man mir gern glauben.
Ich erinnere mich an das Beisammensein nach der Beerdigung. Es fand bei uns zu Hause statt. Mein Vater war zuerst da, hat die Leute begrüßt und Beileidsbekundungen entgegengenommen, aber dann war er irgendwie plötzlich weg. Ich fragte seinen Bruder, meinen Onkel Bob, wohin er verschwunden sei. »Er musste sich hinlegen«, sagte Onkel Bob. »Er war echt fix und fertig, Charlie. Wie wär’s, wenn du rausgehst und was spielst?«
Ich hatte noch nie im Leben weniger Lust zum Spielen gehabt, ging aber trotzdem nach draußen. Dabei kam ich an ein paar Erwachsenen vorbei, die zum Rauchen draußen standen, und hörte einen sagen: Armer Kerl, breit wie ’ne Natter. Schon da, als ich tief in Trauer um meine Mutter war, wusste ich, über wen sie sprachen.
Bevor meine Mutter starb, war mein Vater das, was ich als »regelmäßigen Trinker« bezeichnen würde. Ich war noch ein kleiner Junge in der zweiten Klasse, weshalb man diese Einschätzung wohl mit einer gewissen Skepsis betrachten muss, aber ich stehe dazu. Ich hörte ihn nie lallen, er taumelte nicht durch die Gegend, er versackte nicht in Kneipen, und er wurde mir oder meiner Mutter gegenüber nie handgreiflich. Wenn er mit seiner Aktentasche nach Hause kam, mixte Mama ihm einen Drink, normalerweise einen Martini. Sie trank auch einen. Abends beim Fernsehen genehmigte er sich gern ein, zwei Bier. Das war’s.
Nach der Sache mit der verfluchten Brücke änderte sich das alles. Er war nach der Beerdigung breit (wie ’ne Natter) und dann auch an Weihnachten und an Silvester (den Leute wie er als Amateurnacht bezeichneten, wie ich später erfuhr). In den Wochen und Monaten nachdem wir meine Mutter verloren hatten, war er die meiste Zeit besoffen. Hauptsächlich zu Hause. Er ging abends weiterhin nicht in eine Kneipe (»da sind zu viele Arschlöcher wie ich«, hat er einmal gesagt), und er wurde mir gegenüber weiterhin nicht handgreiflich, aber sein Alkoholkonsum war außer Kontrolle. Jetzt weiß ich das alles; damals habe ich es einfach nur hingenommen. Kinder verhalten sich so. Nicht anders als Hunde.
Zuerst musste ich mir das Frühstück nur zweimal die Woche selbst machen, dann viermal und schließlich praktisch immer. Wenn ich morgens in der Küche Buchstabenpops oder Apfelringe von Kellogg’s futterte, hörte ich ihn im Schlafzimmer schnarchen, laut wie ein Außenborder. Manchmal vergaß er das Rasieren, bevor er zur Arbeit fuhr. Nach dem Abendessen (das er zunehmend von irgendwoher mitbrachte) versteckte ich seinen Autoschlüssel. Wenn er eine neue Flasche brauchte, konnte er ja zum Zippy latschen und sich eine holen. Manchmal machte ich mir Sorgen, er könnte auf der verfluchten Brücke einem Wagen begegnen, aber nicht zu sehr. Ich war mir sicher (ziemlich sicher zumindest), dass meine beiden Eltern unmöglich am selben Ort ums Leben kommen konnten. Mein Vater arbeitete ja bei einer Versicherung, und ich wusste, wofür man dort statistische Tabellen verwendete – um die Chancen zu berechnen.
Mein Dad war gut in seinem Beruf, weshalb er trotz Sauferei mehr als drei Jahre lang über die Runden kam. Ob man ihn bei der Arbeit wohl verwarnte? Das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich schon. Ob die Polizei ihn wohl anhielt, weil er Schlangenlinien gefahren war, nachdem er bereits am Nachmittag mit Trinken angefangen hatte? Wenn ja, ließ man ihn vielleicht mit einer Verwarnung davonkommen. Wahrscheinlich sogar, immerhin kannte er alle Polizisten in der Stadt. Mit denen umzugehen gehörte zu seinem Beruf.
In jenen drei Jahren hatte unser Leben einen Rhythmus. Vielleicht keinen guten Rhythmus, also keinen, auf den man gern tanzen würde, aber einen, auf den ich zählen konnte. Gegen drei Uhr nachmittags kam ich nach Hause. Wenn mein Vater gegen fünf eintrudelte, hatte er schon ein paar Gläser intus, was man an seinem Atem roch. (Abends ging er zwar nie auf Kneipentour, aber wie ich später erfuhr, machte er auf der Heimfahrt vom Büro regelmäßig in Duffy’s Tavern kurz Station.) Er brachte eine Pizza, Tacos oder was Chinesisches von Joy Fun mit. An manchen Abenden vergaß er das, woraufhin wir uns etwas bestellten … Genauer gesagt, tat ich das dann. Und nach dem Essen ging’s mit dem Trinken richtig los. Hauptsächlich Gin. Anderes Zeug, wenn kein Gin mehr da war. Manchmal schlief er vor dem Fernseher ein, und manchmal torkelte er ins Schlafzimmer und überließ es mir, seine Schuhe und die zerknitterte Anzugjacke aufzuräumen. Hin und wieder wachte ich nachts auf und hörte ihn weinen. Es ist ziemlich schrecklich, so etwas mitten in der Nacht mitzubekommen.
Zum Absturz kam es dann 2006. Es waren Sommerferien, und ich hatte um zehn Uhr morgens an einem Baseballspiel mitgewirkt, bei dem mir zwei Homeruns und ein fantastischer Catch gelungen waren. Als ich um die Mittagszeit nach Hause kam, fand ich meinen Vater bereits dort vor. Er saß in seinem Sessel und stierte in den Fernseher, wo irgendwelche historischen Filmstars sich auf einer Burgtreppe duellierten. Dad trug lediglich eine Unterhose und schlürfte ein milchiges Getränk, das nach purem Gilbey’s roch. Ich fragte ihn, wieso er schon zu Hause sei.
Ohne den Blick von dem Schwertkampf abzuwenden, und nur mit ganz leicht verwaschener Stimme, sagte er: »Offenbar hab ich meinen Job verloren, Charlie. Beziehungsweise – um Bobcat Goldthwait zu zitieren – weiß ich zwar, wo der ist, aber jetzt macht ihn jemand anderes. Schon bald jedenfalls.«
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber die Worte kamen mir trotzdem aus dem Mund. »Wegen deiner Trinkerei.«
»Damit werde ich aufhören«, sagte er.
Ich zeigte nur auf das Glas. Dann ging ich in mein Zimmer, verriegelte die Tür und heulte los.
Er klopfte an die Tür. »Kann ich reinkommen?«
Ich antwortete nicht. Er sollte mich nicht flennen hören.
»Komm schon, Charlie. Ich hab das Zeug in die Spüle gekippt.«
Als ob ich nicht gewusst hätte, dass die Flasche mit dem Rest auf der Küchentheke stand. Und eine weitere im Schnapsschrank. Oder zwei. Oder drei.
»Komm schon, Charlie, sag doch was.« Schag do wasch. Ich hasste das Lallen.
»Fick dich, Dad.«
So etwas hatte ich noch nie im Leben zu ihm gesagt, und irgendwie wollte ich, dass er reinkommen und mir eins überziehen würde. Oder mich umarmen. Irgendetwas jedenfalls. Stattdessen hörte ich ihn in die Küche schlurfen, wo die Flasche Gilbey’s auf ihn wartete.
Als ich endlich aus meinem Zimmer kam, war er auf dem Sofa eingeschlafen. Der Fernseher war noch an, aber ohne Ton. Es lief ein anderer Schwarz-Weiß-Film, in dem alte Autos in etwas herumrasten, was unübersehbar eine Filmkulisse war. Dad schaltete beim Trinken immer TCM ein, falls ich nicht gerade zu Hause war und auf etwas anderem bestand. Die Flasche stand auf dem Couchtisch und war weitgehend leer. Den Rest goss ich in die Spüle. Dann öffnete ich den Schnapsschrank und überlegte, ob ich auch alles andere wegschütten sollte, aber der Anblick von dem ganzen Gin, dem Whiskey, den Miniaturflaschen Wodka und dem Kaffeelikör machte mich völlig fertig. Man kann sich vielleicht nicht vorstellen, dass ein Zehnjähriger derart fertig sein kann, aber das war ich.
Fürs Abendessen stellte ich ein tiefgekühltes Fertiggericht von Stouffer’s in die Mikrowelle – Grandma’s Chicken Bake, unser Lieblingsmenü – und rüttelte meinen Vater wach, während das Zeug erhitzt wurde. Er setzte sich auf, blickte sich um, als wüsste er nicht, wo er sei, und gab dann fürchterliche Würggeräusche von sich, wie ich sie noch nie gehört hatte. Die Hände auf den Mund gepresst, schwankte er ins Badezimmer, wo ich ihn kotzen hörte. Es kam mir vor, als würde er nie damit aufhören, doch irgendwann war es so weit. Die Mikrowelle klingelte. Ich holte das Gericht mit den Ofenhandschuhen heraus. Auf dem linken stand GOODCOOKIN’ und auf dem rechten GOODEATIN’ – wenn man so Dinger ein einziges Mal vergisst, während man was Heißes aus der Mikro holt, vergisst man sie nie wieder. Nachdem ich etwas auf unsere Teller gelöffelt hatte, ging ich ins Wohnzimmer, wo Dad mit gesenktem Kopf auf dem Sofa saß. Er hatte die Hände hinter dem Nacken verschränkt.
»Kannst du was essen?«
Er hob den Kopf. »Vielleicht. Wenn du mir vorher ein paar Aspirin bringst.«
Im Badezimmer stank es nach Gin und etwas anderem, eventuell einem Bohnen-Dip, aber wenigstens hatte er alles in die Kloschüssel befördert und weggespült. Ich versprühte etwas Lufterfrischer, dann brachte ich Dad das Pillengläschen und ein Glas Wasser. Er nahm drei Aspirin und stellte das Glas da hin, wo die Flasche Gilbey’s gestanden hatte. Dann sah er mich mit einem Ausdruck an, den ich noch nie an ihm gesehen hatte, nicht einmal da, wo Mama gestorben war. Ich spreche es nicht gern aus, aber genau das habe ich damals nun einmal gedacht: Es war der Blick eines Hundes, der auf den Teppich gekackt hat.
»Ich könnte was essen, wenn du mich umarmst.«
Ich umarmte ihn und entschuldigte mich für das, was ich zuvor gesagt hatte.
»Ist schon okay. Irgendwie hab ich’s wohl verdient.«
Wir gingen in die Küche und aßen so viel von Grandma’s Chicken Bake, wie wir schafften, was allerdings nicht viel war. Während er die Teller nahm und den Rest in den Ausguss schabte, erklärte er mir, er werde aufhören zu trinken, was er am Wochenende auch tat. Am Montag, sagte er, werde er sich nach einem neuen Job umsehen, was er wiederum nicht tat. Er blieb zu Hause, sah sich auf TCM alte Filme an, und als ich nach dem Baseballtraining und der mittäglichen Schwimmstunde im YMCA heimkam, war er ziemlich knülle.
Als er sah, wie ich ihn beäugte, schüttelte er nur den Kopf. »Morgen. Morgen. Ich versprech’s hoch und heilig.«
»Wer’s glaubt, wird selig«, sagte ich und verzog mich in mein Zimmer.
6
Das war der schlimmste Sommer meiner Kindheit. Doch nicht etwa schlimmer als der in dem Jahr, wo deine Mutter gestorben ist, könnte man mir jetzt entgegenhalten. Dem würde ich jedoch widersprechen, weil ich jetzt nämlich nur noch meinen Vater hatte, aber auch weil sich alles in Zeitlupe abzuspielen schien.
Er bemühte sich halbherzig, wieder einen Job in der Versicherungsbranche zu finden, aber da wurde nichts draus, selbst wenn er sich rasierte, duschte und anständig anzog. Gewisse Dinge sprachen sich herum.
Rechnungen trudelten ein und stapelten sich auf dem Tischchen im Flur. Ungeöffnet. Von ihm jedenfalls. Ich öffnete sie, wenn der Stapel zu hoch wurde. Dann legte ich sie ihm vor, und er schrieb entsprechende Schecks aus. Ich wusste nicht, wann die Schecks mit dem Stempel FEHLENDEKONTODECKUNG zurückkommen würden, und wollte es auch nicht wissen. Es war, wie auf einer Brücke zu stehen und mir vorzustellen, dass ein außer Kontrolle geratener Kastenwagen auf mich zuschlitterte. Und was ich wohl als Letztes denken würde, bevor ich zu Tode gequetscht wurde.
Dad nahm einen Teilzeitjob in der Autowaschanlage draußen an der Schnellstraße an. Den behielt er eine Woche lang, dann kündigte er entweder oder wurde gefeuert. Den Grund verriet er mir nicht, und ich fragte ihn nicht danach.
Beim Baseball schaffte ich es ins All-Star-Team, aber wir schieden im Qualifikationsturnier schon nach den ersten beiden Spielen aus. In der regulären Spielzeit hatte ich sechzehn Homeruns erzielt, womit ich der beste Power Hitter in der Mannschaft war, doch in den besagten zwei Spielen schlug ich siebenmal nach Bällen, bei denen ich mich nicht hätte rühren sollen, einmal nach einem, der im Dreck landete, während ein anderer so weit über meinen Kopf hinwegzischte, dass ich einen Aufzug gebraucht hätte, um ihn zu treffen. Der Trainer fragte, was mit mir los sei, und ich sagte: Nichts, nichts, lassen Sie mich einfach in Frieden. Außerdem stellte ich allerhand Schwachsinn an, teils mit einem Freund zusammen, teils allein.
Und ich schlief nicht besonders gut. Zwar hatte ich keine Albträume wie nach dem Tod meiner Mutter, aber ich konnte einfach nicht einschlafen. Manchmal schaffte ich das erst um Mitternacht oder um eins. Irgendwann drehte ich sogar den Wecker um, damit ich die Ziffern nicht mehr sehen musste.
Ich hasste meinen Vater nicht gerade (wobei es mit der Zeit bestimmt dazu gekommen wäre), aber ich empfand so etwas wie Verachtung für ihn. Blöder Schwächling, dachte ich, wenn ich im Bett lag und ihn schnarchen hörte. Und natürlich fragte ich mich, was aus uns werden würde. Das Auto war abbezahlt, ein Pluspunkt, der auf das Haus allerdings nicht zutraf, und bei der Höhe der Raten wurde mir ganz schön schwindelig. Wie lange würde es dauern, bis er den monatlichen Betrag nicht mehr aufbringen konnte? Dazu würde es zweifellos kommen, immerhin lief die Hypothek noch ganze neun Jahre, und es war unmöglich, dass unser Geld so lange reichte.
Obdachlos, dachte ich. Die Bank wird das Haus einkassieren wie in Die Früchte des Zorns, und dann sind wir obdachlos.
Im Stadtzentrum hatte ich schon Obdachlose gesehen, viele sogar, und wenn ich nicht einschlafen konnte, traten sie mir vor Augen. Ich musste viel über diese städtischen Wanderer nachdenken. Sie trugen alte Klamotten, die faltig über ihren hageren Körper fielen oder sich über den Bauch spannten. Von Klebeband zusammengehaltene billige Turnschuhe. Kaputte Brillen. Langes Haar. Irre Augen. Schnapsatem. Ich stellte mir vor, wie wir in unserem Auto schliefen, unten am alten Eisenbahndepot oder auf dem Parkplatz von Walmart zwischen den Wohnmobilen. Ich stellte mir vor, wie mein Vater all unsere Habseligkeiten in einem Einkaufswagen durch die Gegend schob. Dabei sah ich in dem Wagen immer meinen Nachttischwecker. Keine Ahnung, weshalb, aber mich erschreckte das.
Bald würde wieder die Schule losgehen, ob ich nun obdachlos war oder nicht. Manche Jungs aus dem Baseballteam würden mich wahrscheinlich wegen meiner Glanzleistung beim Turnier aufziehen. Nicht so schlimm, wie wenn sie mich damit hänselten, dass mein Vater ein Säufer war, aber wie lange würde es dauern, bis das bekannt wurde? Die Leute in unserer Straße wussten bereits, dass George Reade nicht mehr zur Arbeit ging, und höchstwahrscheinlich war ihnen auch klar, warum. Da machte ich mir nichts vor.
Wir waren schon früher weder in die Kirche gegangen noch in irgendeinem herkömmlichen Sinn religiös gewesen. Einmal hatte ich meine Mutter gefragt, warum wir nicht in die Kirche gingen – ob das daran liege, dass sie nicht an Gott glaube? Doch, das tue sie, erklärte sie mir, aber sie brauche keinen Pfarrer (oder einen Priester oder Rabbi), der ihr sagte, auf welche Weise sie an ihn glauben solle. Sie müsse nur die Augen aufsperren und sich umsehen, um das zu wissen. Dad sagte, er sei in einer baptistischen Familie aufgewachsen, jedoch nicht mehr in die Kirche gegangen, seit man sich dort mehr für Politik als für die Bergpredigt interessiert habe.
Etwa eine Woche vor Schulanfang kam es mir eines Abends trotzdem in den Sinn zu beten. Der Drang dazu war so stark, dass es sich eigentlich um einen Zwang handelte. Ich kniete mich neben mein Bett, faltete die Hände, presste die Augen zu und betete, mein Vater möge aufhören zu trinken. »Wenn du das für mich tust, wer immer du auch bist, dann werde ich auch etwas für dich tun«, sagte ich. »Das verspreche ich dir hoch und heilig. Zeig mir einfach, was du willst, dann tu ich das. Das schwöre ich.«
Dann stieg ich wieder ins Bett, und wenigstens in dieser Nacht schlief ich bis zum Morgen durch.
7
Bevor man ihn rauswarf, hatte Dad bei der Overland National Insurance gearbeitet. Das ist eine große Firma, deren Werbespots man ja hinlänglich kennt, das sind die mit Bill und Jill, den sprechenden Kamelen. Sehr lustig das Ganze. Dad sagte mal: »Die Versicherungen lassen alle lustige Spots drehen, damit man auf sie aufmerksam wird, aber sobald die Versicherten einen Schaden melden, vergeht denen das Lachen. Dann komme nämlich ich ins Spiel. Als Schadenregulierer soll ich die vertraglich vereinbarte Summe nämlich nach unten regulieren, obwohl das natürlich niemand laut ausspricht. Manchmal tue ich’s auch, aber ich will dir ein Geheimnis verraten – am Anfang stelle ich mich immer auf die Seite der Versicherten. Falls ich wirklich keinen Grund finde, der dagegen spricht.«
Die Zentrale von Overland Midwest befand sich am Stadtrand von Chicago in einer Gegend, die Dad als Versicherungsghetto bezeichnete. Als er noch dorthin pendelte, brauchte er von Sentry aus nur eine Dreiviertelstunde oder, wenn viel Verkehr war, höchstens eine. In dem Bürohaus arbeiteten mindestens hundert Schadenregulierer, und im September 2008 kam einer von seinen früheren Kollegen zu uns zu Besuch. Er hieß Lindsey Franklin; Dad nannte ihn Lindy. Es war am späten Nachmittag, und ich saß am Küchentisch bei meinen Hausaufgaben.
Der Tag hatte einen bemerkenswert beschissenen Anfang genommen, und jetzt roch es im Haus immer noch leicht nach Rauch, obwohl ich Lufterfrischer versprüht hatte. Dad hatte beschlossen, zum Frühstück Omelett zu machen. Weiß Gott, wieso er schon um sechs Uhr morgens auf war oder auf die Idee kam, dass ich ein Omelett brauchte; jedenfalls spazierte er aus der Küche, um auf die Toilette zu gehen oder den Fernseher einzuschalten, und vergaß, was auf dem Herd stand. Zweifellos war er vom Vorabend noch halb besoffen. Ich wachte auf, weil der Rauchmelder schrillte, rannte in Unterwäsche in die Küche und sah dort die Rauchwolke vom Herd aufsteigen. Das Ding in der Bratpfanne erinnerte an ein verkohltes Holzscheit.
Ich kratzte es in den Müll und nahm mir eine Schale Apfelringe. Dad trug immer noch die Küchenschürze, was irgendwie dämlich aussah. Als er sich entschuldigen wollte, murmelte ich etwas, damit er den Mund hielt. Aus jenen Wochen und Monaten ist mir im Gedächtnis geblieben, wie er sich ständig entschuldigte, was mich total kirre machte.
Es war jedoch auch ein bemerkenswert guter Tag, einer von den besten, und zwar wegen dem, was am Nachmittag geschah. Man weiß wahrscheinlich schon, worauf ich hinauswill, aber ich werde es trotzdem erzählen, weil ich nie aufgehört habe, meinen Vater zu lieben, selbst wenn ich ihn zwischendurch einmal nicht mochte, und dieser Teil der Geschichte macht mich glücklich.
Lindy Franklin arbeitete also bei Overland. Außerdem war er trockener Alkoholiker. Er gehörte nicht zu den Kollegen, mit denen mein Vater besonders gut befreundet gewesen war, wahrscheinlich weil Lindy nach der Arbeit nie mit den anderen Jungs in Duffy’s Tavern Station machte. Dennoch wusste er, weshalb mein Dad seinen Job verloren hatte, und war auf die Idee gekommen, etwas zu unternehmen. Es wenigstens zu versuchen. Später erfuhr ich, dass so etwas zum Zwölften Schritt der AA gehörte. Er hatte mehrere Termine in unserer Stadt, und sobald er damit fertig war, beschloss er spontan, bei uns vorbeizuschauen. Später erzählte er, dass er es sich um ein Haar anders überlegt hätte, weil er niemand dabeihatte (solche Besuche machten die Anonymen Alkoholiker normalerweise mit Begleitung, so ähnlich wie die Mormonen), aber dann habe er gedacht, es könne ja nichts schaden, und auf seinem Handy unsere Adresse gesucht. Ich stelle mir nicht gern vor, was aus uns geworden wäre, wenn er das nicht getan hätte. Auf jeden Fall wäre ich nie im Schuppen von Mr. Bowditch gelandet, das steht fest.
Mr. Franklin trug Anzug und Krawatte. Die Frisur war sauber geschnitten. Dad – unrasiert, mit heraushängendem Hemd, barfuß – stellte uns einander vor. Mr. Franklin schüttelte mir die Hand und meinte, er freue sich, mich kennenzulernen. Ob es mir wohl etwas ausmachen würde, nach draußen zu gehen, damit er allein mit meinem Vater sprechen könne. Dazu war ich gern bereit, aber wegen der Frühstückskatastrophe standen die Fenster noch offen, und ich bekam ziemlich viel von dem mit, was Mr. Franklin sagte. Vor allem an zweierlei erinnere ich mich. Dad sagte, er würde trinken, weil er Janey noch so sehr vermisse. Worauf Mr. Franklin sagte: »Wenn der Schnaps sie ins Leben zurückholen könnte, hätte ich da keine Einwände. Aber das wird er nicht. Und wie würde sie sich fühlen, wenn sie wüsste, wie du und dein Junge jetzt lebt?«
Außerdem sagte er: »Bist du es nicht leid, dir dauernd leidzutun?« Da fing mein Vater zu weinen an. Normalerweise war es mir zuwider, wenn es dazu kam (blöder Schwächling), aber mir war, als ob sich dieses Weinen irgendwie anders als sonst anhörte.
8
Ihr habt sicher die ganze Zeit über gewusst, wie sich die Geschichte entwickeln würde. Und wahrscheinlich ahnt ihr auch schon, wie sie weiterging. Auf jeden Fall tun das alle, die selbst trockene Alkoholiker sind oder so jemand kennen. Noch am selben Abend nahm Lindy Franklin also meinen Dad zu einem AA-Meeting mit. Als sie zurückkamen, rief er seine Frau an und sagte, er werde bei einem Freund übernachten. Er schlief auf unserem Ausziehsofa, und am folgenden Morgen nahm er Dad zu einem um sieben Uhr stattfindenden Meeting mit, das sich Trockener Sonnenaufgang nannte. Dad besuchte es von da an regelmäßig, und dort bekam er auch die Medaille für sein erstes Jahr. Ich schwänzte die Schule, damit ich sie ihm überreichen konnte, und diesmal war ich derjenige, der ein bisschen heulte. Was niemand etwas auszumachen schien; bei solchen Meetings wird ziemlich viel geheult. Anschließend umarmte mich Dad, und Lindy tat das ebenfalls. Inzwischen nannte ich ihn beim Vornamen, weil er oft bei uns war. Im AA-Programm war er der Sponsor von meinem Dad.
Das war das Wunder. Inzwischen weiß ich eine ganze Menge über die AA, weshalb mir klar ist, dass Männer und Frauen auf der ganzen Welt ständig Ähnliches erleben, aber mir kam es trotzdem wie ein Wunder vor. Seine erste Medaille bekam Dad nicht exakt ein Jahr nach Lindys erstem Besuch, weil er zwischendurch ein paar Ausrutscher hatte, aber er gestand sie ein, und die AA-Leute sagten, was sie immer sagten: Komm einfach wieder. Das tat er, und der letzte Ausrutscher – ein einzelnes Bier aus einem Sechserpack, dessen Rest er dann in die Spüle schüttete – ereignete sich kurz vor Halloween 2009. Als Lindy bei Dads erstem Jahrestag eine kleine Rede hielt, sagte er, massenhaft Leute würden von dem Programm hören, aber nie die Ohren aufsperren. Dad sei einer von denen, die Glück gehabt hätten. Mag sein, dass das stimmte; vielleicht war das mit meinem Gebet ja nur ein Zufall, aber ich möchte gern glauben, dass es keiner war. Bei den AA kann man glauben, was man will. Das steht in dem Buch, das die trockenen Alkoholiker liebevoll Das große Buch nennen.
Jedenfalls war ich jetzt damit dran, ein Versprechen einzulösen.
9
Die einzigen Meetings, an denen ich teilnahm, waren die zu Dads Jahrestagen, aber Lindy war ja oft bei uns, weshalb ich mir viele von den Slogans merkte, die AA-Leute ständig von sich gaben. Unter anderem gefielen mir die Sprüche Man kann aus einer Essiggurke kein Frischgemüse mehr machen und Gott baut keinen Schrott, aber am meisten beeindruckt mich bis heute etwas, was Lindy eines Abends sagte, als Dad von den ganzen unbezahlten Rechnungen erzählt hat und von seiner Angst, das Haus zu verlieren. Dass mein Vater jetzt nicht mehr trinke, sei ein Wunder, meinte Lindy daraufhin. »Aber Wunder sind keine Zauberei«, fügte er hinzu.
Als Dad sechs Monate trocken war, sprach er wieder bei Overland vor, und da Lindy Franklin und einige andere sich für ihn einsetzten – darunter auch sein früherer Vorgesetzter, der ihn hatte rausschmeißen müssen –, bekam er seine Stelle zurück, wenn auch nur auf Probe, was ihm aber voll und ganz bewusst war. Deshalb strengte er sich doppelt an. Im Herbst 2011 (zwei Jahre trocken) führte er dann eine Diskussion mit Lindy, die so lange dauerte, dass Lindy schließlich wieder auf dem Ausziehsofa übernachtete. Dad sagte, er wolle sich selbständig machen, werde das aber nur tun, wenn Lindy seinen Segen dazu gebe. Nachdem der sich vergewissert hatte, dass Dad nicht wieder zu trinken anfangen würde, wenn sein Vorhaben scheitern sollte – soweit das vorauszusagen war; trocken zu werden ist eigentlich keine Hexerei –, meinte er, Dad solle doch einfach mal einen Versuchsballon starten.
Dad setzte sich mit mir zusammen und erklärte, was das bedeute: ohne Netz und doppelten Boden zu arbeiten. »Na, was meinst du dazu?«
»Ich glaube, du solltest den sprechenden Kamelen adios sagen«, sagte ich ernst, was ihn zum Lachen brachte. Dann fügte ich nur noch eines an: »Aber wenn du wieder mit dem Trinken anfängst, wirst du es verbocken.«
Zwei Wochen später reichte er bei Overland die Kündigung ein, und im Februar 2012 hängte er an einem winzigen Büro in unserer Hauptstraße sein Schild auf: George Reade – Unabhängiger Sachverständiger und Schadenregulierer.
In diesem Kabuff verbrachte er allerdings nicht viel Zeit; hauptsächlich war er unterwegs. Er unterhielt sich mit Polizisten und mit Kautionsagenten (»die haben immer gute Tipps«, meinte er), aber vor allem unterhielt er sich mit Rechtsanwälten. Viele kannten ihn von seiner Arbeit bei Overland und wussten, dass man ihm vertrauen konnte. Sie vermittelten ihm Aufträge, richtig schwierige, bei denen die betreffende Versicherung die zu zahlende Summe drastisch reduzieren wollte oder die Entschädigungsforderung gleich ganz ablehnte. Er musste viele, viele Stunden arbeiten. Abends, wenn ich heimkam, war er normalerweise noch nicht da, weshalb ich mir das Abendessen selbst kochen musste. Was mir nichts ausmachte. Wenn mein Dad endlich doch auftauchte, umarmte ich ihn anfangs, um heimlich zu schnuppern, ob er den unvergesslichen Gilbey’s-Geruch verströmte. Nach einer Weile umarmte ich ihn jedoch einfach nur noch so. Und seine morgendlichen AA-Meetings versäumte er nur selten.
Manchmal kam Lindy zum Sonntagsessen; meist brachte er etwas aus irgendeinem Lokal mit, und dann schauten wir uns zu dritt im Fernsehen das aktuelle Spiel der Bears an oder in der Baseballsaison das von den White Sox. An einem solchen Nachmittag sagte Dad, sein Geschäft laufe mit jedem Monat besser. »Es würde schneller gehen, wenn ich mich in kritischen Fällen öfter auf die Seite der Antragsteller schlagen würde, aber viele von denen machen keinen guten Eindruck.«
»Da erzählst du mir nichts Neues«, sagte Lindy. »Kurzfristig könntest du mit so was zwar Gewinn machen, aber am Ende würdest du doch auf den Arsch fallen.«
Kurz vor meinem ersten Jahr an der Hillview High sagte Dad, wir müssten uns mal ernsthaft unterhalten. Ich wappnete mich für einen Vortrag über den Alkoholkonsum von Jugendlichen oder eine Diskussion über den Schwachsinn, den ich und mein Freund Bertie Bird während Dads Trinkerjahren (und eine Weile danach) angestellt hatten, aber er hatte nichts dergleichen im Sinn. Es ging um die Schule. Er erklärte mir, dass ich unbedingt gut abschneiden müsse, wenn ich auf ein gutes College gehen wolle. Richtig gut.
»Mein Geschäft wird weiterlaufen. Zuerst hat es mir Angst gemacht, und vor einer Weile musste ich meinen Bruder sogar um einen Kredit bitten, aber den hab ich fast wieder zurückgezahlt, und ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis wir festen Boden unter den Füßen haben. Auf jeden Fall bekomme ich viele Anfragen. Was allerdings das College angeht …« Er schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht, dass ich dir da viel helfen kann, zumindest nicht am Anfang. Wir haben verdammt Glück, dass wir überhaupt flüssig sind. Was natürlich meine Schuld ist. Ich tu zwar alles, was ich kann, um die Sache in Ordnung zu bringen …«
»Das weiß ich doch.«
»… aber in dem Fall musst du dir selbst helfen. Du musst dich auf den Hosenboden setzen. Wenn dann der Zugangstest ansteht, musst du richtig glänzen.«
Ich hatte vor, den Test im Dezember zu machen, verriet aber nichts davon. Dad war in Fahrt gekommen.
»Außerdem solltest du über ein Darlehen nachdenken, aber nur als letztes Mittel – so was hat man lange am Hals. Ein Stipendium ist auch eine Möglichkeit. Wenn du gut in Sport bist, kannst du zwar auf die Weise eins ergattern, aber am wichtigsten sind die Noten. Noten, Noten, Noten. Der Jahrgangsbeste wirst du vielleicht nicht werden, aber du musst zu den besten zehn gehören. Verstehst du das?«
»Aber ja, Vater«, sagte ich, worauf er mir eine spielerische Ohrfeige verpasste.
10
Ich lernte wie besessen und schaffte gute Noten. Im Herbst spielte ich Football, im Frühjahr Baseball. In meinem zweiten Highschooljahr kam ich in beidem in die Schulauswahl. Wenn es nach Coach Harkness gegangen wäre, hätte ich auch noch Basketball gespielt, aber da weigerte ich mich. Wenigstens für drei Monate im Jahr wolle ich auch mal was anderes machen, sagte ich zu ihm. Worauf der Coach nur den Kopf über den traurigen Zustand der Jugend in dekadenten Zeiten schüttelte.
Nebenbei ging ich zu ein paar Tanzabenden. Ich küsste ein paar Mädchen. Ich fand ein paar gute Freunde, hauptsächlich Sportler, aber nicht nur. Ich entdeckte ein paar Metal-Bands, die mir gefielen, und spielte ihre CDs bei voller Lautstärke. Mein Vater protestierte zwar nie dagegen, schenkte mir zu Weihnachten jedoch Ohrhörer. In meiner Zukunft würden furchtbare Dinge geschehen, von denen ich später noch berichten werde, aber die furchtbaren Dinge, die ich mir früher in meinen schlaflosen Nächten ausgemalt hatte, blieben samt und sonders aus. Das Haus gehörte immer noch uns, und ich konnte mit meinem Schlüssel immer noch die Haustür aufschließen. Alles im grünen Bereich. Wer sich je schon einmal vorgestellt hat, die kalten Winternächte in einem Auto oder einem Obdachlosenasyl zu verbringen, weiß, wovon ich spreche.
Und den Vertrag, den ich mit Gott geschlossen hatte, vergaß ich nie. Wenn du das für mich tust, dann werde ich auch etwas für dich tun, hatte ich gelobt. Auf den Knien hatte ich das getan. Zeig mir einfach, was du willst, dann tu ich das. Das schwöre ich. Es war ein Kindergebet gewesen, also magisches Denken, aber ein Teil von mir (der größte) glaubte das eigentlich nicht. Das ist noch heute so. Ich dachte, mein Gebet sei erhört worden, genau wie in einem von diesen kitschigen Filmen, die man auf Lifetime zwischen Thanksgiving und Weihnachten zeigte. Was bedeutete, dass ich meinen Teil der Vereinbarung halten musste. Wenn ich das nicht tat, würde Gott das Wunder zurücknehmen, und mein Vater würde wieder zu trinken anfangen. Schließlich musste man in Betracht ziehen, dass Highschoolkids – egal wie groß sie als Jungen und wie hübsch sie als Mädchen sein mochten – im Innern weiterhin eher Kinder waren.
Ich gab mir alle Mühe. Selbst wenn manche Tage mit schulischen und außerschulischen Betätigungen nicht nur vollgestopft waren, sondern davon beinah platzten, gab ich mein Bestes, meine Schuldigkeit zu tun.
Unter anderem beteiligte ich mich an einem Projekt, bei dem eine Schülergruppe einen Straßenabschnitt adoptierte. Wir bekamen zwei Meilen vom Highway 226 zugeteilt, die praktisch eine Wüste aus Fastfoodschuppen, Motels und Tankstellen darstellten. In der Zeit habe ich zahllose Big-Mac-Schachteln, noch zahllosere Bierdosen und mindestens ein Dutzend herrenlose Unterhosen aufgesammelt. Einmal schlüpfte ich an Halloween in ein dämliches orangefarbenes Sweatshirt und marschierte durch die Gegend, um Spenden für UNICEF zu sammeln. Im Sommer 2012 saß ich am Tisch einer Kampagne zur Wählerregistrierung, obwohl ich erst anderthalb Jahre später wahlberechtigt sein würde. Außerdem half ich freitags nach dem Sporttraining im Büro meines Vaters aus, wo ich Akten einsortierte und Daten in den Computer einpflegte – echt nervige Arbeit –, während es draußen dunkel wurde und wir Pizza von Giovanni’s direkt aus der Schachtel futterten.
Das alles, meinte Dad, würde auf meinen Bewerbungen fürs College toll wirken, und ich stimmte ihm zu, ohne ihm zu verraten, weshalb ich es tat. Ich wollte nicht, dass Gott auf die Idee kam, ich würde mich nicht an meinen Teil der Vereinbarung halten, aber trotzdem glaubte ich manchmal, den Himmel missbilligend flüstern zu hören: Das genügt nicht, Charlie. Meinst du wirklich, Müll am Straßenrand aufzusammeln reicht als Ausgleich für das gute Leben, das du jetzt mit deinem Vater führst?
Was mich – endlich – zum April 2013 bringt und damit zu dem Jahr, in dem ich siebzehn wurde. Und zu Mr. Bowditch.
11
Die gute alte Hillview High! Es kommt mir vor, als wäre seither eine Ewigkeit vergangen. Wenn ich im Winter mit dem Bus hinfuhr, saß ich ganz hinten neben Andy Chen, einem guten Schulkameraden von mir seit der Grundschule. Andy war ein Supersportler, der es später ins Basketballteam der Hofstra University schaffen sollte. Bertie hingegen war inzwischen weggezogen. Was eine gewisse Erleichterung darstellte. Es gab so etwas wie einen guten Freund, der eigentlich ein schlechter Freund war. In diesem Sinn waren Bertie und ich schlecht füreinander gewesen.
Im Herbst und im Frühling fuhr ich mit dem Fahrrad zur Schule, weil wir in einer hügeligen Stadt wohnten und das eine gute Methode war, die Bein- und Rückenmuskeln zu trainieren. Außerdem hatte ich dabei Zeit zum Nachdenken und zum Alleinsein, was ich genoss. Mein Heimweg führte durch die Plain Street zur Goff Avenue und dann über die Willow zur Pine Street. Die wiederum kreuzte ganz oben auf dem Hügel die Sycamore Street, die von dort zu der verfluchten Brücke hinunterführte. Und an dieser Kreuzung stand das Psycho-Haus, so benannt von Bertie Bird, als wir elf oder zwölf waren.
Eigentlich war es das Haus von Bowditch; der Name stand auf dem Briefkasten, verblasst, aber noch zu entziffern, wenn man die Augen zusammenkniff. Dennoch hatte Bertie gute Gründe. Wir hatten alle den besagten Film gesehen (neben den anderen für Elfjährige vorgeschriebenen Streifen wie Der Exorzist und Das Ding aus einer anderen Welt), und das Haus ähnelte tatsächlich jenem, in dem Norman Bates mit seiner mumifizierten Mutter lebte. Es sah ganz anders aus als die hübschen kleinen Doppelhäuser und die im Ranchstil erbauten Eigenheime in der Sycamore Street und den anderen Straßen in unserer Nachbarschaft. Das Psycho-Haus war ein großer, windschiefer viktorianischer Kasten, dessen früher wahrscheinlich weiße Farbe jetzt zu einem Ton verblasst war, den ich als Scheunenkatzengrau bezeichnen würde. Eingefasst wurde das gesamte Grundstück von einem uralten Lattenzaun, der sich an manchen Stellen nach vorn und an anderen nach hinten lehnte. Ein rostiges, hüfthohes Tor versperrte den rissigen Betonweg zur Haustür. Der Rasen bestand hauptsächlich aus wild wucherndem Unkraut. Die Veranda sah aus, als würde sie sich allmählich vom zugehörigen Haus lösen. Sämtliche Jalousien waren heruntergezogen, was laut Andy Chen sinnlos war, weil die Fenster zu dreckig waren, als dass man hätte hindurchschauen können. Aus dem hohen Gras ragte halb verborgen ein großes Schild mit der Aufschrift ZUTRITTVERBOTEN, und am Tor selbst verkündete ein noch größeres: VORSICHT! BISSIGERHUND.
Zu dem betreffenden Tier, einem Deutschen Schäferhund namens Radar, benannt – wie ich später erfuhr – nach einer Figur aus der Fernsehserie M*A*S*H, hatte Andy eine Geschichte parat. Wir hatten ihn alle schon bellen hören (ohne zu wissen, dass es sich eigentlich um eine Sie handelte), und kurz zu Gesicht bekommen hatten wir den Hund ab und zu ebenfalls, aber Andy war der Einzige, der ihn aus nächster Nähe gesehen hatte. Wie er erzählte, hatte er auf seinem Fahrrad eines Tages angehalten, weil der Briefkasten von Mr. Bowditch offen stand und so mit Prospekten und dergleichen vollgestopft war, dass einiges auf den Gehweg gepurzelt war und durch die Gegend geweht wurde.
»Ich hab den Kram aufgehoben und wieder reingestopft«, sagte Andy. »Damit wollte ich dem Typ bloß einen Gefallen tun, verdammt noch mal. Da hör ich es plötzlich knurren und bellen, WAFF-WAFF-GRR-GRR, und wie ich den Kopf heb, kommt eine verdammte Monsterbestie angedüst, so ein zentnerschwerer Riesenköter. Zähne gebleckt, sabbernde Lefzen, und die Augen ganz blutrot unterlaufen!«
»Klar doch«, sagte Bertie. »Eine Monsterbestie. Wie Cujo in dem Film. Wer’s glaubt.«
»Es war echt so einer«, sagte Andy. »Das kannst du mir ruhig glauben. Wenn der alte Typ dem nicht was zugebrüllt hätte, wär der direkt durchs Tor gestürmt. Und das ist bekanntlich so alt, dass es längst sanisiert werden müsste.«
»Saniert«, sagte ich.
»Ist doch egal, Mann. Jedenfalls ist der Alte auf die Veranda raus und hat ›Radar, Platz!‹ gebrüllt. Darauf hat sich das Biest auf den Bauch geworfen. Bloß dass es mich weiter angestarrt und dabei geknurrt hat. Der Alte sagt zu mir: ›Was tust du da eigentlich, Junge? Klaust du etwa meine Post?‹ Und ich sag: ›Nein, Sir, die ist bloß runtergefallen, und ich hab sie aufgehoben. Der Briefkasten ist nämlich total voll, Sir.‹ Darauf er wieder: ›Um meinen Briefkasten kümmere ich mich schon selbst, mach einfach, dass du fortkommst.‹ Was ich dann auch getan hab.« Andy schüttelte den Kopf. »Der Köter hätte mir glatt die Kehle zerfetzt. Kein Scheiß, Mann.«
Mir war klar, dass Andy übertrieb, das war so eine Gewohnheit von ihm, aber an jenem Abend habe ich meinen Vater trotzdem über Mr. Bowditch befragt. Dad meinte, er wisse nicht viel über ihn, nur dass der Mann ein alter Junggeselle sei und schon in dem alten Kasten gewohnt habe, als er selbst in die Sycamore Street gezogen sei, und das sei immerhin bald fünfundzwanzig Jahre her.
»Dein Freund Andy ist nicht das einzige Kind, das er schon mal angebrüllt hat«, fuhr Dad fort. »Bowditch ist berüchtigt für seine üble Laune und für seinen ebenso schlecht aufgelegten Schäferhund. Der Stadtrat wäre begeistert, wenn er das Zeitliche segnen würde, damit man das Haus abreißen kann, aber er scheint ein zäher Bursche zu sein. Wenn ich ihm begegne, was selten vorkommt, grüße ich ihn immer, und er verhält sich durchaus höflich, aber ich bin ja auch ein Erwachsener. Solche Hagestolze sind nicht selten äußerst allergisch gegen Kinder. Weshalb ich dir rate, ihm lieber aus dem Weg zu gehen, Charlie.«
Was kein Problem war bis zu jenem Tag im April 2013. Von dem ich jetzt erzählen werde.
12
Auf der Heimfahrt vom Baseballtraining hielt ich mit dem Fahrrad an der Kreuzung Pine und Sycamore, um die linke Hand vom Lenker zu nehmen und auszuschütteln. Vom Training in der Halle (das matschige Spielfeld draußen war noch nicht bespielbar) war sie ganz rot und pochte. Coach Harkness, der für Baseball und Basketball verantwortlich war, hatte mich als ersten Batter aufgerufen, während mehrere als Pitcher vorgesehene Typen Würfe probten. Manche von denen hatten ganz schön Kraft in den Armen. Möglicherweise wollte der Coach es mir heimzahlen, dass ich mich geweigert hatte, dem Basketballteam beizutreten, das in der vorherigen Saison gerade einmal ein Fünftel der Spiele für sich entscheiden konnte.
Zu meiner Rechten stand der windschiefe viktorianische Kasten von Mr. Bowditch. Aus dem jetzigen Blickwinkel wirkte das Gebäude noch mehr wie das Psycho-Haus als sonst. Ich legte die Hand gerade wieder an den Lenker, als ich hinter dem Haus einen Hund jaulen hörte. Ich musste an die von Andy beschriebene Monsterbestie denken, die mit gefletschten Zähnen, roten Augen und triefendem Maul, aber das war definitiv nicht das WAFF-WAFF-GRR-GRR eines bösartigen Kampfhunds; das Heulen klang traurig und verängstigt. Vielleicht sogar trostlos. Inzwischen habe ich darüber nachgedacht und mich gefragt, ob ich das nur im Rückblick so empfunden habe, bin aber zu der Einschätzung gelangt, dass dem nicht so ist. Das Heulen wiederholte sich nämlich. Und beim dritten Mal ebbte es ab und war dann so leise, als würde das Tier sich sagen: Was soll’s?
Dann, wesentlich schwächer als das letzte, verklingende Hundeheulen, ein leises Rufen: »Hilfe.«
Hätte der Hund nicht so gejault, wäre ich den Hügel hinab zu unserem Haus gerollt, um mir dort glücklich und zufrieden ein Glas Milch und eine halbe Schachtel Schokokekse einzuverleiben. Was für Mr. Bowditch ziemlich schlecht gewesen wäre. Es ging auf den Abend zu, die Schatten wurden länger, und es war ein verdammt kalter Apriltag. Womöglich hätte Mr. Bowditch die ganze Nacht dort gelegen.
Ich erntete die Lorbeeren dafür, ihn gerettet zu haben – ein weiterer Pluspunkt für meine Collegebewerbungen, sollte ich meine Bescheidenheit über Bord werfen, wie es mein Vater vorschlug, und den eine Woche später erschienenen Zeitungsartikel den einzureichenden Unterlagen beilegen –, aber eigentlich war das alles gar nicht mein Verdienst.
Wer ihn gerettet hat, war Radar mit ihrem trostlosen Geheul.
Kapitel zwei
Mr. Bowditch. Radar. Ein Abend im Psycho-Haus.
1
Ich fuhr um die Ecke zum Gartentor in der Sycamore Street und lehnte mein Fahrrad an den windschiefen Lattenzaun. Das Tor – es reichte mir kaum bis zur Hüfte – ließ sich nicht öffnen. Als ich darüberspähte, sah ich einen dicken Riegel, so rostig wie das Tor, das er versperrte. Ich zerrte daran, aber das Ding rührte sich nicht. Inzwischen heulte der Hund wieder. Ich streifte meinen mit Büchern vollgepackten Rucksack ab und verwendete ihn als Trittleiter. Während ich über das Tor kletterte, knallte ich mit dem Knie an das Schild mit der Aufschrift VORSICHT! BISSIGERHUND, dann landete ich drüben auf dem anderen Knie, weil mein Sneaker sich zwischen zwei Latten verfangen hatte. Ich überlegte, ob ich wohl auf den Gehweg zurückspringen könnte, wenn der Hund auf die Idee käme, sich so auf mich zu stürzen wie auf Andy. Dabei fiel mir der alte Spruch ein, dass Angst angeblich Flügel verleihe. Ob das zutraf, musste ich hoffentlich nicht eigenfüßig überprüfen. Ich hielt mich strikt an Football und Baseball. Hochsprung überließ ich den Leichtathleten.
Das hohe Gras klatschte mir an die Hosenbeine, während ich hinters Haus rannte. Den Schuppen habe ich da irgendwie noch nicht bemerkt, weil ich nur Ausschau nach dem Hund hielt. Der befand sich auf der Veranda. Andy Chen hatte angedeutet, der Hund würde so um die fünfzig Kilo wiegen, und vielleicht war das auch der Fall, als wir noch kleine Jungs waren, aber das Tier, das ich dort sah, war bestimmt nicht mehr als dreißig Kilo schwer. Es war hager, hatte struppiges Fell, einen erbärmlichen Schwanz und eine weitgehend weiße Schnauze. Als es mich sah, trottete es die wacklige Treppe herab und wäre dabei fast über den Mann gestolpert, der auf den Stufen lag. Der Hund kam auf mich zu, aber nicht kampfeslustig, sondern in einem hinkenden, arthritischen Trab.
»Radar, Platz!«, sagte ich. Eigentlich hätte ich nicht erwartet, dass der Hund mir gehorchen würde, aber er legte sich brav bäuchlings auf den Rasen und fing an zu winseln. Während ich zur Veranda marschierte, hielt ich trotzdem gebührend Abstand.
Mr. Bowditch lag auf der linken Seite. Oberhalb vom rechten Knie war in seiner Hose ein Knubbel sichtbar. Man musste kein Arzt sein, um zu erkennen, dass das Bein gebrochen war, und nach der Beule zu urteilen, sogar ziemlich schlimm. Wie alt er genau war, konnte ich schwer schätzen, aber auf jeden Fall ziemlich alt. Das Haar war fast ganz weiß; früher musste es allerdings feuerrot gewesen sein, noch durchzogen es ein paar farbige Strähnen. Dadurch sah es so aus, als ob das Haar rosten würde. Die Fältchen in den Wangen und um den Mund herum waren tief gefurcht. Obwohl es kalt war, standen ihm die Schweißperlen auf der Stirn.
»Ich brauche Hilfe«, sagte er. »Bin von der verfluchten Leiter gefallen.« Er versuchte, darauf zu zeigen. Dadurch verlagerte sich das Bein auf der Treppe, und er stöhnte auf.
»Haben Sie schon den Krankenwagen gerufen?«, fragte ich.
Er sah mich an, als ob ich nicht alle Tassen im Schrank hätte. »Das Telefon ist doch im Haus, Junge. Ich bin hier draußen.«
Was das bedeutete, kapierte ich erst später. Nämlich dass Mr. Bowditch kein Handy hatte. Hatte es nie für nötig gehalten, sich eines zu besorgen, und wusste kaum, was das überhaupt war.
Als er wieder Anstalten machte, sich zu bewegen, bleckte er die Zähne. »Mein Gott, tut das weh.«
»Dann sollten Sie lieber liegen bleiben«, sagte ich.
Ich wählte den Notruf und meldete, man solle einen Rettungswagen zur Kreuzung Pine und Sycamore Street schicken, weil Mr. Bowditch hingefallen sei und sich das Bein gebrochen habe. Es sehe ziemlich schlimm aus. Jetzt sah ich, dass ein Stück vom Knochen aus dem Hosenbein ragte, und das Knie wirkte auch ziemlich geschwollen. Die Frau am Telefon fragte mich nach der Hausnummer, weshalb ich mich bei Mr. Bowditch erkundigte.
Er warf mir wieder seinen Blick zu, als wäre ich strohdumm, und sagte: »Nummer eins.«
Nachdem ich das der Frau mitgeteilt hatte, versprach sie, gleich einen Rettungswagen zu schicken. Bis dahin solle ich bei dem Verletzten bleiben und ihn warm halten.
»Er schwitzt jetzt schon«, sagte ich.
»Wenn der Bruch so schlimm ist, wie Sie sagen, Sir, liegt das wahrscheinlich am Schock.«
»Äh, okay.«
Radar kam wieder angehumpelt. Er hatte die Ohren angelegt und knurrte.
»Schluss damit, Mädel«, sagte Mr. Bowditch. »Platz!«
Radar – offenbar sie, nicht er – legte sich sichtlich erleichtert am Fuß der Treppe auf den Bauch und hechelte.
Ich zog meine Highschooljacke aus, um sie über Mr. Bowditch zu breiten.
»He, was machst du denn da?«
»Ich soll Sie warm halten.«
»Mir ist schon warm.«
Aber ich sah, dass das nicht stimmte, weil er jetzt zitterte. Er hob den Kopf, um meine Jacke zu betrachten.
»Du gehst auf die Highschool, hm?«
»Ja, Sir.«
»Rot und Gold. Das sind die Farben von der Hillview.«
»Stimmt.«
»Bist du in einem Team?«
»In Football und Baseball.«
»Die Hedgehogs. Was …« Er wollte sich bewegen und schrie dabei kurz auf. Radar stellte die Ohren auf und beäugte ihn besorgt. »Was für ein alberner Name das doch ist.«
Da konnte ich nicht widersprechen. »Sie sollten sich lieber nicht bewegen, Mr. Bowditch.«
»Die Stufen schneiden mir überall ins Fleisch. Ich hätte unten auf dem Boden liegen bleiben sollen, aber ich hab gedacht, ich schaffe es auf die Veranda. Und von da ins Haus. Musste es einfach versuchen. Hier draußen wird’s bald verflucht kalt werden.«
Meiner Meinung nach war es schon jetzt verflucht kalt.
»Bin froh, dass du gekommen bist. Hast wohl das alte Mädel jaulen hören.«
»Ja, und dann hab ich Sie rufen gehört«, sagte ich. Ich warf einen Blick auf die Veranda. Da war die Tür, aber er hätte den Knauf kaum erreichen können, ohne sich auf das unverletzte Knie zu erheben. Wozu er wahrscheinlich nicht fähig gewesen wäre.
Mr. Bowditch folgte meinem Blick. »Da ist ’ne Hundeklappe«, sagte er. »Hab gedacht, da kann ich vielleicht durchkriechen.« Er schnitt eine Grimasse. »Sag mal, du hast keine Schmerztabletten dabei, oder? Aspirin oder was Stärkeres? Weil du doch Football spielst, meine ich.«
Ich schüttelte den Kopf. Leise, ganz leise hörte ich eine Sirene. »Was ist mit Ihnen? Haben Sie irgendwo welche?«
Er zögerte, dann nickte er. »Drinnen. Geh schnurstracks den Flur lang. Von der Küche geht eine kleine Toilette ab. Ich glaube, da steht ein Döschen Empirin im Arzneischrank. Aber fass bloß nichts anderes an!«
»Mach ich schon nicht.« Ich wusste, dass er alt war und Schmerzen hatte, war aber wegen dieser Andeutung trotzdem etwas sauer.
Er hob die Hand und packte mich am T-Shirt. »Nicht rumschnüffeln, ja?«
Ich entzog mich ihm. »Ich hab doch gesagt, dass ich das nicht mache.«
»Radar!«, rief Mr. Bowditch, während ich die Treppe hinaufging. »Geh mit!«
Radar humpelte die Stufen nach oben und wartete, bis ich die Tür öffnete, anstatt die Hundeklappe zu verwenden. Dann folgte sie mir den Flur entlang, in dem es düster und irgendwie eigentümlich war. Auf der einen Seite waren alte Zeitschriften aufgestapelt, mit Kordel zu Bündeln verschnürt. Manche davon kannte ich, zum Beispiel Life und Newsweek, aber von anderen – Collier’s, Dig, Confidential und All Man – hatte ich noch nie gehört. Auf der anderen Seite stapelten sich Bücher, hauptsächlich alt und mit dem Geruch, den alte Bücher eben verströmten. Diesen speziellen Geruch mag nicht jeder, ich aber schon. Muffig, doch auf gute Weise.
Die Küche war voll alter Elektrogeräte, darunter ein Herd von Hotpoint. Auf dem Porzellan der Spüle prangten Rostringe von unserem harten Wasser, die Hähne hatten altmodische Kreuzgriffe, und das Linoleum auf dem Boden war so abgenutzt, dass das Muster nicht mehr erkennbar war. Dafür war alles blitzsauber. Im Geschirrkorb standen ein Teller, ein Kaffeebecher und eine Besteckgarnitur – Messer, Gabel, Löffel. Das machte mich traurig. Auf dem Boden stand ein sauberer Fressnapf, auf dessen Rand RADAR gedruckt war, was mich ebenfalls traurig machte.
Ich ging in die Toilette, die kaum größer als ein Kleiderschrank war – nichts als ein Klo mit hochgeklapptem Deckel und weiteren Rostringen in der Schüssel, dazu ein Waschbecken mit einem Spiegelschränkchen darüber. Als ich am Spiegel zog, kam eine Reihe von staubigen Pillendöschen zum Vorschein, die irgendwie alle von der Arche Noah zu stammen schienen. Im mittleren Fach fand ich ein Döschen mit der Aufschrift Empirin. Als ich es herausnahm, sah ich dahinter ein winziges rundes Ding. Ich hielt es für ein Luftgewehrkügelchen.





























