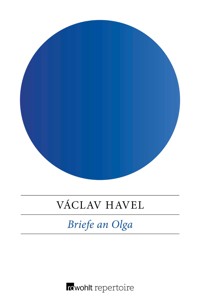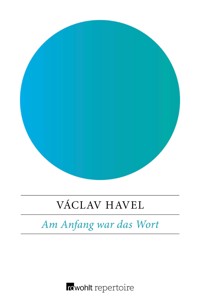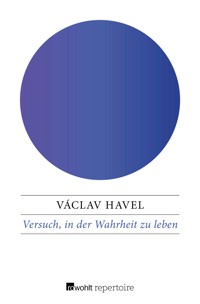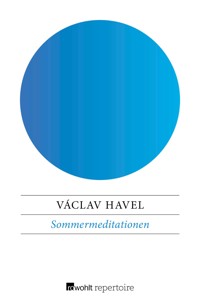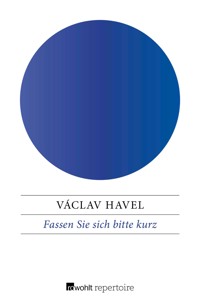
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vom Dissidenten zum Präsidenten: In diesem Buch zieht der Held der Samtenen Revolution Bilanz. Und weil Václav Havel nicht nur einer der größten Politiker Europas, sondern auch ein Dichter war, kommt diese Lebensbeschreibung in ungewöhnlicher Form daher: überraschend offen, brillant komponiert, mit viel Sinn für Humor und Liebe zum Detail präsentiert. Wie schon in seinem ersten Bilanzbuch «Fernverhör» (1986) beantwortet Havel Fragen des kritischen Journalisten Karel Hvížd'ala und weicht dabei keinem Thema aus. Wir verfolgen Hintergründe des schwierigen Neubeginns erst der Tschechoslowakei und dann Tschechiens, werden zugleich Zeuge seines Kampfes mit den Tücken einer bisweilen absurden Bürokratie, erfahren viel über politische Feinde, Freunde, Wegbegleiter. Wir lernen aber auch den privaten Václav Havel kennen, sein Verhältnis zu seinen beiden Ehefrauen und seinen Kampf mit der Krankheit. Seine Autobiographie gewährt seltene Einblicke in die inneren Verhältnisse eines hohen Amtes und eines internationalen Politikerlebens ebenso wie in die persönlichen inneren Konflikte eines Intellektuellen, der selbst immer wieder am meisten über seine besondere Rolle in der Geschichte staunen musste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Václav Havel
Fassen Sie sich bitte kurz
Gedanken und Erinnerungen zu Fragen von Karel Hvížd’ala
Aus dem Tschechischen von Joachim Bruss
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Vom Dissidenten zum Präsidenten: In diesem Buch zieht der Held der Samtenen Revolution Bilanz. Und weil Václav Havel nicht nur einer der größten Politiker Europas, sondern auch ein Dichter war, kommt diese Lebensbeschreibung in ungewöhnlicher Form daher: überraschend offen, brillant komponiert, mit viel Sinn für Humor und Liebe zum Detail präsentiert.
Wie schon in seinem ersten Bilanzbuch «Fernverhör» (1986) beantwortet Havel Fragen des kritischen Journalisten Karel Hvížd’ala und weicht dabei keinem Thema aus. Wir verfolgen Hintergründe des schwierigen Neubeginns erst der Tschechoslowakei und dann Tschechiens, werden zugleich Zeuge seines Kampfes mit den Tücken einer bisweilen absurden Bürokratie, erfahren viel über politische Feinde, Freunde, Wegbegleiter.
Wir lernen aber auch den privaten Václav Havel kennen, sein Verhältnis zu seinen beiden Ehefrauen und seinen Kampf mit der Krankheit. Seine Autobiographie gewährt seltene Einblicke in die inneren Verhältnisse eines hohen Amtes und eines internationalen Politikerlebens ebenso wie in die persönlichen inneren Konflikte eines Intellektuellen, der selbst immer wieder am meisten über seine besondere Rolle in der Geschichte staunen musste.
Über Václav Havel
Václav Havel (1936–2011), weltbekannter Dramatiker und Essayist, war während der kommunistischen Herrschaft ein führender Regimekritiker in Prag. Er gehörte zu den Gründern der Charta 77 und des Bürgerforums 1989. Havel wurde viermal inhaftiert und saß insgesamt fünf Jahre im Gefängnis. Zwischen 1989 und 2003 war er zunächst Präsident der Tschechoslowakei und dann von Tschechien.
Inhaltsübersicht
Für Dáša
Kapitel 1
(Washington, 7.4.2005)
Ich bin geflohen. Ich bin nach Amerika geflohen. Ich bin für zwei Monate geflohen, und zwar mit der ganzen Familie, das heißt mit Dáša und unseren zwei Boxern Sugr und Madlenka. Ich bin geflohen in der Hoffnung, hier mehr Zeit und etwas Konzentration zum Schreiben zu finden. Schon zwei Jahre lang bin ich nicht mehr Präsident, und ich fange langsam an nervös zu werden, weil ich noch nichts Zusammenhängendes geschrieben habe. Wenn ich ständig und immer wieder gefragt werde, ob ich schreibe und was ich schreibe, werde ich durchaus wütend und sage, dass ich in meinem Leben schon genug geschrieben habe, sicherlich mehr als die meisten meiner Mitbürger, und dass Schreiben keine Tätigkeit ist, die man einfordern kann. Ich bin hier Gast der Library of Congress, die mir ein sehr ruhiges und angenehmes Zimmer gegeben hat; ich kann kommen und gehen, wann ich will, und kann tun, was ich will. Man verlangt hier nichts von mir. Das ist hervorragend. Gern würde ich hier – unter anderem – auf die Fragen von Herrn Hvížd’ala antworten.
Herr Präsident, wenn Sie gestatten, werde ich Sie so nennen, wie ehemalige Präsidenten im Ausland tituliert werden. Das Gespräch möchte ich mit einer Frage beginnen, die die zweite Hälfte der achtziger Jahre betrifft, als Sie zum bekanntesten Dissidenten in Mitteleuropa wurden, oder – wie John Keane geschrieben hat – zum «Star im Theater der Opposition». Erinnern Sie sich an den Moment, in dem Ihnen zum ersten Mal klar wurde, dass Sie in die Politik werden gehen müssen und mit der Rolle des Dramatikers, Essayisten und Denkers nicht auskommen werden?
Vor allem möchte ich mich ein wenig gegen den Titel «Star im Theater der Opposition» verwahren. Zum Ersten haben wir alles dafür getan, dass wir nicht aufgeteilt wurden in «Stars» und die Übrigen. Je bekannter jemand von uns war, und daher auch etwas geschützter, desto mehr trat er zur Verteidigung der weniger Bekannten und daher Verletzlicheren auf. Das Regime hielt sich nämlich an das Prinzip «Teile und herrsche». Dem einen sagten sie: «Wie können Sie sich, ein von allen respektierter, gebildeter Mensch, mit solchen Nichtsnutzen abgeben?», dem anderen: «Fang mit denen nichts an, die stehen unter Naturschutz, die lügen sich immer irgendwie heraus und dich lassen sie dann sitzen, damit du alles für sie auslöffelst.» Es ist begreiflich, dass wir in einer solchen Situation besonderen Wert auf den Grundsatz der Gleichheit aller legten, die sich irgendwie oppositionell äußerten. Zum Zweiten: Sie wissen sehr gut, wie ich ständig an mir selbst zweifle, wie ich mir alles Mögliche und Unmögliche vorwerfe, wie ich mir selbst nicht gefalle; ein solches Individuum kann nur schwer ohne Protest die Behauptung ertragen, ein «Star» gewesen zu sein. Andererseits muss ich zugestehen, dass ich wohl eine bestimmte integrative Fähigkeit habe: als Mensch, der dicke Luft, Konflikte und Konfrontationen unmittelbar physisch nicht erträgt, besonders, wenn sie mehr oder weniger überflüssig sind, und der es darüber hinaus nicht gern hat, wenn sich das Gespräch ohne sichtbares Ergebnis immer nur im Kreis dreht, habe ich mich stets bemüht, Menschen zusammenzubringen, zu ihrer Übereinstimmung beizutragen und eine Art und Weise zu finden, den gemeinsamen Standpunkt in eine sichtbare Tat zu verwandeln. Vielleicht waren es gerade diese meine Eigenschaften, die mich schließlich immer – ohne dass ich das wollte oder danach gestrebt hätte – in den Vordergrund trugen, weshalb ich dann manchen wohl als «Star» erscheinen mochte. Nun aber endlich zum Kern Ihrer Frage: Ich glaube nicht, dass sich in meinem Leben eine irgendwie deutliche Zäsur zwischen der Zeit finden lässt, als ich mich nicht mit Politik befasste, und der Zeit, in der ich dies tat. In einem gewissen Maße habe ich mich mit Politik oder öffentlichen Angelegenheiten immer befasst, und in einer gewissen Weise war ich immer – auch als «bloßer» Schriftsteller – eine politische Erscheinung. In totalitären Verhältnissen ist eben eigentlich alles Politik, zum Beispiel auch ein Rock-Konzert. Unterschiede gab es selbstverständlich in der Art oder Sichtbarkeit der politischen Wirkung dessen, was ich tat: In den sechziger Jahren war es anders als in den Achtzigern. Der einzige wirklich umbruchartige Augenblick in meinem Leben war von diesem Gesichtspunkt aus meine Entscheidung im November 1989, die Kandidatur zum Präsidenten anzunehmen. Ab damals ging es nicht mehr allein um die politische Wirkung meines Tuns, sondern auch um eine politische Funktion – mit allem, was damit verbunden ist. Ich habe bis zur letzten Sekunde gezögert.
Hatten Sie Furcht davor, oder hat es Sie verlockt?
Eher hatte ich Furcht. Es war etwas ganz Neues. Ich habe mich nicht seit der Grundschule auf die Präsidentschaft vorbereitet, wie das die amerikanischen Präsidenten machen. Ich musste über eine derart grundlegende Veränderung meines Lebens praktisch innerhalb einiger Stunden entscheiden. Schließlich siegte wohl der Appell meiner Umgebung an meine Verantwortung; sie sagten mir genau das, was ich später vielfach anderen gegenüber wiederholt habe, als ich sie in die Politik rief: dass man nämlich nicht ein ganzes Leben lang kritisieren kann, um dann, wenn man die Chance hat zu zeigen, dass es besser gemacht werden kann, die Hände davon zu lassen. Dieser Appell wurde darüber hinaus von der Überzeugung begleitet, dass dies in einer revolutionären Situation die einzig mögliche Lösung war, und dass ich all unser Streben auf den Kopf stellen und allen anderen ins Gesicht spucken würde, wenn ich – als eine zentrale Figur des Geschehens – es plötzlich ablehnen würde, mich zu engagieren und die Folgen meiner eigenen vorhergehenden Taten zu tragen.
Was hat Ihre damalige Frau Olga dazu gesagt, die ja bekannt war für ihr scharfes Urteil?
Ich muss sagen, dass sie mein vorheriges Wirken als Dissident vorbehaltlos unterstützt hat. Was aber die Kandidatur zum Präsidenten angeht, so war sie in derselben, ja vielleicht sogar noch größeren Verlegenheit als ich. Aber schließlich gab auch sie mir ihre Zustimmung.
Einige Ihrer Kollegen begannen gleich nach der Lektüre unseres Buches «Fernverhör» aus dem Jahre 1986 zu ahnen, dass Sie in die Politik gehen werden. Wenn ich mich richtig erinnere, hat damals Milan Kundera diesen Gedanken Václav Bělohradský gegenüber geäußert. Ich habe zum ersten Mal Anfang Januar 1989 von Pavel Tigrid gehört, dass Sie Präsident werden sollten, der mich fragte, was ich dazu sage. Wann haben Sie zum ersten Mal von diesen Überlegungen gehört und was haben Sie davon gehalten?
Ich wundere mich nicht, dass Milan Kundera das gesagt hat. Ich glaube, er hat mich immer für einen politischeren Menschen gehalten als ich selbst. Als dann Pavel Tigrid in der Exilzeitschrift Svédectví schrieb, ich solle der zukünftige Präsident sein, habe ich darüber nur gelacht und es für einen Witz gehalten, ähnlich wie im Sommer desselben Jahres, als mir das Adam Michnik sagte. Wirklich ernsthaft begann über die Notwendigkeit meiner Kandidatur in den Revolutionstagen, wenn ich mich nicht irre, mein Freund, der Rockmusiker Michael Kocáb, zu reden. Insgesamt scheint es mir heute, mit dem Abstand der Zeit, dass ich überhaupt der Letzte war, der diesen Einfall mit der Präsidentschaft ernst zu nehmen begann.
(Washington, 8.4.2005)
Ich erinnere mich an meine früheren Amerika-Aufenthalte. Zum ersten Mal war ich für sechs Wochen hier im Frühjahr 1968. In Prag begann der Prager Frühling sich zu regen; es eröffnete sich mir die Gelegenheit zu reisen, und so nutzte ich gleich die Einladung von Joe Papp zur Premiere meines Stücks «Die Benachrichtigung» im Public Theater in New York. Ich war damals der Vorsitzende des Kreises unabhängiger Schriftsteller, den wir kurz zuvor als ein Gegengewicht gegen die Parteizellen im Schriftstellerverband gegründet hatten, der damals noch allmächtigen Organisation, und ich habe im Flugzeug unser Programm geschrieben (es würde wohl lohnen, es mal wieder hervorzusuchen und zu lesen, ich wage die Behauptung, dass es ganz aktuell klingen wird) und Whisky dazu getrunken. Mit mir flogen viele Dorfbewohner, hauptsächlich aus der Slowakei, von denen viele zum ersten Mal im Leben in einem Flugzeug saßen. Offenbar nahmen sie die günstige Gelegenheit wahr, ihre reichen amerikanischen Verwandten zu besuchen. Die Landung auf dem Kennedy-Flughafen bei Sonnenuntergang war faszinierend, dieses Erlebnis werde ich nie vergessen. Am Flughafen wartete jemand auf mich und brachte mich sogleich zur Probe meines Schauspiels. Und wieder traute ich meinen Augen nicht: Ich befand mich am anderen Ende der Welt und sah mein Stück genau so aufgeführt, wie ich mir das vorstellte und wie wir es im Prager Theater am Geländer aufgeführt hatten. Die Leute lachten oder klatschten an denselben Stellen, was mich besonders überraschte, denn die Übersetzung war wohl nicht besonders gut, wenn auch einiges in meinen Stücken einfach unübersetzbar ist. Nach der Probe brachte man mich ins Hotel, und ich schlief wie ein Bär. Am nächsten Tag suchte ich unter anderem meinen alten Freund und Mitschüler Miloš Forman auf und zog zu Jiří Voskovec, einem hervorragenden Mann, bei dem ich dann während der ganzen Zeit meines Aufenthalts wohnte. Ich durchlebte dort wichtige Tage meines Lebens. Es war die große Zeit der Hippie-Bewegung, der «beins» im Central Park, die Leute waren behängt mit Korallen, es war die Zeit von Hair (Joe hatte das Musical im Public Theater vor meinem Stück aufgeführt, dann hat er es des Erfolgs wegen an den Broadway verkauft, wo ich die Premiere gesehen habe), die Zeit des Todes von Martin Luther King, die Zeit der gewaltigen Antikriegsdemonstrationen, deren inneres Ethos – stark, aber nicht fanatisch – ich bewunderte, die Zeit der psychedelischen Kunst (viele Plakate habe ich nach Hause mitgenommen und sie hängen bis heute in Hrádeček, unter anderem brachte ich auch die erste Platte von Lou Reed und Velvet Underground mit) usw. usw. Ich denke, dieser Aufenthalt hat mich ziemlich stark beeinflusst. Nach der Rückkehr verbrachte ich mit Freunden einen sehr fröhlichen und zugleich ein wenig nervösen Sommer, der nicht gut enden konnte: Es kam die sowjetische Armee. Und als ich dann die langhaarige und mit Korallen behängte tschechische Jugend Staatsfahnen vor den sowjetischen Panzern schwenken sah und das damals beliebte Lied der Hippies Massachusetts singen hörte, hatte ich in der Tat ein sehr eigenartiges Gefühl. Es klang in diesen Zusammenhängen etwas anders als im Central Park, doch hatte es im Grunde dasselbe Ethos: die Sehnsucht nach einer freien und bunten und poetischen Welt ohne Gewalt. Zum zweiten Mal habe ich Amerika besucht – nach langen und bedrückenden zweiundzwanzig Jahren –, als ich schon Präsident war. Aus damaligen Hippies waren schon geachtete Senatoren oder Leiter supranationaler Körperschaften geworden. Seitdem war ich mindestens zehnmal hier. Ich habe drei amerikanischen Präsidenten nahegestanden, vielen amerikanischen Politikern (eine besondere Rolle spielte meine hervorragende Landsmännin Madeleine Albright) und anderen Menschen, darunter berühmte Stars. Diese Arbeits-, Staats- oder auch offiziellen Besuche waren allerdings sehr kurz und das Programm übervoll, sodass ich bei diesen Gelegenheiten Amerika immer nur aus dem Fenster vorbeizischender Limousinen gesehen habe (Zeit für einen Spaziergang oder zum Besuch eines Rock-Clubs zu finden, war zwar möglich, aber nur mit viel Mühe). Meinen zweiten längeren Aufenthalt erlebe ich also jetzt hier fast vierzig Jahre nach dem ersten. In der Zwischenzeit habe ich allerlei erlebt, und vielleicht gerade deshalb – paradoxerweise – sehne ich mich nach der Souveränität, mit der ich mich hier einst als Dreißigjähriger bewegt habe.
Warum haben Sie nach der «Sanierung» im Jahre 1987 bis zum Umbruch kein weiteres Stück geschrieben? («Morgen geht es los» rechne ich nicht, das war ein Text auf Bestellung für das Theater am Bindfaden und wurde damals selbstverständlich unter einem anderen Namen gespielt.) In den Jahren davor hatten Sie fast alle zwei Jahre ein neues Stück geschrieben. In mir ruft das den Eindruck hervor, dass Sie schon zu jener Zeit innerlich sehr in die Politik hineingezogen waren.
Ich gebe zu, dass ich zum Stückeschreiben immer weniger Zeit hatte. Wurde ich doch zum Ende der achtziger Jahre fast eine Art öffentliche Institution, ja, ich brauchte, ganztags beschäftigt, meinen eigenen Sekretär – es war der Freund Vladimír Hanzel –, was bei jemandem in der Opposition nun in der Tat nicht üblich war. Trotzdem glaube ich nicht, dass ich damals im Stückeschreiben irgendeine außerordentliche Pause hatte. Im Übrigen hat mich unser Umbruch in einer Zeit erwischt, in der ich ein neues Stück schon zur Hälfte geschrieben hatte, wenn auch in einer ersten, noch sehr groben Version.
(4.10.1993)
(…)
5) Am Morgen werde ich eine Stellungnahme zur Situation in Russland abgeben müssen. Die Herren Š. und S. mögen vorbeikommen, wir werden etwas aufschreiben. Der Premierminister hat mich angerufen, er will die Stellungnahmen abstimmen, wir werden uns mit ihm in Verbindung setzen, wenn wir beim Schreiben sind. Vielleicht ruft er aber selbst schon eher an. Oder Zieleniec. Verbinden Sie mich bitte mit ihnen. (…)
9) Den Hecht aus Lány, den ich geschenkt bekommen habe, mögen die Damen M. oder E. sehr originell mit originellen Gewürzen zubereiten für die parlamentarischen Fünf, dass sie das so schnell nicht vergessen. (…)
(17.10.1993)
(…)
2) Möchte bitte jemand aus unseren verschiedenen Aufnahmen und den Aufzeichnungen von Frau B. ein komplettes Protokoll der Gespräche mit Kohl anfertigen. Beim Abendessen haben Sie Aufzeichnungen gemacht (auch da ist einiges Wesentliche gesagt worden, zum Beispiel über Polen). Das wird ein supergeheimes Protokoll, das nur für uns da ist und das wir anderen nur nach sehr reiflicher Überlegung zum Lesen geben.
3) Noch wichtiger ist es, die erste Version der Einladungsbriefe für die mitteleuropäischen Präsidenten anzufertigen. Ich bitte seit Juli darum, es ist höchste Zeit. Am nächsten Wochenende sollte ich sie haben und redigieren. Am nächsten Wochenende sollte ich auch alle Unterlagen für den Brief an Zieleniec, den ich am Wochenende schreiben würde (auf meine Art, ich habe eine Vorstellung wie, nur brauche ich alle Unterlagen dazu, zum Beispiel zu jeder Veranstaltung einige Sätze über ihre Entstehung, den politischen Sinn, die Zusammenhänge usw.).
4) Ich werde versuchen, morgen, also am Sonntag, die Rede für den Vladislav-Saal am 28. Oktober zu schreiben und die Rede zum Gelöbnis. Wenn mir das gelingt, schicke ich sie gleich zur Konsultation. (…)
(24.10.1993)
(…)
2) Ich lege den Text der Rede an die Soldaten beim Gelöbnis am 28. 10. bei. (…) Bitte L., Herrn M. und Gen. T., ihn durchzusehen. Ich bin bereit, kleinere Änderungen (telefonisch) durchzuführen oder zu genehmigen, bitte keine größeren Änderungen im Text vornehmen. Wenn er genehmigt ist, bitte ich V., ihn wie gewöhnlich in großer Schrift auf kleine Karten zu drucken und mir am Nachmittag zu übergeben.
3) Ich bitte V., Herrn D. zu fragen, ob im Vladislav-Saal ein Pult stehen wird oder nicht, und ob es also angebrachter ist, die Rede auf großem Papier oder auch auf kleinen Karten zu haben, und sie mir ebenfalls am Nachmittag zu übergeben.
(14.11.1993)
(…)
Kann überprüft werden, ob die Einladungsbriefe für Litomyšl ordentlich zugestellt worden sind, ob es eventuell irgendeine Reaktion gibt? Gibt es etwas Neues in der Sache Clinton-Besuch? Sollen wir selbst aktiv werden oder nur abwarten? Seinerzeit hat mich der Außenminister aufgefordert, ihm zu sagen, was das Thema des ersten Treffens der außenpolitischen Elf sein sollte. Ich denke, dass es eines von zwei Themen sein sollte: Entschädigung, Dialog mit den Sudetendeutschen und überhaupt die Beziehungen zu Deutschland, oder unser Verhältnis zur Europäischen Union, zur NATO und zur europäischen Integration. Es sollten Formulierungen gefunden werden, die für alle annehmbar sind. Zugleich sollten wir dem Minister den Plan meiner außenpolitischen Aktivitäten präzisieren (Slowenien ist geschehen, München findet nicht statt, die Präsidenten sind nach Litomyšl eingeladen, Präzisierung der Besuchstermine fremder Staatsoberhäupter, evt. meiner Reisen usw.). (…)
(12.12.1993)
(…)
6) Clinton. Die Unterlagen sind sehr gut. Ich bitte Herrn S. und Herrn V., dass sie sich so bald wie möglich – d.h. vor der Ankunft der Vorausdelegation – mit einem Vertreter des Außenministeriums treffen, die Sache mit ihm durchsprechen, weiter erläutern, eine gemeinsame Strategie für die Gespräche mit der Vorausdelegation entwickeln. Mit den höheren Verfassungsorganen möchte ich die Sache, wenn es nicht unbedingt nötig ist, eigentlich nicht mehr konsultieren, sie verursachen nur Chaos. In diesem Zusammenhang bitte ich Herrn V., dass er sich mit Lád’a Kantor oder Michal Prokop in Verbindung setzt. Beide bieten an, dass sie, wenn Clinton in einem Jazz-Club Saxofon spielen wolle, die Reduta freihalten würden, Viklický, Stivín, Hammer und andere sehr gute Jazzer auftreiben werden, mit denen es eine Freude ist zu spielen. (Kantor bietet auch die Teilnahme der Philharmonie in Litomyšl an.) (…)
12) Ich habe die unselige Ahnung, dass der Premierminister beim Rat für Außenpolitik oder per Telefon oder anders den Wunsch haben wird, dass ich ihm die Neujahrsansprache zu lesen gebe. Ich kann nicht behaupten, dass sie noch nicht existiert, aber zugleich möchte ich sie ihm auch nicht geben. Ich bitte darum, eine Strategie auszudenken, wie das zu bewerkstelligen ist, ohne dass es überflüssig konfrontativ ist.
13) Entsprechend den gesammelten Anmerkungen habe ich die letzten redaktionellen Änderungen an der Neujahrsansprache vorgenommen. Ich lege die letzte Version bei. (…)
(18.12.1993)
(…)
7) Heute (d.h. am Samstag) haben mich die Herren Kalvoda und Lux besucht. Es scheint, dass es ein bisschen dicke Luft gibt in der Koalition, das kann schon am kommenden Dienstag bei den Koalitionsgesprächen ausbrechen. Ich habe versprochen, dass ich zur Verfügung stehe, wenn es ernst wird. Wenn sie mich anrufen wollen, ermöglichen Sie ihnen das bitte. Ansonsten wäre es gut, etwas von dem zu erfahren, was hinter den Kulissen der Koalitionsgespräche am Dienstag und der Kabinettssitzung am Mittwoch vorgeht. Meine Priorität: meine Neujahrsansprache soll gut zur Situation passen, soll nicht als Wiederholung von etwas schon Gesagtem oder Reaktion auf die momentane Situation wirken, andererseits auch nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern am ehesten als ein zum rechten Moment artikuliertes «Programm des Staates», soweit möglich unabhängig von den augenblicklichen Parteistreitigkeiten.
(…) 9) Herrn D. bitte ich erneut dringlich, dass er oder jemand anderer, den er benennt, nach Litomyšl fährt. Alle Präsidenten haben bereits ihre Teilnahme versprochen, sogar die Philharmonie bietet sich an, es ist höchste Zeit, damit anzufangen. (…)
(25.12.1993)
(…)
Wenn das ginge, würde ich am liebsten nur dann schreiben, wenn ich den unwiderstehlichen Drang spüre, etwas zu sagen. Einen solchen Zustand werden wir aber kaum erreichen. Jetzt zum Beispiel würde ich mit großer Lust zu einem Thema schreiben, zu dem ich kaum schreiben kann, und schon überhaupt nicht für Indien oder Thailand. Dieses Thema ist – vereinfacht gesagt – die Erneuerung des «Kleintschechentums» in der tschechischen Politik als unsere Version des Postkommunismus. Dieses «Kleintschechentum» würde ich an zahlreichen Beispielen aus unserer Innen- und Außenpolitik illustrieren. (…)
2) (…) Kohl ist es einmal passiert, dass irrtümlich anstelle der richtigen Neujahrsansprache eine aus einem der Vorjahre gesendet wurde. Das droht wohl in unserem Fall nicht. Trotzdem würde ich es sehr begrüßen, wenn Herr Š. die definitive Version der Ansprache vor der Ausstrahlung anschauen könnte, wenn das geht. (…)
5) Wenn es um gar keinen Preis gelingen sollte, einen Kompromiss zwischen den Vorstellungen des Außenministeriums und unseren über den Besuch Clintons zu finden, würde ich es für die beste Lösung halten, dem Minister einen grundsätzlichen und eindringlichen Brief zu schreiben, den ich auch zufaxen würde. Das wäre besser als ein Telefongespräch. Es ist die einzige Art, sie ein wenig in Bewegung zu setzen. (…)
Sehr seltsamer Zufall: gerade hat mich aus Wien der Fürst angerufen mit einer Nachricht von Michael Ž. (…)
Michael scheint ein wenig unglücklich zu sein über die Haltungen und Aktivitäten des Außenministeriums in der Sache des Clinton-Besuchs, und überhaupt über die Atmosphäre um die Sache herum. Das habe ich nur den Andeutungen entnommen. Wichtiger jedoch ist eine andere Sache: Madeleine kommt inkognito einen Tag vor der Ankunft der gesamten amerikanischen Delegation und möchte ein Abendessen (geheim) nur unter sechs Augen mit mir und Michael Ž. Ich glaube, das ist sehr wichtig, nicht nur wegen der inhaltlichen Regie des ganzen Besuchs, sondern auch, weil ich offenbar die neuesten Informationen über den Verlauf des NATO-Gipfels und über die offenbaren und verborgenen Absichten der USA bekomme. (…)
In den achtziger Jahren haben Sie behauptet, ich zitiere: «Ich gebe einer Politik den Vorzug, die vom Herzen ausgeht, nicht von irgendeiner These … Ein Elektriker mit dem Herzen auf dem rechten Fleck kann die Geschichte eines ganzen Volkes beeinflussen.» Haben Sie schon damals angefangen, sich bewusst zu machen, dass alle Ihre Bemerkungen über das Herz im direkten Widerspruch zur praktischen Politik stehen, die in ihren Ergebnissen im Gegenteil sehr pragmatisch sein muss?
Jede Äußerung – Wort, Satz oder Begriff – ist äußerst situationsgebunden und muss in dem Zusammenhang wahrgenommen werden, in dem sie getan wurde. Das, was Sie zitieren, habe ich in einem Essay geschrieben, der sich mit der politischen Bedeutung von sittlichen Haltungen in totalitären Verhältnissen beschäftigt. Darin kann wirklich ein tapferes Wort von Solschenizyn größere politische Kraft entfalten als in demokratischen Verhältnissen die Stimmen von Millionen von Wählern. Aber das nur am Rande. Die Hauptsache ist, dass ich noch heute dahinter stehe. In den letzten fünfzehn Jahren hatte ich nämlich zahllose Möglichkeiten, mich zu überzeugen, wie wichtig es auch in demokratischen Verhältnissen ist, dass die Politik nicht bloße Technologie der Macht ist, sondern wirklicher Dienst am Bürger, ein nach Möglichkeit uneigennütziger Dienst, begründet auf Idealen, der die sittliche Ordnung über uns achtet, die langfristigen Interessen der Menschheit berücksichtigt und nicht nur das, was der Öffentlichkeit in gerade diesem Moment gefällt, und der es ablehnt, sich in ein Spiel der verschiedenen partikulären Interessen oder pragmatischen Ziele zu verwandeln, hinter denen sich schließlich nur eines verbirgt: das Bemühen, um jeden Preis am Ruder zu bleiben. Selbstverständlich: Es ist ein Unterschied, nur unverbindlich zu philosophieren oder wirklich etwas Konkretes in der Politik zu erreichen. Das erkenne ich an. Aber das bedeutet doch nicht, dass die Politik alle Ideale aufgeben, dem «Herzen» entsagen und eine Art technokratischer Selbstläufigkeit annehmen muss.
Nebenbei: Wenn wir uns an Lech Wałęsa erinnern oder an Michail Gorbatschow, die zusammen mit Ihnen wohl am sichtbarsten an den Veränderungen am Ende des 20. Jahrhunderts beteiligt waren, stellen wir fest, dass ihnen nicht viel Dankbarkeit von ihren Mitbürgern zuteil wurde. Warum ist Ihrer Meinung nach Dankbarkeit ein Wert, der nicht in die Politik gehört? Warum wird in der Politik so schnell vergessen?
Ich weiß nicht, ob das die Regel ist, wir können doch auch gerade umgekehrte Erscheinungen sehen: Jemand, der in der Zeit seines politischen Wirkens dauernd und hart kritisiert wurde, kann nach Jahren – am besten nach seinem Tod – zu einer fast vergötterten Gestalt werden, über die nicht ein einziges kritisches Wort verloren werden darf. Wie dem auch sei, das Phänomen des Vergessens oder sogar des Undanks gibt es in der Politik gewiss, und es kann tausend und einen Grund haben. Zum Beispiel: Die modernen Medien leben häufig von Tag zu Tag, von einem verlockenden Aufmacher zum andern, und es ist daher kein Wunder, wenn sie das Heute derart fesseln kann, dass sie darüber jegliches Gestern vergessen. Ja, ich würde sogar sagen, dass sich die Medien manchmal verhalten wie ein launisches Kind; während ich dies schreibe, hat zum Beispiel die Tschechische Republik einen Premierminister, den die Medien für lange Zeit zum weitaus populärsten Mann gemacht hatten, um ihn jetzt vor kurzem innerhalb einiger Tage zum meistgehassten Mann zu machen, wobei weder das eine noch das andere allzusehr mit dem Quantum seiner positiven oder negativen Eigenschaften zusammenhing. Weiter: Manch ein Politiker spielt – dank der Kombination vieler glücklicher Umstände – eine Schlüsselrolle zu einer Zeit, zu der er sozusagen seine Sternstunde hat, wobei das, was er davor oder danach getan hat, nicht immer überhaupt interessant gewesen sein muss. Ist es verwunderlich, dass dieses lange, nicht allzu interessante Leben manchmal die Erinnerung an Verdienste aus jenem einzigartigen Augenblick verdrängen kann? Nicht selten ist allerdings, dass manche Politiker selber – selbstverständlich unwillkürlich – alles dazu tun, den Menschen zuwider zu werden, zum Beispiel indem sie unsinnig hochmütig werden. Auch geschieht es, dass das Wirken von jemandem, der kein Amt mehr innehat, unauffällig von seinem Nachfolger aus der Geschichte radiert wird, bzw. von allen, die sich lieber der Gunst der Herrschenden erfreuen als derer, die nicht mehr herrschen. Eine Rolle spielt auch, dass Politik ein eigenartiger Bereich menschlichen Handelns ist: Selten geschieht es, dass sie ein tatsächlich eindeutig identifizierbares und auf den ersten Blick offensichtliches Ziel erreicht, das sie ein für alle Mal als ihren unstrittigen Erfolg verbuchen kann. Eher ist es umgekehrt: Sie ist ein endlos sich hinziehender Teig, der es einem nie ermöglicht zu sagen: Das Ziel ist erreicht, ich kann es abhaken und mich anderen Dingen widmen. Es ist im Übrigen kein Zufall, dass eher diejenigen vergessen werden, die in Zeiten der Ruhe, der Stabilität und der Ordnung wirkten, als diejenigen, die in auf die eine oder andere Weise umstürzlerischen Zeiten wirkten, wobei es eher zweitrangig ist, wie gut oder schlecht die Rolle war, die sie jeweils spielten. Sie haben aber Gorbatschow erwähnt, das ist ein besonderer und auf seine Weise tragischer Fall: Er hat sich bemüht, den Deckel anzuheben, um ein wenig Dampf aus dem Kessel zu lassen, und es ist ihm offenbar überhaupt nicht eingefallen, dass ein einmal angehobener Deckel für immer wegfliegen kann – wegen der Größe des Überdrucks sogar wegfliegen muss. Sein historisches Verdienst ist riesig – ohne ihn wäre der Kommunismus zwar auch zusammengebrochen, vielleicht aber erst zehn Jahre später und auf Gott weiß welche wilde und blutige Art –, nichtsdestoweniger ist aus offensichtlichen Gründen sein Typ von Verdienst nicht die beste Visitenkarte und kann es nicht sein, für ein politisches Wirken in ganz neuen – und ursprünglich von ihm so gar nicht gewollten – Verhältnissen.
(16.1.1994)
(…)
1) Ich schicke die neue Version der Rede für Indien. Möge Herr Š. so lieb sein und eventuelle grammatische und Rechtschreibfehler (indische Namen) korrigieren. (…)
2) Ich lese in meinem Programm, dass ich Rektoren ernennen soll. Wird da eine Rede nötig sein? Geschrieben oder improvisiert? Ich bin dankbar für eine rechtzeitige Nachricht, damit ich etwas schreiben kann. Wenn jemandem dazu etwas einfällt oder er Informationen dazu hat, soll er mir das aufschreiben.
3) Schon in dieser Woche soll es im Kabinett einen Bericht zu meinem Besuch des Europäischen Parlaments geben. Da werde ich offenbar eine Grundsatzrede halten, die ich auch rechtzeitig schreiben muss. In diesem Fall möchte ich allerdings vom Außenministerium außer den üblichen Unterlagen rechtzeitig (!) auf Papier (!) die ministerielle Vorstellung von dem, was ich da sagen soll. Das Außenministerium selbst hat sich nämlich diese Reise ausgedacht und sie vorgeschlagen. (…)
6) Die Rede für Thailand habe ich nicht geschrieben, ein wenig wegen Zeitnot, hauptsächlich aber wegen schlechter psychophysischer Kondition nach dem Abend im «Na slamníku», der ansonsten schön war und erheblichen Sinn für mich hatte. (…)
(23.1.1994)
(…)
1) Es ist mir gelungen (ich wundere mich sehr darüber), drei Texte zu schreiben: die Rede zur Rektorenernennung, die Rede für Thailand und den Aufruf zum Tag des Theaters. Alle drei haben gemeinsam, dass sie eilig sind. Deshalb möchte ich die Burgmitarbeiter bitten, sich schon am Montag Zeit zu nehmen, die Reden durchzulesen und mit Anmerkungen zu versehen, die ich am Dienstag einarbeiten könnte. (…)
(5.2.1994)
(…)
3) In Hrádeček will ich vor allem die Rede vor dem Europäischen Parlament schreiben. Ich schließe nicht aus, dass ich sie englisch vortrage, wenn sie rechtzeitig übersetzt wird und M. sie mit mir einübt. (…)
4) Das zweite Thema, das ich angesprochen habe und dem ich mich gern in irgendeiner Form widmen würde (Artikel?), ist das Wahlsystem für die höheren Selbstverwaltungsgremien. Dazu wäre es nötig, dass Dr. Ch. es schafft, Herrn Dr. K. dazu zu bewegen, das einst versprochene Gutachten herauszurücken. Die Vorgaben lauten ungefähr so: die Bezirksvertretungen sollten zwischen fünfzehn und dreißig Mitglieder haben (nach Bevölkerungszahl der jeweiligen Bezirke). Ich möchte gern wissen, ob es möglich ist, die Vertretung nach dem von Dr. K. einmal für die Parlamentswahlen vorgeschlagenen kombinierten System zu wählen. Wenn das gehen sollte, müsste jeder Bezirk in die entsprechende Anzahl von Wahlkreisen mit einem Mandat aufgeteilt werden, die – wenn ich richtig rechne – etwa dreimal kleiner als die Wahlkreise für den Senat wären. Das würde eine wirklich gute Möglichkeit der persönlichen Bindung zwischen Wählern und ihren Vertretern bedeuten. (…)
(17.2.1994)
(…)
1) Mit der konzeptionellen, politischen und organisatorischen Vorbereitung der Reise wie auch ihrem Verlauf bin ich über die Maßen zufrieden. Die Reise hatte das, was ich immer fordere, d.h. eine Idee, Ethik, Architektur, Stil, Botschaft usw. Hinter die Kulissen und in das Innere konnte ich verständlicherweise nicht ausreichend sehen, doch schien sie mir sehr gut organisiert zu sein, und sie klappte perfekt. Sie hat in ihrer Bedeutung und in ihrem Verlauf alle meine Erwartungen übertroffen. Ich wiederhole daher meinen Dank und meine Anerkennung allen Mitarbeitern der Präsidialkanzlei, die sich darum verdient gemacht haben. Ich werde mein Lob nicht weiter ausführen und mich nur auf einige Kleinigkeiten konzentrieren, zu denen ich trotz allem kritische Vorbehalte habe, oder die zumindest Gegenstand meines inneren Fragens sind.
2) Mit jedem weiteren Mitglied der Reise wird sie verständlicherweise komplizierter. Deshalb stelle ich mir die Frage, ob wir nicht zu viele waren. Zugleich aber fällt mir niemand ein, der überflüssig gewesen wäre. Herr S. und Herr Š. bildeten meine politische Begleitung, waren bei allem dabei, haben alles notiert, von allem können sie Zeugnis ablegen. Stašek war die Seele der Reise als der hauptsächliche – wenn nicht der einzige – Kenner der Welt, die wir besuchten. Herr Š. kümmerte sich um die Presse wie ein Vater, was alle geschätzt haben. S. kümmerte sich um mich. Vom Protokoll waren es drei. Jemand hat gesagt, drei war die genau richtige Anzahl, die notwendig war, andere wiederum hatten das Gefühl, dass auch zwei Leute gereicht hätten. Ich kann das nicht beurteilen. Iva hat sich um Olga gekümmert, zwei Übersetzerinnen waren unerlässlich, zwei Ärzte angeblich auch (obwohl ich weiterhin glaube, dass auch einer das geschafft hätte).
3) Das Zusammenwirken mit den Ministern und ihrer Begleitung behandeln wir lieber mündlich. Kočárník und Sabela haben viel getan und nichts verkompliziert, sie waren problemlos. Was ihre Helfer getan haben, weiß ich nicht, aber vielleicht war es ja etwas Wichtiges, ich werde das gern glauben. Mit Zieleniec war es komplizierter. Politisch habe ich gut mit ihm zusammengearbeitet, es gab nicht die geringsten Reibungen, im Gegenteil, wir haben uns gut ergänzt. Aber ansonsten hat er eine ziemlich zweideutige Rolle gespielt (hinter den Kulissen Verleumdung aller Leute aus der Präsidialkanzlei, kleinere Hinterhältigkeiten, sein zeitweiliger Ärger darüber, dass er in meinem Schatten steht, seine geringe Kommunikationswilligkeit, Versuche von der Seite, sichtbar zu werden und so weiter und so ähnlich). Ja, ich würde sogar sagen, dass er hinter den Kulissen versucht hat, Kočárník und Sabela ungut zu beeinflussen, damit auch sie mir hin und wieder ein Bein stellen und auch sie gegen die Präsidialkanzlei eingenommen sind).
4) Auf dem Empfang beim thailändischen Premierminister war die ganze Regierung, die Leitung des Parlaments, das gesamte diplomatische Korps, die Leitung der Armee, das höchste Gericht, Banker, Unternehmer usw. usw., also alle, die in diesem Land etwas bedeuten. Trotzdem habe ich bemerkt, dass Tschechen hauptsächlich mit Tschechen zusammenstanden und geredet haben. Das ist sehr unpassend, ja geradezu ungezogen. Wer auch immer aus der Präsidialkanzlei diese Bemerkung als ungerecht empfindet, weil er dort auch mit einem Thailänder gesprochen hat, fühle sich nicht ungerecht behandelt, Ausnahmen bestätigen die Regel, es gilt dies sicher nicht absolut, aber ich hatte einfach das Pech, dass wo immer mein Auge hinfiel, inmitten Dutzender von Thailändern ein Tscheche mit einem Tschechen sprach, wenn er nicht gar ganz allein da stand. (…)
6) Wie Sie alle wissen, bin ich ein Kneipenmensch, bin neugierig auf alles, nichts schockiert mich. Deshalb hat es mir, als ich diese berühmte Avenue in Bangkok entlangging, die Sie alle kennen, im Herzen wehgetan, als ich an den erotischen Gassen vorbeikam. Wie gern hätte ich mir das einmal im Leben angeschaut! Aber ich wusste, dass ich Gast des Königs bin, dass der König von jedem meiner Schritte weiß und dass ich mir das einfach nicht erlauben kann. Warum ich aber davon spreche: Ich halte es nicht für glücklich, dass fast meine gesamte Delegation mit dem Finanzminister an der Spitze die erwähnten Orte besucht hat (…) und sich darüber hinaus dort fotografieren ließ. (…) Was der thailändische König davon hält, weiß ich nicht. (…)
(21.2.1994)
(…)
5) Ich hatte nicht die psychophysische Kraft, die Rede für das EP zu schreiben. Nichtsdestoweniger habe ich wahrhaftig alles gelesen, was ich dazu bekommen habe. Aus den verschiedenen Ratschlägen und Themenvorschlägen geht für mich insgesamt ziemlich klar hervor, was in der Rede enthalten sein sollte: Europa als politische Realität, das eine neue (gewaltlose) Seinsweise sucht. West und Ost. Die geistige (nicht-technokratische) Seite der Integration. Das Problem besteht darin, dass ich genau darüber schon viele Male geschrieben und gesprochen habe. Stört das nicht? Ich habe noch eine Frage: Kann man auch einige Vorschläge vortragen? Die Lektüre aller Dokumente der EG und EU hat mich nämlich davon überzeugt, dass dies ein unglaublich kompliziertes und unübersichtliches Paket ist, lauter administratives Ptydepe, das nur Professionelle verstehen, nicht die Bürger. Das ruft direkt nach der Entstehung einer einfachen Charta der EU und ihrer einfachen, übersichtlichen Verfassung, die dieses ganze Paket in gewisser Weise überdachen oder überwölben (nicht ändern), einfach daraus eine verständliche Sache machen würden. Ebenfalls ist mir eingefallen, dass im Unterschied zu anderen großen europäischen Reichen der Vergangenheit die EU kein klares und einziges Oberhaupt hat und infolgedessen als eine amorphe Missgestalt erscheint, zusammengesetzt aus vielen unterschiedlich miteinander verknüpften Institutionen und Organen. Nötig wäre klarerweise das Amt eines Präsidenten (wenn es schon kein Kaiser sein kann), der rein repräsentativ sein könnte, der aber ein deutlicher Punkt der gesamten Struktur wäre. Vorschlagen kann ihn der Europäische Rat und wählen das Europäische Parlament. Die EU wird eher ein konföderatives Gebilde sein, aber auch ein solches Gebilde soll sein klares Oberhaupt haben, seinen höchsten Punkt. Die EU hat lauter Kollektivorgane und zirkulierende Funktionen, eine typische Erscheinung für Länder vor dem Zerfall (Jugoslawien). Vielleicht ist es nicht passend, solche Überlegungen zu entwickeln, ich erwähne das nur, weil es mir eingefallen ist. Wie dem auch sei, wir müssen uns darüber vor dem nächsten Wochenende, wenn ich die Rede dann schreiben muss, noch beraten. (…)
(27.2.1994)
1) Die Rede für das Europäische Parlament füge ich bei. (…) Termin für eventuelle Anmerkungen ist Montagnachmittag, damit ich sie am Montagabend gegebenenfalls in den Text einarbeiten und den endgültigen Text am Dienstagmorgen zur Burg schicken kann. (…)
5) Noch zur Reise nach Rom und Straßburg: Von Anfang an hatte ich mir vorgestellt, dass es sich um einen kleinen Arbeitsbesuch handelt, keinen monströsen Staatsbesuch, und dass wir alle auch mit einigen Journalisten in die Challenger passen. Ein wenig war ich überrascht, als ich feststellte, wie viele mitfahren und dass wir wieder mit diesem großen Ungetüm fliegen. Ich habe zugestimmt, was sollte ich tun, war doch schon entschieden und mir wurde darüber hinaus erklärt, wie nötig die Teilnahme aller ist. Jetzt lässt sich das nicht mehr ändern, ich gestehe jedoch offen ein, dass mir das je länger desto mehr im Kopf herumgeht. Wir müssen einmal lernen, in kleiner Anzahl zu fliegen! Zum Beispiel zum D-Day will ich auf jeden Fall mit der Challenger und mit minimaler Delegation fliegen. Meine Mitarbeiter sollten wohl verschiedene Funktionen auf einmal erfüllen können, sie sollten austauschbar sein, sollten sich abwechseln, und diejenigen, die irgendwo waren, sollten allen anderen erschöpfende schriftliche Informationen geben, damit die Summe der gewonnenen Erfahrungen zum Besitz aller wird. Je größer die Delegation, desto mehr Arbeit hat sie mit sich selbst und desto mehr Leute braucht sie – und desto mehr kostet das allerdings auch. Ich erwarte, dass die Regierung, die mich, wie bekannt, nicht allzu sehr liebt, früher oder später anfangen wird, mich auf die Größe meiner Exkursionen aufmerksam zu machen. (…)
(Washington, 9.4.2005)
Gestern habe ich mir im Fernsehen das Begräbnis des Papstes angesehen. Es war ein grandioses und beeindruckendes Schauspiel. Den Papst kannte ich, ja, ich wage zu sagen, wir waren Freunde, und vielleicht war ich gerade deswegen nicht fähig, besonders traurig über seinen Tod zu sein. Ich habe nämlich unmittelbar körperlich gespürt, dass er mit großem Frieden in der Seele dorthin geht, wohin – wie er wusste – er zielt: in gute Gegenden. Amerika ist allerdings ein etwas eigenartiges Land. Es ist sehr fromm und erträgt es zugleich, dass die Übertragung des Papstbegräbnisses von Reklame unterbrochen wird, die vielfach genau das verkörpert, was er sein ganzes Leben lang kritisiert hat. Ich habe das wirklich nur mit großen Schwierigkeiten begriffen, immer mehr darunter gelitten, bis ich das Fernsehen schließlich lieber ausgeschaltet habe.
Mit wem und wie haben Sie in den Jahren vor 1989 über Politik diskutiert und wer war Ihr größter Opponent? Worüber haben Sie am meisten gestritten?
In der tschechoslowakischen antitotalitären Opposition, das bedeutet, vor allem in der Charta 77, gab es Leute unterschiedlichster Orientierung, von Trotzkisten über Reformkommunisten, verschiedenen Typen von Sozialisten, denjenigen, die sich zum Liberalismus bekannten, zur Christdemokratie oder zum Konservativismus, bis hin zu vielen, die es ablehnten, sich in irgendeine fertige politische Schublade stecken zu lassen. Alle haben selbstverständlich miteinander debattiert, häufig sehr feurig, aber faszinierend war, dass die Existenz eines gemeinsamen Feindes und eines gemeinsamen, auf die Idee der Menschenrechte gegründeten antitotalitären Programms in bestimmten grundlegenden Dingen alle an einem Strang ziehen ließ. Diese politischen Debatten riefen zwischen ihren Teilnehmern also niemals irgendeine Antipathie, Feindschaft oder das Bedürfnis hervor, einander zu bekämpfen. Zum Beispiel habe ich die unendlichen politischen Streitigkeiten der beiden wohl aktivsten und am engsten zusammenarbeitenden Chartisten in Erinnerung, des katholischen Konservativen Václav Benda und des großen Linken Petr Uhl: Sie waren eine willkommene und manchmal auch ganz spannende Zierde vieler unserer Dissidententreffen oder Partys. Ich selber hatte normalerweise die Neigung, eine Art advocatus diaboli zu spielen, also Argumente zusammenzutragen, die eher zuungunsten dessen sprachen, der gerade in der Übermacht war, als umgekehrt.
(Washington, 9.4.2005)
Vor zwei Tagen war der neue ukrainische Präsident Juschtschenko zu einem Arbeitsbesuch hier. Ich war zu einem größeren Treffen mit ihm eingeladen, sehr freundschaftlich, wo ich frei sprechen sollte. Ich sagte verkürzt das, was ich schon längere Zeit denke: Nach dem Fall des Kommunismus, beziehungsweise des totalitären Systems kommunistischen Typs, trat in der Mehrzahl der Länder des ehemaligen sowjetischen Blocks eine Übergangsphase ein, der man als Arbeitsbezeichnung den Namen Postkommunismus geben könnte. Es ist dies die Zeit einer präzedenzlos schnellen und massiven Privatisierung, noch nicht eingeschränkt von einem festen und bewährten rechtlichen Rahmen, an der natürlich in bedeutendem Maße die ehemalige kommunistische Nomenklatur oder das frühere kommunistische Betriebsmanagement teilhat. Sie haben die entsprechenden Informationen und Kontakte (diejenigen, die ganz außerhalb standen, können sie natürlich nicht haben), was aus ihnen den Kern oder zumindest einen einflussreichen Teil der neuen unternehmerischen Klasse macht. Es sind Menschen, die wissen, dass Demokratie Rede- und Versammlungsfreiheit bedeutet, doch sie verstehen es sehr geschickt, diesen Freiheiten bestimmte Grenzen zu setzen. Das System, dem sie zuneigen, ist dann in Wahrheit nicht offen, sondern tendiert eher dazu, sich abzukapseln. Die wirtschaftliche Macht verbindet sich unauffällig mit der politischen und medialen und es entsteht etwas, was ich einst Mafia-Kapitalismus genannt habe oder was man auch Mafia-Demokratie nennen könnte. (Ich verweise auf Zakaris Unterscheidung von Demokratie und Freiheit oder auf Poppers Analyse des offenen und geschlossenen politischen Systems.) In jedem Land, das sich des Kommunismus entledigt hat, hat dieser Postkommunismus eine andere Gestalt, aber nur wenige entgehen ihm völlig. Mit den Jahren und dem Heranwachsen einer neue «Generation» verliert dann die Öffentlichkeit allmählich die Geduld mit diesem Zustand. Bis sie sich eines Tages auflehnt. Und dann kommt eine Art zweite Generation der Revolutionen oder – genauer – ein Nachspiel der ursprünglichen. Es geht nicht mehr um die Abrechnung mit dem Kommunismus direkt, sondern eher mit seiner Folge – dem Postkommunismus (in dem Sinne, in dem ich hier von ihm spreche). Und so, wie dieser Postkommunismus in jedem Land eine etwas andere Gestalt hat, unterscheiden sich auch die folgenden Aufstände gegen ihn ziemlich: mal können sie die Form überraschender Verschiebungen der Wählerstimmen haben (die slowakische Abrechnung mit dem Mečiarismus), mal die Form friedlichen Drucks von Volksdemonstrationen (Georgien, Ukraine). Die besondere Bedeutung der orangenen Revolution in der Ukraine besteht allerdings nicht nur darin, dass sie sich in einem so großen und wichtigen Land des ehemaligen sowjetischen Imperiums abspielte und für zahlreiche andere, bislang vom Postkommunismus gequälte Länder Inspiration bedeutet, sondern in etwas vielleicht noch Wichtigerem: Diese Revolution gab offensichtlich die Antwort auf die immer noch offene Frage, wo einer der großen Zivilisationskreise der heutigen Welt (der sogenannte Westen) endet und ein anderer beginnt (der sogenannte Osten bzw. Eurasien). Ich erinnere mich – und beim Treffen mit Juschtschenko erwähnte ich es –, wie mich einmal ein bedeutender amerikanischer Politiker fragte, wohin die Ukraine gehöre. Ich hatte den Eindruck, dass sie zu dem gehört, was wir Westen nennen, aber ich sagte es nicht; ich sagte, dies sei eine Frage, über die die Ukraine selber entscheiden müsse. – Hier ist übrigens eine Klarstellung nötig: Wenn heute gesagt wird, man gehöre zum Westen, klingt es wie ein kleines Lob, wird umgekehrt gesagt, man gehöre zum Osten, klingt es oft wie eine kleine Abwertung. Das aber ist nichts als ein typischer Ausdruck westlicher Arroganz. Zum Osten zu gehören ist keine Schande, genauso wie die Zugehörigkeit zum Westen nicht automatisch ein Vorzug ist. Die gegenwärtige globale Welt hat nur dann Hoffnung auf ein gutes und friedliches Leben, wenn sie – unter anderem – auf absolut gleichberechtigter Zusammenarbeit verschieden großer, übernationaler oder regionaler Einheiten begründet ist, die zivilisatorisch, historisch, kulturell und geographisch definiert sind. Unerlässliche Voraussetzung einer solchen Zusammenarbeit nämlich ist die klare Übereinstimmung darin, wo der eine oder andere dieser Kreise anfängt oder aufhört, kurz gesagt, die klare Übereinstimmung über ihre jeweiligen Grenzen. Einzig klar begrenzte und definierte Einheiten können wirklich partnerschaftlich und schöpferisch zusammenarbeiten; jede unklare oder verwischte oder strittige Grenze kann in der Zukunft – ähnlich wie im Falle der Nationalstaaten in der Vergangenheit – nur zur Quelle von Instabilität, Spannung und schließlich auch kriegerischen Konflikten werden. Daher denke ich, dass die Schaffung einer neuen politischen Weltordnung besondere Aufmerksamkeit für das Problem der Grenzen der einzelnen zivilisatorischen Kreise erfordert, ein Problem, das nur dann gelöst werden kann, wenn die einen, die zur Zeit Reicheren, aufhören, sich den anderen, zur Zeit Ärmeren, leicht übergeordnet vorzukommen. Und damit kehre ich zur Ukraine zurück: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich das gesamte Mitteleuropa, aber auch der Balkan, zum Westen bekannt. Das war sicher eine richtige Entscheidung, aus dem richtigen Verständnis der eigenen Geschichte und Kultur erwachsen. Wo aber endet dieser Westen, definiert durch Werte, aber auch geographisch, in östlicher Richtung? Wie kann er mit jedem beliebigen anderen sinnvoll zusammenarbeiten, wenn er sich über die eigenen Grenzen nicht klar ist, d.h. im Grunde über seine eigene Identität? Das berechtigte Gefühl, dass es notwendig ist, sich deutlich auf die gegenseitigen Grenzen neu sich bildender übernationaler politischer Einheiten zu verständigen – und damit über die Grenzen eventueller Erweiterungen ihrer Struktur und Organisationen –, stand offensichtlich im Hintergrund der Frage, die mir jener amerikanische Politiker gestellt hat. Ein Blick auf die Landkarte und in die Geschichte sagt zwar klar, wohin die Ukraine gehört, aber ich habe wirklich gedacht, dass das entscheidende Wort sie selbst sagen muss. Jetzt hat sie es also – zu meiner Freude – getan. Fünfzehn Jahre nachdem die alte Weltordnung zusammengebrochen ist.
In der Zeit nach der Rückkehr aus dem Gefängnis, also nach 1983, haben Sie einen prestigeträchtigen Preis nach dem anderen bekommen: in den Vereinigten Staaten den Preis Obie für ein Schauspiel, das außerhalb des Broadway aufgeführt wurde, 1986 den Erasmus-Preis in Rotterdam, 1989 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels auf der Frankfurter Buchmesse usw. Hatten Sie nicht allmählich die Befürchtung, eher eine politische Ikone zu werden denn ein Schriftsteller zu sein? Dass Sie der Westen mit seinen Auszeichnungen eigentlich aus der Kunst in die Politik vertreibt?
Nur um der Genauigkeit willen: Zweimal habe ich den Preis Obie schon in den sechziger Jahren bekommen, also zu einer Zeit, in der ich bestimmt keine «Ikone» sein konnte. Ich gestehe zu, dass später, das heißt, als ich im Gefängnis war oder nach meiner Rückkehr, verschiedene Doktorate und Preise eher Ausdruck des Respekts vor etwas gewesen sein mochten, das ich meine Geschichte nennen würde, dem Ausdruck der Bewunderung für mein Werk. Ich wurde wahrgenommen als jemand, der von seiner Wahrheit nicht abließ, bereit war, für sie ins Gefängnis zu gehen, dort das Angebot zur Emigration ablehnte, zurückkam und mit genau dem weitermachte, was er vorher getan hatte – das ist doch eine schöne und sehr sinnfällige Geschichte. Ich kann darüber lächeln und mir hundertmal denken, dass ich nicht so schön bin wie meine Geschichte und dass ich also meine Preise nicht unbedingt verdient einsammle, zugleich aber muss ich anerkennen, dass es eigentlich sehr gut ist, wenn eine solche Geschichte überhaupt gesehen, respektiert und ausgezeichnet wird! Einerseits ist es zum allgemeinen Vorteil – als Mittel der Bestätigung bestimmter Werte oder Maßstäbe beziehungsweise des Sinns einer bestimmten Arbeit –, andererseits bedeutet es die sehr konkrete Unterstützung dieser Arbeit, die aufgrund dessen immer ernster genommen wird; wer weiß, ob ich ohne das internationale Interesse meinen Gefängnisaufenthalt überhaupt überlebt hätte, oder ob ich anstelle von fünf nicht hätte fünfzehn Jahre absitzen müssen. Ein wenig anders war die Fortsetzung meiner Geschichte: Die meisten Doktorate und Preise bekam ich erst in der Zeit meiner Präsidentschaft. Damals neigte sich meine Geschichte in fast märchenhafter, wenn nicht gar kitschiger Weise dem Ende zu: der tschechische Honza – obwohl ihm alle gesagt hatten, es habe keinen Wert – ist so lange mit dem Kopf gegen die Mauer gerannt, bis die Mauer tatsächlich fiel und er König wurde und König blieb und blieb und blieb, lange dreizehn Jahre. Ja, diese «Märchenhaftigkeit» konnte selbstverständlich bewirken, dass ich mich einer größeren Bewunderung erfreute und erfreue, als ich es verdient habe, aber auch darüber würde ich nicht lachen. Warum sollten denn nicht gerade solche Happy-Ends hervorgehoben werden? Kann das nicht Quelle der Hoffnung für andere sein, die den Fall der Mauer noch nicht erlebt haben? Welche Gefühle ich dabei habe, ist doch nicht wichtig. Und noch etwas: Diese Preise habe ich unter anderem auch als eine Art Streicheln wahrgenommen, das die unendliche und unsichtbare und erschöpfende Qual aufgewogen hat, die sich hinter dem Präsidententeil meiner Geschichte verbarg.
Sie sind mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Hat es Sie innerlich gewurmt, dass Sie ihn nie bekommen haben?
Jeder wirkliche Mann ist zumindest ein wenig ehrgeizig. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich so tun würde, als ob es mir völlig gleichgültig war, ob ich den Preis bekomme. Selbstverständlich hätte es mich gefreut. Desinteresse oder Verachtung könnten nur der Ausdruck großen Hochmuts sein. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie abstoßend ich es fand, als Jean-Paul Sartre den Nobelpreis für Literatur ablehnte. Vielleicht tue ich ihm unrecht, aber ich hatte damals das Gefühl, dass er sich als Varieté-Rebell aufspielte. In der Zeit des Kommunismus hätte der Preis unseren Kampf erheblich bestärkt, das ist offensichtlich. In der Zeit der Präsidentschaft hätte ich ihn aber mit einer gewissen Verlegenheit angenommen. Ich glaube nämlich, dass Politiker in ihren Ämtern verpflichtet sind, nach Frieden und einer besseren und gerechteren Welt zu streben, sie werden sozusagen dafür bezahlt, und dass es besser ist, wenn den Preis jemand bekommt, der nach etwas Gutem strebt, ohne dass es seine Pflicht ist, und der häufig damit auch ein großes Risiko eingeht. Solche Menschen und ihr Kampf werden durch diese Auszeichnung immer und konkret gestärkt, sie ist also nicht nur eine Auszeichnung für die Vergangenheit.
(Washington, 11.4.2005)
Wir haben ein hübsches Häuschen in Georgetown gemietet. Fast jeden Abend gehen wir hier in irgendeine Kneipe, gestern waren wir in einer mit Madeleine, die um die Ecke wohnt. Vorher waren wir bei Bekannten, die ein schönes Haus mitten in der wilden Natur gleich hinter Washington haben, und davor waren wir mit meinem alten Freund Martin Palous zusammen, jetzt tschechischer Botschafter in den USA, auf einem unglaublichen religiösen Sonntagstreffen. Es waren nur Schwarze da, sie bildeten eine tolle Gemeinschaft, sangen herrlich und kommunizierten in ekstatischem Zustand offensichtlich nicht nur mit dem christlichen Herrgott, sondern durch ihn wohl mit allen Gottheiten, die der Mensch je hatte. Die Atmosphäre des freundschaftlichen Zusammenhalts, gegenseitigen Respekts und der Solidarität war faszinierend. Nach einigen Tagen in Washington scheint es mir überhaupt so zu sein, dass die Menschen hier insgesamt sehr viel angenehmer miteinander umgehen als bei uns. Sie sind geduldig (die Stunden, die sie in den Verkehrsspitzen demütig hinter dem Steuer sitzen, um einige Meter voranzukommen!), rücksichtsvoll (der Charakter der Gesellschaft lässt sich am Verhalten der Autofahrer gegenüber Fußgängern erkennen; ich erinnere mich, wie in Moskau Autofahrer die Fußgänger für Insekten hielten, die entweder zur Seite springen oder überfahren werden), freundlich, verständnisvoll, lächeln; sie haben glatte Haut, die Haare gut geschnitten, es ist zu sehen, dass sie Zeit haben, sich zu pflegen, sie grüßen sich gegenseitig und vor allem – sie sind arbeitsam. Die Menschen arbeiten hier wirklich den ganzen Tag. Nach dem 11. September ist hier offenbar alles viel strenger geworden, man trifft überall auf Bürokratie, Formulare, Polizeikontrollen, Gepäckdurchsuchungen usw., aber was das Interessanteste ist: Überhaupt niemand schimpft darüber, wie das bei uns der Fall wäre, alle begreifen es nicht nur, sondern akzeptieren es auch – jedenfalls scheint es mir so – als Dienst für ihre eigene Sicherheit. Der Polizist wird bei uns – fünfzehn Jahre nach dem Fall des totalitären Systems und Ende des Polizeistaats – immer noch unterbewusst als Feind des Bürgers wahrgenommen; hier nehmen ihn die Leute weit mehr als ihren Beschützer wahr.
Als Dissident haben Sie darüber geschrieben, welches Misstrauen in den Menschen des Sowjetblocks das Wort «Frieden» hervorrief, ganz zu schweigen von der Konstruktion «Kampf für den Frieden». Das war für den Westen eine sehr provokative Ansicht, und trotzdem haben Sie den bedeutenden Olof-Palme-Friedenspreis erhalten. Nicht einmal das kam Ihnen verdächtig vor?
Im Gegenteil! Ich war froh, dass meine damaligen Überlegungen absolut präzise begriffen wurden. Die Kritik des dümmlichen totalitären Missbrauchs des Wortes Frieden ist ja nicht Ausdruck des Widerwillens vor dem Frieden gewesen, sondern nur des Widerwillens vor der Lüge und dem Betrug.
(Washington, 11.4.2005)
Das Zentrum dieser Stadt kommt mir irgendwie vor wie das Ägypten des Altertums: So wie man dort riesige Pyramiden zur Erinnerung an seine Pharaonen gebaut hat, haben auch hier einige der bedeutendsten amerikanischen Präsidenten ihre großen Denkmäler. Einem traditionell unpathetischen, ja, antipathetischen Mitteleuropäer kann das ziemlich lächerlich anmuten, im Grunde ist es aber hübsch: Die Gesellschaft macht auf diese Weise deutlich, dass sie eine Geschichte hat und von ihr weiß, sie achtet, daran denkt, wer diese Geschichte zu schaffen mitgeholfen hat. Zum traditionellen amerikanischen Demokratieverständnis (alle kamen einst mit einem gleich großen Bündel an, also von vornherein ohne irgendwelche Vorrechte) gehört offensichtlich auch Achtung vor den politischen Autoritäten, seien es Funktionen oder Persönlichkeiten. Obwohl man auch hier, wie wir wissen, die Politiker einschließlich des Präsidenten hübsch in die Enge treiben kann. Nicht so viel meiner Bewunderung erntet die historisierende Architektur einiger Regierungsgebäude. Es sind einfallslose Repliken der Antike, gehörig vergrößert (es erinnert an Fellinis vergrößerndes Auge) und entsprechend geistlos. Die moderne Architektur ist hier sehr bunt: Es gibt sehr schöne Bauten zu sehen und auch absolute Beton-Langeweile.
(15.3.1994)
1) Zuerst eine kleine Information über meinen Gesundheitszustand: Den ganzen Samstag, Sonntag und Montag war ich nicht imstande etwas zu tun, nicht einmal lesen. Ich habe nur geschlafen, geschwitzt, mich im Bett hin und her gewälzt und an die Decke gestarrt. Ich hatte auch fürchterliche Fieberträume, zum Beispiel, dass mich S. aufforderte, sofort das Präsidentenamt niederzulegen, denn ich hätte sechs Nachbarländer beleidigt. Heute, d.h. am Dienstag, fühle ich mich zum ersten Mal insgesamt normal, und so beginne ich langsam zu amtieren. Bislang habe ich ausführlich mit Herrn S. gesprochen, mit dem ich bestimmte Dinge verabredet habe. Darüber hinaus habe ich mit Honza Ruml telefoniert, um zu erfahren, was sie mit Schirinowskij tun werden. Die Antwort hat mich zufriedengestellt. Sollten die Journalisten meine Meinung erfahren wollen, bitte keine Stellungnahme ohne Konsultation mit mir herausgeben.
2) In der Zeit, in der ich nicht imstande war, etwas zu tun, nicht einmal lesen, habe ich hin und wieder ein wenig nachgedacht (in den relativ besseren Augenblicken). Ich habe über einige konkrete Dinge nachgedacht, aber hauptsächlich darüber, was man die Konzeption meiner Präsidentschaft in den nächsten Monaten bzw. für dieses Jahr nennen könnte. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass aus der unbestimmten und verschiedengestaltigen Masse meines Tuns regelmäßig in unterschiedlicher Form einige Prioritäten hervortreten sollten, sozusagen meine «Präsidententhemen». Mir scheint es nämlich, als ob mein Präsidentsein – wenn man das so sagen kann – wenig «thematisch» ist. Ich bin zu sehr Objekt des Geschehens, so oder so auf dieses Geschehen reagierend, zu wenig sein Subjekt. (…) Ich habe einfach das Bedürfnis, mich konkreter politisch zu profilieren und konkreter auch die Art und Weise und den Stil meines Präsidentseins zu profilieren. Mit dem ersten Jahr bin ich zufrieden, aber nur unter der Voraussetzung: dass dies kein Vorzeigejahr dafür war, wie ich beabsichtige, bis zum Ende Präsident zu sein, sondern ein Vorbereitungsjahr. Ich gewöhnte mich an den neuen Staat, die neue Stellung als Präsident, die neue politische Situation, ich suchte nach meinem Platz an der Sonne, versuchte, mein Territorium abzustecken, und nicht zuletzt wurde ich den Dreck los, mit dem mich während meines Nicht-Präsidentseins die Regierungspresse bewarf. (…)
3) (…) Daher habe ich das Bedürfnis, Themen zu identifizieren und regelmäßig – auf sehr variable Weise! – auf sie zurückzukommen. Weitere mögliche «Präsidententhemen» aus dem Bereich der Innenpolitik: Energie. Ich sehe hier eine große Absurdität: Wir bauen Temelín, um mehr Energie zu haben – und dabei wollen wir den Energieverbrauch der Produktion vermindern. Wir bauen Temelín, damit die Gewinnung von Braunkohle gedämpft werden und Kohlekraftwerke liquidiert werden können – und dabei schreitet die Gewinnung fröhlich voran, niemand dämpft irgendetwas, die Pläne zur Dämpfung sind minimal, niemand liquidiert die Kohlekraftwerke. Das verlangt nach einer objektiven Analyse, nicht nur aus den Quellen von Minister Dlouhý, sondern auch aus denen grüner Initiativen. Wir wollen in die NATO, behaupten, wie wichtig es ist, der Welt eine aktionsfähige Armee anzubieten – und dabei ist die Armee psychologisch an den Rand des Lebens gedrängt (die Vereidigung darf bloß auf Feldern außerhalb der Stadt stattfinden, als ob wir uns der Armee direkt schämten). Oder: nicht nur den Generalstab besuchen, sondern auch kurze Überfälle der Einheiten veranstalten. Jetzt haben wir eine Kompanie in der Nähe von Sarajewo. Ist das nicht geradezu eine Aufforderung, sie dort für einen halben Tag zu besuchen? Bevor sich Zieleniec oder Baudyš aufmachen? «Präsidententhemen» existieren selbstverständlich auch in der Außenpolitik. Ich zähle nur stichwortartig auf: Seit 1989 befasse ich mich zusammenhängend mit dem, was man europäische Architektur oder Neuordnung Europas nennt. Ich hielt zu diesem Thema Dutzende bedeutender Reden, zuletzt im Europäischen Parlament. Immer jedoch war es in erheblichem Maße ein Werk des Zufalls: Einmal lud man mich in das Hauptquartier der NATO ein, ein anderes Mal in den amerikanischen Kongress, ein anderes Mal vor die parlamentarische Versammlung des Europarats oder auf sein Gipfeltreffen; ich war auf zwei Gipfeltreffen der KSZE, ich habe auf dem Prager Gipfel des Ministerrats der KSZE gesprochen, auf der Konferenz über eine europäische Konföderation usw. usw. usw. Immer habe ich über dasselbe Thema gesprochen, aber immer eigentlich nur, weil mich der Staat irgendwohin ausgesandt hat oder man mich irgendwohin eingeladen hat (auch der Auftritt im Europäischen Parlament war ein Einfall des Außenministeriums!). Sollten wir uns nicht dieses «Präsidententhemas» selber aktiver bemächtigen und ein Programm ausdenken, das es systematisch sozusagen in dramatisch konzipierter Zeit entwickelt, nicht nur in der Zeit, die um uns herum vergeht und Gelegenheiten bietet? (…)
4) Über die Zivilgesellschaft rede ich seit Menschengedenken, über den gemeinnützigen Sektor auch, über die Dezentralisierung auch; über die Möglichkeit, serbische Ziele zu bombardieren, rede ich über ein Jahr, alle waren dagegen, jetzt sind alle dafür, der Angriff wird sogar einen wirklichen Waffenstillstand zur Folge haben, aber niemand erinnert sich daran, dass hier jemand ist, der das vorhergesagt hat. (…)
(17.4.1994)
(…)
4) Irgendwann bald (noch vor dem Großherzog) sollte ich mich auf der Burg mit Herrn D. (eventuell mit weiteren Interessierten, zum Beispiel mit Olga) zusammensetzen und über das Essen, den Service, Bestecke, Art des Servierens usw. reden. Nach einigen Jahren einheimischer und ausländischer Erfahrungen habe ich den Eindruck, dass ich dazu etwas zu sagen habe. Nur so aus dem Ärmel geschüttelt: Je vornehmer und ungewöhnlicher das Essen sein soll, mit dem sie uns beehren, desto mehr ist es ohne jeden Geschmack, sodass man überhaupt nicht weiß, was man isst. Oder eine andere Sache: Eine Menge schönes Silberbesteck wird angeblich von irgendeiner Alten auf der Burg bewacht, die sich weigert, es zur Benutzung herauszugeben, sodass wir bei Bewirtungen mit dem essen, was der Geschmack oder die Geschmacklosigkeit irgendeines Interhoteliers bestimmt. Usw. usw. usw. (…)
(9.5.1994)
(…)
6) Warum macht mir der Computer jedes Mal einen anderen Zeilenabstand? (…) Warum verliebt er sich manchmal in einen Text derart, dass er ihn mir immer wieder druckt, ohne dass man ihn daran hindern kann? (…)
8) Die definitive Zusammensetzung meiner Delegation und Begleitung nach Rumänien, Bratislava, zum D-Day, im Juli in die USA und im September in die USA will ich ausführlich und genau auf der nächsten Programmsitzung abschließen, damit allen längere Zeit im Voraus klar ist, wohin sie fahren und wohin nicht. Ich habe dazu meine Fragen. (…)
(7.6.1994)
(…)
3) Die Außenpolitische Abteilung bitte ich, Dankesbriefe an die englische Königin und den französischen Präsidenten zu schreiben. Die Königin und in einem eigenen Brief Major kann man daran erinnern, dass mir beide versprochen haben, alles dafür zu tun, dass die Königin im nächsten Jahr hierher kommt, dass ich dies also auch in dieser Form noch einmal in Erinnerung rufe und mich darauf freue, dass alles gut ausgeht. (…)
5) Herrn Řechtáček bitte ich, mir das Feuerzeug zu reparieren, zu füllen und zurückzuschicken. (…)
(11.9.1994)
(…)
8) Kalvoda hat versprochen, dass mir sein Amt verschiedene Unterlagen (Argumente) zusammenstellt für die Rede im Parlament, die den Sinn der Reform der öffentlichen Verwaltung betreffen, ihre Idee, ihre Notwendigkeit. Kalvoda ist nicht immer der Zuverlässigste, daher ist es nötig, unauffällig daran zu erinnern und es anzumahnen. (…)
9) Noch zur Zusammensetzung meiner Begleitung in die USA: a) Seinerzeit hat mir T., wenn auch ungern, versprochen, dass nur ein Pistolero mit mir fahren kann. Jetzt sagt er, es müssen mindestens zwei sein. Gut, also zwei. Wird einer davon er selber sein, werde ich das sehr begrüßen. Aber er kann nicht zusätzlich mitkommen, sodass es im ganzen drei sind. Das stünde im Gegensatz zur ganzen Konzeption einer minimalisierten Begleitung. (…)
(23.10.1994)
1) Es ist Sonntag 12.00 Uhr, ich sammle schon seit einiger Zeit Kräfte zum Schreiben der Rede zum 17. November, lese Anmerkungen, die ich erhalten habe, denke darüber nach, wie ich das auffassen soll, und es wird mir immer klarer, dass es ein Treffen mit Studenten sein muss, und nicht mit der Jugend allgemein. Nicht nur, weil mir das nach kommunistischem Klischee riecht (unsere Jungen, unsere Jugend, die Zukunft der Nation, SM