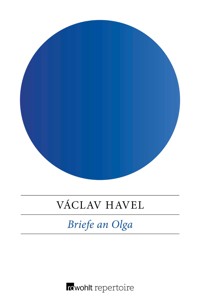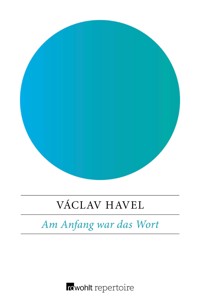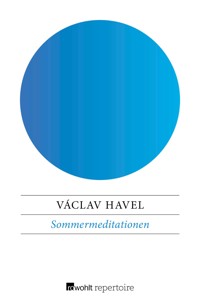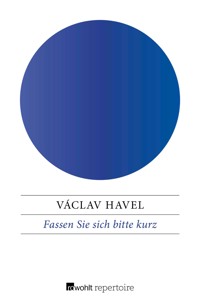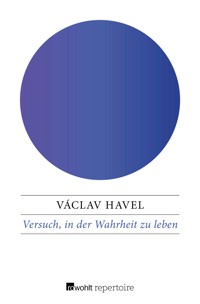
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Niemandem wird geholfen, wenn die Regierung so lange wartet, bis die Menschen demonstrieren und streiken. All dem könnte man sehr einfach durch sachlichen Dialog und durch den guten Willen, auch kritische Stimmen anzuhören, vorbeugen. Solchen Warnungen wurde kein Gehör geschenkt. So erntet die heutige Staatsmacht die Saat ihrer eigenen starren Haltung ... Ich hoffe immer noch, daß die Staatsmacht endlich aufhört, sich wie das häßliche Mädchen zu verhalten, das den Spiegel zerschlägt, in der Meinung, er sei schuld an seinem Aussehen.» Václav Havel, 21. Februar 1989
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Václav Havel
Versuch, in der Wahrheit zu leben
Aus dem Tschechischen von Gabriel Laub
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Niemandem wird geholfen, wenn die Regierung so lange wartet, bis die Menschen demonstrieren und streiken. All dem könnte man sehr einfach durch sachlichen Dialog und durch den guten Willen, auch kritische Stimmen anzuhören, vorbeugen. Solchen Warnungen wurde kein Gehör geschenkt.
So erntet die heutige Staatsmacht die Saat ihrer eigenen starren Haltung ...
Ich hoffe immer noch, daß die Staatsmacht endlich aufhört, sich wie das häßliche Mädchen zu verhalten, das den Spiegel zerschlägt, in der Meinung, er sei schuld an seinem Aussehen.»
Václav Havel, 21. Februar 1989
Über Václav Havel
Václav Havel wurde am 5. Oktober 1936 in Prag geboren. Seiner «bourgeoisen Herkunft» wegen – sein Vater unterhielt bis zur Verstaatlichung 1948 ein gutgehendes Restaurant in Prag – durfte er zunächst kein Abitur machen. Er war als Taxifahrer und Chemielaborant tätig und besuchte das Abendgymnasium, um 1954 das Abitur abzulegen. Da er weder zum Studium der Kunstgeschichte noch zur Filmhochschule oder zur Theaterfakultät der Akademie der Künste zugelassen wurde, absolvierte Havel von 1955 bis 1957 ein Studium der Automation des Verkehrswesens an der Technischen Hochschule Prag.
In diese Zeit fielen auch seine ersten dramatischen und essayistischen Versuche. Havel gehörte zum Kreis junger Dichter um die Literaturzeitschrift «Tvár», die 1965 verboten wurde. Ende der fünfziger Jahre leistete er seinen Wehrdienst ab. Danach war er Kulissenschieber am Prager Theater «ABC», dann arbeitete er im «Theater am Geländer», erst als Bühnenarbeiter, dann als Beleuchter und schließlich als Sekretär, Lektor und ab 1960 als Dramaturg. In diesem Theater wurden auch Havels erste Stücke aufgeführt: 1963 «Gartenfest». 1965 «Die Benachrichtigung» und 1968 «Erschwerte Möglichkeit der Konzentration».
Im Juni 1967 erregte Havel Aufsehen, als er auf dem IV. Schriftstellerkongreß in Prag die Zensur und den Machtapparat des kommunistischen Regimes kritisierte. Er engagierte sich dann während des «Prager Frühlings» 1968 als Vorsitzender eines «Clubs unabhängiger Schriftsteller». Nach der Intervention sowjetischer Truppen erhielt Havel Aufführungs- und Publikationsverbot im gesamten Ostblock. Er verließ Prag und wurde Hilfsarbeiter in einer Brauerei in Trutnova.
In seinem «Offenen Brief an Gustáv Husák», den damaligen Staatspräsidenten, rechnete er schonungslos mit dem System der absoluten «Tiefendemoralisierung» ab und machte den totalitären Existenzdruck des Regimes verantwortlich für die Angst, die die Menschen der Heuchelei, der Depression und der Passivität ausliefere. 1977 wurde die Bürgerrechtsgruppe Charta 77 von Havel und anderen gegründet, die unter Berufung auf die Schlußakte der KSZE-Konferenz in Helsinki Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten auch in der ČSSR forderte. Havel wurde einer ihrer Wortführer und in dieser Rolle mehr und mehr zum «politischen Gewissen» der Nation.
Von März bis Mai 1977 war er inhaftiert und wurde im Oktober 1977 wegen «versuchter Schädigung der Interessen der Republik im Ausland» zu vierzehn Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt. Im Dezember 1977 wurde Havel aus seiner Prager Wohnung ausgewiesen und erhielt nach erneuten Aktivitäten als Bürgerrechtler Hausarrest. Dennoch beteiligte er sich auch weiterhin an der Verbreitung der Werke verbotener Schriftsteller und schrieb neue Bühnenstücke, die nur im westlichen Ausland erscheinen und aufgeführt werden konnten.
Am 29. Mai 1979 wurde er – zusammen mit weiteren Bürgerrechtlern – erneut verhaftet und im Oktober desselben Jahres wegen «Gründung einer illegalen Vereinigung (Komitee für die Verteidigung zu Unrecht Verfolgter) und Aufrechterhaltung von Kontakten zu Emigrantenkreisen» zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Angebot, sein Land zu verlassen, lehnte Havel ab. Daraufhin wurden seine Haftbedingungen verschärft. In dieser Haftzeit entstanden die bewegenden «Briefe an Olga», seine Frau. Im Februar 1983 wurde der erkrankte Havel nach Appellen und Protesten internationaler Organisationen und vieler Schriftsteller in ein ziviles Krankenhaus verlegt. Wenig später wurde der Strafvollzug «aus Gesundheitsgründen» ausgesetzt.
Als Havel am 16. Januar 1989 die Gedenkveranstaltung zum zwanzigsten Todestag des Studenten Jan Pallach mitorganisierte, der sich anläßlich der sowjetischen Intervention während des «Prager Frühlings» selbst verbrannt hatte, wurde er erneut festgenommen und am 21. Februar 1989 zu neun Monaten Haft unter verschärften Bedingungen (für rückfällige Straftäter) verurteilt. Gegen dieses Urteil legten zahlreiche westliche Länder, Organisationen und Gruppen Protest ein. Zum erstenmal erreichten das Regime aber auch Protestschreiben aus sozialistischen Ländern: aus Polen, der UdSSR, der DDR und Ungarn. Auch zahlreiche Künstler und Intellektuelle in der ČSSR selbst protestierten gegen das Urteil. Im März 1989 verkürzte ein Berufungsgericht die Haftstrafe Havels auf acht Monate und hob die «verschärften Bedingungen» auf. Nach Verbüßung der Hälfte seiner Strafe beantragte Havel Haftentlassung, am 17. Mai 1989 entsprach das Gericht seinem Antrag: die vier verbleibenden Monate wurden für achtzehn Monate zur Bewährung ausgesetzt.
Am 15. Oktober 1989 erhielt Havel den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. In der Begründung des Stiftungsrats hieß es, «er habe nie Zweifel daran gelassen, daß er persönlich, selbst unter Verlust seiner Freiheit, für seine Überzeugung einstehe». Von den tschechoslowakischen Behörden erhielt er keinen Paß für die Reise nach Deutschland.
Am 20. November 1989 gründete sich in Prag das Bürgerforum, das eine zentrale Rolle beim Sturz des kommunistischen Regimes spielte. In kurzen Ansprachen auf dem Wenzelsplatz analysierte Václav Havel fast täglich die revolutionäre Umbruchsituation und formulierte die politischen Forderungen des Bürgerforums. Schließlich mußte auch Husák, der sich anfänglich beharrlich geweigert hatte, zurücktreten. Neuer Staatspräsident der Tschechoslowakei wurde am 29. Dezember 1989 Václav Havel.
Inhaltsübersicht
«Der Versuch, in der Wahrheit zu leben», wird hier als Zeichen des Respekts vor dem großen tschechischen Autor in der Reihe rororo Essay wieder aufgelegt. Václav Havels Stimme ist immer weit über sein Land hinaus gehört worden: auch in den langen Zeiten, in denen er eingesperrt war. Seine Stimme und sein Text sind der lebendige Ausdruck des Widerstands und der Hoffnung. Wir stellen dem Essay die knappe Verteidigungsrede voran, die Havel vor Antritt der Haftstrafe am 21. Februar 1989 im Gerichtssaal gehalten hat.
Freimut Duve
Reinbek, 7. März 1989
Die Schlußrede von Václav Havel am 21. Februar 1989 vor dem Prager Gericht
Frau Richterin,
zu den einzelnen Argumenten der Anklage habe ich mich im Verlauf der Verhandlung und der Untersuchung genügend geäußert. Ich werde mich daher nicht wiederholen, will aber meinen Standpunkt zusammenfassen: Mir ist weder Anstiftung noch Behinderung der Dienstausübung eines Mitarbeiters der staatlichen Gewalt nachgewiesen worden. Ich halte mich daher für unschuldig. Ich verlange, daß ich freigelassen werde.
Zu einem Aspekt, von dem bisher nicht die Rede war, möchte ich mich aber gern noch äußern: In der Anklageschrift wird behauptet, daß ich versucht habe, den wahren antistaatlichen und antisozialistischen Charakter der geplanten Versammlung zu verschleiern. Diese Behauptung, die übrigens nicht belegt und durch nichts Konkretes gestützt werden kann, unterstellt meinem Handeln politische Ziele. Das gibt mir das Recht, mich meinerseits der politischen Seite des Vorgangs zuzuwenden. Zunächst muß ich feststellen, daß die Worte «antistaatlich» und «antisozialistisch» schon lange jeglichen semantischen Sinn verloren haben. Sie sind über Jahre hinweg stets als schmähliches Etikett willkürlich auf alle Bürger angewandt worden, die der Macht ohne Rücksicht auf ihre politische Gesinnung – aus welchen Gründen auch immer – unbequem wurden.
In verschiedenen Phasen ihres Lebens sind mit diesen Begriffen sogar drei Generalsekretäre der Kommunistischen Partei der ČSSR charakterisiert worden: Slánský, Husák, Dubček. Heute werden mit diesen Etiketten die «Charta 77» und andere unabhängige Initiativen von Bürgern belegt. Selbstverständlich auch wieder nur deshalb, weil ihr Wirken der Regierung unangenehm ist und diese das Bedürfnis verspürt, sie auf irgendeine Art und Weise zu diskreditieren. Diese rein sprachliche Form der politischen Verunglimpfung hat offensichtlich auch die Anklage gegen mich nicht vermieden.
Was ist nun der wirkliche politische Sinn dessen, was wir machen? Die «Charta 77» entstand und wirkt als eine nichtformelle Gemeinschaft, die sich darum bemüht, zu verfolgen, wie in unserem Land die Menschenrechte respektiert und wie die entsprechenden internationalen Abkommen, beziehungsweise die Verfassung der ČSSR eingehalten werden. Seit zwölf Jahren macht die «Charta 77» die Organe des Staates auf den ernsten Widerspruch zwischen der übernommenen Verantwortung und der politischen Realität in unserer Gesellschaft aufmerksam. Seit zwölf Jahren weist sie auf eine Fülle ungesunder und krisenhafter Erscheinungen hin: auf die Mißachtung von Verfassungsrechten, auf Willkür, Unordnung und Inkompetenz von seiten des Staates. Ich kann mich täglich davon überzeugen, daß die «Charta» mit dieser Arbeit die Meinung eines beträchtlichen Teils unserer Gesellschaft zum Ausdruck bringt.
Seit zwölf Jahren bieten wir der Staatsmacht einen Dialog über diese Dinge an. Seit zwölf Jahren reagiert die Staatsmacht nicht auf unsere Initiative. Statt dessen verfolgt sie uns und sperrt uns ein. Dabei gibt sie heute selbst zahlreiche Probleme zu, auf die die «Charta» bereits vor Jahren hingewiesen hatte und mit deren Lösung schon längst hätte begonnen werden können, wenn auf ihre Stimme gehört worden wäre. Die «Charta» hat immer die Gewaltlosigkeit und die Rechtmäßigkeit ihres Wirkens betont. Ihr Programm war und ist nicht die Organisierung von Straßenunruhen. Nicht nur einmal habe ich öffentlich darauf hingewiesen, daß das Maß an Respekt gegenüber nichtkonformen und kritisch denkenden Bürgern ein Gradmesser für den Respekt vor der öffentlichen Meinung schlechthin ist. Ich habe schon oft gesagt, daß die dauerhafte Mißachtung friedlicher Äußerungen der öffentlichen Meinung am Ende nur immer deutlichere und nachdrücklichere Proteste der Gesellschaft hervorrufen kann. Ich wiederhole hier noch einmal: Niemandem wird geholfen, wenn die Regierung so lange wartet, bis die Menschen demonstrieren und streiken. All dem könne man sehr einfach durch sachlichen Dialog und durch den guten Willen, auch kritische Stimmen anzuhören, vorbeugen. Solchen Warnungen wurde kein Gehör geschenkt. So erntet die heutige Staatsmacht die Saat ihrer eigenen starren Haltung.
Zu einem Vorgang allerdings bekenne ich mich: Am Montag, dem 16. Januar, wollte ich den Wenzelsplatz gleich verlassen, nachdem am Wenzelsdenkmal Blumen zu Ehren von Jan Palach niedergelegt worden waren. Ich blieb schließlich über eine Stunde, vor allem deshalb, weil ich meinen Augen nicht traute. Da geschah etwas, was mir nicht einmal im Traum eingefallen wäre. Ein überflüssiges Eingreifen der Sicherheitskräfte gegen jene, die in Stille und ohne jegliches Aufsehen vor dem Denkmal Blumen niederlegen wollten, verwandelte ganz zufällige Passanten von einem Moment zum anderen in eine protestierende Masse. Mir wurde klar, wie tief die Unzufriedenheit der Bürger sein muß, wenn so etwas geschehen konnte.
Die Anklage wirft mir meine Äußerung gegenüber den staatlichen Organen vor, daß die «Situation ernst» sei. Ich hatte den Vertretern des Staates gesagt, daß die Situation sogar ernster sei, als sie dächten. Aber am 16. Januar habe ich plötzlich begriffen, daß sie sogar ernster ist, als ich es selbst bisher empfunden hatte. Als Bürger, dem daran liegt, daß sich unser Land in Frieden und Ruhe entwickelt, glaube ich fest daran, daß auch die Staatsmacht endlich aus dem, was geschehen ist, Lehren ziehen wird, daß sie einen würdigen Dialog mit allen Teilen der Gesellschaft beginnen wird. Ich glaube, daß sie niemanden von diesem Dialog dadurch ausschließen kann, indem sie ihn als Antisozialisten bezeichnet.
Ich hoffe immer noch, daß die Staatsmacht endlich aufhört, sich wie das häßliche Mädchen zu verhalten, das den Spiegel zerschlägt, in der Meinung, er sei schuld an seinem Aussehen. Darum bin ich überzeugt, daß ich nicht noch einmal erneut ohne Grund verurteilt werde.
Nach dem Urteilsspruch, mit dem er zu neun Monaten Haft verurteilt wurde, erklärte Václav Havel:
Ich fühle mich nicht schuldig, habe daher nichts zu bereuen. Wenn ich bestraft werde, so werde ich meine Strafe als Opfer für eine gute Sache annehmen. Dieses Opfer ist vor dem absoluten Opfer von Jan Palach, dessen Jahrestag wir gedenken wollten, nichtig.
(Aus dem Tschechischen von Jan Pauer)
1
Ein Gespenst geht um in Osteuropa, ein Gespenst, das man im Westen «Dissidententum» nennt.
Dieses Gespenst ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist ein natürlicher Ausdruck und eine unvermeidliche Konséquenz der gegenwärtigen historischen Phase des Systems, in dem es umgeht. Es wurde aus seiner gegenwärtigen Situation geboren, denn dieses System basiert seit langem nicht mehr auf reiner und brutaler Machtwillkür – die jeden nonkonformistischen Ausdruck ausschließt – und auch aus tausenderlei Gründen auf dieser reinen Willkür nicht mehr basieren kann; andererseits jedoch ist es schon solchermaßen politisch statisch, daß es fast unmöglich scheint, einen Ausdruck des Nonkonformismus auf die Dauer in seine offiziellen Strukturen einzubringen.
Wer sind eigentlich diese sogenannten «Dissidenten»? Woher kommt ihre Einstellung und welchen Sinn hat sie? Worin liegt der Sinn jener «unabhängigen Initiativen», in denen sich die «Dissidenten» verbinden, und welche reellen Chancen haben diese Initiativen? Ist es angebracht, im Zusammenhang mit deren Wirken den Begriff «Opposition» anzuwenden? Wenn ja, was bedeutet eigentlich so eine «Opposition» im Rahmen dieses Systems, wie wirkt sie, was für eine Rolle spielt sie in der Gesellschaft, was erhofft sie sich und worauf kann sie hoffen? Liegt es überhaupt in den Kräften und Möglichkeiten der «Dissidenten» – als Menschen, die außerhalb aller Machtstrukturen in der Position von quasi «Untermenschen» stehen –, auf die Gesellschaft und auf das Gesellschaftsystem auf irgendeine Weise einzuwirken? Können sie überhaupt etwas verändern?
Ich denke, daß eine Überlegung über diese Fragen – eine Überlegung über die Möglichkeiten der «Ohnmächtigen» – nicht anders anfangen kann als mit einer Überlegung über das Wesen der Macht in den Verhältnissen, in denen diese «Ohn-Mächtigen» wirken.
2
Unser System wird meistens als Diktatur charakterisiert, nämlich als Diktatur der politischen Bürokratie über eine nivellierte Gesellschaft.
Ich fürchte, daß schon diese Bezeichnung allein – mag auch ihre Verwendung sonst verständlich sein – den wirklichen Charakter der Macht in diesem System eher verschleiert als erklärt.
Welche Vorstellung assoziieren wir mit diesem Begriff? Ich würde sagen, daß er traditionell in unserem Bewußtsein mit der Vorstellung einer bestimmten, verhältnismäßig kleinen Personengruppe verbunden ist, die in irgendeinem Land durch Gewalt die Macht über die Mehrheit der Gesellschaft eroberte; diese Gruppe stützt ihre Macht offen auf direkte Machtinstrumente, über die sie verfügt; man kann sie in sozialer Hinsicht verhältnismäßig leicht von der beherrschten Mehrheit trennen. Zu dieser «traditionellen» oder «klassischen» Vorstellung von der Diktatur gehört wesentlich die Voraussetzung, daß sie vorübergehend, historisch ephemer und unverwurzelt ist; ihre Existenz scheint uns eng mit dem Leben jener Personen verbunden zu sein, die sie eingeführt haben. Es ist in der Regel eine Angelegenheit von eher lokalem Ausmaß und eher lokaler Bedeutung. Unabhängig davon, ob sich so eine Diktatur durch diese oder jene Ideologie legitimiert, leitet sie ihre Macht vor allem von der Anzahl und Ausrüstung ihrer Soldaten und Polizisten ab. Als die größte Bedrohung betrachtet sie dabei die Möglichkeit, daß jemand auftaucht, der in dieser Hinsicht besser ausgerüstet sein könnte und der die herrschende Gruppe stürzt.
Meiner Meinung nach genügt schon ein ganz oberflächlicher Blick, um zu erkennen, daß das System, in dem wir leben, mit solch einer «klassischen» Diktatur sehr wenig gemeinsam hat:
1. Es ist nicht lokal beschränkt, im Gegenteil, es herrscht in einem ganzen riesigen Machtblock, der von einer der zwei gegenwärtigen Supermächte beherrscht wird. Obwohl dieses System selbstverständlich unterschiedliche zeitlich und regional bedingte Besonderheiten aufweist, ist das Ausmaß dieser Besonderheiten grundsätzlich durch den Rahmen dessen begrenzt, was für das ganze Gebiet des Machtblocks verbindlich ist. Nicht nur, daß es überall auf gleichen Prinzipien basiert und auf gleiche Art strukturiert ist (d.h. auf die Art, die von der herrschenden Supermacht entwickelt wurde), sondern es ist auch in allen Ländern durch und durch von einem Netz der Manipulationsinstrumente des Großmachtszentrums durchsetzt und total den Interessen dieses Zentrums untergeordnet.
Dieser Umstand – in einer Welt, in der das «Patt» des nuklearen Gleichgewichts der Supermächte herrscht – gibt ihm freilich eine im Vergleich mit den «klassischen» Diktaturen ungewöhnliche äußere Stabilität: Viele innere Krisen, die in einem isolierten Staat zu einem Systemwechsel geführt hätten, können hier durch Machteingriffe anderer Blockstaaten gelöst werden.
2. Zur Charakteristik der «klassischen» Diktaturen gehört, daß sie historisch unverankert sind – oft erscheinen sie quasi als Laune der Geschichte, als zufälliges Ergebnis zufälliger sozialer Prozesse, beziehungsweise der Neigungen einzelner oder der Massen. Von unserem System kann man nichts Dergleichen behaupten: Obwohl es sich durch seine ganze Entwicklung allen ursprünglichen gesellschaftlichen Bewegungen, die seinen sozialen und gedanklichen Hintergrund bildeten, längst entfremdet hat, bietet ihm doch die Authentizität dieser Bewegungen (ich meine damit die Arbeiter- und sozialistischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts) eine nicht zu leugnende historische Verankerung; dies ist ein gewisser fester Grund, auf den es sich stützen konnte, bevor es sich allmählich zu der neuen sozialen und politischen Realität entwickelte, die es heute darstellt. Als solche hat es sich schon fest in die Struktur der Welt und der modernen Zeit eingefügt. Zu dieser historischen Verankerung gehörte auch die richtige Einschätzung der sozialen Widersprüche jener Zeit, in der die ursprüngliche Bewegung entstand. Daß schon im Kern dieser «richtigen Einschätzung» die Disposition zu der ungeheuerlichen Entfremdung, die die weitere Entwicklung brachte, genetisch angelegt war, ist dabei unwesentlich; übrigens auch dieses Element wuchs organisch aus dem Klima der Zeit, enthielt also auch etwas wie eine eigene «Verankerung».
3. Eine Art Erbe der ursprünglichen «richtigen Einschätzung» ist eine weitere Besonderheit, die unser System von verschiedenen anderen modernen Diktaturen unterscheidet: Es verfügt über eine unvergleichbar konzisere, logisch strukturierte, allgemein verständliche und in ihrem Wesen sehr elastische Ideologie, die in ihrer Komplexität und Geschlossenheit den Charakter einer sekularisierten Religion erreicht: Sie bietet dem Menschen eine fertige Antwort auf jede Frage, und es ist nicht gut möglich, sie nur teilweise zu akzeptieren; wird sie akzeptiert, greift sie tief in die menschliche Existenz ein. In einer Epoche der Krise von metaphysischen und existentiellen Sicherheiten, in einer Epoche der menschlichen Entwurzelung, Entfremdung und der Sinnentleerung der Welt muß diese Ideologie zwangsläufig eine besondere hypnotische Anziehungskraft ausüben: Sie bietet dem irrenden Menschen eine leicht erreichbare «Heimat». Man braucht sie nur zu akzeptieren, und gleich ist alles wieder klar, das Leben bekommt einen Sinn, und es gibt keine Geheimnisse mehr, keine Fragen, keine Unruhe und keine Einsamkeit. Für diese billige «Heimat» muß der Mensch freilich teuer bezahlen: Mit der Absage an seinen eigenen Verstand, sein Gewissen und seine Verantwortung: ein integraler Bestandteil der übernommenen Ideologie ist das Delegieren des Verstands und des Gewissens an die Vorgesetzten, das heißt das Prinzip der Identifizierung des Machtzentrums mit dem Zentrum der Wahrheit (in unserem Fall handelt es sich um eine direkte Anknüpfung an den byzantinischen Cäsaro-Papismus, in dem die höchste weltliche zugleich die höchste geistliche Instanz bedeutete). Es ist zwar wahr, daß diese Ideologie trotz alldem – zumindest im Gebiet unseres Blocks – keinen besonders großen Einfluß auf den Menschen hat (ausgenommen vielleicht in Rußland, wo immer noch das Leibeigenenbewußtsein überwiegt – mit seinem blinden, schicksalergebenen Respekt vor der Obrigkeit und mit seiner automatischen Identifizierung mit allem, was die Obrigkeit behauptet –, kombiniert mit dem Großmachtpatriotismus, für den die Interessen des Reiches traditionell den Interessen des Menschen übergeordnet sind). Dies ist aber nicht wichtig, denn die Aufgabe, die die Ideologie in unserem System hat (davon wird noch die Rede sein), erfüllt diese Ideologie – eben weil sie so ist, wie sie ist – außerordentlich gut.