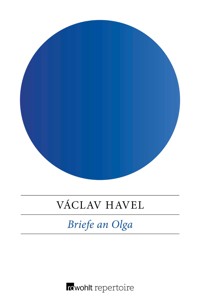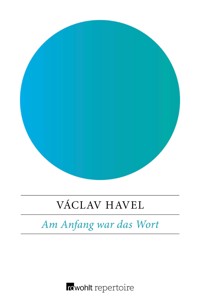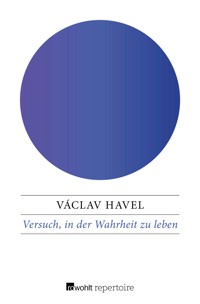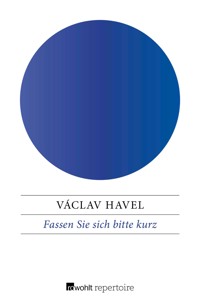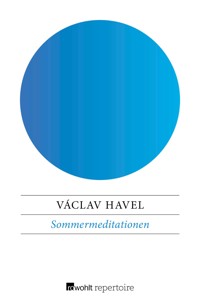
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Er hat es immer der besonderen Verantwortung des Schriftstellers abgefordert, sich nicht nur durch sein literarisches Schaffen in den Dienst der Wahrheit zu stellen, sondern sich auch für die Bürger- und Menschenrechte zu engagieren. Am 29. Dezember 1989 wurde Václav Havel, weltberühmter Dramatiker, Essayist und Dissident, Staatspräsident der Tschechoslowakei. Er, der sein Leben lang «in Konfrontation mit der Macht» gestanden hatte, war plötzlich der höchste staatliche Funktionsträger seines Landes. Damals, so schreibt Havel, sei er von der mitreißenden Revolution an die Spitze des Staates getragen worden, aber inzwischen habe sich die Zeit geändert: Der Karneval der Revolution ist vorbei, «der Himmel hat sich bewölkt, die Klarheit und die allgemeine Übereinstimmung sind verschwunden, und auf unser Land warten nicht geringe Prüfungen». Die hier vorgelegten «Sommermeditationen» sind eine Bilanz der «Prüfungen», die – ruinöse Erblast des totalitären Regimes – den Weg zur Demokratisierung säumen. Aber sie träumen auch von einer Zukunft, in der der «Schock der Freiheit» überwunden, «Gleichmacherei, Uniformität, Anonymität und Häßlichkeit» verschwunden sind und die Bürger Selbstbewußtsein und Selbstachtung wiedererlangt haben, ein Gefühl der Mitverantwortung entwickelt und ein neues europäisches Zuhause gefunden haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Václav Havel
Sommermeditationen
Aus dem Tschechischen von Joachim Bruss
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Er hat es immer der besonderen Verantwortung des Schriftstellers abgefordert, sich nicht nur durch sein literarisches Schaffen in den Dienst der Wahrheit zu stellen, sondern sich auch für die Bürger- und Menschenrechte zu engagieren. Am 29. Dezember 1989 wurde Václav Havel, weltberühmter Dramatiker, Essayist und Dissident, Staatspräsident der Tschechoslowakei. Er, der sein Leben lang «in Konfrontation mit der Macht» gestanden hatte, war plötzlich der höchste staatliche Funktionsträger seines Landes. Damals, so schreibt Havel, sei er von der mitreißenden Revolution an die Spitze des Staates getragen worden, aber inzwischen habe sich die Zeit geändert: Der Karneval der Revolution ist vorbei, «der Himmel hat sich bewölkt, die Klarheit und die allgemeine Übereinstimmung sind verschwunden, und auf unser Land warten nicht geringe Prüfungen».
Die hier vorgelegten «Sommermeditationen» sind eine Bilanz der «Prüfungen», die – ruinöse Erblast des totalitären Regimes – den Weg zur Demokratisierung säumen. Aber sie träumen auch von einer Zukunft, in der der «Schock der Freiheit» überwunden, «Gleichmacherei, Uniformität, Anonymität und Häßlichkeit» verschwunden sind und die Bürger Selbstbewußtsein und Selbstachtung wiedererlangt haben, ein Gefühl der Mitverantwortung entwickelt und ein neues europäisches Zuhause gefunden haben.
Über Václav Havel
Václav Havel (1936–2011) war ein tschechischer Dramatiker, Essayist, Menschenrechtler und Politiker.
Inhaltsübersicht
Für Klaus Juncker
Vorwort
Als zum erstenmal die Idee aufkam, ich solle für das Amt des Präsidenten kandidieren, hielt ich das für einen absurden Scherz: Ich, der ich mein ganzes Leben lang in Konfrontation mit der Macht gestanden habe, der ich auch nicht einen Augenblick lang irgendeine politische Funktion ausüben wollte, der ich immer Wert auf meine Unabhängigkeit gelegt habe und allzu Ernstes, allzu Feierliches, allzu Offizielles überhaupt nicht schätze, sollte jetzt plötzlich ein staatlicher Funktionsträger werden, und noch dazu der höchste!
Knapp einen Monat nachdem diese für mich so schockierende Vorstellung aufgekommen war, wurde ich einstimmig zum Präsidenten meines Landes gewählt. Ich bin es also wahrlich schnell geworden, wahrlich unerwartet, sozusagen von einem Tag auf den anderen. Ich hatte daher auch kaum Zeit zur Vorbereitung auf dieses Amt und zum Nachdenken. Noch wenige Stunden vor der großen Demonstration, auf der Jiří Bartoška im Namen des «Bürgerforums» und der «Öffentlichkeit gegen Gewalt» meine Kandidatur ankündigte, war ich unentschlossen; die Freunde, deren Argumente mich schließlich überzeugten, werde ich lieber nicht nennen. Man kann also sagen, daß mich die Revolution an die Spitze des Staates getragen hat.
Wenn ich heute über all dies mit kühlem Kopf und zeitlichem Abstand nachdenke, wundere ich mich, wieso ich mich damals so gewundert habe. Habe ich doch eigentlich von jeher, wann immer ich mich – gewöhnlich mit der mir eigenen Gründlichkeit – für eine Sache engagiert habe, bald an deren Spitze gestanden – nicht weil ich etwa klüger oder ehrgeiziger als die anderen war, sondern weil ich offenbar mit allen gut auskam, weil ich die Menschen versöhnen und vereinen, wie eine Art Kitt wirken konnte. Es lag also nur in der Ordnung der Dinge, daß ich – obwohl ich formal im Bürgerforum keinerlei Funktion hatte – wiederum als sein Wortführer angesehen wurde und, als die kommunistische Macht so schnell zusammenbrach und auf unseren Aufruf hin der Staatspräsident zurücktrat, ich zur Kandidatur aufgerufen wurde.
Obwohl ich in anderen Dingen durchaus vorausschauend bin, zeigte ich hier, wo es um mich selbst ging, überraschend wenig Voraussicht.
Trotzdem habe ich nicht allzulange gezögert – und das nicht nur, weil zum Zögern keine Zeit war, sondern weil ich die Aufgabe nur als die Konsequenz dessen ansah, was ich vorher getan hatte, also als die natürliche Fortsetzung meines vorausgegangenen bürgerlichen Engagements und meines Wirkens im revolutionären Geschehen des Jahres 1989. Ich hatte schon so lange A gesagt, da konnte ich nicht plötzlich nicht B sagen: Es wäre nicht gerade seriös und verantwortungsbewußt gewesen, sein Leben lang das kommunistische Regime zu kritisieren und dann, wenn es endlich – durch mein Dazutun – fällt, die Teilnahme am Aufbau von etwas Besserem abzulehnen.
Meine erste Präsidentschaft war kurz, vom 29. Dezember 1989 bis zum 5. Juli 1990, und ich verstand sie als einen zeitlich begrenzten Dienst an unserer Sache. Ich habe mich nicht allzusehr mit der Frage gequält, ob ich mich für eine solche Funktion eigne oder nicht, ob mir ihre Ausübung Freude macht oder nicht; ich wurde einfach – in der Atmosphäre der allgemeinen Begeisterung über unsere schnell und elegant gewonnene Freiheit – «vom Sein gezogen»: Ohne Verlegenheit, Lampenfieber und Zögern schaffte ich alles, was erforderlich war. Ich, der ich nie in der Öffentlichkeit aufgetreten war, war fähig, täglich frei auf einigen überfüllten Plätzen zu reden, selbstbewußt mit den Großmächten zu sprechen, vor fremden Parlamenten aufzutreten usw., kurz und gut: so souverän aufzutreten, als ob mich mein ganzes Leben für eine Präsidentschaft geschult und auf sie vorbereitet hätte. Dem war aber nicht etwa so, weil die historische Gelegenheit in mir plötzlich eine besondere Begabung gerade zur Ausübung dieses Amtes entdeckt hätte, sondern weil ich zum «Instrument der Geschichte» geworden war; diese besondere Zeit hat mich einfach in ihren heftigen Wirbel hineingezogen und mich gezwungen zu tun – ohne daß ich für irgendwelche Selbsterforschung viel Zeit hatte –, was notwendig war. Ähnlich war das bei meiner Frau. Ich war angenehm überrascht, mit welcher Selbstverständlichkeit sie, die lange eine Gegnerin meiner Kandidatur gewesen war, ihre neue Stellung und alle daraus folgenden Pflichten auf sich nahm, ihre eigene öffentliche Identität und Arbeit fand, ohne davon negativ beeinflußt zu werden. Wenn auch vielleicht auf andere Weise, so hätten andere an meiner Stelle doch auch kaum anders gehandelt; es gab keine Wahl, und so ist die Geschichte – wenn man das so sagen kann – auch durch mich vorwärtsgestürmt und hat über mein Tun Regie geführt.
Meiner zweiten Wahl gingen ebenfalls nicht viel Verlegenheit und Rätselraten voraus. Ich war der einzige Kandidat. Vorgeschlagen wurde ich von Kräften, die auf ganzer Linie die Wahlen gewonnen hatten, aber auch die Opposition hat in dieser Frage keine andere Meinung vertreten. Ich selber habe keine Anstrengungen unternommen, gewählt zu werden, habe mich aber auch nicht dagegen gewehrt. Eine Ablehnung dieser meiner zweiten Kandidatur wäre allgemein als eine unverständliche Flucht vom Schlachtfeld aufgefaßt worden, wenn nicht gar als Verrat am frisch begonnenen Werk. So war also auch meine zweite Präsidentschaft gewissermaßen nur eine Konsequenz der ersten, ihre gesetzmäßige Fortsetzung, die Erfüllung derselben Aufgabe, die ich schon vorher akzeptiert hatte: diesem Lande beim Übergang vom Totalitarismus zur Demokratie, von der Satellitenstellung zur Unabhängigkeit, von der zentralen Planwirtschaft zur Marktwirtschaft zu helfen.
Inzwischen jedoch – nicht ganz zwei Jahre nach meiner ersten Wahl und einige Monate vor der nächsten Präsidentenwahl (diesmal schon für eine normale mehrjährige Wahlperiode) – hat sich die Situation radikal geändert. Die Zeit der Begeisterung, der Einmütigkeit, des allgemeinen gegenseitigen Verständnisses und der Bereitschaft, der gemeinsamen Sache Opfer zu bringen, liegt weit hinter uns, und ich fühle mich schon lange nicht mehr nur als das fröhlich überraschte Objekt der Geschichte, den «das Sein mitzieht» und der sich voll darauf verlassen kann, daß er in die Richtung gezogen wird, in die alle anderen auch gezogen werden, daß es allen um dasselbe geht, daß also alle automatisch verstehen, worum es ihm geht, und daß er deswegen über sich selbst und sein Programm nicht allzuviel nachdenken muß, denn es ist ja «alles klar».
Die Zeit hat sich geändert, der Himmel hat sich bewölkt, die Klarheit und die allgemeine Übereinstimmung sind verschwunden, und auf unser Land warten nicht geringe Prüfungen.
Es ist die Zeit der schweren Tagesarbeit gekommen, der Widersprüche und der Interessenkonflikte, die Zeit der Ernüchterung, die Zeit, in der alle – und die Politiker vor allen anderen – immer wieder klar und deutlich machen müssen, worum es ihnen geht.
Und so fühle auch ich auf einmal, daß ich meinen Mitbürgern etwas schuldig bin: nämlich ein klares, zusammenhängendes und kurzes Wort darüber, was ich eigentlich will und welche Absichten ich habe. Sicher, ich habe schon Hunderte von öffentlichen Reden gehalten, jede Woche spreche ich die Öffentlichkeit im Rundfunk an, und doch scheint es mir notwendig, meine Überlegungen, Ansichten und Absichten – gerade weil ich sie bisher nur verstreut geäußert habe (wer hat in der täglichen Eile die Möglichkeit, alles zu verfolgen und zu registrieren?) – in einem zusammenhängenderen Ganzen zusammenzufassen. Dieses Buch ist keine Essaysammlung und noch weniger ein politologisches Werk. Es ist eher eine Serie von spontan geschriebenen Anmerkungen darüber, wie ich dieses Land und seine Probleme heute wahrnehme, wie ich seine Zukunft sehe und wofür ich mich einsetzen will.
Die Herrschaft der Gesetze
Unsere drei Parlamente sind im Jahre 1990 für zwei Jahre gewählt worden, die Amtsperiode unserer drei heutigen Regierungen ebenso wie meine als Präsident der Republik war auf diese zwei Jahre begrenzt. Bei vielen westlichen Politikern hat die Entscheidung, die Legislaturperiode auf eine so kurze Zeitspanne zwischen zwei Wahlen zu begrenzen, Erstaunen ausgelöst. Sie meinten, daß man innerhalb von zwei Jahren zwar manches Gute anfangen, aber kaum etwas beenden kann.
Ich bekenne, daß ich einer der Hauptkämpfer für diesen teuflischen Terminplan war. Dabei bin ich von folgender Überlegung ausgegangen: Wir befinden uns in einer Übergangsphase, in der eigentlich alles erst entsteht, angefangen von der staatsrechtlichen Ordnung und dem Verfassungs- und Rechtssystem bis hin zum politischen Spektrum der Parteien. Alles hat den Charakter eines Provisoriums, vieles den Charakter der Improvisation und des Suchens. In einer solchen Situation hielt ich es für notwendig, Handlungs- und Zeitdruck zu schaffen. Jede Verlängerung der ungeklärten und provisorischen Situation würde nur unselige Folgen haben.
Die Hauptaufgabe unserer heutigen Parlamente besteht in der Annahme einer neuen Verfassung. Ich bin davon überzeugt, daß der Zeitdruck sie zu schneller Arbeit zwingt und daß so die Chance besteht, den Grundstein unseres demokratischen Staates innerhalb von zwei Jahren zu behauen und zu legen; hätte das Parlament dafür vier Jahre zur Verfügung gehabt, so würde dieselbe Arbeit sicher auch vier Jahre gedauert haben, ohne daß das Mehr an Zeit eine Garantie für ein besseres Ergebnis gewesen wäre. Der Zustand des Provisoriums hätte sich so über eine unerträglich lange Zeit hingezogen. Man kann nicht so lange im unklaren leben, eine Gesellschaft würde ein derartig unstabiles Provisorium nur schwer ertragen, und der Ruf nach vorzeitigen Wahlen, wodurch er auch immer motiviert sein mag, käme wahrscheinlich immer häufiger. Darüber hinaus waren unsere letzten Wahlen noch keine Wahlen im eigentlichen Sinne des Wortes; sie waren eher eine Art Volksabstimmung, in der zwar die Idee der Demokratie gesiegt hat, wirkliche Demokratie aber noch nicht geschaffen wurde: Die tatsächliche politische Schichtung der Gesellschaft war erst im Entstehen begriffen. Ein differenziertes, ein überschaubares und stabiles Spektrum politischer Parteien existierte noch nicht und konnte auch noch nicht existieren. Daß sich dieses erst während der etwa nächsten zwei Jahre herauskristallisieren würde, war klar; erst dann aber ist die politische Situation zumindest in dem Maße geklärt und reif für wirkliche Wahlen, so wie man sie in entwickelten Demokratien versteht: Die Bürger könnten sozusagen in «Reinschrift» wählen, nämlich gemäß der neuen Verfassung, wobei sie schon – nach einer zweijährigen Übergangs- und «Kennenlern»-Phase – wesentlich bessere Kenntnis von dem hätten, wer wer ist, was eigentlich welche Partei konkret will, welche Persönlichkeiten ihr zur Verfügung stehen, wobei manche von diesen Persönlichkeiten überhaupt erst Zeit hätten heranzuwachsen. Während die vergangene Wahl in erheblichem Maße noch der Ausklang oder die Vollendung unserer Revolution war und daher auch viele revolutionäre Züge in sich trug – einmal habe ich sie sogar «Generalprobe» für wirkliche Wahlen genannt –, könnte die zukünftige, bereits auf ein neues, vernünftigeres und wahrhaft demokratisches politisches und Verfassungssystem gestützte Wahl der Anfang einer stabileren Ära sein. Wenn sich die «revolutionäre Phase» unserer entstehenden Demokratie allzu lange hinzieht und immer neue Improvisationen, einschließlich des Anfügens immer neuer Verfassungsergänzungen an die kommunistische Verfassung, erforderlich werden und nicht einmal etwas so Grundlegendes wie die Verfassung unter Dach und Fach ist, dann besteht die Gefahr, daß Ungewißheit und Chaos in einen Zustand allgemeiner Anarchie, Frustration und damit in eine gesellschaftliche Dauerkrise münden.
Wenn ich bisher in meinem Amt irgendwelche sichtbaren Erfolge erreicht habe, dann immer deswegen, weil ich das Eisen geschmiedet habe, solange es noch heiß war: Wir hätten viele Mißerfolge und Krisen vermeiden können, wenn wir seltener gezögert und einige Dinge nicht unnötigerweise auf später verschoben hätten. Nur ein Beispiel von vielen: Wir hätten dieses langwierige Gezerre um die Bezeichnung des Staates nicht durchmachen müssen, wenn wir nur leicht die parlamentarischen Gewohnheiten verletzt und an dem Tag, an dem ich dies im Parlament vorschlug, die Auslassung des Wortes «sozialistisch» durchgesetzt hätten und wenn wir uns nicht hätten verwirren lassen durch die Erklärung, dies benötige «Zeit». In den anderen postkommunistischen Ländern war man mit diesem Thema in einer Stunde durch!
Wenn ich mir all die Stunden in Erinnerung rufe, die ich im letzten Jahr mit Verhandlungen über die Verfassung verbracht habe, dann jagt mir die Vorstellung, daß diese Verhandlungen nicht durch die Wahl im Jahre 1992, sondern erst durch das Jahr 1994 terminiert gewesen wären, wirklich einen Schrecken ein. Vier Jahre Streiten über die zukünftige Gestalt unseres Staates könnte in unserem Fall bedeuten, daß wir schließlich an deren Ende fast keinen Staat mehr hätten und damit nichts mehr, dem wir eine neue Verfassungsform geben könnten.
Bis heute also bedaure ich nicht, daß wir uns für einige grundlegende Aufgaben nur zwei Jahre Zeit gegeben haben; ich glaube, daß dies eine richtige Entscheidung war. Auch der Vorschlag, daß zumindest der Präsident – als ein gewisser Garant der Kontinuität – für eine längere Zeit gewählt wird, stieß bei mir auf vehemente Ablehnung, und ich habe mich schließlich durchgesetzt. Ich hatte hierfür mehrere Gründe: Ein Staat mit einer anderen Verfassung und einem möglicherweise ganz anders definierten und auch gewählten Präsidenten kann nicht automatisch einen Präsidenten aus der vorhergehenden Ära erben, der noch nach der alten Verfassung gewählt worden ist, und außerdem trägt es zum Erfolg von Veränderungen bei, wenn alle Hoheitsträger ohne Ausnahme von derselben, für alle gleich terminierten Verantwortung gebunden sind.
In fast allen postkommunistischen Ländern fanden früher als ursprünglich geplant, oder häufiger, als es in stabilisierten Demokratien üblich ist, Wahlen statt. Das hängt ohne Zweifel mit der Dynamik der Veränderungen, der Geschwindigkeit der politischen Entwicklung und überhaupt der schneller vergehenden Zeit in diesem Teil der Welt zusammen. Und es ist entschieden besser, einen früheren Wahltermin zu planen als sich dann vom dramatischen Strom der Ereignisse zu vorzeitigen Wahlen zwingen zu lassen.
Die große Bedeutung, die ich der Schaffung und der Annahme der neuen Verfassung zuschreibe, mag dem einen oder anderen übertrieben vorkommen. Ich verstehe das. Jahrzehntelang war es doch völlig gleichgültig, was in unserer Verfassung geschrieben stand, der Alltag der Bürger war davon ohnehin nicht betroffen, und die Verfassung hatte keine Bedeutung für unser Leben. Ob die Kommunisten gerade mal wieder mit härterer Hand regierten oder ob Tauwetter herrschte – alles wurde ohnehin von der Partei bestimmt und dirigiert. Und für sie war es überhaupt kein Problem, alles so einzurichten, daß ihre Diktatur immer in Übereinstimmung mit der Verfassung stand. Daß viele auf dem Hintergrund einer solchen langjährigen Erfahrung die Verfassung für etwas außerordentlich Theoretisches, Abstraktes halten, das vielleicht die Politiker interessiert, nicht aber das alltägliche Leben der Bürger betrifft, ist verständlich. Den Bürgern brennen ganz andere Probleme unter den Nägeln: ob die Preise steigen oder nicht, ob ihr Betrieb vernünftig geleitet wird und gedeiht oder ob in ihm irgendeine Mafia herrscht, die nur am eigenen Vorteil interessiert ist.
Ich begreife solche Reaktionen, weiß aber auch, daß sie falsch sind. Tagtäglich kann ich mich im Gegenteil davon überzeugen, daß in unserer Situation vom entstehenden Verfassungssystem fast alles abhängt oder auf die eine oder andere Weise mit ihm zusammenhängt: ob wir ein oder zwei Staaten sein werden, wer darüber entscheiden wird, wie die Wirtschaftsreform verlaufen soll, welche Menschen unseren Staat leiten und welche Rechte sie haben werden, welchen Einfluß die Bürger auf die Regierenden nehmen können. Schon die Verteilung der Kompetenzen, sei es zwischen der Föderation und den Republiken oder der örtlichen Verwaltung und den Betrieben oder Ministerien, den verschiedenen Bestandteilen der Exekutive, zeigt, daß es im Alltag des Bürgers nichts gibt, was nicht mit der Verteilung der Kompetenzen zusammenhinge. Selbst die Tatsache, ob Züge fahren, wie sie fahren und wieviel die Fahrkarte kostet, hängt entscheidend davon ab, welche Direktion oder welches Ministerium darüber bestimmt oder welche Institutionen die Entscheidungskompetenz an sich ziehen wollen!
Es nützt nichts: Wir stehen am Anfang einer Zeit, in der wieder Gesetze herrschen, und daher beginnt es wieder wichtig zu werden, was für Gesetze wir haben. Und dabei kommt es besonders auf die Verfassung an, von der sich alle weiteren Gesetze ableiten. Das Alltagsleben eines jeden von uns hängt in genau dem Maße von der Verfassung ab, wie es von dem Staat abhängt, in dem wir leben; wird es doch bald wieder die Verfassung sein, die unseren Staat de facto definiert!
Deshalb habe ich für mich selbst ziemlich bald, nachdem ich zum zweitenmal zum Präsidenten gewählt worden war, die Sorge um die Vorbereitung der neuen föderalen Verfassung zu einer meiner Prioritäten, wenn nicht zur wichtigsten überhaupt gemacht. Und deshalb habe ich auch schon zu Anfang dieses Jahres einen eigenen (natürlich nur vorläufigen) Entwurf einer föderalen Verfassung veröffentlicht und begonnen, ihn bei verschiedenen Gelegenheiten zu erläutern.
Die grundsätzliche Frage, um die sich heute die Vorbereitung der föderalen Verfassung dreht und an der sie auch hauptsächlich steckenbleibt, ist unsere staatsrechtliche Ordnung bzw. die Beziehung zwischen unseren zwei Nationen und Republiken, die die Föderation bilden.
Die Mehrheit der Tschechen hat nie begriffen, wie stark der Wunsch der Slowaken nach Eigenständigkeit und deren staatsrechtlichem Ausdruck ist, und die meisten Tschechen waren völlig überrascht, wie ausgeprägt und wie schnell nach unserer Revolution sich dieser Wunsch artikulierte.
Wenn ich über dieses Phänomen nachdenke, welches heute vielen Tschechen als rein irrational erscheint und das manche gar als einen Verrat an der tschechischen Nation und dem tschechoslowakischen Staat begreifen, mache ich mir bewußt, daß ich eine seiner Dimensionen sehr wohl begreife (und besonders gut begreife ich sie immer dann, wenn ich mich in der Slowakei aufhalte): Es ist der insgesamt verständliche Widerstand der Slowaken dagegen, daß sie von anderswoher regiert werden. In ihrer Geschichte sind sie eigentlich immer (mit der unrühmlichen Ausnahme des slowakischen Staates) von anderswoher regiert worden. Und je mehr sie sich ihre nationale Identität bewußtmachten, desto mehr begann sie dies zu stören. Während der gesamten Existenz des tschechoslowakischen Staates wurden sie de facto von Prag aus regiert – und das ist für sie entscheidender als alles andere. Für manche von ihnen ist es weniger wichtig, ob sie gut oder schlecht regiert werden, mit ihrer Beteiligung oder ohne sie, mit Rücksicht auf ihre Interessen oder ohne Rücksicht darauf, wichtiger ist die bloße Tatsache, daß es von anderswoher geschieht. Wann immer die Verhältnisse bei uns in Bewegung geraten, wollen die Slowaken sich auf irgendeine Weise (der Zeit angemessen und der Zeit entsprechend) von Prag lösen. Wobei diese Abnabelung an sich wichtiger zu sein scheint als der politische Kontext, in dem sie stattfindet. Mir ist lebhaft in Erinnerung, wie im Jahre 1968 einige slowakische Intellektuelle die Losung «Erst Föderalisierung, dann Demokratisierung» ausgaben, ohne zu begreifen, daß ohne Demokratie keine wirkliche Föderation existieren kann. Und wirklich: es folgte ein föderalisierter Totalitarismus. (Paradox ist, daß dasselbe, was im Jahre 1968 in der Slowakei die Losung des Tages und das Ziel aller war, nämlich die Föderation, heute von einem Teil der politischen Repräsentanz und der Journalisten als Synonym des «Prager Zentralismus» behandelt wird: «Föderal» ist zum Synonym für «Unterdrücker» geworden; die Föderation wird beinahe aufgefaßt als eine tschechische Erfindung und ein tschechischer Trick zur Einschränkung der slowakischen Mündigkeit.)
Das slowakische Volk ist kleiner; es hatte – im Unterschied zum tschechischen – jahrhundertelang keinen eigenen Staat; die slowakische Gesellschaft war lange im Vergleich zur tschechischen weniger gegliedert und entwickelt; sie hat andere historische Erfahrungen, eigene Modelle des Sozialverhaltens und eine – von den Tschechen häufig nicht wahrgenommene – eigene Lebensart. Das alles bewirkt, daß sich die Slowaken seit der Entstehung des gemeinsamen Staates immer – ohne Rücksicht auf die konkreten politischen Verhältnisse und die konkrete Politik des «Zentrums» – als der vernachlässigte kleinere und schwächere Bruder vorkamen, der dazu verurteilt ist, im Schatten des größeren und stärkeren Bruders zu leben. Ob diese Gefühle sachlich berechtigt oder unberechtigt waren oder sind, ist vom soziologischen oder politischen Standpunkt aus unerheblich, wichtig ist, daß sie existierten und existieren. Verschiedene Bemühungen der Zentralmacht, zur schnelleren Entwicklung der Slowakei beizutragen, verstärkten bei den Slowaken eher den Widerstand gegen die Tschechen (um so mehr, als manche dieser Maßnahmen, vor allem die aus der Zeit des Kommunismus, sehr zweifelhaft waren); wer das nicht versteht, lese William Fulbrights «Arroganz der Macht»: Der Autor erklärt dort, warum die Amerikaner in Ländern, denen sie zu helfen bemüht waren, verhaßt sind; dies ist eine sehr lehrreiche Lektüre nicht nur für Slowaken, sondern mehr wohl noch für Tschechen.
Es scheint in der Slowakei nicht um Widerstand gegen die Tschechen als solche zu gehen, sondern um den Widerstand gegen ein Zentrum der Macht, das über die Slowakei regiert, aber irgendwo außerhalb ihres Territoriums liegt – und dazu noch auf dem Gebiet ihres stärkeren oder größeren oder älteren oder reicheren Bruders. Dieses wird so nachhaltig als negativ empfunden, daß Tatsachen und sachliche Argumente nicht hinreichen, um dieses Gefühl zu konterkarieren; die zentralen Behörden in Prag könnten voller Slowaken sein – ändern würde sich dadurch nichts. Ein in Prag wirkender Slowake gilt als jemand, der seine Herkunft verraten hat, als jemand, der sich hat kaufen lassen, entschieden aber als ein «weniger authentischer» Slowake, und dies sogar auch dann, wenn er zuvor möglicherweise sehr vehement in Namen slowakischer Interessen um seinen Sitz in Prag gekämpft hat.
Diese slowakische Empfindlichkeit, die einfach existiert, ob nun der Sitz der zentralen Macht Prag, Budapest, Warschau oder Brüssel heißt, ist mir absolut verständlich, und mir ist klar, daß auch dann, wenn die tschechoslowakische Föderation aufrechterhalten bleibt, auch wenn sie tatsächlich gerecht ist und mit der Zeit das Vertrauen der Slowaken gewinnt, die Slowakei immer noch lange schwer daran tragen wird, daß die Hauptstadt der Föderation Prag heißt, grundlegende Entscheidungen mithin also anderswo getroffen werden. Ich fürchte sogar, daß diese tief verwurzelte Bitterkeit auch dann nicht verfliegt, wenn ein Teil der föderalen Institutionen nach Bratislava umzöge. In den Augen der Slowaken wäre dies wahrscheinlich eine bloße Prager Geste, ein Scheinopfer, das an der dominanten Stellung Prags im Grunde nichts ändert.
Die Slowaken wollen die Tschechen nicht regieren. Sie empfinden sich einfach als eine mündige Gemeinschaft, die über ihre Angelegenheiten zu Hause entscheiden will – und ein solcher Wille ist legitim trotz des primitiven, fremdenfeindlichen und in seinen Folgen selbstmörderischen Nationalismus, von dem er begleitet zu werden pflegt. Alle Völker mußten die Phase ihrer nationalen Selbstbewußtwerdung durchmachen und die damit verbundene Phase des Kampfes um die eigene Staatlichkeit, und sie mußten ihre eigene nationale Souveränität erfahren, erleben und verdauen, bevor sie reif genug waren zu begreifen, daß die Teilnahme an übernationalen Einheiten, die auf dem Bürgerprinzip beruhen, nicht nur ihre nationale Identität und Souveränität nicht unterdrückt, sondern sie im Gegenteil in einem gewissen Sinne verlängert, stärkt und kultiviert. Die Tschechen sind in dieser Hinsicht, scheint es, weiter als die Slowaken, nicht etwa, weil sie von Natur aus einer entwickelteren Spezies angehören, sondern ausschließlich wegen der ein wenig unterschiedlichen Geschichte, zu der – unter anderem – auch gehört, daß sie die Tschechoslowakei – weitaus mehr als die Slowaken – immer als ihren wirklichen Staat wahrgenommen haben; sie haben ihn sogar häufig in einer so egoistischen, überheblichen und gefühllosen Weise als den ihren wahrgenommen, daß sie die Slowaken geradezu dazu getrieben haben, ihn nicht als den ihren annehmen zu können. (Deshalb hat auch die Idee der tschechischen Staatlichkeit, über die heute aufgrund der slowakischen Entwicklung immer häufiger gesprochen wird, in Böhmen bislang keine große Resonanz, ja für manche hat sie überhaupt keinen Sinn: so sehr ist für sie in Gedanken die tschechische Staatlichkeit schon mit der tschechoslowakischen eins geworden.)