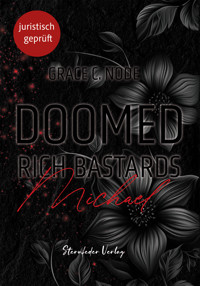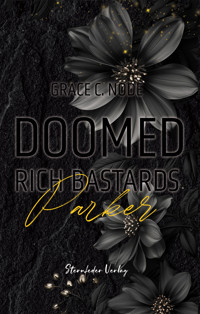3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
X-Mas war noch nie so HOT! Er ist wahnsinnig sexy … Aber viel zu jung! Er ist definitiv ultra-heiß … Aber: ER IST ZU JUNG! Diese verdammten Vorurteile kotzen mich echt an! Denn ausgerechnet die schärfste Frau der Welt – meine Kollegin – hat damit ein Problem. SHIT! Ich lernte früh, meine Träume zu verwirklichen ohne verdammtes Vitamin-B, was dich nur zum Laufburschen anderer degradiert. Meine Leidenschaft ist es, Menschen zu helfen und ich bin verflucht gut darin. Doch meinen versnobten Eltern ist das ein Dorn im Auge und damit ein fucking Problem. Von all dem weiß Laila – die Frau meiner schlaflosen Nächte – nichts, denn sie denkt, ich sei ein Weiberheld, ein Abenteurer und Womanizer. Tja, damit liegt sie sowas von daneben. Ich bin kein Kostverächter, Gott bewahre. Aber wenn zwei Menschen sich aufeinander einlassen, sich vertrauen, wird es TIEFER, INTENSIVER, EPISCHER, als man es sich in seinen wildesten Träumen vorstellen kann. Genau das will ich mit Laila haben. Sie meint, mir widerstehen zu können. O Honey, du hast ja keine Ahnung … Die bittersüße X-Mas-Story und damit der Auftakt der Vancouver Wild Boys Reihe Vorwissen aus der Bad Boys of Vancouver Reihe ist nicht zwingend notwendig, jedoch empfehlenswert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
FCKNG X-mas
Grace C. Node
Buchbeschreibung:
Vorurteile pflastern seit jeher den Weg von Jeff Douglas, der gegen das elitäre Image seiner Eltern sowie dem permanenten Gerücht, er sei der größte Schürzenjäger aller Zeiten, ankämpfen muss.
Wenig hilfreich ist, dass er trotz seines taffen Auftretens in seinem Freundeskreis und auf der Arbeit auch noch der Jüngste ist.
Aber Taten sagen mehr über einen Menschen aus, als bloße Worte und ein Kerl wie Jeff ist nicht nur ein echter Kumpel, sondern setzt sich für humanitäre Werte und Gerechtigkeit ein.
Und dann ist da noch die Frau, die Jeff seit langem bewundert: Laila Rodriguez. Allerdings ist sie zehn Jahre älter, und hat den strikten Vorsatz, das junge Männer zwar Spaß, allerdings auch jede Menge Ärger bedeuten.
Jeff rettet Laila aus einer bedrohlichen Situation, und damit legt er unwissentlich den Grundstein für eine Freundschaft, die er nicht für möglich gehalten hat.
Aber wird es nur platonisch oder schafft er es, Lailas Regeln zu brechen?
Band 1 der Vancouver Wild Boys Reihe
Über den Autor:
Neugierige Wortaktrobatin, mutiger lebenshungriger Schöngeist, Film-Junky und Book-Nerd.
Die Kombination aus Romantik, Thriller und jeder Menge Spannung gewürzt mit einer ordentlichen Prise Gefühlschaos - das ist meine Welt.
Gefühlsfeuerwerk, Kopfkino und dramatische Twists garantiert.
Für Suchtgefahr nach mehr Lesestoff übernehme ich keine Haftung!
GRACE C. NODE
1. Auflage, 2022
© 2022 Grace C. Node – alle Rechte vorbehalten.
Grace C. Node
c/o Autorenservice Gorischek
Am Rinnergrund 14/5
8101 Gratkorn
Österreich
Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung von Grace C. Node.
Coverdesign: Nessunomas
Bildquelle: (lizensiert)
Korrektorat/Lektorat: Marina Ocean, Grace C. Node
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek:
https://portal.dnb.de/opac.htm
Das Buch ist rein fiktiv. Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Sämtliche Inhalte dieses E-Books und seiner Teile sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentlichen Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Grace C. Node die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
An alle, die mit Vorurteilen zu kämpfen haben:
Lasst euch nicht davon unterkriegen!
Denn wer auf Voreingenommenheit vertraut, ist eurer Freundschaft unwürdig.
Für Ela!
Danke, dass du den wundervollen Liam Sullivan erschaffen hast.
Er ist etwas ganz Besonderes.
Prolog
Als die Tür hinter mir ins Schloss fiel und mir die eiskalte Winterluft entgegenschlug, atmete ich erleichtert aus und stürmte zum Auto. Keine Sekunde länger als nötig wollte ich hier sein, denn dass sie derart herablassend über meinen Berufswunsch herzogen, gab mir den Rest. Ignoranz und Hochmut – zwei Eigenschaften, die mir verhasst sind und mir eben mit voller Wucht entgegengeschleudert wurden. Und das am Weihnachtsabend.
Die Reisetasche mit den hastig gepackten Klamotten landete auf dem Rücksitz und als ich einstieg, hörte ich die anklagende Stimme meiner Mutter hinter mir.
Scheiß drauf!
Ich sah ihre dunkle Silhouette vor dem hell erleuchteten, mit dezenter Weihnachtsdekoration versehenen Herrenhaus, das ich vor nicht mal einer Minute geschworen hatte, nie wieder zu betreten, im Rückspiegel, und richtete meinen Fokus stur auf die Straße vor mir. Sie wollen aus mir einen Arschkriecher und Speichellecker machen – keine Chance.
Ein Douglas zu sein verpflichtet dich Arzt oder Jurist zu werden, und ist gleichbedeutend mit Cocktail-Partys, auf denen es darum geht, möglichst viele wichtige Kontakte zu knüpfen, um in den elitären Kreisen gut gelitten zu sein. Man will ja schließlich dazu gehören. Empathie, Fürsorge oder gar Liebe – Fehlanzeige.
Bis zu meinem zwölften Lebensjahr verlebte ich eine gute Kindheit. Meine Eltern waren streng, aber gerecht. Dachte ich. Denn ab da hieß es nur noch: Der Beste zu sein. Alles wurde zum Wettbewerb, zu einem ewigen Vergleich und einem immer währenden Kampf. Meine Eltern leisteten in dieser Hinsicht ganze Arbeit, da ich mich bis zum Schulende ihre Ideale erfüllte und in ihrem wenigen Lob sonnte. Ein kleiner elterlicher Bonus.
Seit ich die Schule mit Bestnoten beendet und das Studium begonnen habe, war die Schonzeit allerdings vorbei. Sehr gut war nicht genug – ich musste exzellent sein. Fehler wurden bestraft. Mit Ablehnung, Maßregelung und den fortwährenden Predigten, was es bedeutet, die Nummer zwei zu sein – ein Versager. Und der eisige Hauch von Verachtung lag permanent in der Luft. Meine Mutter mutierte zu einer herrischen, kalten Frau, die mir nichts außer den eisernen Regeln der Douglas-Familie vortrug und jegliche emotionale Bindung ablegte. Mein Vater wahrte Distanz, hielt mir Vorträge, wie wichtig es sei, seinen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und das erreiche man nur durch Disziplin, harte Arbeit und dem Fokus auf dem Ziel: Einfluss und Geld.
Doch Menschen zu helfen, steht eindeutig nicht auf der Agenda der Familie.
Zum inneren Kreis meines Vaters beispielsweise gehören Richter, unzählige Firmenchefs und weitere wohlhabende Klienten, die ihm ein utopisch hohes Honorar für seine juristischen Winkelzüge zahlen, um ihren elitären Arsch zu retten, weil sie mal wieder gegen Gesetze verstoßen haben.
Meine Mutter rühmt sich als Ärztin für Orthopädie und Inhaberin mehrerer Röntgeninstitute, Reha-Zentren und Laboratorien für Mikrobiologie einer unzähligen Gefolgschaft an Gleichgesinnten, die sich eine goldene Nase verdienen. Ihr Bestreben, mich mit der Tochter einer dieser Familien ihres Freundeskreises zu verkuppeln, habe ich vehement unterbunden – sehr zum Verdruss meiner Eltern.
Nachdem ich ihnen zwischen der alljährlich an Weihnachten aufgetischten Hummersuppe und dem edlem Rehragout erzählte, ich wolle mich nach dem Medizinstudium bei Ärzte ohne Grenzen verpflichten, flippten sie aus, schimpften mich einen Taugenichts und fragten, wie ich so dumm sein könnte, mein Talent und Potential derart zu vergeuden. Im Klartext: Wieso ich für einen Hungerlohn arbeiten wolle, wo doch eine renommierte Praxis für die Reichen und Schönen auf mich warten würde, die sie mir bei einem ihrer Freunde in dessen Institut besorgen wollten. Alles war bereits geplant. Sogar die Inneneinrichtung, da es wichtig sei, zu zeigen, was man hat, wie Mom pikiert betonte.
Ich widersprach, erklärte meine Ziele, meinen Lebenstraum, doch ich stieß auf taube Ohren. Egal welche Argumente ich anführte, sie schalten mich einen Tagträumer und unterstellten mir, ich hätte den Fokus verloren. Wie falsch sie damit lagen.
Nie war mir etwas klarer.
Der Weihnachtsabend endete in einem Fiasko, und ich konnte es nicht ertragen, wie abfällig sie schon seit jeher über die ›armen Schlucker von angestellten Ärzten‹ debattierten, wenn wir uns über mein Medizinstudium und meine bevorstehende Karriere unterhielten. Eigentlich war es mehr eine sich ständig wiederholende Vortragsreihe meiner Eltern, die in mir ein weiteres Aushängeschild ihrer bisherigen Laufbahn sahen. Zu keinem Zeitpunkt nahmen sie meine Zukunftspläne überhaupt wahr, geschweige denn konnten sich dazu herablassen, Medizin als das zu würdigen, was sie ist: Ein Weg, um Menschen zu heilen.
Eine Woche später schmiss ich das Medizinstudium und schrieb mich bei der Royal Canadien Army als Feldsanitäter ein. Ein Schlag ins Gesicht für meine Eltern, da sie es als unter der Familienwürde empfanden, einen Job beim Militär abzuleisten. Scheiß auf den Abschluss, scheiß auf das Geld – es geht mir darum, Menschenleben zu retten, und wo könnte man damit besser anfangen als in der Army?
Ein Jahr später | Weihnachten
»Douglas, schwing deinen Arsch hier her. Sofort!«, brüllt mein Sergeant, der mit zwei Männern meiner Einheit Deckung vor dem einsetzenden Kugelhagel in einem zerbombten Ziegenstall gesucht hat. Wir eskortieren einen UNICEF-Hilfsgüterkonvoi durch ein Krisengebiet und kamen in einen Hinterhalt der hiesigen Rebellen. Ein Offizier der begleitenden US-Einheiten war so dumm, eine Diskussion eskalieren zu lassen, und schon fielen die ersten Schüsse.
Einer der Jungs schreit erstickt auf, sein Gesicht blass, die Augen zusammengekniffen und die blutverschmierte Hand auf seine Bauchwunde gepresst. Sofort knie ich neben ihm. Mit geübtem Blick scanne ich seinen Körper nach weiteren Verletzungen ab, doch zum Glück ist es die Einzige.
»Hey, sieh mich an«, lenke ich die Aufmerksamkeit des Kameraden auf mich. »Ich werde die Weste entfernen und mir das ansehen, okay?« Ohne seine Antwort abzuwarten, schiebe ich eine Mullbinde unter seine Hand, die sich sofort rot färbt. Als wir ihm die schusssichere Weste abnehmen, brüllt er vor Schmerzen. Ich reiße das T-Shirt auf, um mir die Verletzung genau ansehen zu können. Er krallt sich in meinen Arm, doch ich nehme ihn resolut weg, denn ich muss arbeiten – ihn retten.
»Die Kugel steckt in der Wunde. Ich werde sie rausholen. Das wird höllisch wehtun«, instruiere ich den Verletzten, der mich mit schmerzverzerrtem Gesicht anstarrt.
»Scheiße, es ist jetzt schon unerträglich«, faucht er atemlos.
»Hier, draufbeißen!« Ich schiebe ihm eine Gummibeißschiene zwischen die Zähne. »Wenn sich ein Stofffetzen in die Wunde gebohrt hat, muss ich ihn ebenfalls entfernen, sonst stirbst du an einer Blutvergiftung.«
Der Lärm des Gefechts umgibt uns wie das stetige Surren eines Wespenschwarms und ich blende alles aus, während ich mich auf meine Aufgabe konzentriere und ihm die Mullbinde wegnehme.
Dunkles Blut quillt aus der Wunde.
»Du hältst ihn fest. Egal wie sehr er schreit«, weise ich einen anderen jungen Soldaten eindringlich an, der mit großen Augen auf das viele Blut starrt. »Hey! Hast du verstanden?«
»Äh, ja, Sir«, stammelt er ängstlich.
»Dann wollen wir mal.« Mit der Spreizzange öffne ich die Wunde ein wenig. Die Kugel ist zum Glück nicht zu tief eingerungen. Sollte also schnell gehen. Der Verletzte brüllt auf, lässt fast die Beißschiene aus dem Mund fallen und verdreht die Augen. Mein Helfer hat Mühe, den armen Teufel festzuhalten, damit ich ihn mit meinem Besteck nicht zusätzlich verletze. Die Luft ist stickig, der aufgewirbelte Staub erschwert mir die Arbeit und der Lärm ist kaum zu ertragen. Der Gestank von Urin und Blut, der von meinem Patienten ausgeht, ist nichts Neues für mich, doch mein Helfer ist kreidebleich und ich bete inständig, dass er einen widerstandsfähigen Magen hat. Entschlossen setze ich mich auf die Beine des Verletzten, damit ich mit dem unangenehmen Teil meiner Arbeit beginnen kann.
Vorsichtig drücke ich die gebogene Pinzette in die Eintrittswunde, ertaste mit deren Spitze die Kugel und ... Mist, sie rutscht mir weg.
Mein Patient zittert vor Anstrengung und sein ersticktes Wimmern ist ein sicheres Zeichen, dass er kurz vor einer Ohnmacht steht.
»Gleich geschafft, Kumpel«, spreche ich ihm Mut zu, und spreize die Pinzette erneut.
Mein Helfer stöhnt auf, als ein Schwall Blut mitsamt der Kugel aus dem Körper kommt. Er dreht sich würgend zur Seite und kotzt in den Sand.
Schnell suche ich den Stofffetzen, doch er ist nicht dabei. Hier habe ich keine Chance, das winzige Teil zu finden, und ohne Narkotika werde ich den Kerl kein zweites Mal überreden können, mich in seiner Wunde stochern zu lassen. Also verbinde ich ihn, damit der Blutverlust nicht zu groß ist, doch wir müssen im Stützpunkt den Stofffetzen entfernen und mit zwei, drei Stichen nähen.
»Sergeant, der Verletzte muss ins Lazarett.«
»Verstanden.« Es wird eine Trage herbeigeschafft, und wir hieven den nun ohnmächtigen Kameraden darauf, um ihn zu einem der Humvees zu bringen. Das Feuergefecht erstirbt in vereinzelten Salven, bis wieder Ruhe einkehrt. Die spürbare Spannung der Männer flaut merklich ab, wobei ich mir den mit Staub und Blut vermischten Schweiß von der Stirn wische.
Der Konvoi sammelt sich und zieht weiter zu seinem Bestimmungsort, in ein etwa fünf Meilen entferntes Flüchtlingslager, das die Hilfsgüter dringend benötigt. Ein Weihnachtsgeschenk der UNICEF. Dort angekommen, melde ich mich bei dem diensthabenden Feldarzt, der den Verwundeten an einen seiner Kollegen übergibt, und ich werde umgehend zur Versorgung einer Gruppe Kinder eingeteilt, die dehydriert und abgemagert auf Pritschen verteilt in dem großen Zelt liegen.
Ein stinknormaler Arbeitstag.
Zwei Jahre später
Man könnte meinen, ich wäre sprunghaft – bin ich nicht. Ich bin nur gradlinig. Leider lege ich mir damit selbst Steine in den Weg, denn ich ertrage es nicht, wenn in humanitärer Hinsicht mit zweierlei Maß gemessen wird.
In den letzten beiden Jahren habe ich mehr Leben gerettet, Wunden genäht und Knochen gerichtet als jeder praktizierende Arzt in seiner friedvollen Praxis und doch bin ich keiner von ihnen. Aber das ist in Ordnung. Denn ich weiß, was ich kann und fachlich macht mir niemand etwas vor. Und genau da liegt das Problem.
In einem Kampfeinsatz wurde einer der Jungs schwer verwundet und ich übernahm die Erstversorgung als Feldsanitäter. Zurück in der Basis entschied einer der leitenden Ärzte, die von einer Kugel durchschlagene Hand des Verletzten nur zu klammern, was ein Fehler war. Hätte er die Operation, die ich vorgeschlagen hatte, bekommen, wäre die Hand des Soldaten voll funktionsfähig geblieben. Der diensthabende Chefarzt wimmelte meinen Vorschlag kaltlächelnd ab, da ich in meinem Alter angeblich weder die fachliche Kompetenz noch die hinreichende Erfahrung hätte – zu dem Zeitpunkt war ich vierundzwanzig.
Was für ein lächerlicher Vorwand.
Nun hat der arme Kerl drei steife Finger und ist dienstuntauglich, denn eine Waffe wird er mit der Hand nie wieder führen können.
In meiner Naivität beschwerte ich mich über den Arzt und seine inkompetente Entscheidung bei unserem Commander. Das Ergebnis: Ich erhielt eine Abmahnung wegen Missachtung der Befehlskette und der Denunzierung eines ›geschätzten‹ Kollegen. Ich war der Schandfleck der Truppe, denn man verpetzt keine Kameraden. Als der Junge mit der verpfuschten Hand zwei Wochen später transportfähig war, bot ich an, ihn zurück nach Kanada zu begleiten, was mir niemand verwehrte. Sicher waren sie froh, mich auf diesem einfachen Wege loszuwerden.
Durch meine gute Arbeit und den damit verbundenen Ruf konnte ich die Hand meines Schützlings ohne Aufwand in einem Militärkrankenhaus röntgen und bot ihm an, seine Hand zu operieren. Zwar hatte ich kein schickes Diplom an der Wand hängen, dafür wusste jeder, wie gut ich in dem war, was ich liebte: Menschen medizinisch zu helfen.
Zwei meiner Freunde auf der Basis halfen mir bei dem Eingriff. Wir konnten zwei seiner Finger retten, und mit vernünftiger Krankengymnastik, etwas Geduld und Zeit sollte er zumindest eine Chance haben, die Hand wieder einsatzfähig zu bekommen.
Anstatt dass mich diese Aktion rehabilitierte, trat sie mir mächtig in den Hintern, denn das ›Wunder‹ sprach sich schnell herum, was der Chefarzt, der die Hand verpfuscht hatte, gar nicht gut hieß, und ich flog aus dem Dienst.
Wut und Frust führten mich in die Kampfsport-Szene Vancouvers, in der ich vor der Army bereits recht gut unterwegs war. Einer der Jungs im Studio erzählte von einem Limousinen-Service, der auch Personenschützer ausbilde und da ich eh nichts Besseres zu tun hatte, schieb ich mich dort ein.
Darin bin ich sogar so gut geworden, dass ich von einer großen Investmentbank engagiert wurde, die Herren der Chefetage durch die Gegend zu chauffieren. Manchmal ist sogar etwas Action dabei, wenn es bei den ausschweifenden Partys rund geht, und ich gebe zu, dass es mir insgeheim ein diebisches Vergnügen bereitet, den feinen Schnöseln in den gestelzten Arsch zu treten.
Die Arbeitszeiten sind mies, die Bezahlung schlecht, aber immerhin ist es ein Job, der mich neben dem als Türsteher im Red Continental Club über Wasser hält. Dort brachte ich vor einem halben Jahr einen Bekannten unter, den ich im Boxverein kennen und schätzen gelernt hatte: Scott Tyrell. Er machte mir Mut, dass es da draußen noch ehrliche Männer gibt, die weder korrupt noch selbstherrlich sind. Das, sowie der freiwillige Dienst in einem der Kinderheime, bei dem ich neben Gute-Nacht-Geschichten auch ein aufgeschürftes Knie reinige, Nasenbluten stoppe oder den gebrochenen Arm richte, geben mir das Gefühl, etwas Gutes zu tun.
Auch wenn es nicht viel ist.
Kapitel 1
Heute | Februar
Heilige Scheiße! Was für ein Rasseweib. Mühevoll bringe ich meine entgleisten Gesichtszüge unter Kontrolle, als unsere Chef-Barkeeperin, Laila Rodriguez, in all ihrer glorreichen Weiblichkeit an uns vorbei stolziert und mir mit dem sinnlichsten Hüftschwung aller Zeiten den Verstand raubt. Bekannt für ihr feuriges Temperament und ihre scharfe Zunge liegen ihr die Männer praktisch zu Füßen und ihr Lächeln reißt jeden Kerl vom Hocker. Mich eingeschlossen.
Sie setzt ihre Reize pointiert ein, macht damit jede Menge Umsatz an der Bar und sollte ihr jemand ungebeten zu nahe kommen, nun, dann wird sich derjenige ihrem uneingeschränkten Zorn gegenüber sehen. Auf dumme Sprüche hat sie immer eine passend freche Antwort parat, was manchen in die Flucht schlägt, den ein oder anderen allerdings auch anstachelt, die bildhübsche Latina aus der Reserve zu locken. Doch wer so unvorsichtig ist, mit ihr ein Trinkduell einzugehen, weil er glaubt, leichtes Spiel mit ihr zu haben, wird schnell eines Besseren belehrt. Schon so einige Kerle hat sie unter den Tisch getrunken – sehr zur Belustigung unseres Teams.
Aber ihre Trinkfestigkeit ist keinesfalls der Punkt, der mich an Laila fasziniert. Vielmehr sind es ihr gutes Herz, die Ehrlichkeit und ihre Prinzipien, welche – neben der Tatsache ihrer optischen Vorzüge – seit jeher mein Interesse geweckt haben. Mit ihr kann man Pferde stehlen, sie ist ein echter Kumpel und gleichzeitig die heißeste Versuchung aller Zeiten. Eine teuflische Mischung, wie ich finde.
Wir arbeiten im angesagten Red Continental Club im Herzen Vancouvers, in dem sich nicht nur Einheimische, sondern auch gutsituierte Gäste und Promis von außerhalb vergnügen, wenn sie hier Urlaub machen.
Heute ist jedoch ein ganz normaler Freitagabend, an dem das Partyvolk das Wochenende einläutet. Unser Team ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen, der eingespielt und harmonisch den Laden schmeißt. Der Security-Chef und gleichzeitig mein Freund Scott Tyrell hat den Laden im Griff und ich bin dankbar, hier an den Wochenenden etwas Geld dazu verdienen zu können.
»... die Kisten aus dem Keller ... Jeff, hörst du mir überhaupt zu?«, reißt mich Holly aus meiner Laila-Fantasie. Die charmante Blonde ist ein echter Wirbelwind und steht seit langem hinter dem Tresen des Red Continental.
»Sorry, was hast du gesagt?«, entschuldige ich meine geistige Abwesenheit, was sie mit einem breiten Grinsen kopfschüttelnd zur Kenntnis nimmt.
»Whiskyflaschen, Keller ...«
»Ja klar. Bin schon unterwegs«, rufe ich ihr über die Schulter zu und stürme Richtung Keller. Dass sie mich beim Träumen erwischt hat, ist mir peinlich und ich hoffe, es war nicht zu offensichtlich, wem meine Schmachterei galt. Ich schnappe mir eine Kiste mit Whiskyflaschen sowie einen Karton Tequila und bringe beides zur Hauptbar, an der Laila bereits mitten in den Vorbereitungen auf den heutigen Gästeansturm steckt. Als ich die Kisten hinter der Theke abstelle, wirft sie mir einen kessen Blick zu.
»Du wirkst abgelenkt. Ist etwas passiert?«
Mit einem unschuldigen Lächeln auf den Lippen schüttele ich den Kopf. »Nein, hab nur viel um die Ohren«, entgegne ich.
»Halten dich deine Eroberungen wach?«, schmunzelt sie, aber in ihrem Blick funkelt etwas auf, das nicht nur bloße Neugier ist.
»Wenn wäre es eher umgekehrt«, schieße ich zurück und sie verdreht schnaubend die Augen.
»Na klar. Große Sprüche klopft ihr Jungs ja immer. Aber wenn es um Tatsachen geht, ist Hängen im Schacht.«
Ihre gezielte Provokation amüsiert mich, also spiele ich ihr Spielchen mit. »Ich reiße weder große Sprüche, noch habe ich es nötig, dick aufzutragen.«
»Natürlich nicht«, seufzt sie theatralisch und ich verkneife mir ein Lachen.
»Willst du herausfinden, ob ich meine Versprechen halte?« Dabei mache ich instinktiv einen kleinen Schritt auf sie zu und sehe ihr direkt in die dunklen, mandelförmigen Augen. Ohne den Blickkontakt zu unterbrechen, kommt sie mir entgegen, und mir stockt der Atem, wobei ich einen Hauch ihres betörenden Parfüms erhasche.
»Du bist so niedlich, wenn du meinst, einen auf starken Kerl machen zu können«, murmelt sie mit einem sinnlich verruchten Unterton in der Stimme, bei dem es mich in den Fingern juckt, mit einer Hand in ihre dunklen Locken zu packen und sie zu mir zu ziehen. Ein tendenziell herablassender Ausdruck huscht über ihr Gesicht, als sie die Hand hebt. »Das ist eine Nummer zu groß für dich, befürchte ich.«
Laila flirtet gerne und es ist normalerweise ein ausgeglichener Schlagabtausch, da sie kein Blatt vor dem Mund nimmt, was ich höchst erfrischend finde. Aber ihre Unverschämtheit schreit förmlich nach einem Dämpfer.
Mit einem Satz bin ich bei ihr, stehe ganz nah vor ihr, sodass sie zu mir aufblicken muss und ich könnte schwören, dass die Luft zwischen uns kurzzeitig vibriert. Sie hat die Theke im Rücken und wenn ich wollte, könnte ich sie zwischen meinen Armen gefangen nehmen, was ich jedoch nicht tue. Das wäre vermessen und unangebracht. Aber alleine die Tatsache, dass ich so dicht vor ihr stehe, hat sie ein wenig aus dem Konzept gebracht. Bevor sie etwas erwidern kann, beuge ich mich zu ihrem Ohr.
»Du kannst mich testen. Egal wann, egal wo, egal wie«, raune ich ihr zu und ihr scharf eingezogener Atem ist mir Antwort genug.
Um die Situation zu entschärfen, trete ich zwei Schritte von ihr weg, greife mir die Whiskyflaschen und räume sie in die Regale unter der Theke. Von der Stille neugierig angezogen, blicke ich zu Laila, die noch an derselben Stelle steht, und sich keinen Millimeter bewegt hat. Gerade, als ich fragen will, ob alles bei ihr in Ordnung ist – denn ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn sie sauer auf mich wäre – hebt sie eine Augenbraue und wendet sich dem Spülbecken zu.
Unsicher, ob ich vielleicht doch zu weit gegangen bin, beobachte ich sie verstohlen, entscheide mich dann aber dafür, ihr etwas Raum zu geben, und gehe zu den Jungs, um die heutige Einteilung an der Tür noch mitzubekommen.
Um einundzwanzig Uhr ist Einlass und vor der Absperrung tummeln sich jede Menge gutgelaunter Menschen, die darauf warten, endlich den Club stürmen zu können. Heute bin ich für die Stichproben verantwortlich, was bedeutet, mir jeden genau anzusehen, ihn bei Bedarf beiseitezunehmen, um seine Taschen zu durchsuchen und Personalien zu überprüfen. Auch wenn wir im hochpreisigen Segment der Clubs rangieren, gibt es genug Kriminelle und Verrückte da draußen, die einem gehörig den Abend vermiesen können, wenn wir nicht richtig aufpassen.
Als endlich der Einlass gewährt wird, strömen die Leute lachend und aufgedreht in den Club. Jack und einer der anderen Jungs begrüßen die Gäste, die an mir vorbei zur Kasse gehen. Die erste Viertelstunde passiert nichts, doch dann weckt eine kleine Gruppe Männer, die alle in dunkler Kleidung in der Schlange stehen, meine Aufmerksamkeit. Natürlich wollen wir zahlende Gäste, und ein Kerl, der einer Lady einen Drink ausgibt, ist immer gut fürs Geschäft. Doch die Vier sehen irgendwie nach Ärger aus.
»Jack, die dort zu mir«, instruiere ich meinen Kollegen, der mit einem kurzen Nicken meinen Wunsch bestätigt. Sobald die Gruppe die nächsten in der Reihe zum Einlass ist, stellt sich Jack zu mir.
»Guten Abend die Herren. Wir würden Sie bitten, kurz hier zu uns zu kommen«, lotse ich die Gruppe von den Kassen weg, wobei einer der Vier mich abschätzig taxiert, ein zweiter schnaubend den Kopf schüttelt und die beiden anderen keine Miene verziehen.
»Gibt es ein Problem?«, will einer der beiden wissen.
»Nein, reine Routinekontrolle«, antworte ich souverän, ohne mein Gegenüber aus den Augen zu lassen.
»Was macht der hier für’n Aufstand?«, mault der Überhebliche, bekommt ein siegessicheres Grinsen seines Freundes zugeworfen und ich wappne mich für eine Verbalattacke.
»Wir prüfen nur, ob Sie Waffen bei sich tragen. In dem Fall könnte ich Sie leider nicht in den Club lassen«, erkläre ich unsere Absichten, was einer der Männer mit einem Schnauben abtut, während ein anderer mich angafft, als hätte ich ihn aufgefordert nackt durch Vancouver zu laufen.
»Der Kleine scheint ’ne mächtig große Lippe zu riskieren, was Hugh«, grollt ein anderer, doch Hugh, der Kerl, der mir der Vernünftigste von der Truppe scheint, sieht mich müde lächelnd an.
»Kommt schon Jungs, er macht nur seinen Job.« Damit hebt er die Arme, und ich taste ihn fachkundig ab. Auch die Hosenbeine prüfe ich, denn ich kenne den Trick mit dem Messer im Socken nur zu gut.
»Das harte Teil ist keine Kanone, Kleiner«, raunt Hugh mir zu und ich verbeiße mir einen giftigen Kommentar. War klar, dass so etwas kommt.
»Sauber, der Nächste«, fordere ich die Truppe auf. Einer nach dem anderen lässt sich von mir abtasten und Jack nimmt die Personalien von Hugh auf, der erstaunlich kooperativ ist.
Als alle durchgecheckt sind, wünsche ich ihnen einen schönen Abend und deute auf die Kasse. Bevor der Aufmüpfige der vier einen blöden Spruch loslassen kann, zieht ihn Hugh breit grinsend von mir weg und sie verschwinden in der Menge.
»Die waren ganz schön großkotzig«, bemerkt Jack nachdenklich und ich funke Scott an.
»Jeff, hier. Hör mal, da ist gerade eine vierer Gruppe Männer, alle schwarz gekleidet, rein. Wir haben sie überprüft, waren sauber, aber ich wollte trotzdem Bescheid geben. Irgendwas sagt mir, dass sie Ärger machen könnten.«
»Verstanden. Ich halte die Augen offen«, gibt Scott durch. Er geht immer auf Nummer sicher, was seiner Zeit beim US-Militär geschuldet ist. Mein Kollege ist ein echt harter Hund, dem man nicht blöd kommen sollte, doch er hat ein großes Herz und einen noch größeren Beschützerinstinkt. »Wie läuft es sonst da vorne?«
Rasch werfe ich einen Blick auf die Schlange, die sich bisher noch nicht wesentlich verkürzt hat. »Wir werden Full House haben, denke ich.«
»Alles klar. Wir sehen uns gleich.«
Nachdem der Ansturm überstanden ist, lasse ich die Jungs vorne alleine und drehe eine Runde durch den Club. Natürlich führt mich mein Weg an der Bar vorbei, an der Laila mit ihren Kolleginnen und Kollegen wirbelt und ich gönne mir einen Augenblick, sie zu beobachten. Ihre Energie überträgt sich auf das Team, es herrscht eine gelöste Stimmung und das fördert das Geschäft. Bevor ich wieder in irgendwelche Laila-Fantasien abrutsche, setze ich meinen Weg fort.
Die Schicht verläuft ruhig, sogar ziemlich ereignislos, und wir können planmäßig um fünf Uhr die letzten Gäste verabschieden. Mit einem Pling-Ton erreicht mich eine Message, dass ich einen neuen Job bei meinem Fahrdienst habe, was bedeutet, dass etwas Geld in die Kasse kommt. Zwar würde ich lieber mehr im freiwilligen medizinischen Dienst machen, aber außer einer warmen Mahlzeit gibt es da nur den humanitären Gedanken, der zählt. Mal sehen, welchen schrägen Vogel ich diesmal herumkutschieren darf.
Kapitel 2
»Was ist denn mit Tyrell los? So hab ich ihn ja noch nie erlebt«, brummt Jack einige Wochen später, als er mir bei der heutigen Schicht über den Weg läuft.
»Wieso? Was ist denn passiert?«, will ich wissen.
»Er wirkt noch angespannter als sonst und hat sich bei Laila einen Drink nach dem anderen genehmigt.«
Verblüfft reiße ich die Augen auf. Wenn es eines gibt, was Scott nie tun würde, dann ist es während des Dienstes trinken. Das hat er uns allen mehr als deutlich eingebläut und ich finde diese Regelung vollkommen gerechtfertigt. Immerhin müssen wir gegebenenfalls schnelle Entscheidungen treffen und mit einem benebelten Verstand ist das kaum möglich.
»Wo steckt er jetzt?«
Jack deutet in Richtung Bar. »Ich schätze, er will Laila erweichen, ihm noch einen einzuschenken«, grinst er amüsiert, da er genau weiß, dass Laila äußerst rigoros sein kann, wenn sie es für nötig erachtet.
»Hmm, das sehe ich mir mal an«, schmunzle ich und mache mich auf zur Bar.
Schon von weitem höre ich Scotts sonore Stimme grollen. »Schätzchen, an deiner Stelle würde ich mich um die Gäste kümmern. Nicht, dass es noch Beschwerden wegen des mangelnden Services gibt.«
Laila hält Scott am Arm gepackt und glüht förmlich vor Wut, während er sich von ihr befreien will, doch stehe ich ihm dabei im Weg. Die beiden scheinen in eine hitzige Debatte vertieft gewesen zu sein und ich beschließe, dem ganzen Spiel ein Ende zu setzen.
»Hast du mal ’ne Minute?«, lenke ich Scott daher ab. »Dauert nicht lange.« Ein Blick auf Laila, die sich die Flasche Scotch geschnappt hat, und ich deute in Richtung Büro und damit raus aus der Gefahrenzone. Scott wirkt aufgebracht, was für ihn höchst untypisch ist, da er sonst die Ruhe selbst und hochkonzentriert ist. Dass Jack sein unkonventionelles Verhalten mitbekommen hat, ist bedauerlich, was gleichzeitig bedeutet, dass der Rest der Truppe ebenfalls Wind von seiner augenscheinlichen Schwäche bekommen haben wird.
Energisch schiebe ich ihn in den Gang zum Privatbereich. Er scheint eine klare Ansage nötig zu haben, um den Scheiß, der ihn aus der Bahn wirft, rational beurteilen zu können.
Also die Bad-Ass-Methode.
»Egal, was es ist, krieg’s in den Griff«, fahre ich ihn daher an, was ihn stutzen lässt.
»Du solltest jetzt gut überlegen, was du als Nächstes sagst«, warnt er mich mit einem lauernden Unterton in der Stimme, doch das ignoriere ich. Vielmehr ist das die Vorlage für meinen Konter.
»Alter, wie oft hast du jeden von uns angemacht, dass die Bars während der Schicht tabu sind. Und jetzt willst du dich vor aller Augen besaufen?«, ziele ich auf seine eigenen Regeln und die damit verbundene Vorbildfunktion ab, denn Scott würde jedem von uns den Arsch aufreißen, wenn wir im Dienst auch nur einen Schluck Alkohol trinken würden. Den Stier bei den Hörnern packen – mal sehen, ob das wirkt.
»Na und? Wie du richtig erkannt hast, bin ich der Boss und ...«
»Du fährst jetzt heim und ich regele das hier, klar!?« Ich schiebe ihn ins Büro, damit er seine Sachen einsammelt, um sich dann ein Taxi zu rufen, doch Scott ist ein sturer Mistkerl, der es keinesfalls duldet, dass man ihn bevormundet. Wutentbrannt reißt er sich los, schubst mich beiseite, sodass ich nach hinten stolpere. Jetzt reicht’s.
»Letzte Warnung, Tyrell!«, belle ich ihn an, doch er will schon zurück in den Club marschieren. Nicht mit mir, Freundchen. Blitzschnell packe ich seinen Arm, drehe ihn auf seinen Rücken und drücke ihn mit aller Kraft gegen die Wand, darauf bedacht, dass er sich nicht einfach so befreien kann. Unter normalen Umständen hätte ich kaum eine Chance gegen ihn, doch er ist leicht angetrunken und seine Reaktionszeit dadurch eingeschränkt. Allerdings wehrt er sich wie ein Wilder, ich halte jedoch dagegen, wissend, wenn er loskommt, wird es richtig ungemütlich.
»Lass es gut sein«, warne ich ihn vor Anstrengung keuchend, denn er ist ein echt starker Gegner.
»Wenn du nicht sofort deine Pfoten von mir nimmst, garantiere ich für nichts«, schnaubt er stinksauer auf und spannt den Körper an. Mühsam halte ich ihn in meinem Griff, verlagere für einen besseren Stand das Gewicht, was er geschickt ausnutzt und sich von der Wand weg drückt. Damit schafft er es, sich aus meinem Griff zu befreien. SHIT!
Auge in Auge starren wir uns schnaufen und japsend an. Ich will keine Schlägerei mit Scott anzetteln, aber ich muss ihn zur Vernunft bringen.
»Ernsthaft, willst du eine Prügelei riskieren, nur weil du wegen irgendwas angepisst bist?«, frage ich daher und beobachte jede seiner Bewegungen ganz genau, um gegen eine spontane Attacke gewappnet zu sein. Als hätten meine Worte eine Blockade bei ihm gelöst, blinzelt er irritiert und ich mache innerlich drei Kreuze, dass er offenbar erkennt, wie seltsam er sich verhält.
»Tut mir leid, Mann. Ich war ein totaler Idiot«, entschuldigt er sich verdattert und reicht mir versöhnlich die Hand.
»Allerdings«, schnaube ich und schüttele Scott kräftig die Hand. Mit einer Kopfbewegung deute ich in Richtung Büros.
»Du hast recht. Ich verzieh’ mich«, brummt er angefressen. »Derzeit ist es ... ach egal.« Er muss mir nicht erzählen, was ihm über die Leber gelaufen ist, aber ich will ihm signalisieren, dass alles gut zwischen uns ist.
»Hey, wollen wir morgen trainieren? Du könntest etwas Dampf ablassen. Vielleicht gehen wir danach was essen«, schlage ich daher versöhnlich vor.
»Klingt gut.«
»Cool. Und jetzt verschwinde, bevor ich dir noch mal den Arsch aufreißen muss«, grinse ich ihn an.
»Lange nicht mehr deine eigenen Schreie gehört, was?!«, schießt er zurück, wobei er über meinen frechen Kommentar schmunzeln muss.
»Das werden wir morgen im Ring sehen«, lache ich, hebe die Hand zum Gruß und verschwinde zurück in den Club, wo ich bei Laila stoppe, die mich neugierig ansieht.
»So hab ich ihn noch nie erlebt«, bekennt sie kopfschüttelnd. Dem kann ich nur zustimmen.
»Ja, er war richtig aufgebracht.«
»Scott und Alkohol – das ist eine Kombination, die ich ehrlichgesagt nicht kenne«, grübelt sie.
»Stimmt. Abgesehen von seiner Regel, dass keiner während der Arbeit trinkt, habe ich ihn noch nie mit Schnaps oder was in der Art gesehen«, gebe ich zu.
»Etwas muss ihn furchtbar aufgeregt haben. Ob er Ärger hat?«, überlegt Laila laut.
»Wer weiß das schon.«
»Hast du ihn im Keller eingesperrt oder wo ist er hin?«, scherzt sie, wobei ihr die Erleichterung anzumerken ist.
»Nein, hab ihn heimgeschickt.«
»Respekt.« Anerkennend mustert sie mich. »Ich hätte nicht gedacht, dass du Scott dazu bewegen könntest seine Meinung zu ändern.«
Schulterzuckend zwinkere ich ihr zu. »Ich hab da so meine Möglichkeiten.«
»Pfff, ja klar.« Mit einem kessen Augenrollen schnappt sie sich ein Handtuch, um die gespülten Gläser abzutrocknen. »Ich kann mir schon denken, wie die aussehen.«
»Er ist freiwillig nach Hause gefahren.«
»Wer’s glaubt«, schnaubt sie.
»Traust du mir so wenig zu?«, frage ich gerade heraus, denn es interessiert mich wirklich, was sie in der Hinsicht von mir hält.
Ihr Blick verändert sich kaum merklich und es scheint, als ob sie sich fragt, was und wieviel sie mir erzählen soll. »Ich denke, dass ihr beiden einen auf ›Wer-ist-hier-der-Stärkere‹ gemacht habt und aus mir unerfindlichen Gründen hast du gewonnen.« Ein irrationaler Stolz macht sich in meiner Brust breit, den ich schnell wieder verdränge, denn ich will nicht mit so etwas Banalem bei Laila punkten.
»Ich kann ziemlich überzeugend sein, wenn ich will. Schätze, ich habe die richtigen Argumente vorgebracht«, erwidere ich und vergrabe die Hände in den Hosentaschen. »Außerdem wollte ich verhindern, dass er etwas Unüberlegtes macht, was ihm ewig nachhängen könnte.«
Erstaunt hebt sie die Augenbrauen. Die Jungs können schon mal flache Sprüche raushauen, die unqualifiziert ja fast pubertär wirken, wobei ich mich immer aus solchen Frotzeleien heraushalte, was nicht heißt, dass ich nicht mithalten könnte, wenn ich wollte. Aber ich bin eher der ruhige Typ und muss mich nicht profilieren.
Bevor es zu einer unangenehmen Stille zwischen uns kommt, schnappe ich mir ebenfalls ein Handtuch und helfe Laila, die Gläser zu polieren. Ihre verstohlenen Blicke entgehen mir nicht, was mich mit Genugtuung erfüllt – sie scheint sich für mich zu interessieren. Einträchtig verrichten wir die letzten Handgriffe, dann nimmt sie mir das Handtuch ab und lächelt mich an. Ein bezauberndes Lächeln.
»Vielen Dank. Ich bin mit deiner Hilfe schneller fertig geworden, als gedacht.«
»Schön, wenn ich helfen konnte«, antworte ich ehrlich.
»Hör mal, ich wollte eben nicht so ... so von oben herab klingen.« Verdutzt runzele ich die Stirn.
»Schon okay.«
Mit einem verlegenen Räuspern verschränkt sie die Arme vor der Brust. »Manchmal kann ich etwas zu direkt sein«, erklärt sie sich, und damit hat sie einen weiteren Pluspunkt auf der Haben-Seite bei mir erreicht. Nicht viele Menschen haben die Größe, sich zu entschuldigen.
»Ich mag deine direkte Art«, gebe ich ohne Umschweife zu. Ein Funkeln in ihren Augen zeugt davon, dass ihr meine Antwort zu gefallen scheint.
»Da bist du mit Scott so ziemlich der Einzige«, lacht sie auf.
»Damit kann ich leben«, schmunzele ich und beobachte sie dabei, wie sie ihre dunklen Locken geschickt zu einem wirren Dutt hochsteckt, den sie mit einem Bleistift, der auf der Theke liegt, fixiert. Ihr schlanker Hals wird dadurch betont und ich erwische mich dabei, wie ich sie anstarre, denn ihr verschmitzter Gesichtsausdruck spricht Bände.
»Wir sollten uns langsam an die Arbeit machen, findest du nicht?«, erinnert sie mich an die bevorstehende Schicht und seufzend nicke ich.
»Da hast du recht. Also, bis später.«
»Ja, bis dann«, lächelt sie und hat sich bereits einer ihrer Kolleginnen zugewandt, die ihr eine Frage zum heutigen Ablauf stellt.
Mein kleiner Austausch mit Laila macht mich nachdenklich. Mehrfach hat sie in den lockeren Gesprächen mit den Kollegen bereits betont, dass sie auf Männer und nicht auf Jungs steht. Laut ihrer Aussage seien es alles testosteronverseuchte Hallodris, die nur eine schnelle Nummer suchen. Ihre Meinung zu jüngeren Kerlen scheint geprägt von klassischen Attributen wie lautem Auftreten, Alphamännchengehabe und Überheblichkeit zu sein. Durch meine eher bescheidene Haltung hinsichtlich der Auseinandersetzung mit Scott scheine ich ihr imponiert zu haben. Dadurch formt sich der Gedanke, genau mit dieser atypischen Art ihre Ressentiments mir gegenüber abbauen zu können.
Schon überlege ich, ob ich ihr beiläufig von meiner Arbeit im Kinderheim berichten soll, verwerfe diese Überlegung allerdings sofort wieder. Ich will mich ja nicht anbiedern. Das wäre der falsche Weg.
Laila soll sich ihr eigenes Bild von mir machen – damit sind meine charakterlichen und nicht optischen Vorzüge gemeint. Ihre Erfahrungen mit Männern scheinen höchst fragwürdig gewesen zu sein, denn sonst wäre sie nicht so beharrlich, was ihr Urteil anbelangt: Alle jungen Kerle haben kein Verantwortungsbewusstsein.
Tja, da ich nicht zu dieser Kategorie Jungs zähle, sollte es möglich sein, ihr in Bezug auf meine Person den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das zumindest ist meine leise Hoffnung.
Aber wie stelle ich es an, dass wir uns privat außerhalb der Arbeit näher kennenlernen?
Und ja, ich meine damit Kennenlernen im klassischen Sinne und nicht direkt in die Kiste springen. Auch wenn ich mir dazu schon viel zu oft Gedanken gemacht habe. Wer könnte es mir verübeln?
Doch eines nach dem anderen.
Kapitel 3
Eine verrückte Woche geht zu Ende, als ich Samstag früh um zwei Uhr morgens nach Hause komme. Ich durfte einen Shuttledienst eines Kollegen übernehmen, der krank im Bett liegt, und nahm die Chance direkt wahr, die Kohle mitzunehmen. Mein Gast, ein Cedric Bertrand, war nett und weniger herablassend als seine Kollegen, mit denen ich bislang zu tun hatte. Ein angenehmer Kunde, der, wie ich annehme, Diskretion schätzt, denn ich habe ihn in zwei höchst exklusive Erotik-Clubs der Stadt gefahren, in denen er jeweils zwei Stunden verbrachte.
Von Kollegen weiß ich, dass sie gerne mal über die Gewohnheiten ihrer Klienten tratschen, was ich unangenehm sowie unprofessionell empfinde und mich aus derartigem Gerede heraushalte.
Nach einer ausgiebigen Dusche falle ich todmüde ins Bett, schlafe bis Mittags durch und um die Lethargie abzuschütteln, gehe ich trainieren. Neben dem Boxstudio, in dem ich Scott getroffen, und ihm damals den Job im Club besorgt habe, bin ich Mitglied in einem Fitnessstudio, bei dem ich an zwei Nachmittagen kostenlose Trainingsstunden für Kinder aus ärmeren Familien gebe. Ein Deal mit dem Besitzer, der in der heruntergekommenen Immobilie täglich ums Überleben kämpft, denn hierher verirren sich selten zahlungskräftige Kunden. Er wollte mir für meine Dienste schon den Mitgliedsbeitrag erstatten, was ich strikt ablehne, denn für ihn zählt jeder Dollar.
Heute steht mein eigenes Programm auf dem Plan und nach einer Aufwärmphase gehe ich in den Freihantel-Bereich, um die von Scott empfohlenen Übungen durchzuziehen. Der Kerl ist weiß Gott gut in Form und irgendwann erzählte er mal beiläufig von dem Training bei den SEALS, was mich tief beeindruckt hat. Seitdem habe ich mein Training angepasst, eine anfängliche Qual, aber ich bin von den Resultaten mehr als begeistert.
Mit den Ear-Pods und einem aufpeitschenden House-Mix im Ohr beginne ich mit den Übungen. Jede Bewegung ist kontrolliert, jede Wiederholung beißt in den Muskeln und ich merke, wie mein Herz kräftig gegen den Brustkorb hämmert. Einzig die nächste Muskelkontraktion zählt, denn die Welt um mich herum habe ich ausgeblendet.
Eine halbe Stunde später gönne ich mir eine Trinkpause und beobachte durch den riesigen Wandspiegel die anderen Trainierenden, die an den Geräten ackern oder auf den Laufbändern gegen die lästigen Pfunde ankämpfen. Es ist recht voll geworden, was mich für Vince, den Inhaber freut, und wische mir mit dem Handtuch den Schweiß von der Stirn.
Moment, ist das etwa ...
Das gibt es doch nicht: An einer der Beinpressen entdecke ich Laila, die gerade die Gewichte einstellt und mir damit ihren Hintern präsentiert, der in einer hautengen, grauen Trainingshose einen wahrhaft epischen Eindruck hinterlässt. Sie richtet sich auf und setzt sich auf die Maschine, hebt die Beine an die Platte und beginnt sich davon wegzudrücken. Wie gebannt beobachte ich sie, sehe, wie sich die Sehnen und Muskeln ihrer Beine bewegen und wundere mich, dass sie mir hier noch nie aufgefallen ist.
Ob ich sie ansprechen soll?
Oder wird ihr das unangenehm sein, wenn wir uns außerhalb der Arbeit über den Weg laufen?
Und wenn ich einfach an ihr vorbeigehe, um ihr die Möglichkeit zu geben, mich anzusprechen?
Wäre das weniger aufdringlich?
»Hey, bist du hier fertig?«, spricht mich ein Typ mit schütterem Haar und Dreitagebart an, der auf die Hantelbank deutet, auf der mein Telefon und meine Handschuhe liegen.
»Oh, ja. Bin ich. Entschuldigung.« Sofort räume ich mein Zeug weg, denn ich habe schon einen Platz entdeckt, der näher bei Laila ist, wo ich mein Training fortsetzen kann.
Ich breite das Handtuch auf der Matte aus, hole mir die zehn Kilo Kettlebell und starte die Kniebeugen, die mir Scott gezeigt hat. Dabei sehe ich stur auf einen imaginären Punkt vor mir, um nicht nach Laila Ausschau zu halten.
Im Augenwinkel nehme ich eine Bewegung neben mir wahr und schnaufend stelle ich die Kettlebell ab, um mich gleich Auge in Auge mit Laila wiederzufinden, die mich mit vor der brustverschränkter Arme mit einer Mischung aus Neugier und Vorsicht ansieht.
»Hi, das ist ja eine Überraschung«, grinse ich sie an, darauf bedacht, den Blick auf ihr Gesicht und nicht über ihren Körper wandern zu lassen, der in diesem verdammten, hautengen Sportdress mehr als einladend ist.
»Hi Jeff. Ich wusste gar nicht, dass du hier trainierst«, erwidert sie, wobei sie ihrerseits interessiert den Blick über meinen Körper wandern lässt. Das T-Shirt, welches ich trage, ist durchgeschwitzt, und ich könnte schwören, ein Funkeln in ihren Augen zu bemerken, als sie meinen Oberkörper abcheckt.
Interessant!
So unbeteiligt wie möglich greife ich mir das Handtuch vom Boden und gönne mir einen kurzen Ausblick auf ihre Beine. Sonnengebräunt, straff und wohlgeformt.
»Ja, ich hab hier alles, was ich brauche, und die Leute sind nicht so überkandidelt wie in den angesagten Studios«, antworte ich und hänge mir das Handtuch um den Nacken.
»Wohnst du in der Nähe?« Ihre Frage versetzt mich in Euphorie, denn dass sie nach solch privaten Informationen fragt, ist neu.
Mit einem verstohlenen Lächeln sehe ich sie an. »Um die Ecke ist es nicht, aber mit dem Auto nur eine Viertelstunde.« Sie nickt und ich überlege, ob ich ihr die Gegenfrage stellen soll, da nimmt sie mir die Entscheidung ab.
»Ich bin hier aufgewachsen. Meine Mutter wohnt zwei Blocks von hier. Wir ... ich bin nach der Schule und dem ersten festen Job weggezogen. Es war nicht immer einfach, also brauchte ich einen Tapetenwechsel.«
Wow, das war die wohl intimste Konversation, die wir beide je miteinander hatten.
»Kann ich gut nachvollziehen.« Neugierig mustert sie mich. »Ich bin auch weggezogen. War eine gute Entscheidung«, gebe ich zu, während Laila wissend nickt.
»Tja, dann sehen wir uns wohl jetzt häufiger – beim Training und im Club«, stellt sie treffend fest und ich muss sagen, dass mir diese Aussichten sehr gefallen.
»Trainierst du mit einem speziellen Fokus?«, hake ich nach, beiße mir allerdings auf die Zunge, bevor ich ihr überstürzt anbiete, ihr bei den Übungen zu helfen. Das wäre eindeutig zu früh und anhand ihrer skeptisch hochgezogenen Augenbraue sehe ich meine Vermutung bestätigt, daher winke ich schnell ab. »Nur interessehalber.«
Ihre Haltung strafft sich und sie taxiert mich mit einem ihrer berühmt-berüchtigten Blicke, die schon so manchen Mann in die Knie gezwungen haben.
»Um nicht einzurosten, gehe ich aufs Laufband und um nicht auseinanderzufallen, mache ich ein wenig Krafttraining«, lässt sie mich mit einem kühlen Unterton in der Stimme wissen.
»Klingt doch gut.« Etwas Besseres fällt mir nicht ein, denn ich hoffe tatsächlich, dass wir uns hier öfter unterhalten können, sofern sie das zulässt. »Bist du denn mit deinem Training fertig?« Dabei deute ich auf ihre Trainingstasche.
»Ja, ich bin durch für heute.« Wieder wandert ihr Blick über meinen Körper, was mir ein Kribbeln in der Magengegend beschert. Ihr scheint zu gefallen, was sie sieht und das wiederum ist eine Streicheleinheit für mein Ego. »Und du?«
Bevor ich antworte, hebe ich die Kettlebell auf, und ihr Blick schießt zu meinem Arm, klebt an den gespannten Muskelsträngen und insgeheim fühle ich mich wie der größte Hecht im Teich, dass Laila so auf mich reagiert. »Nein, ich muss noch ein paar Übungen machen«, erkläre ich und sehe, wie sie schwer schluckt, als ich die Kettlebell spielerisch in die andere Hand nehme.
»Ja, äh okay, dann lasse ich dich mal in Ruhe. Also, bis dann.« Ein kurzes Winken, ein Lächeln, und schon ist sie verschwunden. Mit einem zufriedenen Grinsen widme ich mich meiner Übung, im Kopf Laila vor Augen.
An meinen heutigen freien Tag habe ich nach einem kurzen Frühstück mein Mountainbike ins Auto geworfen und bin in den Cypress-Provincial-Park gefahren. Über die Lions Gate Bridge und den British-Columbia-Highway 99 hoch bis zur Abfahrt zur Cypress-Bowl-Road. Mitten in der Woche ist zum Glück der Verkehr moderat. Als ich den Wagen auf einem der Parkplätze abstelle und das Rad aus dem Auto hieve, ist außer mir nur noch ein älteres Pärchen da, das auf einer der Bänke mit einer Thermoskanne sowie ein paar Sandwiches freundlich grüßt.
Die Luft ist würzig frisch, denn es hat die letzten beiden Tage geregnet, allerdings ist es kalt und der Wind scharf, wie immer Ende Februar hier in Vancouver. In meiner Thermokleidung und mit der Schutzbrille bin ich gut gerüstet für einen der vielen Trails im Park, die nicht ganz ungefährlich sind, da es an einigen Stellen steil bergab gehen kann. Doch genau das fixt mich an.
Gut gelaunt radel ich locker zum Startpunkt meiner heutigen Tour, die mich ein gutes Stück bergauf führt, um dann an einem Aussichtspunkt vorbei in eine anspruchsvolle Downhill-Strecke zu wechseln. Je nach Witterung können schon mal tiefe Löcher in den weichen Waldboden geschwemmt worden sein und nicht selten liegen auf der Strecke umgestürzte Bäume oder Äste, die es zu umfahren gilt.
Die Sonne blitzt durch die Baumwipfel, der Boden ist noch etwas feucht – genau mein Wetter.
Mit dem kleinsten Gang trete ich den Kampf gegen den gewundenen Anstieg an und genieße die Anstrengung, die mir abverlangt wird. Im Hintergrund höre ich das leise Rauschen eines Wasserfalls und zwei Elstern streiten in einem der Bäume wütend miteinander. Alle lästigen Gedankenspiele werden ausgeblendet, die Konzentration liegt auf der Strecke, meinem Körper und der Verteilung meiner Kraftreserven. Jeder Meter ist hart erarbeitet.
Nach einer halben Stunde erreiche ich keuchend und mit brennenden Muskeln den Aussichtspunkt, von dem aus man einen traumhaften Blick auf die Bucht von Vancouver hat, und ich frage mich, ob Laila schon hier oben war. Sicher war sie das, immerhin ist sie in dieser Gegend aufgewachsen. Vielleicht war sie mit ihrem Freund auf der Anhöhe und hat einen romantischen Abend mit einem grandiosen Sonnenuntergang erlebt. Jedenfalls würde ich mit ihr hierher kommen, wenn sie ... ach verdammt, ich schweife wieder ab.
Ich gönne mir zwei großzügige Schlucke des mit Magnesium angereicherten Wassers, verscheuche die unschönen Gedanken an Laila und einen Kerl, in der Hoffnung, das beißende Gefühl in der Brust loszuwerden. Mittels einer Atemtechnik, die die Herzfrequenz beruhigt, gelingt es mir tatsächlich. Jetzt kann ich die Downhill-Strecke angehen.
Moderat geht es los und ich nehme die kurvenreiche Route, die mit einigen Schlammpfützen eine Schlitterpartie ist, in einem zügigen Tempo. Mein Fokus liegt ganz auf den wenigen Metern vor mir, auf denen ich Steinen, Wurzeln und glitschigem Laub ausweichen muss. Gleichgewicht ausbalancieren, Lenker nicht verreißen, Schräglagen abfangen, Gewicht verlagern.
Bei einem Sprung über einen quer über der Strecke liegenden großen Ast, der von einem Sturm vom Baum abgerissen worden ist, wäre ich fast gestürzt, fange mich gerade so mit einem Bein ab. Dabei ermahne ich mich selbst zur Vorsicht, denn weit und breit ist keine Menschenseele zu sehen. Der Hang wird zusehends steiler, der Boden ist mit Geröll angereichert, aber der Baumbestand ist etwas lichter als oben zu Beginn der Strecke. Konzentriert presche ich durch die Schneise, die ihre Tücken hat, doch ich habe sie alle schon gemeistert und genieße den euphorischen Rausch des Adrenalins, wenn ich eine solche hinter mir habe.
Im letzten Drittel ist das wohl anspruchsvollste Stück des Trails, denn hier kommt das dichte Unterholz dazu, das die Sicht einschränkt und in dem man leicht die Orientierung verlieren kann.
»Hilfe. Bitte, helfen Sie mir. Hallo, ich bin hier!«
Scharf bremse ich. War da nicht ein Hilferuf? Ich steige vom Rad und suche die Gegend ab.
»Wo sind Sie?«, rufe ich, um einen Anhaltspunkt zu bekommen, wo ich suchen soll.
»Hier. Die Böschung runter«, ertönt eine gepresste männliche Stimme hinter mir.
Rasch suche ich einen sicheren Abstiegspunkt, denn das Geröll wie auch der feuchte Waldboden sind rutschig, und ich will durch meinen Abstieg so wenig Erdmasse wie möglich in Bewegung versetzen. Ein grellgelbes Mountainbike liegt etwas unterhalb meiner Position. Aber wo ist der Fahrer?
»Ich kann ihr Rad sehen«, lasse ich den Hilfesuchenden wissen.
»Sie müssen weiter runter«, ruft er mir zu. Vorsichtig mache ich mich auf die Suche und wenige Meter unter mir finde ich einen Mann, dessen Fuß unter einem aus dem Boden gerissenen Wurzelwerk eines riesigen Baumes eingeklemmt ist. Schon bin ich bei ihm, sondiere die Situation, um abschätzen zu können, wie ich helfen kann. Er hat einige Kratzer im Gesicht, die nicht weiter wild sind. Die Thermokleidung hat das Schlimmste verhindert, doch er wird sicher überall blaue Flecken haben, wenn er den Hang heruntergestürzt ist. Das Problematischste ist sein eingeklemmter Fuß.
»Ich bin Jeff Douglas. Ich werde versuchen, Ihren Fuß zu befreien«, erkläre ich kurz.
»Okay. Ich bin Mike. Mike Saunders«, stellt er sich mit zusammengebissenen Zähnen vor.
»Freut mich, Mike. Das wird vermutlich wehtun. Bereit?« Grimmig nickt er.
Mit aller Kraft hieve ich das schwere Wurzelwerk ein paar Zentimeter an, und geschickt zieht Mike unter Schmerzgeheul den Fuß aus der entstandenen Lücke.
»Verfluchte Scheiße!«
»Lass mich mal sehen«, biete ich an und mit einer schmerzverzerrten Fratze nickt er.
Ich schiebe die Hose hoch und die Socken runter. Der Knöchel ist dick geschwollen, mit dunkelblauen Blutergüssen überzogen. »Ich ziehe den Schuh aus, damit ich mir ein besseres Bild machen kann, in Ordnung?« Stumm nickt er. Als ich den Fuß aus dem Schuh befreie, stößt er zischend die Luft aus.
»So eine verdammte ... Arrrghhh, tut das weh!«
»Sorry, aber das sollte unbedingt geröntgt werden. Ich kann dich ins Krankenhaus bringen«, biete ich an, was er zähneknirschend befürwortet, denn wenn der Knöchel gebrochen ist, muss er unverzüglich gerichtet werden. Der Abstieg mit dem Verletzten wird eine Tortur für ihn, aber wir haben keine andere Wahl. Mit dem Auto ist hier kein Hochkommen, also müssen wir den Abstieg zu Fuß wagen.
»Du stützt dich auf mich und versuchst den Fuß so wenig wie möglich zu belasten«, instruiere ich ihn, wobei ich ihm meine Wasserflasche reiche. Gierig trinkt er.
»Ich versuch’s. Aber es wird eine Weile dauern, bis du mich von diesem Berg herunterbugsiert hast«, grummelt er, was mich zum Lachen bringt.
»Keine Sorge, ich hab schon schwierigere Situationen gemeistert.«
»Dein Wort in Gottes Ohr.« Ich helfe ihm auf, was einige Anläufe braucht und als er schwankend auf einem Bein steht, gebe ich ihm Halt.
»Es gibt eine flachere Route, wenn wir hier weiter nach Osten gehen, wird das Gelände etwas erträglicher«, deutet er in die Richtung, in der wir aufbrechen. Allerdings bin ich unsicher, ob er überhaupt zwei Schritt weit kommen wird. Die Alternative wird ihm jedenfalls nicht gefallen.
»Na dann, auf geht’s!«
Schwer stützt er sich auf mich, hüpft mit dem gesunden Bein nach vorne und will sich mit dem verletzten abfangen, brüllt jedoch vor Schmerzen auf, als er unglücklich den Fuß belastet und fällt fast dabei hin. Tja, da hilft nur Plan B.
»So ein elender Mist. Verfluchte Scheiße. Trish wird mir den Arsch aufreißen«, flucht er keuchend und mitleidig sehe ich ihn an.
»Hör zu. Wenn wir dich zum Auto bringen wollen, werde ich dich wohl oder übel tragen müssen.« Erbost starrt er mich an.
»Auf keinen Fall. So ein blöder Unfall wird mich nicht zum Baby machen.« Schnaufend stützt er sich erneut auf mich und will weiter humpeln, hat allerdings das gleiche Problem wie beim ersten Mal und hält heulend inne, als ich ihn auffange.
»Ich weiß, das ist keine besonders heldenhafte Variante, hier wegzukommen, aber glaub mir, es ist die Einzige.« Und um ihm ein etwas besseres Gefühl zu geben, werfe ich hinterher: »Es muss niemand erfahren.«
Gehetzt huscht sein Blick hin und her, sucht nach einer Alternative, doch es gibt keine. Verärgert holt er tief Luft.
»Also schön. Aber ich warne dich, wenn du mich fallen lässt ...«
»Das wird nicht passieren.« Eindringlich sehe ich ihn an und bekomme seine stumme Zustimmung.
»Auf drei. Eins, zwei, drei«, zähle ich an, gehe etwas in die Knie, sodass er mit einiger Anstrengung auf meinen Rücken hüpfen und ich ihn huckepack tragen kann. Ist nicht das erste Mal, dass ich einen Kerl auf diese Weise aus der Scheiße geholt habe.
»Na gut Kumpel, bringen wir es hinter uns.«
Damit stapfe ich sicheren Trittes den Pfad hinunter zum Auto.
Kapitel 4
Mikes Mountainbike-Tour ist gekrönt von einem angeknacksten Sprunggelenk, einer fiesen Bänderzerrung und einem lädierten Ego. Er versicherte mir, dass das Ego am meisten schmerzen würde, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann. Als ich ihn mit drei kurzen Verschnaufpausen endlich im Auto hatte, war mir sein ewiger Dank wie auch sein Respekt sicher, denn er meinte, er hätte nicht geglaubt, dass ich ihn in einem Stück so schnell zum Parkplatz bekäme. Auf dem Weg erfuhr ich von ihm, dass er Chief bei der freiwilligen Feuerwehr Vancouver Citys ist, mit Trish seine Verlobte sowie Seelenverwandte gefunden hat und er neben Mountainbiken mit ein paar Jungs einige Runden im Boxring absolviert. Ganz meine Kragenweite. Als ich im Auto wieder zu Atem kam, berichtete ich von Scott, dem Boxclub, in dem wir gelegentlich zusammen trainieren und Mike wollte, sobald er wieder fit sei, unbedingt bei uns vorbeischauen.
Im Krankenhaus teilte ich dem Notarztteam die Details der vorläufig festgestellten Verletzungen mit, empfahl ein Röntgenbild, eine Elektroimpulstherapie und kalte Kompressen mit einer ordentlichen Vitamin-Elektrolyt-Infusion.
Trish lernte ich ebenfalls kennen, die Mike aus dem Auto angerufen hatte. Eine hübsche Rothaarige, die die Ärzte ordentlich herumkommandierte, sie sollen gefälligst das Beste für ihren Verlobten geben und mir ihren herzlichsten Dank für seine Rettung aussprach. Ich bekam eine Einladung zum Abendessen bei den beiden daheim, das Mindeste, was sie mir schuldig seien, wie Trish mir versicherte und einen Abend in einer der Sport-Bars mit Mikes Kameraden, um meine heldenmütige Hilfe zu feiern.
Zwei Wochen später
Die Runde ist schwer in Ordnung, stelle ich an diesem Abend fest, denn die Jungs des 32. Fire Departments haben mich sofort in ihrer Mitte willkommen geheißen, als ich mit Mike, den ich daheim abgeholt habe, an diesem Donnerstagabend in der Bar eintreffe. Nach einer herzlichen Begrüßung erzählt Mike auch schon von meinem beherzten Eingreifen, was die Jungs begeistert aufnehmen. Fast ist es mir peinlich, mit so viel Lob überschüttet zu werden, denn ich habe nur jemanden in einer Notlage geholfen. Doch heutzutage scheint das eine Besonderheit zu sein.
Egal. Ich werde niemandem, der Hilfe braucht, die meine versagen. Das ist unethisch und für mich ein totales No-Go.
Vor mir steht ein Teller mit einem köstlich duftenden Porterhouse Steak und einem großen Salat. Beides hat mir Mike spendiert, was ich nur unter Protest angenommen habe. Aber er kann äußerst beharrlich sein und mit der Rückendeckung seiner Truppe blieb mir keine Wahl, als es anzunehmen.
»Und du arbeitest im Red Continental?«, werde ich von Hunter ausgequetscht.
Kauend nicke ich. »Ja, an der Tür. Willst du vorbeikommen?«, frage ich den dunkelhaariger Mittdreißiger mit gepflegtem Bart und stechend grünen Augen.
Grinsend lehnt er sich zu mir. »Hab gehört, die Ladys dort sind die heißesten der Stadt.«
»Das habe ich auch gehört«, mischt sich Caiden ein, ein aufgeweckter Blonder mit haselnussbraunen Auge. Er fährt meist die Einsatzfahrzeuge und ist mit 29 der Jüngste in der Gruppe – abgesehen von mir, denn ich bin zwei Jahre jünger als er.
»Ich werde mal ein gutes Wort für euch einlegen. Aber wenn mir Beschwerden zu Ohren komme, reiße ich euch den Arsch auf«, grinse ich amüsiert, was von einem lautstarken zustimmenden Gegröle beantwortet wird.
»Keine Sorge, die Jungs wissen sich zu benehmen«, wirft Mike wohlwollend ein, doch sein warnender Blick ist nicht zu übersehen.
»Also schön. Dann sagt mir Bescheid, wann ihr kommen wollt«, biete ich an und die Truppe toastet mir johlend zu.
Die nächste Runde geht auf mich, was mich an die lange Bar am Ende des Lokals führt. Als ich meine Bestellung aufgegeben will, höre ich das dunkle, verführerische Lachen, das ich unter tausenden erkennen würde und sehe mich suchend um.
Da sitzt sie.
An einem der vielen Stehtische, die direkt um die Bar stehen, und der von einem alten Stahlträger halb verdeckt wird, sitzt sie mit zwei Frauen zusammen. Alle vertieft in ein lebhaftes Gespräch. Wie gebannt starre ich Laila an – ich kann nicht anders – und lehne plötzlich an dem Stahlträger, ohne dass sie mich sehen kann. Die perfekte Position, dem Gespräch der Ladys zu lauschen und auf meine Getränke zu warten.
»Dieser Kerl ... Gott, hast du seine Arme gesehen«, quietscht die eine gerade und seufzt sehnsuchtsvoll auf.
»Mir ist eher sein Knackarsch in Erinnerung geblieben«, schnaubt die Zweite und erntet damit ein Lachen von Laila.
»Tja, da ist was dran. Mir hat aber sein Blick gefallen. Der war so dunkel, ungezügelt. So ein Mann weiß ganz genau, was er will und wie er es bekommen kann«, zwinkert sie den beiden zu.
Oha! Miss Rodriguez scheint auf leidenschaftliche Männer zu stehen.
Dass sie von einem Kerl derart schwärmt, weckt ein ungutes Gefühl der Eifersucht in mir, welches mich dazu verleitet, wie gebannt weiter zuzuhören.
»Von mir aus. Solange er mit seinem besten Stück umzugehen weiß, ist mir alles recht«, gibt die Erste schulterzuckend zu.
»Es geht nicht nur um das Vögeln. Es geht viel mehr darum, dass ich mich als Frau sinnlich, begehrenswert und sexy fühlen will«, erklärt Laila und ich spitze die Ohren. »Er sollte dich mit Worten genauso verführen können, wie im Bett selbst. Jungs können zwar die ganze Nacht pimpern, aber das gewisse Etwas fehlt meist dabei.«
»Hm, mir wäre eine wilde Nacht ganz recht«, gluckst die Zweite und spielt versonnen mit dem Schirmchen in ihrem Cocktail.
»Was ist denn aus dem letzten Kerl geworden, der dir das Bett gewärmt hat?«, will Laila wissen.
»Ach der? Wie sich herausstellte, war er weniger ›standfest‹ wie er zu Beginn behauptet hat und als ich ihn mit einer anderen händchenhaltend im Stanley Park gesehen habe, war die Sache für mich erledigt.«
»Oh, was für eine miese Nummer«, grollt Laila und legt mitfühlend die Hand auf die ihrer Freundin.
»Das hat man davon, wenn man mit jüngeren Kerlen anbandelt. Nur Flausen im Kopf. An jedem Finger eine andere warm halten und bloß keine Verpflichtungen eingehen. Typisch für solche Jungs«, brummt die Erste und schüttelt missbilligend den Kopf.
»Wem sagst du das. Denen geht es nur um Spaß und sonst nichts. Da ist alles erlaubt, aber wehe es wird ernst. Dann sind die Typen schneller verschwunden, als du gucken kannst«, pflichtet Laila ihrer Freundin grimmig bei.
»Das stimmt«, antwortet die Erste. »Es ist zwar eine wilde Zeit in der Kiste, aber den Rest kannst du vergessen. Herzschmerz, Lügen und am Ende die bittere Enttäuschung, dass du nur eine von vielen bist.«
»Absolut. Das brauche ich keinesfalls«, stimmt ihr Laila im Brustton der Überzeugung zu, woraufhin alle drei anstoßen.
»Allerdings sind die impulsiven Jungs für eine kurze, heiße Affäre immer gut. Man darf dabei nur nicht das Herz verlieren. Aber sich ohne Verpflichtungen austoben ... also dagegen ist nichts einzuwenden«, lacht die Erste frech.
»Was ist denn mit deinem Kollegen. Dem superheißen Kerl, den du uns im Club gezeigt hast?«, lenkt die Zweite ab und Laila senkt den Blick.