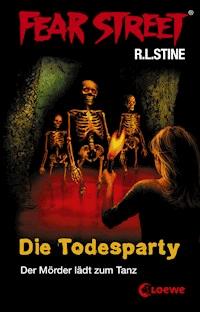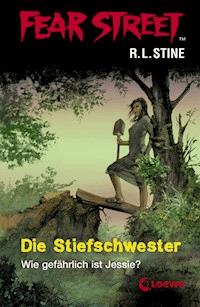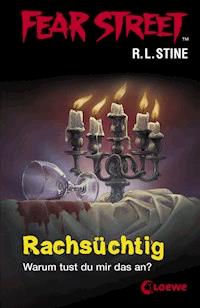Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Fear Street
- Sprache: Deutsch
Meggie nimmt auf dem Landsitz Tanglewood eine Stelle als Gouvernante an. Doch das alte, von Efeu überwucherte Herrenhaus birgt ein schreckliches Geheimnis. Die beiden Söhne Andrew und Garrett scheinen seltsam verstört, und nachts hallen unheimliche Laute durch die finsteren Gänge. Als Meggie ihnen nachgeht, stößt sie auf eine verriegelte Tür. Eine Tür, die zu öffnen ihr verboten wurde ... Mit den Horror- und Thriller-Büchern aus der Fear Street schuf Bestsellerautor R.L. Stineeine Reihe, die inzwischen zu den Klassikern derHorrorliteratur für Jugendliche zählt. Seit über 20 Jahren gibt es seine Geschichten schon auf Deutsch und seitdem begeistern sie gleichermaßen Jungs und Mädchen ab 12 Jahren und alle Fans von Gruselgeschichten. Ab 2021 zeigt Neflix den Klassiker Fear Street als Horrorfilm-Reihe!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Kapitel 1 – „Wie wär’s mit …
Kapitel 2 – „Warum mussten wir …
Kapitel 3 – Meggie spürte, wie …
Kapitel 4 – Vier Monate später …
Kapitel 5 – Hast du es immer …
Kapitel 6 – Meggie schrie erschrocken …
Kapitel 7 – „Meggie musste ein …
Kapitel 8 – Meggie schaute aus …
Kapitel 9 – Meggie machte einen …
Kapitel 10 – Garretts Fäuste hämmerten …
Kapitel 11 – „Was meinst du …
Kapitel 12 – Entgeistert starrte Meggie …
Kapitel 13 – Am oberen Ende …
Kapitel 14 – „Sagen Sie das nicht!“ …
Kapitel 15 – Meggie stolperte rückwärts …
Kapitel 16 – Vorsichtig wickelte Meggie …
Kapitel 17 – Mrs Malbourne öffnete …
Kapitel 18 – Mr Malbourne ließ …
Kapitel 19 – Meggie rollte sich …
Kapitel 20 – Sie sah, wie …
Kapitel 21 – „Was? Oh, Andrew! …
Kapitel 22 – Meggie kreischte. Garrett …
Kapitel 23 – „Der Geist von Mrs Malbourne …
Kapitel 24 – Die dürren Hände …
Kapitel 25 – Meggie fuhr blitzschnell …
Kapitel 26 – Meggies Ohren dröhnten …
Kapitel 27 – Mrs Malbourne schrie zornig …
Kapitel 28 – „Endlich konnte Meggie auch …
Alle Einzelbände der Reihe „Fear Street“ als eBook:
Über den Autor
Weitere Infos
Impressum
Prolog
Niemand weiß, woher er kam. Niemand kennt mehr seinen Namen. Und doch – das, was ein junger Mann vor vielen Jahrhunderten in einer Vollmondnacht heraufbeschwor, hinterließ seine Spuren. Spuren, die bis heute eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzen.
Der junge Mann war der Urahn der Familie Fear. Und er hatte einen Todfeind. Diese Feindschaft trieb ihn zu einer Tat, die er bitter bereuen sollte. Denn um seinen Rivalen zu besiegen, rief er dunkle Mächte zu Hilfe.
Er entfachte in einer Höhle ein Feuer. Dann murmelte er die magischen Worte, die heute keiner mehr kennt. Erwartungsvoll blickte er in die Flammen, doch nichts geschah. Er wartete.
Als die Flammen plötzlich hoch aufloderten und sich rasend schnell über die Feuerstelle hinaus verbreiteten, schrak er zusammen und wich einen Schritt zurück. Doch das Feuer war schneller und erfasste ihn binnen Sekunden.
„Ich werde verbrennen“, dachte der junge Mann entsetzt. „Gleich bekomme ich keine Luft mehr, und dann …“ Noch während er das dachte, merkte er, dass das Feuer einen Kreis um ihn gebildet hatte, sodass er von einer hohen Flammenwand umgeben war. Er schloss die Augen. Was hatte er da getan? Was für Mächte hatte er heraufbeschworen? Plötzlich ertönte aus den Flammen ein Zischeln, das sich langsam zu Worten formte.
„Du hast mich gerufen“, wisperte es.
Er sah sich gehetzt um, doch da war niemand – nur das Feuer.
„Du willst Macht, und ich gebe sie dir“, zischte es wieder. „Dafür gehörst du nun mir. Und alles Blut von dir. Ihr werdet mir Opfer bringen.“
Die Stimme schwieg, doch nur für einen kurzen Moment. „Dominatio per malum“, wisperte sie. „Dominatio per malum.“
Der junge Mann schluckte. „Was … was heißt das?“, stammelte er heiser.
„Macht“, kam die Antwort aus den Flammen, „Macht durch das Böse!“
Die Flammen schlossen sich enger um ihn, und er fühlte, wie ihn die Macht durchfuhr – eine heiße Woge. Er hatte es geschafft, er hatte die Macht heraufbeschworen, er fühlte sie mit jeder Faser seines Körpers. Doch er erschauerte, als er spürte, wie stark diese Kraft war. So ungeahnt stark, dass er sich beklommen fragte, ob er es nun war, der diese Macht kontrollierte, oder ob sie ihn beherrschte. Aber nun war es zu spät …
Die Flammen loderten noch einmal hoch auf, dann wurden sie kleiner und zogen sich wieder auf die Feuerstelle zurück.
Der junge Mann fühlte sich wie betäubt. Er fiel auf die Knie und starrte lange ins Feuer. War das alles eben wirklich geschehen, fragte er sich. Hatte sich tatsächlich eine Flammenwand um ihn geschlossen? Das konnte nicht sein.
Doch da fiel sein Blick auf etwas Glänzendes, das zwischen den Steinen vor dem Feuer lag. Er beugte sich vor, um es besser erkennen zu können. Es war ein silbernes Amulett, besetzt mit leuchtend roten Steinen, die im Kreis um einen kleinen Totenkopf angeordnet waren. Als er das Amulett aufhob, stellte er erstaunt fest, wie schwer es in der Hand lag. Vorsichtig drehte er es hin und her und betrachtete es genauer. Auf der Rückseite waren die Worte Dominatio per malum eingraviert. Macht durch das Böse.
„Du gehörst nun mir – und alles Blut von dir“, wiederholte er leise die Worte der Stimme aus dem Feuer. Was hatte sie damit gemeint? Alles Blut von dir … Ein Gedanke durchzuckte ihn – ein schrecklicher Gedanke. „Das war ein Fluch! Ich und alle meine Nachkommen sind verflucht“, wurde ihm klar. „Und das Amulett ist nicht nur das Zeichen meiner Macht, sondern auch das Zeichen des Fluchs.“ Während er das dachte, glomm das Amulett heiß in seiner Hand auf. Noch einmal drang ein Zischeln durch die Höhle, dann hörte das Amulett auf zu glühen und fühlte sich wieder kühl an.
Nachdenklich betrachtete er den kleinen silbernen Totenkopf. Was geschehen war, konnte er nicht mehr rückgängig machen. Es war sinnlos, sich zu fragen, ob es das wert gewesen war. Der Preis für die gewonnenen Kräfte war hoch – das hatte er erst jetzt erkannt. Zu hoch.
Mithilfe seiner neu erlangten Macht gelang es ihm, seinen Feind zu besiegen. Doch die Familie Fear war fortan verflucht. Es war ein mächtiger Fluch, der die Jahrhunderte überdauerte und nichts von seiner Grausamkeit einbüßte. Manchmal schwieg das Böse für eine Weile, doch nur, um schließlich mit neuer Kraft zu erwachen und Tod und Verderben zu säen. Dann brach es unerwartet über die nächste Generation herein und riss die Familie ins Unglück. Und selbst, als die Fears ausgelöscht waren, bestand das Böse fort. An einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Stadt …
Kapitel 1
Boston, 1858
„Wie wär’s mit einer Gruselgeschichte?“
Timothy Fear schauderte. Doch gleich darauf schalt er sich dafür. „Ich bin durchgefroren, das ist alles“, dachte er. „Wir waren zu lange draußen bei der Eiseskälte und haben es einfach ein bisschen übertrieben mit Schlittenfahren, Schneeballschlachten und Schneemännerbauen.“
„Eine Gruselgeschichte am Kamin! Das ist eine tolle Idee!“, jubelte Betsy. Ihre Wangen waren von der Kälte gerötet.
„Ja! Ja! Jemand soll eine Geistergeschichte erzählen!“, verlangte auch Edwina.
Vielleicht war jetzt die Zeit gekommen, um die Geschichte zu erzählen, dachte Timothy. Wenn er sie jetzt erzählte, konnte er sie vielleicht endlich vergessen.
„Ich kenne eine“, sagte er und zwang sich, die Gruppe von Freunden anzulächeln, die ihn erwartungsvoll ansahen.
Die knochige alte Köchin seiner Familie warf Timothy einen entsetzten Blick zu. Die Becher mit dem heißen Apfelwein kamen auf dem Tablett, das sie in den Händen hielt, ins Wackeln, und sie schüttelte den Kopf.
Es war kaum zu übersehen, dass sie nicht wollte, dass er die Geschichte erzählte. Aber Timothy achtete nicht auf sie. Er glaubte, dass die Zeit dafür gekommen war. Jetzt oder nie.
Draußen ging bereits die Sonne unter. Die Schatten im Salon des Herrenhauses wurden länger. „Wie Finger, die nach mir greifen“, dachte Timothy.
„Ich kenne eine Gruselgeschichte, die von einem bösen Jungen handelt“, sagte Timothy zu seinen Freunden. „Aber die ist so grässlich – ihr werdet sie nicht hören wollen.“ Das Feuer im Kamin loderte plötzlich hoch und prasselte lauter.
„Klar wollen wir das!“, rief Clyde von seinem Platz am Fenster aus.
„Du musst sie uns unbedingt erzählen“, verlangte Edwina.
Timothy nippte an seinem heißen Apfelwein. Sein Blick wanderte über die Gesichter seiner Freunde. Ihre Augen funkelten im Schein des Kaminfeuers.
„Überlegt es euch gut“, riet er. „Ihr müsst wissen, dass es eine wahre Geschichte ist. Und sie ist so unheimlich, dass ihr euch zu Tode ängstigen werdet.“
„Ooooh! Ich sterbe schon vor Angst!“, rief Philip aus. Er beugte sich vor und packte Betsy mit beiden Händen am Hals. Sie kreischte erschrocken auf, und alle mussten lachen.
„Euch wird das Lachen bald vergehen“, dachte Timothy.
„Oh, bitte! Erzähl die Geschichte!“, rief Betsy. „Wir sind bereit, das Risiko einzugehen. Das stimmt doch, oder?“
„Stimmt!“, riefen die anderen begeistert.
Timothy nippte noch einmal an seinem Becher. „Also gut, ich erzähle sie euch – aber nur unter einer Bedingung.“ Wieder wanderte sein Blick von einem zum anderen. „Niemand darf mich unterbrechen … und niemand darf gehen, bevor ich zu Ende gesprochen habe.“
Edwina grinste. „Du willst uns schon Angst machen, bevor es angefangen hat!“ Sie drohte ihm mit dem Zeigefinger und zwinkerte ihm dabei zu.
„Und es funktioniert“, fügte Betsy mit einem nervösen Lachen hinzu. „Ich wette, dass ich keinen einzigen Fingernagel mehr habe, wenn du deine Geschichte zu Ende erzählt hast.“
Timothy zuckte die Achseln. „Noch könnt ihr gehen.“
„Niemals“, rief Ethan von seinem Sitzplatz auf der Sofalehne aus. Aber sehr überzeugt klang er nicht.
Die anderen fingen an zu lachen, und Ethans Wangen wurden leuchtend rot.
Dann richteten sich alle Augen auf Timothy.
Sie warteten.
„Ich werde natürlich die Namen ändern“, sagte er, „um die Überlebenden dieses Dramas zu schützen. Aber alles andere ist genauso, wie man es mir selbst erzählt hat. Und soweit ich weiß, entspricht es der Wahrheit.“
Seine Freunde schwiegen erwartungsvoll.
Obwohl Timothy direkt vor dem Kaminfeuer stand und die Hitze an seinen Beinen und am Rücken spürte, durchlief ihn ein weiterer Schauder.
„Lass dich nicht von deiner Angst besiegen“, beschwor sich Timothy. „Erzähl es ihnen. Erzähl ihnen alles.“
„Die Geschichte beginnt in New York“, fing er schließlich an. „Und sie hat sich vor mehr als sechs Jahren ereignet …“
Kapitel 2
New York, 1852
„Warum mussten wir nur gestern Abend streiten, Vater und ich? Warum mussten wir uns unbedingt am Abend seines Todes streiten?“ Tränen brannten in den Augen von Meggie Alston. Sie holte tief Luft in dem Bemühen, sich zusammenzureißen.
Ihre ältere Schwester Henrietta streichelte Meggie beruhigend über das lange rote Haar. „Oh, Meggie, ich werde mir nie verzeihen, dass ich gestern bei diesem albernen Hausmusik-Abend der Greens war. Niemals! Es muss so schrecklich für dich gewesen sein, ganz allein mit Vater, als er …“ Sie stieß einen unterdrückten Schluchzer aus.
„Du wirst nie wissen, wie schrecklich es war“, dachte Meggie.
Wieder hatte sie den grauenhaften Anblick vor Augen.
Sie hatte den erstickten Schrei ihres Vaters gehört. Daraufhin war sie im Morgenmantel nach unten gerannt. Ihr Vater war im großen Salon auf die Knie gesunken, er keuchte laut, die Hände auf den Bauch gepresst.
Seine alten grauen Augen füllten sich mit Entsetzen, als er vergebens nach Luft schnappte. Ein Krampf schüttelte ihn, dann lag er still.
Meggie schrie um Hilfe. Sie schrie und schrie. Aber es war sinnlos. Außer ihr war niemand im Haus. Und als Dr. Marston dann endlich kam …
Meggie schüttelte den Kopf. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen.
„Weißt du, was am schlimmsten ist?“, fragte sie Henrietta. „Dass wir uns auch noch gestritten haben. Oh, Henrietta, warum habe ich mich nur dauernd mit ihm in die Haare bekommen? Warum?“
„Weil du das Temperament unseres Vaters geerbt hast“, erwiderte Henrietta mit einem traurigen Lächeln. Aus ihrem Dutt hatte sich eine Strähne ihres braunen Haars gelöst, die sie sich mit einer langsamen Bewegung aus dem Gesicht strich.
„Das stimmt“, bestätigte Meggie. „Es hat so viele furchtbare und sinnlose Streitgespräche zwischen uns gegeben. Und gestern Abend war ich besonders gemein zu ihm. Was, wenn er in dem Glauben gestorben ist, dass … dass ich ihn nicht geliebt habe …?“ Verzweifelt schlug Meggie die Hände vor ihr Gesicht und begann, leise zu schluchzen.
Henrietta nahm sie in die Arme und schaukelte sie liebevoll hin und her. „Er wusste genau, dass du ihn liebst. Natürlich wusste er das.“
Meggie ließ sich von ihr hin und her wiegen wie ein kleines Kind. „Wenigstens habe ich noch Henrietta“, dachte sie.
Ihre Mutter war gestorben, als Meggie sechs war. Henrietta war damals erst neun gewesen, aber sie hatte es übernommen, Meggie die Mutter zu ersetzen. Sie hatte sie getröstet, wenn sie aus einem Albtraum erwacht war. Sie hatte zugehört, wenn Meggie Probleme hatte.
Die liebe Henrietta.
Mit einem vorsichtigen Lächeln schaute Meggie zu ihrer Schwester auf. „Ohne dich würde ich das alles nie durchstehen.“
„Wir müssen stark sein“, stimmte Henrietta ihr zu. „Sehr stark.“
Jemand klopfte an die Tür.
Henrietta räusperte sich. „Herein!“, rief sie.
Das Zimmermädchen Colleen trat ein und knickste. Ihre runden Wangen waren leuchtend rot.
„Ja?“, fragte Henrietta.
„Draußen sind zwei Polizisten, die Sie beide sprechen möchten, Miss“, sagte das Mädchen.
Henrietta stand langsam auf. „Polizisten?“
„Ich habe ihnen gesagt, dass Sie keinen Besuch empfangen, Miss, aber sie bestehen darauf.“ Colleens Hände verkrampften sich in ihrer Schürze.
„Wissen sie denn nicht, dass wir in Trauer sind?“, fragte Henrietta.
Meggie hörte das Beben in der Stimme ihrer Schwester. „Die arme Henrietta“, dachte sie. „Es ist nicht fair, dass sie immer diejenige ist, die sich um mich kümmern muss. Ich werde mich in Zukunft auch um sie kümmern.“
„Doch, Miss. Das habe ich ihnen gesagt“, berichtete Colleen.
„Führ sie herein“, befahl Meggie wütend und sprang auf. „Ich werde ihnen klar machen, dass man Trauernden mit Respekt zu begegnen hat.“
„Jawohl, Miss.“
Einen Augenblick später kehrte das Dienstmädchen mit den zwei Polizisten zurück. Beide trugen blaue Uniformen mit funkelnden Polizeiabzeichen. Meggie fiel auf, dass beide nicht nur einen Revolver im Gürtel stecken hatten, sondern auch einen Schlagstock. Sie schauderte. Was wollten sie bloß bei ihnen?
Die beiden Männer nahmen hastig ihre Uniformmützen ab. Einer von ihnen war alt und kahlköpfig. Der andere war noch jung, und sein rotes Haar hatte fast denselben Ton wie das von Meggie.
„Sind Sie die Alston-Schwestern?“, fragte der kahlköpfige Polizist und sah abwechselnd Meggie und Henrietta an.
Henrietta griff nach Meggies Hand und drückte sie ermutigend. „Sie will nicht, dass mein Temperament mit mir durchgeht“, dachte Meggie. Also kniff sie die Lippen zusammen und überließ das Antworten ihrer Schwester.
„Ja, das ist Meggie Alston“, sagte Henrietta mit einem Blick auf ihre jüngere Schwester. „Und ich bin Henrietta Alston.“
„Es tut uns Leid, Sie zu einer solchen Zeit belästigen zu müssen“, fuhr der ältere Polizist fort.
„Wirklich Leid“, fügte der jüngere hinzu und wurde so rot, dass seine Sommersprossen nicht mehr zu erkennen waren.
„Und worum geht es?“, fauchte Meggie. „Sie sagen, dass es Ihnen Leid tut, und trotzdem sind Sie hier. Und das, wo unser Vater noch nicht einmal unter der Erde ist!“
„Meggie“, murmelte Henrietta warnend.
„Dr. Marston, der Arzt Ihres Vaters, war bei uns“, erklärte der kahlköpfige Polizist. Er zögerte und starrte Meggie und Henrietta durchdringend an. „Es scheint …“
„Was scheint?“, fuhr Meggie ihn ungeduldig an.
„Es scheint, dass Ihr Vater keines natürlichen Todes gestorben ist. Er ist vergiftet worden.“
Meggie hatte das Gefühl, als wäre im Zimmer plötzlich das Licht ausgegangen. Das einzige Geräusch, das sie noch hörte, war das Ticken der Standuhr. Es klang viel lauter als sonst. In ihrem Kopf drehte sich alles.
„Er ist ermordet worden?“, stieß sie ungläubig hervor.
„Das kann nicht sein! Dr. Marston muss sich irren“, verkündete Henrietta entschieden. Aber ihr Gesicht war leichenblass.
„Es ist kein Irrtum“, widersprach der ältere Polizist.
„Aber … wer würde denn so etwas tun?“, stieß Meggie hervor. Sie ballte die Hände zu Fäusten. Wenn wirklich jemand ihren Vater ermordet hatte, sollte er dafür bezahlen. Sie würde dafür sorgen, dass er dafür bezahlte.
„Deswegen wollten wir mit Ihnen sprechen“, sagte der jüngere Mann und drehte nervös seine Uniformmütze zwischen den Fingern. „Wir haben uns gefragt, ob Ihr Vater irgendwelche Feinde hatte …“
„Irgendwelche Feinde?“, wiederholte Henrietta fassungslos. „Nein, nicht dass ich wüsste.“
„Er hatte sicher keine Feinde“, bestätigte Meggie. „Er war der netteste Mensch der Welt! Wie können Sie nur so etwas fragen?“
„Und gestern hatten unsere beiden Hausangestellten frei“, fügte Henrietta hinzu. „Meggie und Vater haben den Abend allein verbracht, was bedeutet, dass niemand die Gelegenheit hatte, ihn …“
Henrietta verstummte plötzlich, und ihr Unterkiefer klappte herunter.
Meggie spürte, wie ihre Kopfhaut zu prickeln begann, als ihr Blick von Henrietta zu den Polizisten wanderte. Die beiden starrten sie misstrauisch an.
Die glaubten doch wohl nicht, dass sie … Sie konnten doch nicht ernsthaft annehmen, dass Meggie ihrem eigenen Vater etwas antun würde, oder?
„Stimmt das, Miss?“, fragte der Ältere langsam an sie gewandt. „Waren Sie und Ihr Vater den ganzen Abend allein?“
„Ja, allerdings“, sagte Meggie. „Aber was …?“