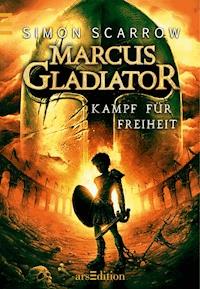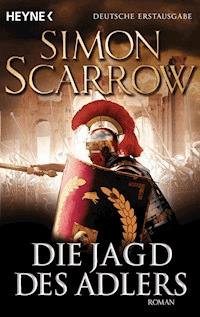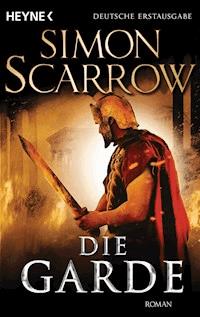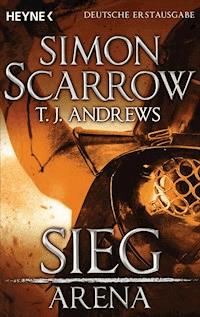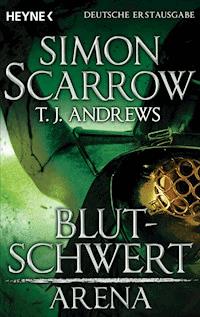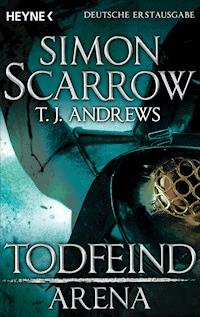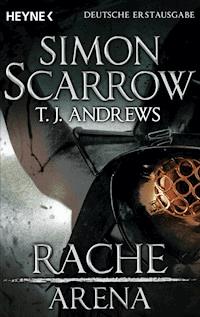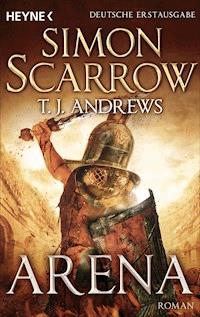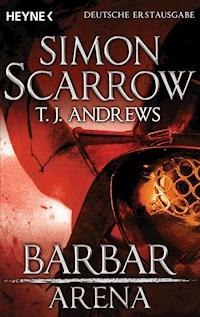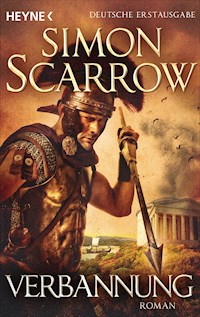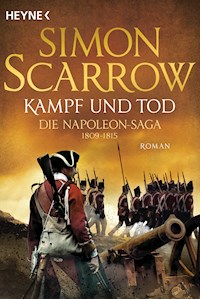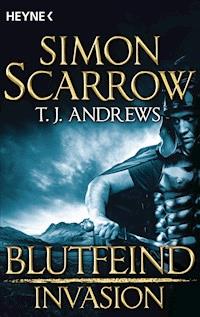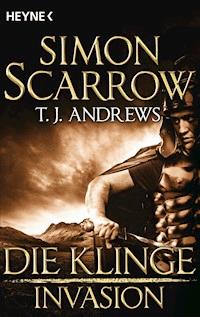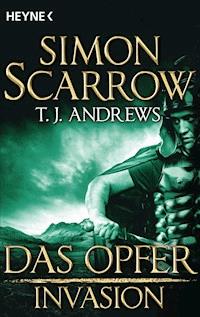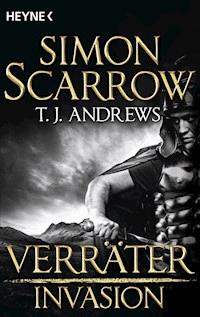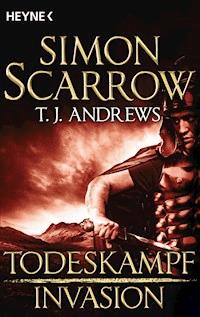9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Napoleon-Saga
- Sprache: Deutsch
1804. Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen, trachtet danach, Europa zu unterwerfen. Nach der Niederlage in der Schlacht von Trafalgar erringt er bei Austerlitz einen glorreichen Sieg gegen die Russen und Österreicher. Er zwingt den spanischen König zur Abdankung und verhilft seinem Bruder auf den Thron. Doch ein erbitterter Feind steht ihm weiterhin im Weg. Arthur Wellesley führt die Britischen Truppen auf dem Kontinent an. Er befreit Portugal aus der französischen Herrschaft und führt das Heer in Spanien von Sieg zu Sieg. Bei jenen, die sich der napoleonischen Herrschaft nur widerwillig unterworfen haben, keimt die Hoffnung, dass der Vormarsch der Franzosen gestoppt werden kann: Freiheit liegt in der Luft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1006
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DAS BUCH
Als er sich dem Eingang näherte, hielt Napoleon inne und drehte sich um, dann hob er die Hände und winkte zur Menge, ein strahlendes Lächeln auf dem von dunklem Haar gerahmten Gesicht. Die Leute stießen Freudenschreie aus und wogten auf die Kette der Grenadiere zu, die sich unter dem Druck ausbuchtete. Die Stiefel der Männer scharrten über die Pflastersteine, als sie sich dem Ansturm entgegenstemmten und die Leute mit den Läufen ihrer Musketen zurückstießen.
Napoleon wandte sich ab und schritt weiter auf das hohe Kirchenportal zu. Als er an Talleyrand vorbeikam, neigte er den Kopf in Richtung des Außenministers.
»Die Leute scheinen einverstanden zu sein.«
»Ja, Sire.«
»Und bereitet Ihnen meine Entscheidung, die Ehre anzunehmen, noch immer Kopfzerbrechen?«
Talleyrand zuckte leicht mit den Achseln. »Nein, Sire. Sie genießen das Vertrauen der Leute, und ich bin sicher, sie werden dafür sorgen, dass Sie es nicht enttäuschen.«
Napoleons Lächeln erstarb, und er nickte bedächtig. »Heute sind Frankreich und ich eins. Wie kann es da Widerspruch geben?«
»Wie Sie meinen, Sire.« Talleyrand neigte den Kopf und deutete unauffällig zum Eingang. »Ihre Krone wartet auf Sie.«
DER AUTOR
SimonScarrowwurdeinNigeriageborenundwuchsinEnglandauf.NachseinemStudiumarbeiteteervieleJahrealsDozentfürGeschichteanderUniversitätvonNorfolk,bevorermitdemSchreibenbegann.MittlerweilezählterzudenwichtigstenAutorenhistorischerRomane.MitseinergroßenRom-SerieunddervierbändigenNapoleon-SagafeiertScarrowinternationaleBestsellererfolge.
Besuchen Sie Simon Scarrow im Internet unter www.simonscarrow.co.uk
Simon Scarrow
FEUER UND SCHWERT
DIE NAPOLEON-SAGA 1804–1809
Aus dem Englischen von Fred Kinzel
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Die englische Originalausgabe
Fire and Sword
erschien 2009 bei Headline Review, London.
er Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 10/2020
Copyright © 2009 by Simon Scarrow
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München, unter Verwendung von Motiven von © Arcangel Images / Jordi Bru
Umsetzung Ebook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-23648-9V002
www.heyne.de
Für Murray, Gareth und Mark in der Hoffnung, dass wir mit Glynne mithalten können!
1
Napoleon
Paris, Dezember 1804
Als Napoleons Kutsche vor Notre-Dame hielt, brach dieriesige Menschenmenge, die in der Kälte gewartet hatte,inJubelaus,dervondermächtigengrauenFassadewiderhallte.DieGebäude,welchefrüherdiegroßeKathedraleumgebenhatten,warenabgerissenworden,umPlatzfürdieKrönungsprozessionzuschaffen,unddieBürgervonParisdrängtensichindemvondenkaiserlichenGrenadierenabgeriegeltenBereich.DieSoldatenstandenzweiReihentiefentlangdergesamtenRoute,undihrehohenBärenfellmützenraubtendenLeutengrößtenteilsdieSicht,sodasssienurgelegentlicheinenBlickaufdiereichverziertenKutschenunddiePassagiereinihrenFestgewändernerhaschten.ZwischendenKutschentrabtenSchwadronenvonKürassieren,derenlederneBrustpanzersosorgfältigpoliertwaren,dasssieihreUmgebungverzerrtwiderspiegelten.DerKaiser,seineGemahlinunddiekaiserlicheFamilie,dieMinisterundMarschällefuhreninmehralsvierzigeigensfürdieKrönungangefertigtenKutschen.NochniehatteParisdergleichengesehen,undNapoleonwaresmiteinemStreichgelungen,allenPompundallePrachtderBourbonenindenSchattenzustellen.
Er lächelte zufrieden bei diesem Gedanken. Während die französischen Könige ihre Krone einer zufälligen Abstammung verdankten, hatte Napoleon die seine durch Können, Mut und die Liebe des französischen Volkes erlangt. Es war das Volk, das ihm die Kaiserkrone geschenkt hatte, in einer Abstimmung, bei der ihm nur einige Tausend Seelen in ganz Frankreich ihre Unterstützung versagten. Im Gegenzug hatte ihnen Napoleon Siege und Ruhm geschenkt, und sein Kopf war bereits voller Pläne, diesen Ruhm weiter zu mehren.
Es gab eine kurze Verzögerung, als zwei aufwendig gekleidete Diener mit einer kleinen Treppe geschwind zur Kutsche liefen und die Tür aufzogen. Napoleon, der in erhabener Einsamkeit auf der mit Seide bezogenen Bank saß, holte tief Luft, stand auf und erschien in der Tür der Kutsche. Seine grauen Augen schweiften über das Meer der hingebungsvollen Gesichter, und seine Lippen öffneten sich zu einem Grinsen. Wieder brandete gewaltiger Jubel auf, und hinter den Reihen der Grenadiere wurden Arme und farbenfrohe Federhüte geschwenkt.
Napoleon sah sich um und entdeckte Talleyrand, seinen Außenminister, der mit den übrigen Ministern am Eingang der Kathedrale stand und missbilligend die Stirn runzelte. Napoleon konnte sich ein leises Kichern angesichts des Unbehagens nicht verkneifen, das den Aristokraten wegen des kaiserlichen Mangels an Schicklichkeit befiel. Nun, dann missbilligte er es eben, dachte Napoleon. Das alte Regime existierte nicht mehr, die Revolution hatte es hinweggefegt, und an seine Stelle war eine neue Ordnung getreten. Eine Ordnung, die auf dem Willen des Volkes gründete. Napoleon war dankbar und hellsichtig genug, den Gruß der Menschen zu erwidern, und er drehte sich nach allen Seiten und winkte der darüber begeisterten Menge zu, ehe er aus der Kutsche stieg. Die Diener ergriffen unverzüglich die Schleppe seines goldbestickten roten Gewands und folgten ihm gemessenen Schritts über den Teppich zum Eingang der Kathedrale.
Wie die meisten Gäste war auch seine Familie bereits ins Innere der Kirche und zu ihren festgelegten Plätzen geführt worden. Die Minister und hohen Staatsdiener würden dem Kaiser folgen und die prestigeträchtigsten Plätze im Zentrum der Zeremonie einnehmen. Ursprünglich hatte Napoleon beabsichtigt, seine Generäle in die Kirche zu führen, aber sein Bruder Joseph und Talleyrand hatten ihn bedrängt, die Krönung als eine vorwiegend zivile Feier zu begehen. Auch wenn Napoleon mithilfe der Armee zum Machthaber Frankreichs aufgestiegen war, musste er sich der Welt als politischer und nicht als militärischer Führer präsentieren. Talleyrand hegte immer noch die Hoffnung, einen dauerhaften Frieden in Europa erreichen zu können, wenn sich die anderen Mächte überzeugen ließen, dass der neue Kaiser in erster Linie Staatsmann und erst in zweiter Feldherr war.
Nach so vielen Jahren des Krieges hatte der kurzlebige Vertrag von Amiens beim Volk Appetit auf Frieden und Stabilität geweckt. Vor allem Stabilität, was die Einsetzung einer neuen, dauerhaften Regierungsform bedeutete. Napoleon hatte den Boden dafür geschickt bereitet, indem er sich vom Konsul zum Ersten Konsul und dann zum Ersten Konsul auf Lebenszeit ernennen ließ, bevor er dem Volk die Gelegenheit gab, seinem Verlangen nach der Besteigung eines neuen Throns zuzustimmen. Natürlich hatten es die Senatoren als notwendiges Mittel verkleidet, die Republik vor ihren äußeren und inneren Feinden zu schützen, doch die Republik gab es nicht mehr. Sie war in den Geburtswehen des Kaiserreichs gestorben. Schon hatte sich Napoleon mit einem schrillen Panoptikum von Adligen umgeben und den Einfluss von Senatoren, Tribunen und Volksvertretern beschnitten. Und es gab Pläne, eine Vielzahl neuer Adelstitel und Auszeichnungen zu vergeben, um das neue Regime zu stützen. Napoleon hoffte, dass das Kaiserreich mit der Zeit von den übrigen europäischen Mächten akzeptiert werden und diese aufhören würden, Franzosen für Mordanschläge auf ihn zu bezahlen.
Als er sich dem Eingang näherte, hielt Napoleon inne und drehte sich um, dann hob er die Hände und winkte zur Menge, ein strahlendes Lächeln auf dem von dunklem Haar gerahmten Gesicht. Die Leute stießen Freudenschreie aus und wogten auf die Kette der Grenadiere zu, die sich unter dem Druck ausbuchtete. Die Stiefel der Männer scharrten über die Pflastersteine, als sie sich dem Ansturm entgegenstemmten und die Leute mit den Läufen ihrer Musketen zurückstießen.
Napoleon wandte sich ab und schritt weiter auf das hohe Kirchenportal zu. Als er an Talleyrand vorbeikam, neigte er den Kopf in Richtung des Außenministers.
»Die Leute scheinen einverstanden zu sein.«
»Ja, Sire.«
»Und bereitet Ihnen meine Entscheidung, die Ehre anzunehmen, noch immer Kopfzerbrechen?«
Talleyrand zuckte leicht mit den Achseln. »Nein, Sire. Sie genießen das Vertrauen der Leute, und ich bin sicher, sie werden dafür sorgen, dass Sie es nicht enttäuschen.«
Napoleons Lächeln erstarb, und er nickte bedächtig. »Heute sind Frankreich und ich eins. Wie kann es da Widerspruch geben?«
»Wie Sie meinen, Sire.« Talleyrand neigte den Kopf und deutete unauffällig zum Eingang. »Ihre Krone wartet auf Sie.«
Napoleon richtete sich zu voller Größe auf, fest entschlossen, so königlich auszusehen, wie es seine schmächtige Statur gestattete. Er war seit über vier Jahren auf keinem Feldzug mehr gewesen, und das gute Leben, das er genoss, hatte ihn ein wenig rundlicher werden lassen. Josephine war so taktlos gewesen, bei mehr als einer Gelegenheit darauf hinzuweisen und ihn sanft in die Seite zu stupsen, wenn sie einander in den Armen lagen. Bei dem Gedanken wurde ihm leicht ums Herz, und er warf einen Blick durch das Portal der Kirche den Mittelgang hinunter, wo sie sitzen musste. Neun Jahre waren seit ihrem Kennenlernen vergangen, zu einer Zeit, da er zum ersten Mal ins Licht der Öffentlichkeit getreten war. Sie hatte unmöglich ahnen können, dass der schlanke Brigadegeneral mit dem glatten Haar eines Tages der Herrscher über Frankreich sein würde, geschweige denn, dass sie als Kaiserin an seiner Seite thronen würde. Napoleons Herzschlag beschleunigte sich vor Stolz auf seine Leistungen. Am Anfang hatte er befürchtet, sie könnte zu gut für ihn sein und es nur allzu schnell erkennen. Doch sein Aufstieg zu Ruhm und Wohlstand hatte ihre Furcht zum Verstummen gebracht, und obwohl er Josephine liebte, wie er nie eine andere Frau geliebt hatte, begann er sich inzwischen zu fragen, ob sie seiner würdig war.
Napoleon atmete ein letztes Mal tief die kühle Luft ein, dann betrat er Notre-Dame. In dem Moment, in dem er die Schwelle überschritt, fing am anderen Ende der Kathedrale ein Chor zu singen an, und die Teilnehmer der Zeremonie erhoben sich unter dem Rascheln von Gewändern und dem Scharren von Stuhlbeinen. Ein dunkelgrüner Teppich erstreckte sich vom Eingang bis zu dem Podest vor dem Altar, auf dem der Papst stand und wartete. Das Lächeln des Kaisers erstarb beim Anblick des Heiligen Vaters. Trotz seiner Bemühungen, die Rolle der katholischen Kirche in Frankreich zu verringern, hing das gemeine Volk hartnäckig an seiner Religion, und Napoleon hatte den Segen des Papstes benötigt, um seiner Krönung den Anschein göttlicher Zustimmung zu verleihen.
Sowohl das Podium als auch der Altar waren neu. Zwei alte Altäre sowie eine kunstvoll geschnitzte Chorschranke waren abgerissen worden, um einen eindrucksvolleren Raum im Herzen von Notre-Dame zu schaffen. Links und rechts neigten Staatsmänner, Botschafter, Offiziere und Sprösslinge der Pariser Gesellschaft das Haupt, als der Kaiser vorbeischritt. Seine Hand glitt zum Knauf des Schwerts von Karl dem Großen, das man aus einem Kloster in Aix-la-Chapelle herbeigeschafft hatte, um Napoleons Regalien zusätzlichen Glanz zu verleihen. Auch das gehörte zu den Anstrengungen, um der Krönung das Gewicht jahrhundertealter royaler Traditionen zu verleihen. Ein neuer Karl der Große für eine neue Zeit, überlegte Napoleon, als er aus der Allee aus Seide und Hermelin trat, in der die Juwelen der Damen funkelten und die goldenen Tressen und Orden der Generäle und Marschälle Frankreichs leuchteten. An ihrer Spitze stand Murat, der schmucke Kavallerieoffizier, der mit Napoleon bei Marengo gekämpft und später Caroline, die Schwester seines Generals, geheiratet hatte. Sie lächelten sich kurz zu, als der Kaiser an ihm vorbeiging.
Papst Pius VII. saß auf einem Thron vor dem Altar. Hinter und neben ihm war sein Gefolge aus Kardinälen und Bischöfen, hell erleuchtet von den Lichtstrahlen, die durch die hohen Fenster fielen. Napoleon trat vor die drei Stufen, die auf das Podest führten. Bei einem Blick nach links sah er seine Brüder und Schwestern. Der noch junge Louis konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, aber Joseph nickte ernst, als sein Bruder vorüberschritt. Es war eine Schande, dass nicht seine ganze Familie anwesend sein konnte, dachte Napoleon. Jérôme und Lucien waren in Ungnade gefallen, nachdem sie sich geweigert hatten, ihre Ehefrauen zugunsten von Frauen aufzugeben, die Napoleon für geeigneter hielt, um in den kaiserlichen Haushalt aufgenommen zu werden. Napoleons Mutter Letizia fehlte ebenfalls. Sie beteuerte, zu krank zu sein, um Italien verlassen und an der Krönung teilnehmen zu können. Napoleon hatte sich von ihren Ausreden nicht täuschen lassen. Sie hatte ihre Abneigung gegen Josephine von Beginn an sehr deutlich gezeigt, und ihr Sohn zweifelte nicht daran, dass Letizia eher verdammt sein wollte, als mit anzusehen, wie Josephine zusammen mit Napoleon gekrönt wurde. Hätte nur sein Vater diesen Tag noch erlebt. Carlo Buonaparte hätte seine widerborstige Frau zur Vernunft gebracht.
Napoleon nahm aus dem Augenwinkel Bewegung wahr, und er sah den Maler Jean-Louis David auf der anderen Seite der Kathedrale ein frisches Blatt dickes Papier auf sein Zeichenbrett legen, damit er eine weitere Skizze des Ereignisses anfertigen konnte. Napoleon hatte ein Monumentalgemälde in Auftrag gegeben, das die Krönung darstellen sollte, und David hatte ihm mitgeteilt, dass es drei Jahre dauern könne, bis das Werk fertiggestellt sei. Das heutige Schauspiel, dachte Napoleon, würde seinen Glanz wahrhaftig durch die Jahrhunderte verbreiten.
Der Papst erhob sich von seinem Thron und streckte eine Hand in Richtung Napoleon aus. Der Kaiser beugte ein Knie und ließ es auf einem reich bestickten Kissen ruhen, das vor dem Pontifex lag. Der Chorgesang erstarb, Stille senkte sich auf den Kirchenraum, und der Papst begann, mit hoher, dünner Stimme seinen Segen zu sprechen; die Worte schallten durch die Kathedrale und hallten dumpf von den Wänden wider.
Während der Heilige Vater mit seinem Sprechgesang fortfuhr, starrte Napoleon unverwandt auf den Teppich vor sich, da ihn plötzlich der Drang zu lachen überfiel. Trotz allen Prunks, trotz der prächtigen Kostüme und der kunstvoll ausgeschmückten Kulisse, trotz der monatelangen Vorbereitungen und der wochenlangen Proben erschien ihm dieser Augenblick der religiösen Zeremonie als in hohem Maße lächerlich. Der Gedanke, dass ausgerechnet er göttlichen Segen nötig hatte, war nicht nur lachhaft, sondern beleidigend. Fast alles, was er erreicht hatte, war das Ergebnis eigener Anstrengung. Den Rest verdankte er blindem Glück. Die Vorstellung, Gott lenke die Flugbahn jeder Musketen- oder Kanonenkugel auf dem Schlachtfeld, war absurd. Religion war für Napoleon das Gebrechen der Geistesschwachen, Leichtgläubigen und Verzweifelten. Es war eine Schande, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen an solchem Aberglauben festhielt. Aber es war auch zu seinem Vorteil. Solange er ein Lippenbekenntnis zu den religiösen Empfindungen seiner Untertanen ablegte, konnte er die Kirche als weiteres Mittel nutzen, um sie zu beherrschen. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, seine Bedürfnisse mit denen des Papsttums zu versöhnen.
Für den Moment gab sich Napoleon damit zufrieden, in den Augen der Leute ein Einvernehmen mit der Kirche erreicht zu haben, und er kniete mit gesenktem Haupt, während die Worte einer ausgestorbenen Sprache über ihn hinweggingen. Er blendete sie aus und konzentrierte sich auf die Rolle, die er zu erfüllen haben würde, wenn der Papst mit seinem Segen fertig war. Es würde keine Messe geben, in diesem Punkt war Napoleon unnachgiebig gewesen. Alles, was noch kam, würde seiner persönlichen Machtbefugnis entspringen. Keinem anderen als Napoleon selbst stand es zu, Napoleon zu krönen. Und Josephine, wenn er schon dabei war. Auch sie würde die Krone aus seiner Hand empfangen.
Einen Moment lang wandte er seine Gedanken den anderen gekrönten Häuptern Europas zu. Er verachtete sie, weil sie solche Macht lediglich aufgrund ihrer Geburt innehatten. Genau wie all diese Aristokraten, die Napoleons Schulzeit zu einer solchen Qual gemacht hatten. Es gab jedoch ein Paradox, dachte er und biss sich leicht auf die Unterlippe. Nur durch das Prinzip der vererbten Regierungsgewalt genossen die Staaten Stabilität. Das wilde Blutvergießen der Französischen Revolution hatte bewiesen, wie nötig stabile Verhältnisse waren, und erst als Napoleon die Macht ergriffen und begonnen hatte, mit eiserner Faust zu regieren, war wieder Ordnung in Frankreich eingekehrt. Ohne Napoleon würde abermals Chaos ausbrechen, und deshalb hatte das Volk seiner Ernennung zum Kaiser nur zu gern zugestimmt. Es würde rechtzeitig einen Erben geben müssen. Er wandte den Kopf kurz zu Josephine. Sie fing seinen Blick auf und blinzelte.
Napoleon lächelte, obwohl er eine große Traurigkeit in seinem Herzen fühlte. Er hatte bisher keine Kinder gezeugt, und die Zeit lief Josephine davon. Bald würde sie zu alt sein, um ein Kind auszutragen. Plötzlich befiel ihn die Furcht, er könne zeugungsunfähig sein. In diesem Fall würde die Dynastie, die mit dem heutigen Tag begründet wurde, mit ihm sterben. Es war ein Gedanke, der ihn frösteln machte, und Napoleon verscheuchte ihn rasch wieder und richtete seine Überlegungen stattdessen auf die unmittelbareren Schwierigkeiten, die seine Stellung gefährdeten. Auch wenn auf dem Kontinent ein fragiler Frieden herrschte, lag Frankreich immer noch im Krieg mit seinem unversöhnlichsten Feind.
Auf der anderen Seite des Ärmelkanals widersetzten sich ihm die Briten weiterhin, vor seinem Zorn geschützt durch ihre Kriegsschiffe, die ohne Unterlass die Seewege kontrollierten und Napoleon den Triumph verwehrten, der seine Herrschaft über Europa vervollständigen würde. Schon dachte er über eine Invasion nach, und es gab Pläne für den Bau einer enormen Zahl von Landungsbooten in den Häfen und Marinestützpunkten an der französischen Küste, die England gegenüberlagen. Wenn die Zeit gekommen war, würde Napoleon eine große Schlachtflotte zusammenstellen und die britische Flotte aus dem Weg der Invasionsboote fegen.
War England erst einmal unterworfen und gedemütigt, würde es keine andere Nation mehr wagen, sich ihm zu widersetzen, überlegte Napoleon. Bis dahin würde er Österreich und Russland sorgsam im Auge behalten müssen, da seine Spione berichteten, sie würden selbst in diesem Augenblick bereits aufs Neue zum Krieg rüsten.
Plötzlich kam ihm zu Bewusstsein, dass der Papst zu sprechen aufgehört hatte und Stille herrschte. Napoleon murmelte rasch ein Amen und bekreuzigte sich, bevor er mit fragendem Blick den Kopf hob. Der Papst ließ sich soeben würdevoll in seinem reich verzierten Sessel nieder, die rechte Hand noch zur Segensgeste erhoben. Er fing den Blick des Kaisers auf und nickte leicht. Napoleon richtete sich auf und wäre fast gestolpert, da sich ein Teil seiner Schleppe unter seinem Fuß verfangen hatte. Er wahrte gerade noch das Gleichgewicht und tat mit einem unterdrückten Fluch den letzten Schritt auf das Podium. Neben dem Papst lagen auf einem kleinen vergoldeten Gestell die beiden Samtkissen mit den für den Kaiser und die Kaiserin angefertigten Kronen.
Napoleon näherte sich dem Gestell und hielt einen Moment lang inne, um die Ehrfurcht zum Ausdruck zu bringen, die dem Augenblick angemessen war. Dann streckte er beide Hände aus und ergriff den goldenen Lorbeerkranz der Kaiserkrone, die an die Cäsaren erinnern sollte. Er drehte sich langsam um und hielt sie in die Höhe, damit alle sie sehen konnten. Er holte tief Luft, und auch wenn er genau wusste, was er zu sagen hatte, schlug sein Herz laut vor nervöser Aufregung.
»Durch die mir vom Volk verliehene Macht nehme ich diese Krone und den Kaiserthron Frankreichs an. Ich gelobe allen Anwesenden bei meiner Ehre, dass ich die Nation gegen alle Feinde verteidigen und nach Gottes Willen im Einklang mit den Wünschen des Volkes und in seinem Interesse regieren werde. Möge dieser Augenblick die Größe Frankreichs versinnbildlichen. Möge diese Größe anderen Nationen als Leuchtfeuer dienen, und mögen sie sich uns in der Herrlichkeit des kommenden Zeitalters anschließen.«
Er hielt inne, dann hob er die Krone direkt über seinen Kopf und ließ sie langsam herabsinken. Der goldene Lorbeerkranz war schwerer, als er erwartet hatte, und er vergewisserte sich sorgfältig, dass er sicher saß, ehe er seine Hände wegzog. Sofort setzte der Chor auf dem Balkon hinter dem Altar ein und sang ein Stück, das zur Feier dieses Moments komponiert worden war. Napoleon hob leicht den Kopf und blickte über die Reihen der Gäste vor ihm. Ihre Mienen waren gemischt. Manche lächelten. Andere blickten ernst drein, wieder andere wischten sich Tränen aus den Augenwinkeln, überwältigt von der Erhabenheit des Augenblicks. Er blickte erneut zu Joseph und sah, dass die Lippen seines älteren Bruders verlegen zitterten, da er den Stolz und die Liebe zu unterdrücken versuchte, die er für Napoleon empfand. Es waren der Stolz und die Liebe, die er immer empfunden hatte, seit sie sich vor vielen Jahren ein Kinderzimmer in dem bescheidenen Zuhause in Ajaccio geteilt hatten, bevor die stolze korsische Familie mit Mühe das Geld aufgebracht hatte, um den Jungen eine anständige Erziehung in Frankreich zu sichern.
Napoleon gestattete sich ein kurzes Lächeln in Richtung seines Bruders, ehe sein Blick weiterwanderte, über die Reihen seiner Marschälle und Generäle, darunter viele, mit denen er seit Beginn seiner militärischen Laufbahn alle Gefahren und Abenteuer geteilt hatte. Tapfere Soldaten wie Junot, Marmont, Lannes und Victor. Männer, die er in den kommenden Jahren zu weiteren Siegen zu führen plante, falls die übrigen Mächte Europas es wagten, sich der neuen Ordnung in Frankreich zu widersetzen.
Als der Chor ans Ende des Liedes kam und verstummte, wandte sich der Kaiser an Josephine, und sie trat vor. Ihre Schleppe wurde von zwei für diese Ehre ausgewählten Freundinnen gehalten, nachdem sich Napoleons Schwestern der Aufgabe verweigert hatten. Wie ihr Gemahl trug sie eine schwere scharlachrote Robe, reich mit goldenen Motiven verziert, und auch wenn ihre Miene gefasst blieb, funkelten ihre Augen wie unbezahlbare Edelsteine, als sie anmutig zu den Stufen schritt und sich zu Napoleons Füßen auf das Kissen kniete. Sie neigte den Kopf und verharrte reglos.
Nach einer kurzen Pause räusperte sich Napoleon und sprach zum Publikum. »Es ist uns eine große Freude, die Krone der Kaiserin von Frankreich an Josephine zu vergeben, die uns lieb und teuer ist wie das Leben selbst.« Er nahm die verbliebene Krone und näherte sich seiner Frau, hielt den goldenen Reif über ihren Kopf und senkte ihn langsam auf die sorgfältig geflochtenen Zöpfe ihres braunen Haares. In dem Augenblick, in dem er einen Schritt von ihr zurücktrat, setzte der Chor mit dem Lied ein, das zu ihren Ehren komponiert worden war, und die melodiösen Stimmen trugen durch das gesamte Kirchenschiff. Napoleon beugte sich vor, ergriff Josephines Hände und zog sie zu ihrer vollen Größe empor, dann stieg sie auf das Podium, drehte sich um und stand an seiner Seite vor ihren Untertanen.
Die Zeremonie endete mit einem Gebet des Papstes, dann führte Napoleon seine Kaiserin die Stufen hinab und zurück zum Eingang von Notre-Dame. Als er an seinem Bruder vorbeikam, beugte er sich zu ihm und murmelte: »Ach, Joseph, wenn Vater uns jetzt nur sehen könnte!«
2
April 1805
Napoleon stand vor dem Fenster und blickte in die gepflegten Gärten des Tuilerien-Palasts hinunter. An den Zweigen sprießten die ersten Frühjahrsknospen, der Himmel war nach einem kurzen Regenguss hell und klar, und der Wind hatte die Wolke aus Ruß und Rauch weggefegt, die für gewöhnlich über Paris hing. Ein derart schöner Morgen hob normalerweise seine Stimmung, aber heute betrachtete der Kaiser die Szenerie mit ausdruckslosem Gesicht. Beunruhigende Gedanken wegen des Berichts, den ihm Talleyrand soeben umrissen hatte, lasteten auf seinem Gemüt. Niemand in Europa bezweifelte, dass Frankreich die größte Macht auf dem Kontinent war. Sein Einfluss erstreckte sich von den Gestaden der Ostsee bis zum Mittelmeer. Aber dort, an den Küsten des Kontinents, endete Napoleons Macht. Draußen auf dem Meer spotteten die Kriegsschiffe der britischen Marine seinem Ehrgeiz, und der Widerstand der Briten nährte die unterschwellige Feindseligkeit Preußens, Österreichs und Russlands.
Napoleon seufzte müde am Fenster und drehte sich zu seinem Außenminister um. »Und unsere Agenten sind sich ihrer Sache sicher?«
»Ja, Sire.« Talleyrand nickte. »Die österreichischen Generäle haben Befehl, ab Ende Juni ihre Truppen außerhalb von Wien zusammenzuziehen. Die Nachschubwagen sammeln sich bereits bei Depots entlang der Donau. Beauftragte von Kaiser Franz reisen kreuz und quer durch Europa, um neue Pferde für ihre Kavallerie zu kaufen. Die Festungen zum Schutz der Pässe nach Italien hinein wurden verstärkt und mit neuen Vorwerken versehen. Unser Botschafter hat den österreichischen Hof auf diese Dinge angesprochen und eine Erklärung verlangt.«
»Und?«, fragte Napoleon barsch.
»Die Österreicher behaupten, es handle sich um nichts weiter als eine längst überfällige Nachbesserung ihrer Wehranlagen. Sie streiten ab, dass es irgendeinen düsteren Hintergrund für all diese Entwicklungen gebe.«
»Was sonst.« Napoleon lächelte grimmig. »Nichtsdestoweniger sind es unverkennbar Kriegsvorbereitungen.«
»Es sieht so aus, Sire.«
»Wie steht es mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen unseres Botschafters in Russland? Sosehr sich die Österreicher ihrer militärischen Tüchtigkeit rühmen mögen, bezweifle ich doch ernsthaft, dass sie einen Krieg gegen Frankreich ohne Bündnis mit wenigstens einer weiteren europäischen Macht riskieren würden. Die Frage ist, wird Russland an der Seite Österreichs kämpfen oder Preußen?« Napoleon hielt kurz inne. »Oder alle beide? Alle natürlich von ihren britischen Zahlmeistern subventioniert und zum Handeln gedrängt.«
»Ja, Sire.« Talleyrand nickte abermals. »Ich denke, die Briten werden unseren Feinden die üblichen Kreditlinien verlängern, dazu werden sie Ausrüstung und Waffen liefern und Gold und Silber fließen lassen.«
»Natürlich.« Napoleon schniefte verächtlich. »Wie immer geben die Briten von ihrem Reichtum und lassen ihre Verbündeten mit Blut und Menschenleben zahlen. Was ist nun also mit Russland?«
Talleyrand zog kurz ein Blatt Papier zurate, das er in der Hand hielt, und sah seinen Kaiser dann an. »Botschafter Caulaincourt berichtet, dass es dem Zaren zu widerstreben scheint, von sich aus in einen Krieg gegen uns einzutreten. Nichtsdestoweniger hat es ein Maß an Mobilmachung der russischen Streitkräfte gegeben, das sich mit einer Verteidigungshaltung allein nicht mehr erklären lässt. Falls uns Österreich tatsächlich den Krieg erklärt, wird sich Russland wohl überreden lassen mitzumachen.«
Napoleon faltete die Hände und ließ das Kinn auf den Fingerspitzen ruhen. Wie immer schienen seine Rivalen zur Vernichtung Frankreichs entschlossen. Beinahe so, als ginge es um nichts anderes als die Vernichtung selbst. Wenn sie nur akzeptieren könnten, dass sich Frankreich verändert hatte. Es würde keine Rückkehr zur Tyrannei der Bourbonen geben. Frankreich bot ein Modell einer besseren Gesellschaft an, und das fürchteten sie mehr als alles andere. Wenn ihre eigenen Völker erkannten, dass es eine Alternative zur parasitenhaften Aristokratie durch Geburt gab, würden ihre Regierungen fallen wie Dominosteine. Wenn man ihnen die Zeit dazu ließ, würden sie Frankreich auf dem Weg der Revolution folgen und am Ende aufgeklärter, befreiter sein, und sie würden unvermeidlich in eine Familie aus Nationen unter dem Einfluss Frankreichs und seines Kaisers gezogen werden. Napoleon runzelte die Stirn. Dieser Tag lag noch in weiter Ferne. Gegenwärtig rotteten sich seine Feinde zusammen wie Wölfe, und wenn er sie besiegen wollte, musste er in einem ersten Schritt Mittel und Wege finden, sie auseinanderzudividieren. Er sah Talleyrand an. »Was halten Sie von dem neuen Zaren?«
Talleyrand schürzte die Lippen und formulierte eine Antwort. »Nach Caulaincourts Berichten und meinen Gesprächen mit dem russischen Botschafter hier in Paris zu urteilen, scheint Zar Alexander ein leicht zu beeindruckender Mensch zu sein. Und eine Art Idealist. Es verlangt ihn, das Los seines Volkes zu verbessern, möglicherweise bis hin zur Abschaffung der Leibeigenschaft. Er ist jedoch kein Narr. Er weiß sehr wohl, dass die Landbesitzer gegen seine Bestrebungen eingestellt sind, und er weiß, wie gefährlich das sein kann.«
Ein Lächeln huschte über Napoleons Gesicht. »Es kommt in der Tat selten vor, dass ein Zar eines natürlichen Todes stirbt.«
Talleyrand nickte. »Ganz recht, Sire.«
Napoleon setzte sich an seinen Schreibtisch und verschränkte die Hände. »Wir haben es hier also mit so etwas wie einem Radikalen zu tun. Das ist gut. Vielleicht gelingt es uns, einen solchen Mann zu unserer Sicht der Dinge zu bewegen.«
»Vor allem, da der Zar beabsichtigt, den Einfluss Russlands bis zum Mittelmeer und in den Osten auszudehnen.«
Napoleon blickte auf. »Wo er mit den Briten und ihren Ambitionen aneinandergeraten wird.«
»Richtig, Sire.«
»Gut. Nun denn, sorgen Sie dafür, dass Caulaincourt den Zaren regelmäßig mit Informationen über den unstillbaren britischen Machthunger füttert. Und was Preußen angeht …«, er lächelte kurz, »… so wollen wir ihnen eine kleine Belohnung in Aussicht stellen. Wir bieten den Preußen Hannover im Tausch für ihre Neutralität an. König Friedrich Wilhelm ist kein Kriegsheld. Der Mann ist schwach und leicht beeinflussbar. Sein Stillhalten wird sich erkaufen lassen. Der Zar ist unser eigentliches Problem. Besonders, da wir mit England im Krieg liegen und wahrscheinlich in naher Zukunft auch mit Österreich.«
»Ja, Sire«, stimmte Talleyrand zu.
Etwas an seinem Verhalten ließ Napoleon aufmerken, und er musterte seinen Außenminister eingehend, bevor er weitersprach. »Sie haben etwas zu sagen.«
Es war eine Feststellung, keine Frage, wie Talleyrand sofort begriff. Er nickte.
»Dann reden Sie.«
»Jawohl, Sire. Mir ist der Gedanke gekommen, dass wir einen Krieg mit Österreich unter Umständen verhindern und vielleicht sogar einen dauerhaften Frieden mit England erreichen könnten.«
»Frieden mit England? Mit dieser verräterischen Schlangengrube? Ich glaube, Sie haben den Verstand verloren, Talleyrand. Die Regierenden dieser Insel verspüren keinerlei Lust auf Frieden. Sie haben gelesen, was in ihren Zeitungen über mich steht.« Napoleon stieß den Zeigefinger auf seine Brust. »Ungeheuer, Tyrann, Diktator – so nennen sie mich.«
Talleyrand tat es mit einer Handbewegung ab. »Nur eine Marotte ihrer Presse, Sire. Britische Zeitungen sind für ihre Voreingenommenheit bekannt. Genau wie die von Paris«, fügte er mit sanftem Nachdruck hinzu. »Aber sie sind nicht das Sprachrohr ihrer Regierung. Und es gibt Männer in hohen Positionen, die gewillt sind, die Aussicht auf einen Frieden mit Frankreich am Leben zu halten.«
»Wieso haben sie ihren Wunsch dann nicht deutlicher zum Ausdruck gebracht?«
Talleyrand zuckte mit den Achseln. »Es ist in Kriegszeiten nicht immer einfach, das Wort für den Frieden zu ergreifen. Doch die britischen Untertanen müssen des Krieges so überdrüssig sein wie die Bürger Frankreichs. Es gibt gewiss einen Spielraum für ein friedliches Zusammenleben unserer Nationen, Sire. Wir müssen den Teufelskreis der Feindseligkeit durchbrechen, ehe er uns alle ins Verderben führt. Wir müssen verhandeln.«
»Warum? Welchen Sinn hat es?«, entgegnete Napoleon ungehalten. »England hat deutlich gemacht, dass es sich mit nichts weniger als meiner Vernichtung, der Wiederherstellung der Bourbonen-Herrschaft und der Demütigung Frankreichs zufriedengeben wird. Und dann wird England den Kontinent dominieren.«
»Dem stimme ich bei allem Respekt nicht zu, Sire. England ist im Kern eine Nation von Kaufleuten, von Geschäftsmännern. Wenn wir ihnen bewiesen, dass sie nach Belieben freien Handel in Europa treiben können, dann würden sie sich vielleicht davon überzeugen lassen, dass dieser Krieg in jeder Hinsicht unprofitabel ist. Wenn es nur ein gewisses Entgegenkommen gäbe, dann wäre Friede mit den Briten und Friede in ganz Europa möglich.« Talleyrand hielt inne und sah seinen Kaiser durchdringend an. »Sire, wenn Sie mir gestatten würden, Verhandlungen mit Britannien aufzunehmen, dann …«
»Nichts dann!« Napoleon schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Nichts würde dabei herauskommen. Ich werde keinen Kompromiss eingehen. Ich werde mir von dieser Nation von Krämern nichts vorschreiben lassen! Im Herzen Europas ist nur für eine Macht Platz. Verstehen Sie denn nicht, Talleyrand? Wenn Sie wirklich Frieden wollen, müssen wir Europa beherrschen. Wenn wir Entgegenkommen zeigen und unsere Nachbarn als ebenbürtig behandeln, wird es immer Differenzen, Feindseligkeiten und Konflikte geben.«
Talleyrand sah Napoleon einige Augenblicke schweigend an und schüttelte dann den Kopf. »Das ist der Rat, den die Verzweiflung eingibt, Sire. Es ist doch fraglos besser zu verhandeln, um andere auf seine Seite zu ziehen, als sich auf Krieg zu stützen?«
»Mag sein, aber zumindest hat der Krieg den Vorteil, dass er dem Sieger das Recht gewährt, die Friedensbedingungen zu diktieren. Dann ist kein Entgegenkommen nötig.«
»Aber zu welchem Preis, Sire? Wie viel Gold wäre vergeudet? Wie viele Leben zerstört? Krieg ist nichts weiter als das Versagen der Diplomatie, Sire.«
»Sie irren sich, Talleyrand. Krieg ist die Fortsetzung der Diplomatie bis zum Äußersten. Er ist außerdem die stärkste einigende Kraft in einer Nation. Er duldet kein Entgegenkommen, und wenn er mit einem Sieg endet, ist eine Nation reich an Ruhm und Selbstachtung und kann die Welt um sich herum nach ihren Interessen formen. Verhandlung ist die erste Zuflucht der Schwachen. Krieg ist das Reich der Starken. Wenn Frankreich die Befähigung zum Krieg hat, dann wird der Krieg zu dem Mittel, mit dem es seinen Einfluss am wirkungsvollsten ausüben kann.« Napoleon lehnte sich zurück und lächelte. »Und haben wir in den letzten Jahren nicht ein besonderes Talent zum Krieg bewiesen?«
»Ein Talent zum Krieg?« Talleyrand zog überrascht die Augenbrauen in die Höhe. »Krieg ist eine furchtbare Sache, Sire. Man sollte meinen, ein solches Talent, wie Sie es nennen, wäre eher peinlich und weniger eine Tugend.«
»Sie kennen den Krieg nicht, wie ich ihn kenne«, konterte Napoleon. »Ich war fast mein ganzes Leben lang Soldat. Ich war nahezu zwölf Jahre lang im Krieg. Ich habe Feldzüge quer durch Europa und bis zu den Wüsten Arabiens geführt. Ich habe in unzähligen Schlachten gekämpft und im Hagel aus Musketen- und Kanonenkugeln die Stellung gehalten. Ich wurde verwundet und habe Freunde sterben sehen. Ich habe die Toten und Sterbenden gesehen, Talleyrand. Riesige Felder von ihnen. Ich habe auch Männer in ihren besten Augenblicken gesehen. Ich habe gesehen, wie sie Furcht und Schrecken beherrschten und gegen eine überwältigende Übermacht angriffen. Ich habe sie tagelang ohne Unterbrechung marschieren sehen, barfuß und hungrig, und am Ende haben sie eine Schlacht ausgefochten und gewonnen. Das alles habe ich gesehen.« Er lächelte. »Sie sehen, Talleyrand, ich weiß ganz gut Bescheid über den Krieg. Aber Sie? Was wissen Sie davon? Ein Aristokrat durch Geburt? Ein Geschöpf der Salons von Paris und der Paläste von Prinzen und Königen. Was wissen Sie von Gefahr? Auf dem Höhepunkt der Revolution waren Sie nicht einmal in Paris. Bevor Sie sich also erlauben, mich über die Übel des Kriegs zu belehren, seien Sie so freundlich, Ihre Kommentare auf Ihr Fachgebiet zu beschränken. Sie sind diplomatisch tätig. Sie leisten für Frankreich mit Ihrer glatten Zunge und Ihren Intrigen, was in Ihren Möglichkeiten steht. Aber vergessen Sie eins nicht: Sie sind ein Diener Frankreichs. Ein Diener des Kaisers. Sie sind ein Mittel zum Zweck, und ich, ich allein, entscheide, welcher Art dieser Zweck ist. Verstanden?«
»Ja, Sire«, erwiderte Talleyrand mit zusammengebissenen Zähnen. »Ich verstehe vollkommen.«
Napoleon sah seinen Außenminister einen Moment lang aufmerksam an, dann lächelte er plötzlich und fuchtelte mit der Hand. »Ach, kommen Sie! Haken wir es ab. Lassen Sie uns nicht weiter philosophieren, sondern von machbaren Dingen reden. Im Augenblick habe ich nicht mehr Verlangen nach Krieg als Sie. Aber man muss für alle Eventualitäten gewappnet sein.«
»Natürlich, Sire.«
»Dann müssen wir unsere Freunde, die Österreicher, zu der Überzeugung führen, dass sie bei einem Krieg gegen uns nichts zu gewinnen haben. Wir haben sie aus den italienischen Herrschaftsgebieten vertrieben. Jetzt müssen wir sie wissen lassen, dass Frankreich der neue und dauerhafte Herr über die italienischen Königreiche ist.«
»Sire?«
»Ich möchte, dass Sie Vorbereitungen für eine weitere Krönung treffen.« Napoleon legte den Kopf in den Nacken. »Spätestens zum Ende des Frühjahrs werde ich zum König von Italien gekrönt werden. Und wir werden alle Vorteile unseres bürgerlichen Rechts und unseres Regierungssystems auf die Einheimischen dieses Landes ausdehnen. Kurz, wir werden so schnell wie möglich Franzosen aus ihnen machen, sodass sie es nie mehr erdulden müssen, von Österreich regiert zu werden.«
»König von Italien?«, sagte Talleyrand. »Das ist Ihr Wille?«
»Das ist er. Sorgen Sie dafür, dass die Vorbereitungen unverzüglich beginnen.«
»Ja, Sire.«
»Sie dürfen jetzt gehen, Talleyrand. Ich habe meine Angelegenheiten in Paris abgeschlossen und werde für einige Tage in Malmaison bei der Kaiserin und meiner Familie sein, falls Sie mich brauchen.«
»Ja, Sire.« Talleyrand hielt inne. »Und diese andere Sache, Sire?«
»Welche andere Sache?«
»Die Frage, ob wir Verhandlungen mit England aufnehmen.«
»Es wird keine Verhandlungen geben. England will Krieg, und den werden sie bekommen.«
Talleyrand nickte betrübt und humpelte auf seinem missgebildeten Bein aus dem Raum. Sobald sich die Tür hinter dem Außenminister geschlossen hatte, wurde Napoleons Gesichtsausdruck hart. Sosehr er seine diplomatischen Fähigkeiten schätzte, er traute Talleyrand nicht. Sein geschmeidiger Charme und der immer leicht spöttische Tonfall erregten Bitterkeit und Zorn bei Napoleon, Gefühle, die der Kaiser verbergen musste, um sich die Dienste seines Außenministers zu bewahren. Gleichwohl beschloss er, dass er den Mann von Fouchés Spionen noch genauer beobachten lassen würde. Auch wenn Napoleon nicht bezweifelte, dass Talleyrand ein Patriot war, so war sein Patriotismus doch an eine sehr eigentümliche Vorstellung von Frankreichs wahren Interessen geknüpft, eine Vorstellung, die nicht im Einklang mit Napoleons Plänen für das Reich stand.
Eins war jedoch sicher: England musste vernichtet werden. Dank der zwanzig Meilen Meer, die Frankreich von den Klippen Dovers trennten, gab es nur einen Weg, den Feind vernichtend zu schlagen – die britische Marine musste aus dem Ärmelkanal gefegt werden, damit Napoleon die Grande Armée zu einer Invasion Britanniens führen und die Friedensbedingungen in London selbst diktieren konnte.
3
Und warum sollte ich nicht zehn Paar neue Schuhe haben dürfen?« Josephine runzelte die Stirn, als sie sich eine frische Tasse Kaffee einschenkte. Dann verharrte ihre Hand über einem Teller Gebäck, ehe sie nach einem schlanken, mit Honig beträufelten Biskuit griff. Sie hielt es anmutig zwischen Daumen und Zeigefinger, biss ab und kaute ein wenig, ehe sie fortfuhr. »Schließlich bin ich die Kaiserin, und es würde ein schlechtes Licht auf dich werfen, wenn ich mich in fadenscheinigem Sackleinen und einem Paar abgestoßener Holzpantinen in der Öffentlichkeit blicken ließe. Davon abgesehen kannst du es dir leisten.«
Sie waren allein in dem privaten Salon, der zu den Gärten auf der Rückseite des Schlosses hinausging. Draußen senkte sich die Dämmerung auf die ländliche Umgebung, und es war kühl genug, damit das Feuer im Kamin, von dem gelegentlich das Krachen oder Zischen eines frischen Scheits zu hören war, seine Berechtigung hatte. Napoleon blätterte Korrespondenz durch, die in einer Schale auf seinem Schoß lag. Er tippte auf einen weiteren Brief.
»Und hier ist noch einer. Von einem Vorhanglieferanten in Lyon … fünf Ballen Seide.« Napoleons Augenbrauen gingen steil nach oben. »Fünf Ballen Seide! Großer Gott, weißt du, was er dir dafür in Rechnung gestellt hat?«
Josephine zuckte mit den Achseln.
Napoleon seufzte und wies mit einem Kopfnicken auf die Briefe in der Schale. »Die meisten unter ihnen sind von Lieferanten des kaiserlichen Haushalts. Außer von Seide ist von Schuhen, Hüten, Kleidern die Rede, von Pferden, Möbeln, Wein, Kuchen … Und in allen Fällen wird respektvoll festgestellt, dass die Rechnung noch nicht beglichen wurde.«
»Sie haben allen Grund, respektvoll zu sein, die undankbaren kleinen Gauner.« Josephine schniefte. »Nachdem ich mir die Mühe gemacht habe, sie zu kaiserlichen Hoflieferanten zu ernennen. Man sollte meinen, sie hätten ein Gefühl für die Ehre, die ich ihnen erweise.«
»Sie müssen trotzdem bezahlt werden«, mahnte Napoleon. »Das sind keine Wohltätigkeitsorganisationen. Und du darfst nicht so weitermachen. Für das, was du jeden Monat für sinnlosen Luxus ausgibst, könnte ich eine Infanteriebrigade ausrüsten. Das muss aufhören, bevor diese Verschwendung unseren Ruf beschädigt.«
»Wie könnte es das? Fouché, dieser kleine Rüsselkäfer, kontrolliert, was in die Zeitungen kommt. Er wird kaum zulassen, dass irgendwelche Klatschgeschichten veröffentlicht werden, die das Ansehen seines Herrn untergraben.«
»Klatsch verbreitet sich von Mund zu Mund ebenso leicht wie über Zeitungen«, entgegnete Napoleon müde. »Und ich werde nicht dulden, dass die Leute murren, weil du deine Schulden nicht bezahlst.«
»Tja, das ist deine eigene Schuld«, erwiderte Josephine bockig. »Wenn du mir genug geben würdest, damit ich über die Runden komme, müsstest du dich nicht mit diesen kleinlichen Geizhälsen und ihren Beschwerden herumschlagen.«
»Eine gute Ehefrau versteht es, mit ihrem Budget auszukommen.«
»Wo kommt das denn her?« Josephine lachte höhnisch. »Noch so ein handfester korsischer Sinnspruch deiner Mutter?«
»Ich warne dich nicht zum ersten Mal. Du wirst meine Mutter respektieren. Insbesondere während sie unter meinem Dach weilt.«
Letizia hatte sich vor mehr als einem Monat dem kaiserlichen Haushalt angeschlossen, nachdem sie von ihrer Krankheit genesen war.
»Das ist noch so eine Geschichte«, fügte Josephine an. »Wie lange wird sie bleiben?«
»So lange sie es möchte.«
»Natürlich.« Josephine lachte freudlos. »Sie richtet sich hier häuslich ein und verbringt ihre Tage damit, an fast allem herumzunörgeln, was ich tue oder sage. Sie verachtet mich, und ich weiß, sie träufelt bei jeder Gelegenheit Gift über mich in dein Ohr.«
»Das reicht!«, brauste Napoleon auf und schleuderte die Korrespondenz in Richtung seiner Frau. Die Schale traf den Gebäckteller, das zarte Porzellan rutschte samt Inhalt vom Tisch und zersprang auf dem Boden. Josephine fuhr auf ihrem Stuhl zurück, die Augen groß vor Furcht. An ihren Lippen hingen noch Krümel, sie schluckte nervös und sah ihren Gatten an. Napoleon stand auf, trat auf sie zu und unterstrich seine Worte, indem er den Zeigefinger in ihre Richtung stieß.
»Du wirst nicht noch einmal in dieser Weise sprechen, hast du mich verstanden?«
»Ja, mein Gemahl.« Ihre Stimme zitterte. »Wie du wünschst.«
»Ganz recht.« Er nickte. »Wie ich wünsche. Du wirst höflich und respektvoll gegenüber meiner Mutter und dem Rest meiner Familie sein, was immer sie zu dir sagen. Tief in meinem Innern bin ich trotz allem noch immer Korse, und meine Familie bedeutet mir mehr, als du je begreifen wirst. Verstanden?«
Josephine nickte und presste beide Hände an die Brust. Schon stiegen ihr Tränen in die Augen, und sie beobachtete ihren Mann ängstlich. Napoleon sah sie noch einen Moment lang böse an, dann seufzte er tief und nahm ihre Hände in seine.
»Es tut mir leid. Mein Temperament ist mit mir durchgegangen. Ich habe viel um die Ohren und bringe wenig Geduld für die kleinen Dinge auf, um die sich jeder Ehemann kümmern muss. Verzeih mir.« Er neigte den Kopf und küsste ihre Finger.
Josephine nickte, und ihre Brust wogte ein wenig auf und ab, als sie gegen die Tränen ankämpfte. »Es ist meine Schuld. Ich weiß, ich sollte ihr mehr Respekt erweisen, aber … sie hasst mich. Deine ganze Familie hasst mich. Sie haben mich immer gehasst. Ich ertrage es nicht.«
»Pst.« Napoleon legte beschwichtigend seine Hand an ihre Wange. »Niemand hasst dich. Sie sind nun mal Korsen mit korsischen Moralvorstellungen.« Napoleons Gedanken schweiften kurz zu Pauline und ihrem skandalösen Benehmen ab. Ihre zahlreichen Affären waren öffentlich bekannt. Aber sie war schon immer promiskuitiv gewesen. Napoleon zuckte zusammen bei der Erinnerung, wie er sie vor neun Jahren bei seinem ersten Italienfeldzug hinter einer Trennwand in seinem Kartenraum mit einem Grenadier in flagranti erwischt hatte. Er schüttelte den Kopf. »Die meisten jedenfalls. Wie auch immer, du wirst meine Familie nicht mehr lange erdulden müssen.«
»Ach?«
Napoleon lächelte. »Wir verlassen Frankreich für zwei, vielleicht drei Monate.«
»Wir verlassen Frankreich?«, erwiderte Josephine müde. »Doch nicht ein weiterer Feldzug?«
»Nur falls England beschließt, in Italien einzumarschieren.«
»Italien!« Josephines Miene heiterte sich sofort auf bei der Erinnerung an die Zeit von Napoleons erstem Armeekommando und den beinahe königlichen Hof in Montebello, wo sie ein sorgenfreies Leben geführt hatte und von den klügsten Köpfen und lebhaftesten Persönlichkeiten Italiens umgeben gewesen war. »Wann brechen wir auf?«
»Noch in diesem Monat.« Napoleon lächelte. »Achte nur darauf, dass du keine neuen Kleider für die Reise bestellst, die du dir nicht leisten kannst.«
»Du Ekel!« Josephine versetzte ihm einen Schlag auf die Schulter, dann wurde ihr Gesichtsausdruck ernst. Sie schlang die Arme um seinen Hals, zog ihn auf den Stuhl herab und küsste ihn mitten auf den Mund. Sein Herzschlag beschleunigte, und dann waren seine Hände an den Riemen ihres Mieders.
»Es wird wie beim letzten Mal sein«, hauchte sie. »Nein, besser als bei unserem letzten Italienaufenthalt. Ich verspreche es.«
Napoleon strich mit den Lippen sanft über den Bogen ihres Halses und weiter zur weichen Rundung ihrer Brust, und mit einem Auge schielte er zu der Uhr über dem Kamin und sah, dass sie noch Zeit hatten, sich zu lieben, bevor er sich zum Abendessen mit seiner Familie ankleiden musste.
Normalerweise betrachtete Napoleon Essen als notwendiges Übel und schlang nur rasch etwas hinunter, ehe er zu seiner Arbeit zurückkehrte. Doch nicht so heute Abend. Um den Tisch saßen seine Frau, seine Brüder Joseph und Lucien, seine Schwestern Caroline und Pauline, und am anderen Ende des Tischs thronte seine Mutter Letizia. Als der Hauptgang serviert worden war und die Diener sich zurückgezogen und leise die Tür hinter sich geschlossen hatten, räusperte sich Caroline.
»Ich höre, du willst Italien besuchen.«
Josephine erschrak ein wenig bei dieser Aussage und sah rasch zu ihrem Mann, der sich zwang, seine Überraschung zu verbergen. »Von wem hast du das gehört?«, fragte er.
»Von meinem Mann. Joachim hat es von seinem Stabschef.«
»Wirklich?« Napoleon zog eine Augenbraue in die Höhe. Marschall Joachim Murat war der talentierteste Kavallerieoffizier des Kaisers, aber wie die meisten seiner Art neigte er zu Großspurigkeit und Indiskretion. Wenn er die Neuigkeit von der bevorstehenden Italienreise gehört hatte, war es vermutlich bereits Tagesgespräch in der Hälfte der Pariser Salons.
Er nickte in Richtung seiner Schwester. »Nun denn, da das Geheimnis bereits gelüftet ist – ja, es stimmt. Ich beabsichtige eine Rundreise zu unseren italienischen Herrschaftsgebieten.«
»Und stimmt es auch, dass du dich zum König von Italien krönen lassen willst?«
Das konnte nur von Talleyrand gekommen sein, wie Napoleon sofort begriff. Aber warum sollte er Napoleons Pläne ausplaudern? Vielleicht, um potenziellen Attentätern einen Wink zu geben? Kaum war der Gedanke in seinem Kopf, zwang sich Napoleon, ihn zu verwerfen. Seit dem blutigen Anschlag auf sein Leben vor vier Jahren neigte er dazu, überall Gefahren zu sehen, aber er begriff, dass er kein vernünftiges Leben führen konnte, wenn er in einem permanenten Zustand der Angst lebte.
»Es stimmt, Caroline.«
Am anderen Ende des Tischs lachte Letizia humorlos. »Noch eine Krönung? Sammelst du jetzt Kronen, mein Sohn?«
Napoleon lachte, und die anderen fielen ein, wodurch sich die Spannung, die seit Beginn des Mahls über der Tafel hing, endlich ein wenig löste.
»Ich bin bereit, Kronen zu sammeln, wenn es zweckdienlich ist, es zu tun, Mutter. Es wäre jedoch unschicklich, zu sehr solchen Erwerbungen zu frönen.«
»Besonders für jemanden, der vor nicht allzu vielen Jahren noch ein leidenschaftlicher Jakobiner war«, fügte Lucien leise an.
Napoleon wandte sich seinem jüngeren Bruder mit überdrüssiger Miene zu. Lucien war immer der radikalste seiner Geschwister gewesen, er war auf eine gefährliche Art radikal.
Lucien trank einen Schluck Wein und fuhr fort. »Weißt du noch, Bruder, wie wir das Direktorium stürzten und du Erster Konsul wurdest?«
»Ja.«
»Und erinnerst du dich, dass ich meinen Säbel zog und schwor, falls du Frankreich je verrietest und zum Tyrannen würdest, würde ich dir persönlich diese Klinge ins Herz stoßen?«
»Ich erinnere mich.«
»Jetzt bist du Kaiser und im Begriff, eine weitere Krone anzunehmen.« Er hob sein Glas zu einem ironischen Salut. »Damit ist mein Schwur zu einer ziemlichen Farce geworden, findest du nicht?«
»Das träfe zu, wenn ich zum Tyrannen geworden wäre«, erwiderte Napoleon ruhig. »Aber das Volk hat dafür gestimmt, dass ich Kaiser werde, und das macht mich zur Verkörperung seines Willens. In diesem Fall bin ich kein Tyrann, und dein Schwur ist intakt.«
»Ein Anwalt hätte mit dieser Wortwahl wohl kein Problem«, räumte Lucien ein. »Aber mein Schwur wird damit eher dem Buchstaben als dem Geist nach eingehalten.«
»Wie du meinst, Lucien. Aber die Zeiten haben sich geändert. Die Revolution war dabei, im Chaos zu versinken, bis wir dem Direktorium ein Ende bereitet haben. Seitdem herrscht Ordnung in Frankreich.«
»Richtig, aber wir haben Ordnung gegen Freiheit getauscht.«
»Das mag sein, aber glaubst du wirklich, es spielt für die große Mehrheit der Leute eine Rolle? Sie brauchen Arbeit. Sie brauchen Brot, und mehr als alles andere brauchen sie ein Gefühl von Stabilität. Und das alles beabsichtige ich ihnen zu bieten. Es hängt alles davon ab, was du mit Freiheit meinst, Lucien.« Napoleon hielt inne, während er sich in den Gedanken vertiefte. »Für dich und mich und für die Besucher der Salons ist sie ein Ideal, und wie jedes Ideal ist sie ein Luxus. Die einzige Freiheit, die für das gemeine Volk zählt, ist die Freiheit von Leid.«
Lucien runzelte die Stirn, schüttelte den Kopf und blickte auf seinen mit einem Goldrand verzierten Teller hinab. »Wenn Menschen nicht nach Idealen streben dürfen, Napoleon, was unterscheidet uns dann von gewöhnlichen Tieren?«
»Es wird immer einen Platz für Ideale geben und für die Männer, die über sie debattieren und ihre Sache vorantreiben. Aber solche Männer sind rar und müssen gepflegt und in gehobene Positionen gebracht werden.«
»Mit anderen Worten, sie müssen zu Aristokraten werden. Mir scheint, du trittst für eine Rückkehr zu den Übeln der Bourbonen-Herrschaft ein.«
Napoleon zuckte mit den Achseln. »Solange ein Mann Talent hat, halte ich ihm seine Herkunft nicht vor, selbst wenn er ein hochnäsiges Arschloch wie Talleyrand ist.«
Joseph lachte, und nach einem Blick in die entsetzten Gesichter der Frauen am Tisch fiel Napoleon mit ein.
Selbst Lucien lächelte über die Bemerkung. »Du schätzt den Mann richtig ein, Bruder.«
Sie hoben beide das Glas und tranken einen Schluck.
Letizia räusperte sich. »Es ist natürlich sehr schön, dass du talentierte Männer in dieser Weise belohnst, aber wie kannst du sicherstellen, dass sie der neuen Ordnung treu bleiben? Kannst du Männern trauen, die sich so leicht von dem Glitzerschmuck blenden lassen, den du ihnen bietest?«
»Natürlich, Mutter. Was könnte Treue mehr befördern als die Aussicht auf Belohnung für gute Dienste?«
»Familie«, antwortete sie sofort. »Es gibt kein stärkeres Treueband als Blut.«
Napoleon nickte. »Und deshalb muss ich meine Familie und meine Freunde in hohe Positionen bringen und sie mit der Zeit unter die Herrscherhäuser der europäischen Mächte platzieren, vielleicht mit ihrem eigenen Thron.«
»Das kann nicht dein Ernst sein.« Joseph lachte. »Du würdest mich zum König machen?«
»Eines Tages vielleicht, und früher, als du denkst.«
»Wie absurd!« Joseph schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht zum König geboren, nicht mehr als Lucien hier oder Louis und Jérôme.«
»Das sehe ich anders«, erwiderte Napoleon. »Jeder meiner Brüder ist so viel wert wie zehn Zaren oder irgendein anderer Herrscher, der durch Geburtsrecht auf einem Thron sitzt. Man braucht nur nach England zu blicken, dann hat man den Beweis. König George ist geisteskrank, und sein Erbe ist ein verantwortungsloser Frauenheld und Freigeist. Gibt es nicht hundert, tausend bessere Männer in Britannien, die in der Lage wären zu regieren? Deshalb werde ich euch alle zu Königen machen, wenn die Zeit gekommen ist.«
»Ob wir es wollen oder nicht?«, fragte Lucien.
»Ich brauche Verbündete, denen ich vertrauen kann. Wie Mutter sagt, was ist stärker als Blutbande? Bist du auf meiner Seite?«
Lucien überlegte kurz und zuckte mit den Achseln. »Du bist mein Bruder. Natürlich bin ich auf deiner Seite. Solange du kein Tyrann wirst.«
»Und du, Joseph?«
Sein älterer Bruder grinste und erhob sein Glas. »Bis zum bitteren Ende.«
»Das einzige Ende, das ich sehe, ist immerwährender Ruhm.«
»Immerwährend?« Letizia schürzte die Lippen und warf einen Blick auf Josephine. »Das wird nur eintreten, wenn du einen Nachfolger hervorbringst. Ohne einen Erben zerbricht die ganze Sache.«
»Es wird einen Erben geben«, sagte Napoleon mit Nachdruck. »Es ist nur eine Frage der Zeit.«
»Zeit ist genau das Problem«, sagte seine Mutter. »Du bist jetzt seit mehr als zehn Jahren verheiratet. Josephine, wie alt sind Sie doch gleich?«
Die Kaiserin zuckte zusammen, antwortete jedoch nicht. Letizia beugte sich in ihre Richtung und klopfte mit dem Finger auf den Tisch. »Zweiundvierzig, wenn ich mich recht erinnere. Habe ich recht?«
Josephine nickte.
»Nun, meine Liebe, verzeihen Sie mir, aber ist das nicht ein bisschen spät, um ein Kind zu gebären?«
Napoleon eilte zur Verteidigung seiner Frau. »Ältere Frauen haben gesunde Kinder zur Welt gebracht, Mutter. Es ist immer noch Zeit.«
Josephine sah ihn über den Tisch hinweg an und sagte mit tonloser Stimme: »Ältere Frauen? Danke.«
»Du brauchst einen Erben«, ließ Letizia nicht locker.
»Und ich werde einen haben. Josephine hat zwei gesunde Kinder zur …«
»Das ist lange her.«
»Und sie wird weitere Kinder hervorbringen.«
»Wann?«, fragte Letizia in scharfem Ton.
»Zur richtigen Zeit, Mutter.«
»Und wenn nicht?«
»Sie wird«, entgegnete Napoleon wütend, auch wenn er tief in seinem Innern wusste, wie unwahrscheinlich es war.
»Sie muss, wenn sie die Frau des Kaisers von Frankreich sein will.«
»Das reicht jetzt!« Josephine schlug mit der Hand auf den Tisch, sodass alle vor Schreck verstummten. »Niemand spricht in dieser Weise über mich. Verstanden? Niemand. Sag ihr das, Napoleon.«
Napoleon sah sie an, dann blickte er zu seiner Mutter.
Josephines Unterlippe bebte. »Ich dulde das nicht! Welches Recht hat sie, so von mir sprechen?«
»Welches Recht?« Letizia richtete ihre schmale Gestalt auf. »Das Recht einer Frau, die dreizehn Kinder in diese Welt gesetzt hat, von denen acht überlebten. Nicht nur zwei.«
Josephine sah sie mit bitterer Miene an, dann stand sie abrupt auf. »Zum Teufel mit Ihnen! Zum Teufel mit euch Korsen!«
Sie drehte sich um und marschierte zur Tür, riss sie auf und schlug sie hinter sich zu. In dem überraschten Schweigen waren ihre Schritte zu hören, die sich im Flur entfernten.
Caroline warf einen Blick in die Runde und murmelte: »Ich habe immer gesagt, dass sie nicht gut genug für Napoleon ist.«
»Still!«, fuhr Napoleon sie an. »Du weißt nicht, wovon du redest, du dumme kleine Gans. Ist dein Gedächtnis so kurzlebig? Als wir in Frankreich ankamen, waren wir Flüchtlinge, ohne Zuhause, ohne Geld, ohne Einfluss. Josephine war die Frau eines Grafen, die Vertraute der mächtigsten Politiker in der Hauptstadt, und Männer haben ihr Herz an sie verloren. Und doch hat sie mich zum Mann gewählt, als ich mir die Uniform kaum leisten konnte, die ich trug, und in einem heruntergekommenen Elendsviertel wohnte. Hast du eine Ahnung, was mir das bedeutet? Ich habe sie angebetet. Ich bete sie nach wie vor an«, fügte er rasch hinzu. »Bei Josephine kann ich ganz ich selbst sein. Während ich von geringeren Männern und Speichelleckern umgeben bin, finde ich nur bei Josephine Aufrichtigkeit und Verständnis. Ich schulde ihr Treue. Und Liebe. Also wage es nicht, dich zwischen uns schieben zu wollen.«
Caroline zuckte mit den Achseln. »Schön und gut, aber im Gegenzug schuldet sie dir einen Erben, Napoleon. Wo ist euer Kind?«
Napoleons Miene verdüsterte sich, doch ehe er antworten konnte, ergriff seine Mutter das Wort.
»Spielt es eine Rolle? Diese Frau ist eindeutig zu alt, um zu gebären. Es gibt nur eine Lösung für dieses Problem, und je früher du dich dem stellst, desto besser, mein Sohn.«
Napoleon schüttelte den Kopf. »Nein. Ich werde es nicht tun.«
»Nicht sofort, vielleicht. Aber ungeachtet deiner Gefühle für sie hast du eine Verpflichtung gegenüber deinem Volk. Es muss einen Thronfolger geben.« Letizia drohte ihm mit dem Zeigefinger. »Früher oder später musst du Frankreich einen Thronerben liefern. Vor allem, wenn du wieder in den Krieg ziehst und dich in Gefahr begibst.«
»Gefahr?« Napoleon lachte. »Hast du es denn nicht gehört, Mutter? Mein Leben steht unter einem Zauber.«
»Dein Glück wird nicht ewig halten.«
»Warum nicht?«
Letizia zuckte mit den Achseln. »Das Glück keines Mannes währt ewig. Ich lebe lange genug, um es zu wissen. Und deshalb brauchst du einen Erben.«
»Dafür wird noch Zeit genug sein.« Napoleon leerte sein Glas und rückte seinen Stuhl vom Tisch zurück, womit er zu verstehen gab, dass das Mahl beendet war. »Aber zunächst wäre da noch die kleine Angelegenheit, dass England ein für alle Mal vernichtet werden muss.«
4
Arthur
London, September 1805
Für Sir Arthur Wellesley war London nach sechs Monaten Seereise von Indien ein willkommener und vertrauter Anblick. Fast neun Jahre waren vergangen, seit er seinen Fuß zuletzt in die Hauptstadt gesetzt hatte, und er konnte nicht anders, als aufzustehen und sich aus dem Fenster zu beugen, während die Kutsche einen flachen Hügel erklomm, von dem sich ein schöner Blick auf das Häusermeer Londons bot, auf die glitzernde Themse und einen Wald von Masten jener Schiffe, die Rohstoffe und Luxusgüter nach England brachten und die im Land gefertigten Waren in die ganze Welt transportierten.
Dank seiner eigenen Bemühungen und der seines Bruders Richard trugen nun die riesigen Gebiete in Indien, die sie erobert hatten, zu Britanniens Reichtum und Macht bei. Während Richard als Generalgouverneur gedient hatte, hatte sich Arthur seine Sporen in der Armee verdient und war vom Rang eines Obersts zu dem eines Generalmajors an der Spitze einer Armee aufgestiegen, die eine Reihe großartiger Siege errungen hatte. Schließlich waren seine Leistungen mit dem Ritterschlag belohnt worden, und er kehrte als ein Mann von Erfahrung, Wohlstand und Einfluss nach England zurück.
Mit sechsunddreißig fühlte er sich auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit und konnte seinem Land in dessen titanenhaftem Kampf gegen Frankreich gut dienen. Bei seiner Abreise war Frankreich eine revolutionäre Republik gewesen. Jetzt war es ein Reich, regiert von dem Tyrannen Bonaparte. Da er über viel Zeit verfügte, hatte Arthur im letzten halben Jahr jede Zeitung gelesen, die in einem der Häfen auf dem Weg an Bord gekommen war, und Napoleons Entwicklung zu immer mehr Macht und Stärke verfolgt. Es war eine verblüffende Erfolgsgeschichte, wie Arthur widerwillig einräumen musste. Der Mann war offenbar eine phänomenale Naturgewalt, da er so viele Dinge in so kurzer Zeit zuwege gebracht hatte. Es war ein Jammer, dass Bonapartes Qualitäten als General und Staatsmann von keinem Verlangen nach Frieden mit seinen Nachbarmächten gemäßigt wurden. Am Ende des gegenwärtigen Kriegs würde Bonaparte die ganze Welt beherrschen, oder Frankreich würde gedemütigt sein. Nach Arthurs Ansicht war es Englands Pflicht, diese Niederlage Frankreichs herbeizuführen, egal wie lange es dauerte, wie viele Millionen Pfund es kostete und wie viele Menschenleben es forderte.
Bis zu den ersten kühlen Herbsttagen blieben noch einige Wochen Zeit, deshalb war der Himmel über der Stadt nur von einem feinen gelblichen Rauchschleier bedeckt. Sobald der Winter einsetzte, würde an windstillen Tagen eine Rußschicht aus Zehntausenden von Feuerstellen reglos über der Stadt hängen. Er dachte mit Freude an die frischen Winde auf seiner letzten Seereise. Das Schiff hatte erst vor zwei Tagen in Portsmouth angelegt, und er hatte das Gefühl, auf See zu sein, noch nicht verloren. Jedes Mal, wenn er aus der Kutsche stieg, schien der Boden unter seinen Füßen zu schwanken, als stünde er noch auf einem Schiffsdeck, das endlos auf und ab schaukelte. Es hatte einige Tage mit ruppigem Wetter gegeben, als sich der Indienfahrer um das Kap herumkämpfte, aber für den größten Teil der Reise hatte er ruhen und sich von den Anstrengungen des jahrelangen harten Militärdienstes in Indien erholen können.
Der Anblick der Stadt heiterte ihn auf. Er lächelte bei der Aussicht, wieder mit seiner Familie vereint zu sein, und er freute sich darauf, viele alte Freunde zu treffen. Vor allem aber wollte Arthur unbedingt sehen, wie die Dinge zwischen ihm und Kitty standen, der jungen Liebe, die er in Irland zurückgelassen hatte. Die seltene Korrespondenz zwischen ihnen in den letzten zehn Jahren waren eine schlechte Basis, um die wahre Natur ihrer Gefühle für ihn beurteilen zu können. Und was würde er von ihr halten? Zehn Jahre konnten eine beträchtliche Veränderung in Kittys Charakter bewirkt haben, von ihrem Aussehen ganz zu schweigen. Es war jedoch nicht ihr Aussehen, mit dem sie sein Herz erobert hatte, rief er sich in Erinnerung. Es war ihre schrullige Lebhaftigkeit, die sie von all den großäugigen, gesitteten und durch und durch langweiligen Debütantinnen in den gesellschaftlichen Zirkeln von Dublin Castle unterschied. Wenn sie noch ungetrübt war, würde ihre Persönlichkeit bewundernswert zu ihm passen. Die entscheidende Frage lautete: Wie sollte Arthur vorgehen, um ihre Hand zu gewinnen?
Er hatte es schon einmal versucht; einige Monate vor seinem Aufbruch nach Indien hatte er ihren älteren Bruder Tom um die Erlaubnis gebeten, sie heiraten zu dürfen. Nichts weiter als ein Major mit wenig Hoffnung, ein Vermögen zu machen, sowie großzügiger Aussicht auf einen frühzeitigen Tod, hatte Arthur außer Liebe nicht viel zu bieten gehabt. Ein praktisch veranlagter Mann wie Tom fand ein solches Gefühl weder anziehend noch wünschenswert. Und so hatte er Arthurs Ersuchen abgelehnt, ungeachtet der Tatsache, dass Kitty ihr Herz dem jungen Offizier bereits geschenkt hatte. In einem letzten Versuch, sich ihre Zuneigung zu bewahren, hatte Arthur einen Brief geschrieben, dass sich seine Gefühle für sie nicht geändert hatten und sein Angebot immer noch bestehen würde, wenn er mit Rang und Reichtümern aus Indien zurückkehrte und sie noch unverheiratet war.
Die Straße führte sanft abwärts, und der Blick auf London ging hinter einer Baumreihe verloren, deshalb ließ sich Arthur wieder auf seinem Platz gegenüber der beträchtlichen Masse des anderen Passagiers nieder, der nach London reiste. Der Mann trug eine dunkle Jacke mit weißem Spitzenbesatz in einem verschlungenen Muster. Sie hatten sich bei Antritt der Reise rein formell begrüßt und seither nur wenige Worte gewechselt. Mr. Thomas Jardine hatte sich als Bankier vorgestellt und offenkundig noch nie von dem jungen Generalmajor gehört, als Arthur ihm seinen Namen genannt hatte. Mr. Jardine hatte beim letzten Halt eine Zeitung gekauft, die er nun zusammenfaltete und neben sich auf den ledernen Sitz legte.
Arthur zeigte auf die Zeitung. »Darf ich?«
»Natürlich. Bitte sehr.«
»Danke.«