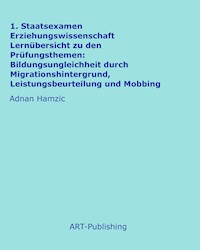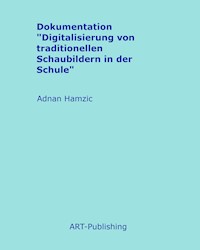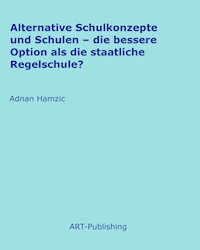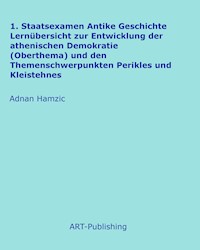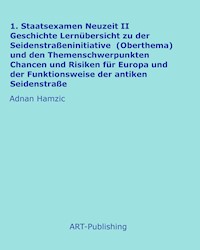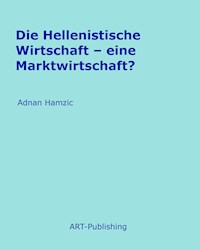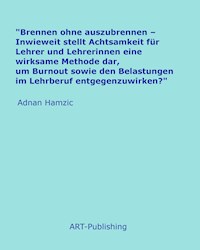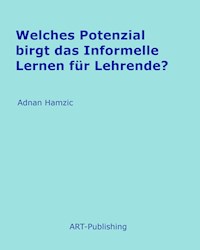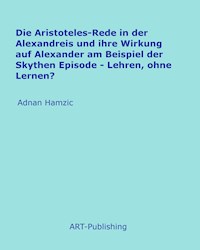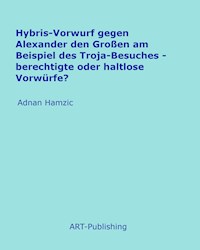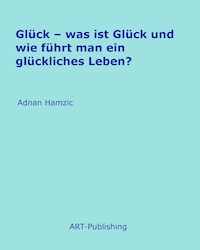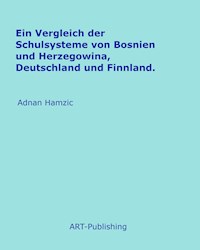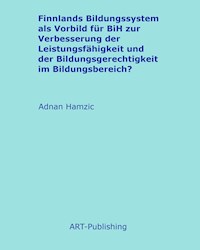
Finnlands Bildungssystem als Vorbild für BiH zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Bildungsgerechtigkeit im Bildungsbereich? E-Book
Adnan Hamzic
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ART-Publishing
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Trennung von Unterrichtsklassen nach ethnisch-nationaler Zugehörigkeit, gegen die Segregation streikende Schüler und Schülerinnen (nachfolgend mit SuS abgekürzt), weit verbreitete Korruption, schlecht ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen (nachfolgend mit LuL abgekürzt), mangelhafte institutionelle Bedingungen für erfolgreiches Lernen, drei voneinander abweichende Curricula in einem Staat, drei völlig unterschiedliche Perspektiven auf Geschichte, drei verschiedene Sprachen sowie zwei divergierende Schriftsprachen. Um welches Bildungssystem eines mittelfristigen EU-Beitrittskandidaten handelt es sich bei dieser Beschreibung? Diese Beschreibung trifft auf das Schulsystem in Bosnien und Herzegowina (nachfolgend mit BiH abgekürzt) zu. Seit Jahren kämpft das Land im Herzen des Balkans mit diesen Herausforderungen. Die Aussicht auf Besserung ist schwindelerregend gering, obwohl internationale Vereinigungen seit Beendigung des Krieges im Jahr 1995 versuchen Reformen anzustoßen, die den Status Quo im Bildungsbereich verbessern. Deshalb die vorliegende Arbeit genauer auf die Schwachpunkte des Schulsystems in BiH ein und beleuchtet diese näher. Im Gegensatz haben wir das finnische Schulsystem, das für gelungenes Lernen steht und regelmäßig bei PISA von den ersten Plätzen grüßt. Finnland entwickelte ein erfolgreich funktionierendes Schulsystem und hat stetig engagiert versucht Verbesserungen am eigenen Bildungssystem vorzunehmen, um Lehr-Lern Prozesse, Organisationsstrukturen und den Lernerfolg der SuS zu verbessern. Kontrastär dazu ringt BiH mit einem unübersichtlichen und komplexen Schulsystem. Die Schulsysteme der zwei Staaten werden auf struktureller Ebene im Elementar-, Primar-, Sekundarbereich I und II miteinander verglichen. Förder- und Sonderschulen werden bei diesem Vergleich außer Acht gelassen, da diese nicht dem staatlichen Regelschulsystem angehören. Die Leitfrage der Arbeit lautet, inwieweit Finnland eine Art Vorbildfunktion für das Schulsystem von BiH einnehmen kann? In welchen Bereichen kann BiH von Finnland noch etwas lernen oder sogar Aspekte übernehmen, um den Status Quo des Schulsystems zu verbessern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Internationale Vergleichsstudien
3. Finnland
4. Bosnien und Herzegowina
5. Operationalisierte Vergleichskategorien
6. Fazit
7. Abbildungsverzeichnis
8. Literaturverzeichnis
Impressum:
Copyright © 2021 ART-Publishing
ISBN 978-3-98592-015-0
ART-Publishing
Sonnenblumenweg 2
77656
Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieses Werkes, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei ART-Publishing. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsschutz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Auswertungen durch Datenbanken und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.
Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, wird zudem kostenpflichtig abgemahnt und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
Zulassungsarbeit
Finnlands Bildungssystem als Vorbild für BiH zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Bildungsgerechtigkeit im Bildungsbereich?
Ein Indikatoren-gestützter Vergleich auf der Makroebene der Schulsysteme von Finnland sowie Bosnien und Herzegowina
Adnan Hamzic
Abkürzungsverzeichnis
APOSO Agencija za predskolsko, osnovno i srednje obrazovanje (Agentur für Vor-, Grund- und Mittelschulbildung)
BiH Bosnien und Herzegowina
FBiH Bosnische Föderation (eine der beiden Teilentitäten von BiH)
LuL Lehrer und Lehrerinnen
KM Konvertible bosnische Mark (Währung in BiH)
OECD Organization for Economic Co-Operation and Development
OSCE Organisation for Security and Co-Operation in Europe
OHR Office of the High Representative/ Büro der Hohen Repräsentanten in BiH
RS Republika Srpska (eine der beiden Teilentitäten von BiH)
SFRJ Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien
SuS Schüler und Schülerinnen
1. Einleitung
1.1 Motivation und Fragestellung
Trennung von Unterrichtsklassen nach ethnisch-nationaler Zugehörigkeit, gegen die Segregation streikende Schüler und Schülerinnen (nachfolgend mit SuS abgekürzt), weit verbreitete Korruption, schlecht ausgebildete Lehrer und Lehrerinnen (nachfolgend mit LuL abgekürzt), mangelhafte institutionelle Bedingungen für erfolgreiches Lernen, drei voneinander abweichende Curricula in einem Staat, drei völlig unterschiedliche Perspektiven auf Geschichte, drei verschiedene Sprachen sowie zwei divergierende Schriftsprachen. Um welches Bildungssystem eines mittelfristigen EU-Beitrittskandidaten handelt es sich bei dieser Beschreibung? Diese Beschreibung trifft auf das Schulsystem in Bosnien und Herzegowina (nachfolgend mit BiH abgekürzt) zu. Seit Jahren kämpft das Land im Herzen des Balkans mit diesen Herausforderungen. Die Aussicht auf Besserung ist schwindelerregend gering, obwohl internationale Vereinigungen seit Beendigung des Krieges im Jahr 1995 versuchen Reformen anzustoßen, die den Status Quo im Bildungsbereich verbessern. Deshalb die vorliegende Arbeit genauer auf die Schwachpunkte des Schulsystems in BiH ein und beleuchtet diese näher. Da BiH nicht regelmäßig an internationalen Vergleichsstudien teilnimmt, wie beispielsweise TIMSS oder PISA, verfügt diese Arbeit über keine aussagekräftigen Daten, die ein abschließendes Urteil zu der Leistungsfähigkeit des Bildungssystems in BiH erlauben. Die einzige Teilnahme an einer internationalen Vergleichsstudie BiH’s liegt mittlerweile 12 Jahre zurück. Damals nahmen die SuS BiH‘s an der Vergleichsstudie TIMSS teil. Die Resultate waren ernüchternd, denn es wurde aufgezeigt, dass SuS in BiH nicht über die angestrebten Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Insbesondere wurden große Defizite bei Problemlösungen festgestellt.
Im Gegensatz haben wir das finnische Schulsystem, das für gelungenes Lernen steht und regelmäßig bei PISA von den ersten Plätzen grüßt. Finnland entwickelte ein erfolgreich funktionierendes Schulsystem und hat stetig engagiert versucht Verbesserungen am eigenen Bildungssystem vorzunehmen, um Lehr-Lern Prozesse, Organisationsstrukturen und den Lernerfolg der SuS zu verbessern. Kontrastär dazu ringt BiH mit einem unübersichtlichen und komplexen Schulsystem. Die Schulsysteme der zwei Staaten werden auf struktureller Ebene im Elementar-, Primar-, Sekundarbereich I und II miteinander verglichen. Förder- und Sonderschulen werden bei diesem Vergleich außer Acht gelassen, da diese nicht dem staatlichen Regelschulsystem angehören. Die Leitfrage der Arbeit lautet, inwieweit Finnland eine Art Vorbildfunktion für das Schulsystem von BiH einnehmen kann? In welchen Bereichen kann BiH von Finnland noch etwas lernen oder sogar Aspekte übernehmen, um den Status Quo des Schulsystems zu verbessern.
1.2 Aufbau der Arbeit
Zu Beginn der Arbeit wird ein Blick auf die PISA-Studien der OECD geworfen. Daraus resultiert, was die PISA-Studien überhaupt sind, welche Leistungen erhoben werden, mit welcher Intention diese internationalen Vergleichsstudien von der OECD durchgeführt werden sowie welche Aussagekraft die festgestellten Daten haben. Hierbei werden ebenfalls kritische Stimmen zu den PISA-Studien berücksichtigt. Darauf aufbauend findet eine Überleitung statt, warum gerade das Bildungssystem Finnlands als Vergleichsparameter für das Bildungswesen in BiH ausgewählt wurde. An dieser Stelle kann gesagt werden, dass sich Finnland bereits seit der ersten Erhebung im Jahr 2000, in der Spitzengruppe der leistungsstarken Bildungssysteme im internationalen Vergleich etablieren konnte und sich dementsprechend für einen Vergleich dieser Form eignet. Diese Arbeit verfolgt das Ziel Handlungsempfehlungen für das Bildungssystem in BiH auszusprechen. Demnach lohnt sich der Blick nach Finnland, die über ein vorbildlich funktionierendes, fortschrittliches sowie effizientes Bildungssystem verfügen. Darauffolgend werden allgemeine Informationen zu Finnland, die Entwicklung des finnischen Bildungssystems sowie das Bildungswesen Finnlands auf der strukturellen Ebene deskriptiv dargestellt. Nach der Beschreibung des finnischen Bildungssystems folgt derselbe Schritt für das bosnische. Hierbei wird auf einen Vergleich auf der strukturellen Ebenen der beiden Schulsysteme verzichtet und die Abhandlung wird aufeinander folgend abgehandelt. Dieser Schritt ist unerlässlich, um die strukturellen Unterschiede und Voraussetzungen zwischen BiH und Finnland zu verstehen. Im Anschluss daran, wird das Kategorien-System für erfolgreiche Bildungssysteme von Andreas Schleicher vorgestellt und beschrieben. Diese, von ihm aufgestellten Indikatoren bilden die Basis für die operationalisierten Vergleichskategorien, anhand derer der Vergleich zwischen den Bildungssystemen von Finnland sowie BiH durchgeführt wird. Schleichers Kategorien stützen sich auf den Daten der PISA Erhebungen und anerkannter internationaler Forschungsliteratur. Anschließend daran werden die Bildungssysteme Finnlands und BiH’s anhand dieser operationalisierten Vergleichskategorien miteinander verglichen. Auf Grundlage des Vergleiches werden, im letzten Schritt der vorliegenden Arbeit, Herausforderungen im Bildungswesen BiH’s aufgezeigt. Somit werden Empfehlungen und Handlungsoptionen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und der Bildungsgerechtigkeit herausgearbeitet. In diesem Fall wird geschaut, was das finnische Bildungswesen in den zu betrachtenden Bereichen bereits besser macht und inwieweit BiH einen Nutzen daraus ziehen kann.
2. Internationale Vergleichsstudien
2.1 OECD – PISA Studien
Bevor wir uns thematisch den PISA-Studien annähern, wird zuerst die Frage beantwortet, welche Organisation mit welcher Zielsetzung hinter der internationalen Vergleichsstudie steckt. Hinter der Abkürzung OECD, die am 30. September 1961 gegründet wurde, verbirgt sich der englische Name „Organization for Economic Co-operation and Development“. Der OECD gehören 36 Mitgliedsländer an, bei denen es sich um weit entwickelte Industrienationen handelt, die über die höchsten pro Kopf Einkommen weltweit verfügen (OECD 2019a). Die OECD gilt als bedeutendste Wirtschaftsorganisation der westlichen Industrieländer. Zu ihren Aufgaben gehört die Koordinierung von Wirtschafts-, Handels und Entwicklungspolitik in den Mitgliedsstaaten. Ziel dieser Organisation, mit Sitz in Paris, ist es eine Politik zu unterstützen, die sowohl das soziale als auch das wirtschaftliche Leben der Menschen weltweit weiter verbessert. Auf der Agenda der OECD stehen ein angemessenes Wirtschaftswachstum, eine hohe Arbeitnehmerquote sowie ein steigender Lebensstandard, bei Währungs- und Preisstabilität. In Nicht-Mitgliedsstaaten setzen sie sich für wirtschaftliches Wachstum sowie die Expansion und Öffnung des Welthandels ein. Dahingehend gehört die Bildung zu einem der Arbeitsbereiche der OECD (OECD 2019b). Die Intension der OECD hinter den PISA-Studien besteht in den Wirtschaftsinteressen der Industrienationen. Sie erhoffen sich langfristig durch eine bessere Steuerung und Kontrolle über die Bildung die Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeitskräften für den Arbeitsmarkt zu sichern. Neben dem wirtschaftlichen Engagement werden aber auch gesellschaftspolitische Rückschlüsse auf Basis der erhobenen Daten gezogen, die vor allem auf die Ermittlung der Bildungsgerechtigkeit in den Teilnehmerstaaten abzielt (OECD 2004).
Das Untersuchungsprogramm PISA wurde im Jahr 1997 von den OECD-Mitgliedsstaaten ins Leben gerufen. Im Jahr 2000 wurde die erste PISA-Studie durchgeführt und wird seitdem im drei Jahres Rhythmus durchgeführt (Jude & Klieme 2010, S. 11). PISA ist eine internationale Vergleichsstudie, die Daten im Bildungsbereich erhebt, auswertet und analysiert. Infolgedessen werden Länderrankings erstellt, die zeigen auf welchem Platz sich das jeweilige Land im Bildungsbereich im internationalen Vergleich befindet. Die PISA-Befunde liefern erkenntnisreiche Informationen über systematische Charakteristika eines Bildungssystems sowie Aufschluss über Kompetenzen von SuS in ausgewählten Bereichen (Jude & Klieme 2010, S. 13). PISA untersucht, über welche grundlegende Kompetenzen SuS zum Ende ihrer Pflichtschulzeit verfügen. In diesem Fall beträgt das durchschnittliche Alter der teilnehmenden Schülerschaft 15 Jahre. Des Weiteren machen die SuS Angaben zu sozioökonomischen Merkmalen sowie der häuslichen und schulischen Umwelt. Auf Basis dieser Angaben kann untersucht werden, inwieweit diese Indikatoren in Zusammenhang mit dem Kompetenzprofil der SuS stehen. Folglich ist es möglich Veränderungen im Laufe der Zeit zu analysieren und zu ergründen, wie sich externe Faktoren auf den Kompetenzerwerb auswirken (Jude & Klieme 2010, S. 13).
Zu den wesentlichen Kompetenzbereichen von PISA gehören die Lesekompetenz, die mathematische und die naturwissenschaftliche Kompetenz (Jude & Klieme 2010, S. 13). Diese Kompetenzbereiche werden mithilfe von standardisierten Fragebögen, die Testaufgaben beinhalten, ermittelt. Die Testaufgaben, die auf dem theoretischen Rahmenkonzept für PISA beruhen, werden durch das internationale Konsortium und Expertengruppierungen entwickelt. Die Testaufgabengestaltung in den PISA-Studien gestaltet sich divers. Mehrere Aufgabenformate werden hier eingesetzt. Diese beinhalten neben grafischen Abbildungen auch Texte, Formeln und Bilder (Jude & Klieme 2010, S. 14). Wie bereits erwähnt, werden im Zuge der Kompetenzerfassung auch Kontextmerkmale der SuS erfasst. Dieser Extra-Fragebogen erfasst Merkmale über die sozioökonomische und kulturelle Herkunft sowie Einstellungen, Verhalten und Einschätzungen zu Schule und Gewohnheiten, die sich speziell auf den Lernprozess beziehen. Auf der Grundlage dieser Angaben lassen sich Aussagen über die Rahmenbedingungen des Lernens treffen (Jude & Klieme 2010, S. 15).
Nichtsdestotrotz sind die Feststellungen der PISA-Studien eine Momentaufnahme des Bildungssystems zu einem bestimmten Zeitpunkt. In diesem Sinne zeigen die PISA-Ergebnisse keine Entwicklungen, Fortschritte oder Verbesserungen des Bildungssystems auf. Dafür sind die erhobenen Daten der OECD nicht geeignet. Überdies können auf Basis der bereitgestellten Informationen keine Kausalzusammenhänge hergestellt werden. Ungeklärt bleibt, welche Organisationen und Einrichtungen den Bildungsfortschritt bremsen bzw. begünstigt haben. Daraus ergibt sich, dass die OECD zwar feststellen kann, wie ein erfolgreiches Bildungssystem aufgebaut ist, jedoch nicht, wie ein schwaches Bildungssystem verbessert werden kann (Schleicher 2019, S. 71). Trotzdem bietet PISA einen Mehrwert für politische Entscheidungsträger. Die größte Stärke von PISA besteht darin, aufzuzeigen, wie Bildungsprozesse in anderen Ländern gestaltet werden. Dadurch entsteht eine Vergleichbarkeit von den Bildungssystemen. Werden nun Rückschlüsse aus den Befunden von den Bildungspolitikern gezogen, so können sie damit Verbesserungen im eigenen Bildungssystem anstoßen (Schleicher 2019, S. 72). Die von der OECD durchgeführten PISA-Studien können als ein Element einer Strategie verstanden werden, deren langfristiges Ziel es ist ein internationales Bildungsprogramm zu schaffen, das länderübergreifend die Lerninhalte sowie die temporäre Basis des Lernens definiert (Fuchs 2003, S. 173)
2.2 Kritik an der OECD Studie
Die von der OECD durchgeführten PISA-Studien sind ein kontrovers diskutierter Gegenstand, der seit Beginn der Evaluationsstudien häufig in der Kritik der bildungswissenschaftlichen Debatte steht. Nichtsdestotrotz bieten die PISA-Studien die einzigen Leistungswerte für Bildungssysteme auf internationaler Ebene, die infolgedessen eine Vergleichbarkeit zwischen den Bildungswesen einzelner Staaten schaffen. In der Literatur finden sich etliche Aufsätze und Publikationen, die vor allem die Methodik aber auch daneben politische, wirtschaftliche sowie kulturelle Bereiche der PISA-Studien kritisieren. In der vorliegenden Arbeit wird kein vollumfänglicher Blick auf die Kritik der PISA-Studien geworfen. Dieses Vorhaben würde den Rahmen der Arbeit sprengen und auch nicht den Kern der vorliegenden Arbeit treffen. Nichtsdestotrotz hat diese Arbeit einen wissenschaftlichen Anspruch, der eine Nennung sowie Erläuterung von kritischen Meinungen zu PISA nicht unerwähnt lassen darf. Demzufolge werden einzelne Kritikpunkte an den PISA-Studien genannt und erklärt. Hierbei liegt der Fokus auf der Pauschalisierung von Ergebnissen, dem Übersetzungsproblem, der Probandenmotivation sowie der Aufgabenkonzeption.
Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass Pisa lediglich die Lese-, mathematische- und naturwissenschaftliche Kompetenzen einer Stichprobe 15-jähriger SuS erhebt und auf Basis dieser Information auf die Leistungsfähigkeit des gesamten Schulsystems schließt. Folglich verschiebt sich die Betrachtung des einzelnen Schülers hin zu einer ganzen Organisation (Hopmann, Brinek & Retzl 2007, S. 71/ Sjoberg 2004, S. 53f.). Bereiche aus der Geistes-, Sprach-, Literatur-, Politik- und Wirtschaftswissenschaft werden komplett außen vorgelassen, obwohl diese Bereiche in den Curricula verankert sind. Des Weiteren wird kritisiert, dass es bisher keinen Evidenz-basierten Zusammenhang zwischen den untersuchten Basiskompetenzen in den PISA-Studien und dem hypothetischen Erfolg in beruflicher und privater Lebensführung gibt (Fuchs 2003, S. 171). In diesem Kontext bemängelt Zedler (2000, S. 33), dass ungeklärt ist, wie Kompetenzen optimal erzeugt werden und was sie nutzen. Des Weiteren wird nicht beantwortet, ob SuS, die im Ländervergleich besser bei den internationalen Vergleichsstudien abschneiden, auch im späteren beruflichen und privaten Leben erfolgreicher sind.
Der Bildungsbegriff der OECD, die Herkunft der Lesertexte sowie die Testaufgaben stammen aus dem angelsächsischen Raum. Infolgedessen sind Probanden aus englischsprachigen Räumen vertrauter mit der Aufgabenstellung im Vergleich zu SuS aus nicht-englischsprachigen Staaten. Selbst nach Übersetzung der Aufgaben, in andere Sprachen, werden Personennamen sowie Ortsangaben nicht angepasst. Dahingehend darf nicht außer Acht gelassen werden, dass in bestimmten Staaten standardisierte Test verstärkt zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel in den USA oder Kanada. Infolgedessen weisen diese SuS eine höhere test-wiseness auf (Wuttke 2007, S. 96f.). Test-wiseness bezeichnet „die Fähigkeit, gewisse Strategien zu nutzen, um unabhängig von dem thematischen Wissen aber durch „ungewollte“ Hinweise (seitens der Testkonstruktion) in den Aufgaben möglichst viele Testaufgaben richtig zu beantworten“ (Gun-Brit & Köller 2018, S. 65). Die in den PISA Aufgaben zu lesenden Texte sind in der englischen Originalfassung wesentlicher kürzer als in der Übersetzung mancher Sprachen, was wiederum ungleiche Voraussetzungen für die Probanden in den anderen Ländern schafft. Übrigens ist in einigen Staaten der Ausschluss von behinderten SuS sowie von Sonder- und Förderschulen gängig. Daraus ergibt sich einer Überschätzung oder eine zu positive Bewertung der Schülerleistungen in diesen Ländern, da vermutlich leistungsschwächere SuS von vorneherein aus dem Testzyklus ausgeschlossen werden (Wuttke 2007, S. 96f.).
Nicht zu vergessen ist, dass der PISA Test unter enormen Zeitdruck stattfindet. Dahingehend misst PISA nicht das Wissen und Können der Probanden, sondern vielmehr die Leistung in dem Test. In diesem Sinne wird Leistung als Arbeit durch Zeit verstanden. Die Aufgabenformate messen nicht, inwieweit der Teilnehmer in der Lage ist diese zu lösen. Hierbei liegt der Fokus darauf herauszufinden, wie der Proband in einer vorgegebenen Zeit eine Fülle von Aufgaben bearbeitet. Um diesen Berg von Aufgaben bearbeiten zu können, sollten bereits bekannte Teststrategien angewendet werden. Andernfalls fehlt die Zeit für die Bearbeitung aller Aufgaben. In diesem Zusammenhang ist das Nachlassen der Schülerleistungen im Verlauf des Testes auffällig (Wuttke 2007, S. 97). Unmittelbar vor Beginn des Testes wird in Taiwan und Korea die Nationalhymne gesungen, um die Motivation dafür zu steigern. Zusätzlich fordern die Schulleitungen die Schülerschaft auf ihr bestes an den Testtagen zu erbringen. Im Kontrast dazu wird das in anderen Ländern nicht gemacht. Es ist mehr als fraglich, ob in diesem Zusammenhang die Motivation der SuS aus anderen Staaten genauso hoch ist, wie die der Gleichaltrigen in Taiwan und Korea, sobald sie feststellen, dass die Aufgaben keinen Spaß machen und sie sich die Frage stellen, was ihnen der Test bringt. Dies führt zwangsläufig zu einer Verzerrung der Resultate (Sjoberg 2007, S. 220-223). Neben den Übersetzungsverzerrungen herrscht zwischen den Schülerschaften der teilnehmenden Staaten eine unterschiedliche Vertrautheit mit den Aufgabenformaten des PISA-Tests. Infolgedessen werden Aufgaben schneller erfassbar bzw. schwerer zu verstehen (Meyerhöfer 2007, S. 90).
Sälzer und Prenzel weisen jegliche Kritik von den PISA-Studien ab. Sie führen die geäußerte oder veröffentlichte Kritik auf Unwissen und Missverständnisse zurück, die lediglich auf Zeitungsberichten, Rankings oder Internet-Blogs beruhen. Dabei wurden aber keine fachlichen Publikationen mit wissenschaftlichem Anspruch berücksichtigt. In diesem Sinne ist ihrer Meinung nach die geäußerte Kritik unberechtigt (Sälzer & Prenzel 2013, S. 20f.). Interessanterweise waren beide Bildungswissenschaftler in den PISA-Studien involviert. Jedoch ist das ein bekanntes Verhaltensmuster der PISA Verantwortlichen auf öffentliche Kritik zu reagieren.