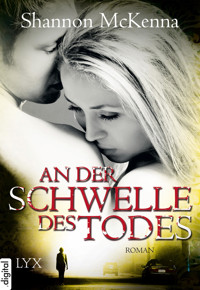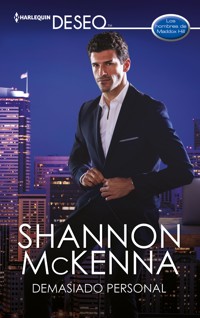9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: McCloud Brothers
- Sprache: Deutsch
Als die geheimnisvolle Lily Parr das Restaurant von Bruno Ranieri betritt, fühlt er sich sofort zu ihr hingezogen. Sie behauptet, von Verbrechern verfolgt zu sein, die es auch auf sein Leben abgesehen haben. Bruno schwört, Lily zu beschützen, doch die beiden geraten schon bald in größte Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 882
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
SHANNON MCKENNA
Flammen
der Rache
Roman
Ins Deutsche übertragen
von Patricia Woitynek
Zu diesem Buch
»Such Bruno Ranieri! Er wird es wissen.« – Dieser kryptische Auftrag ist der einzige Hinweis, den Lily Parr von ihrem Vater noch bekommt, bevor sie gewaltsam aus seinem Krankenhauszimmer entfernt wird und kurz darauf die Nachricht von seinem angeblichen Selbstmord erhält. Lily hat keine Ahnung, in welche Machenschaften ihr Vater verstrickt war, und viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihr nicht, denn auf der Suche nach Bruno heften sich augenblicklich mehrere Auftragsmörder an ihre Fersen. In letzter Sekunde stolpert sie in Brunos Diner – und direkt in seine Arme. Sie verbringen eine heiße Liebesnacht zusammen, doch schnell wird klar, dass der unnahbare Mann selbst eine düstere Vergangenheit hat. Als ihr Versteck auffliegt, zögert er jedoch keine Sekunde, Lily auf ihrer Flucht vor den skrupellosen Killern und einem übermächtigen Feind beizustehen. Dabei beginnt Brunos harte Fassade allmählich zu bröckeln, und Lily gelingt es, einen Blick auf den verletzlichen Mann dahinter zu werfen. Lang gehütete Geheimnisse seiner Kindheit drängen ans Licht, und plötzlich scheinen ihre Schicksale weitaus dichter miteinander verwoben zu sein, als beide ahnen können …
Prolog
Upper West Side, Manhattan
Siebzehn Jahre früher
Die Warnung erreichte ihn um drei Uhr in der Nacht und kündigte sich durch dreimaliges kurzes Schrillen an der Tür an.
Dr. Howard Parr sprang auf und stieß dabei versehentlich seinen Drink um. Die Zigarette fiel ihm aus der Hand, Funken stoben. Er klammerte sich am Geländer fest und schwankte langsam die Stufen hinunter zur Tür seines Stadthauses. Er linste durch den Spion. Ein großer Umschlag lag auf der Eingangstreppe. Howard zog die Tür auf. Er machte sich nicht die Mühe, ihn vorsichtig aufzuheben, um potenzielle Fingerabdrücke nicht zu verwischen. Es war klar, dass er nicht zur Polizei gehen würde.
Es befanden sich zwei Gegenstände darin. Bei dem ersten handelte es sich um die zertrümmerten Überreste der Kamera, die er in dem absurden Versuch, seine Eingangstür zu überwachen, installiert hatte. Sie war, wenige Tage nachdem er sie angebracht hatte, gewaltsam entfernt worden. Hätte er das doch bloß nicht getan. Howard war seither jede Minute auf einen Denkzettel gefasst gewesen. Er wünschte, er könnte sich auf den Rücken rollen, ihnen seine Kehle darbieten und sie um Verzeihung anflehen. Aber das würde sie nicht beeindrucken.
Der andere Gegenstand war eine Videokassette. Eine kalte Faust schloss sich um seinen Magen und drückte zu.
Seine Augen scannten die nächtliche, von Autos gesäumte Straße. Es war niemand zu sehen, trotzdem spürte er das Böse wie Giftgas in der Dunkelheit aufsteigen.
Howard schleppte sich die Stufen hoch und schob gehorsam wie ein geprügelter Hund die Kassette in den Videorekorder. Ein verbrannter Geruch stieg ihm in die Nase. Er schaute nach unten. Seine Zigarette kokelte ein Loch in den Teppich. Er trat sie aus, als die Wiedergabe begann.
Eine Welle der Übelkeit erfasste ihn, sobald er realisierte, dass das verwackelte Bild der Kamera das Innere seines Hauses zeigte. Sie bog um eine Ecke, dann zoomte sie Howard heran, der im Vollrausch auf dem Küchenboden lag. Er hätte nicht sagen können, welcher Tag es war. Seine Nächte endeten oft auf diese Art. Er fand das Gefühl der harten, kalten Fliesen an seinem heißen Gesicht irgendwie tröstlich.
Die Kamera bewegte sich die Treppe hinauf, vorbei an Howards Schlafzimmer. Eine von einem Latexhandschuh verhüllte Hand drehte einen Türknauf und trat in das Zimmer seiner elfjährigen Tochter. Howards Eingeweide krampften sich vor Panik zusammen.
Die Kamera näherte sich Lilys Bett. Aus dem Flur fiel Licht herein. Die Linse zeigte auf Lilys halb geöffneten Mund. Die Hand brachte mit einer schwungvollen, triumphierenden Geste eine Spraydose zum Vorschein und gab einen Sprühstoß auf Lilys Gesicht ab. Sie murmelte etwas, doch das Betäubungsmittel wirkte, bevor sie aufwachen konnte. Die Kamera sank tiefer, als der Mann sich auf die Bettkante setzte. Er gab Lily eine Ohrfeige. Sie regte sich nicht.
Die Hand zog mit höhnischer Langsamkeit ihre Decke weg. Die Kamera schwenkte über den eingerollten Körper seiner Tochter. Sie war mit T-Shirt und Slip bekleidet. Die Latexhand schob das Oberteil über ihre Rippen hoch und streichelte ihre knospenden Brüste. Sie veränderte die Position von Lilys Körper, winkelte ihr Knie an und kippte ihren Schenkel zur Seite. Anschließend zoomte sie nahe an den Schritt ihres unschuldigen Baumwollschlüpfers heran, starrte lange, entsetzliche Sekunden direkt auf die konturlose weiße Fläche.
Howard presste die Hand auf den Mund, um seinen Brechreiz zu bezwingen.
Ein Messer tauchte in der Hand auf. Mit einer kurzen, dunklen Klinge. Howard atmete stoßweise. Lily ging es gut. Sie war oben und schlief. Bevor sie zu Bett gegangen war, hatte sie ihn ausgeschimpft, weil er betrunken war. Wie immer. Sie war wütend gewesen, aber nicht … verletzt. Howard nagte an seiner Faust, als die Klinge auf intime Weise über ihren Körper strich, mal hier und mal da Druck ausübte.
Sie verharrte über ihrer Oberschenkelarterie. Danach zog die nicht identifizierbare Hand die Decke wieder hoch und steckte sie fürsorglich unter Lilys Kinn fest. Sie schloss sich für einen kurzen Moment um ihre Kehle, dann stieß sie ihr einen Finger in den Mund, zog ihn langsam wieder heraus und streichelte ihre weichen Lippen.
Howard stürzte zum Badezimmer, schaffte es aber nicht rechtzeitig. Er spie den Alkohol aus seinem Magen mitten in die Diele. Von Bauchkrämpfen geschüttelt fiel er auf die Knie. Fast eine ganze Stunde verharrte er in dieser Haltung, bevor er es wagte aufzustehen. Bevor er den Mut fand zu tun, was er tun musste.
Er schüttelte zwei Tabletten aus einer speziellen Flasche, zögerte einen Augenblick und ließ eine dritte herausfallen.
Er tat es aus Liebe, versicherte er sich wieder und wieder. Er tat es für sie. Für sein kostbares Mädchen. Er konnte Lily nur beschützen, indem er den Mund hielt und das Gift schluckte. Er musste sein Wissen unter einem Felsbrocken verbergen. Sein furchtbares Geheimnis. Aber dafür brauchte er Hilfe, und zwar etwas Stärkeres als Alkohol. Wenn es ihn umbrachte, dann sollte es eben so sein.
Für Lily wäre es das Beste.
1
Portland, Oregon
Heute
Es war nur ein Traum, Mann. Nur ein beschissener Traum.
Und? Zu wissen, dass es nichts weiter als ein Traum gewesen war, änderte nicht das Geringste. Wenn Bruno ihn träumte, steckte er darin fest, gefangen in einem weißen Nirgendwo, in dem diese dröhnende Stimme in seinem Kopf ihn fast in den Wahnsinn trieb, obwohl sie nur Zahlenfolgen aussprach. »… DeepWeave vier Punkt zwei, Kampfstufe acht, Sequenz fünf läuft an … vier, drei, zwei, eins …«
Dann griff Rudy, der nach Bier und Schweiß stank, ihn an. Mit einem Schnappmesser in der einen Hand und einer zerbrochenen Bierflasche in der anderen attackierte er Bruno wie ein Berserker.
Zusammengeschlagen und blutend kauerte Brunos Mutter hinter Rudy auf dem Boden, ihr Blick flehend über dem Knebel. Und das alles nur, weil ihr nutzloser Hasenfuß von einem Sohn nicht die Eier gehabt hatte, sich Rudys Beretta zu schnappen und den Drecksack abzuknallen. Auch ein Stich mit der Küchenschere in die Halsschlagader würde genügen. Ein Brotmesser zwischen die Rippen. Eine Machete. Nimm das, du Schwanzlutscher. Oder besser noch: eine Kettensäge, mit der er den tollwütigen Hund in Stücke reißen konnte, bis das Blut in alle Richtungen spritzt. Das hast du jetzt davon, dass du meine Mama geschlagen hast, du verfickter Hurensohn.
Aber selbst dann, wenn ihm im Traum ein perfekter Treffer gelang, starb Rudy nicht. Stattdessen verschwand der Bastard einfach spöttisch zwinkernd von der Bildfläche, und ein neuer, unversehrter Rudy schoss an einer anderen Stelle aus dem Boden. Es war ein Videospiel aus der Hölle, in dem jemand mit gespaltener Zunge die Regeln bestimmte.
Ausweichend, angreifend, zustoßend, boxend und tretend kämpfte Bruno erbittert weiter, bevor Rudy sich zu sechs Klonen vervielfachte, die ihn alle gleichzeitig attackierten und zu Boden warfen.
Die Bilder zersplitterten. Sie rangen weiter um die Vorherrschaft in seinem Kopf, doch die Realität stahl sich mit dem Aufwachen durch die Risse.
Autsch. Es hätte eine Erlösung sein müssen, aber oh Gott – sein Kopf. Er dröhnte, als wäre er mit einem Baseballschläger bearbeitet worden. Brunos Herz hämmerte gegen seine Rippen.
Der Sturz auf den Boden hatte ihn aufgeweckt. Er lag neben seinem Bett. Er war Bruno Ranieri, und er war zweiunddreißig Jahre alt, keine zwölf mehr. Dies war sein breites Doppelbett in seiner Eigentumswohnung und nicht in dem schäbigen Apartment seiner Mutter in der Mietskaserne in Newark. Das schweißgetränkte Laken, das sich wie eine Schlinge um seinen Knöchel gewickelt hatte, war eine Maßanfertigung aus hochwertiger ägyptischer Baumwolle. Das Panoramafenster rahmte die rosa getönte Skyline von Portland und den Mount Hood ein, anstatt den Blick auf eine rußige Backsteinmauer freizugeben, vor der eine Reihe Mülltonnen stand. Hier gab es keine dünnen Wände, hinter denen ein betrunkener, tobender Rudy Brunos Mutter verdrosch. Er ließ den Blick durch seine Wohnung, sein Leben schweifen.
Er bemühte sich, es zu glauben, es als das Seine anzusehen.
Bruno rang heiser keuchend nach Luft. Er war schweißgebadet, und seine Muskeln zuckten, als hätte man ihm Elektroschocks verpasst. Er zerrte das verdrehte Laken von seinem Knöchel und streckte sich lang auf dem kühlen Holzboden aus.
Das alles lag weit hinter ihm. Rudy war seit Jahrzehnten tot, dafür hatte Onkel Tony gesorgt. Auch seine Mutter war gestorben – vor achtzehn Jahren. Niemand konnte ihr mehr wehtun.
Es war nur … ein … verfickter … Traum. Vergangenheit. Tot und begraben.
Er hatte sich zu neuen Ufern aufgemacht, sein Leben umgekrempelt. Er war heute nicht mehr dieser hilflose Junge. Nachdem er tief durchgeatmet hatte, stand er schwankend auf. Er griff auf die Tricks zurück, die Kev ihn gelehrt hatte. Wenn du nicht ertragen kannst, was in deinem Kopf passiert, gewinne Distanz dazu, riet Kev ihm immer. Trete drei Schritte davon zurück. Verringere die Lautstärke. Dann sieh wieder hin. Mit mäßigem Interesse. Es sind nur drei Affen, die in einem Käfig gegeneinander kämpfen. Dumm und irrelevant. Sie können dir nichts anhaben.
Die Luft strich kühl über seine Haut, als er ins Wohnzimmer stolperte. Die Lichter der Stadt wurden von den breiten Bodendielen reflektiert. Bruno ließ sich in die Haltung des Pferdes sinken und begann mit den Kung-Fu-Figuren, die Kev ihm beigebracht hatte. Seine Beine zitterten, und die Affen schlugen noch eine Weile kreischend in ihrem Käfig um sich, doch schließlich fand er seine innere Ruhe wieder. Während er hochsprang, sich duckte und zuschlug, wurde er eins mit der Nacht. Der schwarze Panter erklimmt den Baum. Der Kranich bewacht sein Nest. Der Kranich fliegt in den Himmel. Der wilde Tiger hebt den Kopf. Der goldene Drache streckt die linke Klaue aus. Die Minuten verlangsamten sich zu einem gemächlichen Strom.
Das Telefon klingelte. Wer zur Hölle rief ihn um diese unchristliche Zeit an?
Vielleicht war es Kev. Dieser Hoffnungsschimmer unterbrach Brunos entspannte Zen-Trance, und er stürzte zum Telefon. »Ja?«
»Hier ist Julio.« Die nikotinraue Stimme des Kochs aus Tante Rosas Diner zerrte unangenehm an Brunos Nerven.
Er verspürte einen Stich der Enttäuschung. Es war nicht Kev.
Natürlich nicht. Wieso sollte Kev anrufen? Er war gerade auf Weltreise, zusammen mit Edie, seiner einzig wahren Liebe. Bestimmt lagen sie gerade erotisch verschlungen an einem weißen, mondbeschienenen Sandstrand. Und das war absolut in Ordnung. Bruno freute sich für ihn. Er hatte gehofft und fleißig daran mitgewirkt, dass Kev sein Glück, sein Lächeln, seine sexuelle Erfüllung fand. Er war euphorisch, dass es so gekommen war. Nach dem entsetzlichen Horror, den Kev hatte durchmachen müssen, verdiente er jedes Glück und die besten Orgasmen der Welt.
Wären da nur nicht diese Träume gewesen. Kev war der Einzige, mit dem er darüber sprechen konnte. Kev hatte ihn aufgefangen, als Bruno mit dreizehn fast an den verheerenden, nicht enden wollenden Rudy-Albträumen zugrundegegangen wäre. Damals war ihm der Gedanke, sich vor einen Bus zu werfen, durchaus verlockend erschienen. Kev hatte dafür Verständnis gehabt. So wie er für alles immer Verständnis hatte. Er hatte Bruno so oft und in so vielerlei Hinsicht den Arsch gerettet.
Aber schließlich war Kev auch ein verdammtes Genie. Das bestritt niemand.
»… ist los mit dir, Mann? Hörst du mir überhaupt zu?«
Bruno tauchte aus seiner Gedankenversunkenheit auf und versuchte, sich auf Julios heiseren Monolog zu konzentrieren. »Entschuldige, ich bin noch verschlafen. Was hast du gesagt?«
»Ich sagte, dass Otis sich heute nicht hat blicken lassen, außerdem hat Jillian angerufen, weil sie es nicht bis sechs schafft, und ich bin total am Ende, Mann. Ich schiebe jetzt schon seit zwölfeinhalb Stunden Dienst.«
»Sie erscheinen einfach nicht zur Arbeit? Was ist los mit denen?«
Julio grunzte. »Ich weiß es nicht, Kumpel, und es ist mir auch schnurz. Ruf sie selbst an, wenn es dich interessiert. Jedenfalls haue ich Punkt sechs hier ab. Ich mach den Laden einfach dicht. Nur damit du Bescheid weißt.«
Bruno schaute zur Uhr und kalkulierte, wie lange er zum Anziehen und für die Fahrt benötigen würde. »Können wir uns auf halb sieben einigen?«
Julio überlegte kurz. »Aber keine Sekunde später, Alter«, knurrte er.
Klick. Der Koch hatte aufgelegt. Bruno ließ das Telefon fallen und glitt an der Wand nach unten, bis er mit dem nackten Hintern auf dem Boden saß. Verdammt. Eine Extraschicht im Diner. Das machte seine entspannte Kung-Fu-Stimmung mit einem Schlag zunichte.
Es gab keinen logischen Grund für sein Widerstreben, Tonys Diner zu schließen, um die Stadt nach anständigem Servicepersonal abzuklappern. Aber das Lokal war ein Fixpunkt in seinem Leben, seit seine Mutter ihn mit zwölf zum ersten Mal dort hingebracht hatte, kurz bevor das Grauen seinen Lauf nahm. Bruno hatte während seiner ganzen Jugend im Diner Tische abgeräumt und bedient.
Vor dreißig Jahren, nach Vietnam, hatte sein Onkel Tony beschlossen, in seiner Wahlheimat Portland ein Restaurant zu eröffnen. Ein schlichtes Lokal mit guter Hausmannskost, wo man rund um die Uhr anständige Bratkartoffeln bekam, so wie in den Diners seiner Jugend in New Jersey und New York. Schichtarbeiter konnten hier zu jeder Tages- und Nachtzeit knusprige Fritten und Koteletts essen. Er hatte seine unverheiratete Schwester, Brunos Tante Rosa, überredet, nach Portland zu ziehen und ihm zu helfen. Sie hatte heroische Anstrengungen unternommen, um Gerichte zu zaubern, bei denen die Geschmacksknospen vor Entzücken in sechs Tonlagen seufzten, während gleichzeitig die Arterien tödlich verstopften.
Aber Onkel Tony war tot. Er war vor nunmehr fast einem Jahr als Held gestorben und hatte dabei nicht nur Brunos Leben, sondern auch das vieler anderer gerettet. Bruno konnte die schroffe, militärische Kommandostimme seines Onkels praktisch in seinem Kopf hören. Was soll das werden? Du willst Tonys Diner wegen was schließen? Wegen Albträumen? Wegen verfluchtem Stress? Du bist müde, Junge? Scheiß auf müde! Müde ist was für Schlappschwänze! Du kannst dich ausruhen, wenn du tot bist!
Tony ruhte sich aus. Nur Bruno schien dazu nicht in der Lage zu sein, solange die Rudy-Träume anhielten und Tante Rosa in der Küche fehlte. Sie hatte sich ein paar Wochen Urlaub genommen, um der Geburt eines weiteren Exemplars der vielköpfigen McCloud-Brut beizuwohnen, und erwartete von Bruno, dass er den Laden währenddessen schmiss. Kev war aus dem Schneider, weil Rosa sich sehnsüchtig wünschte, dass er sich fortpflanzte, und dieses schweißtreibende Unterfangen schließlich Zeit und Muße erforderte. Aber auf Bruno nahm niemand Rücksicht.
Lasst den Jungen ruhig Tag und Nacht schuften. Es macht nichts, wenn er keinen Schlaf bekommt. Ist nicht so wichtig, wenn er sich nicht um sein eigenes Lenkdrachen- und Spielzeugunternehmen kümmern kann.
Zum Glück war seine Firma eine perfekt geölte Maschine. Eins von Brunos Talenten bestand darin, gute Mitarbeiter zu finden und sie zu motivieren. Dumm nur, dass Rosa diese Fähigkeit nicht auch beherrschte.
Aber das Lokal war seine wichtigste Verbindung zu Tony. Gott, wie er den alten Schweinepriester vermisste. Tony hatte das Diner geliebt, und Bruno verdankte seinem Onkel sein Leben. Tony hatte das Lokal nie geschlossen, mit Ausnahme weniger sehr denkwürdiger Tage. Darunter zum Beispiel jener vor achtzehn Jahren, an dem Rudy und sein Schlägertrupp das Diner gestürmt hatten, um Bruno zu entführen und mundtot zu machen. Dank Kev – seines Zeichens Ninjakämpfer der Extraklasse – und Tony war es ihnen nicht gelungen. Sein Onkel hatte die Gangster in seinen Pick-up verfrachtet und einem unbekannten, aber nicht schwer zu erratenden Schicksal zugeführt. Es war ein Morgen voller Blut, Gewalt und zerbrochenem Glas gewesen.
Ein zweites Mal blieb das Lokal an Tonys Todestag geschlossen. Auch dieser Tag war geprägt gewesen von Blut, Gewalt und zerbrochenem Glas. Nicht zu vergessen die Bomben und Pistolenkugeln.
Jesus, Maria und Josef. Bei genauerer Betrachtung schien es, als würde Bruno das Unheil praktisch selbst heraufbeschwören, wenn er das Diner ein weiteres Mal zumachte.
Na gut, dann würde er den Laden eben schmeißen, solange es nötig war. Sein Schlaf war sowieso keinen Pfifferling wert, weil Rudy ihm Nacht für Nacht einen Besuch abstattete. Auch sein Liebesleben war im Grunde nicht mehr existent. Man konnte keine weiblichen Bekanntschaften für erotische Vergnügungen zu sich einladen, wenn man jeden frühen Morgen eine Verabredung mit Monstern hatte, die der eigenen kranken Psyche entsprangen. Das war ein echter Stimmungskiller. Bruno hatte schon seit Monaten keinen horizontalen Tango mehr hingelegt.
Offen gesagt, fehlte es ihm auch nicht. Er war zu müde.
Er ging ins Bad und betrachtete sein Spiegelbild über dem Waschbecken. Er sah übel aus, wie er kritisch feststellen musste. Seine Augen waren blutunterlaufen, die Wangen hohl. Seitdem die Träume ihn wieder heimsuchten, hatte er fast zehn Kilo abgenommen. Sein Kopf pochte erneut, seit die gesegnete Zen-Trance von ihm abgefallen war. Er öffnete den Arzneischrank und nahm mehrere Fläschchen mit verschreibungspflichtigen Tabletten heraus, die mit einem Gummiband zusammengehalten wurden.
Er hatte wegen seines Problems vor einigen Wochen einen Psychiater aufgesucht. Die Empfehlung des Arztes war dieser schauerliche Mix aus Antidepressiva, Anxiolytika und Antipsychotika gewesen. Bruno hatte via Internet herausgefunden, dass seine Antipsychotikadosis das für schizophrene Patienten empfohlene Maximum noch übertraf. Sie entsprach in etwa dem, was man Irakveteranen verabreichte, die nach mehrfachen Kriegseinsätzen an posttraumatischen Belastungsstörungen litten. Er musste einen ziemlichen Eindruck auf den Seelenklempner gemacht haben. Abgesehen von den positiven Effekten gab es zahlreiche Nebenwirkungen wie Diabetes, Gewichtszunahme, Muskelkrämpfe, undeutliches Sprechen, Orientierungslosigkeit, Tremore. Gelegentlich kam es vor, dass Veteranen, die sie einnahmen, im Schlaf starben.
Und trotzdem holte er die Flaschen heraus und studierte ein weiteres Mal die Etiketten.
Nein. Abgesehen von den positiven Effekten – wie zum Beispiel dem Tod –, sagte ihm sein Instinkt, dass Rudy ihn bloß richtig fertigmachen würde, wenn er den Kerl medikamentös verdrängte. Solange er sich Rudys bewusst war, konnte er zumindest erkennen, womit er es zu tun hatte. Er würde sich langsam an das Problem herantasten, denn er war nicht besonders gut in Selbstbetrachtung. Er mochte Action. Konstante, rastlose Action.
Denk nicht daran. Blende es aus. Das Loch in seinem Bauch war auch so schon tief genug. Immer schön an der Oberfläche bleiben, das war der Trick. Da konnte man jede seiner Exfreundinnen fragen.
Bruno schob die Flaschen mit dem Handrücken beiseite und suchte weiter. Schließlich entdeckte er ein paar Aspirin, schluckte sie trocken und drehte das Wasser an, um sich diesen erschöpften Ausdruck aus dem Gesicht zu waschen. Vielleicht gelang es ihm, sich selbst auf ähnliche Weise zu helfen, wie Kev es vor vielen Jahren getan hatte. Kev hatte das luzide Träumen erforscht, indem er mithilfe seiner Schnelllesemethode Hunderte Bücher und medizinische Fachjournale studiert hatte. Jeden Abend hatte Kev ihn in der Gasse hinter dem Diner Kung-Fu-Figuren üben lassen und ihn gelehrt, von dem Affenkäfig zurückzutreten. Danach hatte Kev sich zu Bruno ans Bett gesetzt, wenn dieser schlafen ging, und ihm dabei geholfen, sich visuell vorzustellen, wie Rudy seine Waffen niederlegte und verblasste, seine tobende Stimme leiser wurde und erstarb.
Danach hatte Kev neben dem Bett eine Decke auf dem Boden ausgebreitet und darauf geschlafen. Wann immer der Albtraum Bruno heimgesucht hatte, hatte Kev ihn geweckt. Jede Nacht, über Monate hinweg. Und ganz allmählich hatte es Wirkung gezeigt. Es kam die erste traumlose Nacht, dann noch eine. Bruno rastete in der Schule fast gar nicht mehr aus und kassierte auch nicht mehr ausschließlich Fünfen und Sechsen. Da er von Natur aus überdreht war, konnte er noch nie sonderlich gut schlafen, doch es wurde besser. Und schließlich hörten die Träume ganz auf. Er war geheilt.
Zumindest hatte er das bis vor wenigen Monaten gedacht.
Er könnte eine Audioaufnahme machen, in der Art von Kevs beschwörendem Monolog, und sich damit selbst hypnotisieren, so wie Kev es getan hatte. Nur leider hatte er den Verdacht, dass es Kevs festem Willen geschuldet war, dass die Technik funktioniert hatte. Er war ein Bollwerk neben seinem Bett gewesen. Mit Kev legte sich niemand an.
Aber Rudy wusste ganz genau, dass Bruno ihm nichts entgegenzusetzen hatte. Daran würde auch keine lahme suggerierte Visualisierung mit Brandungswellen und Vogelgezwitscher etwas ändern. Doch was könnte er tun? Kev anrufen und ihn anbetteln, nach Hause zu kommen und den kleinen Bruno ins Bett zu bringen? Ihn winselnd um Hilfe anflehen, wie es der hypernervöse zwölfjährige Junge getan hatte, der er bei ihrem Kennenlernen gewesen war?
Nein. Werd erwachsen. Lass dir ein Rückgrat implantieren. Komm endlich drüber hinweg.
Bruno quälte sich in die Dusche und lehnte sich Halt suchend gegen die Kacheln. Das Wasser prasselte auf seine geschlossenen Lider.
Setz deinen faulen Arsch in Bewegung, Ranieri. Du wirst nicht nach Stunden bezahlt. Fast hätte er gelacht. Tony schon wieder. Er wurde wehmütig, wenn er sich an die brüske Grobheit erinnerte. Scheiß auf den Schlaf. Kev würde bald zurück sein, um in wenigen Wochen seine Hochzeit mit Edie zu feiern, die deren Furcht einflößende Tante für sie organisierte. Er konnte dann zwischen Smoking-Anproben, Testläufen für die Trauung, Abendessen, Junggesellenabschied und dem restlichen vorehelichen Zeremoniell mit ihm sprechen.
Bis dahin würde er den Monstern wie ein Mann entgegentreten.
Tapfere Vorsätze, Kumpel, kommentierte seine innere Stimme lakonisch.
Und?, schoss er zurück. Halt die Klappe, wenn dir nichts Sinnvolles einfällt.
Er lauschte auf eine Erwiderung, während er sich fertig machte, aber Wunder über Wunder … Seine innere Stimme war verstummt.
2
Lily Parr starrte auf ihren Laptopbildschirm. Das Schlingern des Taxis in den Kurven machte sie nervös, doch sie riss sich zusammen. Die Übelkeit war unangenehm, aber wenn sie den Laptop zuklappte, würde sie daran denken müssen, was ihr bevorstand – und wie sie sich dabei fühlte.
Lieber würde sie ihren Kopf mit psychologischen Texten vollstopfen, bis nicht einmal mehr Platz für einen flüchtigen Gedanken war. Außerdem blieben ihr nur vier kurze Tage, um den Stoff von sechs Jahren in der Diplomarbeit abzuhandeln, an der sie gerade schrieb. Ein beachtliches Pensum, aber der Typ, der sie als Ghostwriterin angeheuert hatte, hatte ihr die geforderten fünfzig Prozent Vorschuss – Gott sei Dank – an diesem Morgen übergeben, darum stand sie nun in der Pflicht. Mit diesem Honorar plus dem anderen Geld, das sie zusammengekratzt hatte, indem sie die Nebenkosten für ihre Wohnung nicht überwiesen und nur das absolute Minimum auf ihre überzogenen Kreditkartenkonten einbezahlt hatte, war es ihr gelungen, die monatliche Gebühr für Aingle Cliff House, Howards Privatklinik, aufzubringen. Lily konnte nur hoffen, dass sie nicht zu ungeplanten Ausgaben wie U-Bahn-Tickets oder Lebensmitteleinkäufen genötigt sein würde, bis weitere ausstehende Honorare eintrudelten. Doch sobald sie das täten, müsste sie sowieso schon wieder haushalten, um die Ausgaben für den nächsten Monat decken zu können. Lily wusste nicht, welche Vorräte sich noch in den dunklen Ecken der Speisekammer verbargen, doch sie würde noch diese Woche Bekanntschaft mit ihnen schließen. Und wozu sollte sie mit der U-Bahn fahren? Sie wohnte in Manhattan. Sie konnte laufen. Ihren Schenkeln würde die Bewegung guttun.
Sie zwang ihre Aufmerksamkeit zurück auf den Monitor. Der Trick bestand darin, ihr Hirn permanent beschäftigt zu halten, so wie einen Stift, der sich nicht von einem Blatt Papier lösen durfte. Wenn sie doch nur vergessen könnte, dass sie einen Körper hatte. Wäre sie doch nur eine Dunstwolke, dann wären manche Dinge erheblich leichter, wie zum Beispiel das Einsparen von Lebensmitteln. Ihr lästiger Körper war das Medium, durch das sich Gefühle bemerkbar machten. Sie konnte sich schon seit ihrem zehnten Lebensjahr keine Gefühle mehr leisten, nur hatten diese bis heute nicht kapiert, dass sie nicht willkommen waren.
Welch eine Ironie, dass sie nun diese Abschlussarbeit ausgerechnet in Psychologie schrieb. Es war wie ein Crashkurs über die Mechanismen des menschlichen Gehirns. Sie konnte es sich eigentlich nicht erlauben, über solches Zeug genauer nachzudenken. Ebenso wenig wie zum Beispiel über die Tatsache, dass ein Kerl promovieren würde, der eine andere Person dafür bezahlte, an seiner Stelle zu studieren, seine Prüfungen für ihn zu absolvieren, seine Hausarbeiten und seine Abschlussarbeit zu schreiben – und das dank Lily vermutlich sogar cum laude –, bevor er sich eine Tätigkeit im Bereich Psychologie suchte, womöglich Diagnosen stellte und schlimmstenfalls sogar Menschen behandelte.
Und sie, Lily Parr, hatte dieses Szenario überhaupt erst ermöglicht.
Dumm gelaufen. Sie verscheuchte diese Gedanken. Sie hatte es sich nicht freiwillig ausgesucht, es war einfach passiert und zum Selbstläufer geworden. Jetzt gab es kein Zurück mehr, zumindest so lange nicht, wie sie für Howard sorgen musste. Die Welt war nun mal ein beschissener Ort, und es tat ihr zwar leid, aber ethische Bedenken waren ein weiterer Luxus, den sie sich nicht leisten konnte.
Es war immer noch besser, als Banken auszurauben oder mit Drogen zu dealen.
Bei der letzten Arbeit, die sie gegen Honorar geschrieben hatte, war es um Ethik gegangen. Aber immerhin war es eher unwahrscheinlich, dass ein falscher Ethiker einem Menschen Schaden zufügen konnte, wenn er auf die Welt losgelassen würde. Zumindest das war ein kleiner Trost.
Monat für Monat musste sie neben ihren drastisch abgespeckten Lebenshaltungskosten elftausend Dollar aufbringen für die Fachleute, die versprochen hatten, ihren Vater rund um die Uhr mit Argusaugen zu bewachen, um sicherzustellen, dass er sich nichts antat.
Vor Aingle Cliff hatte sie ihren Vater in verschiedenen weniger teuren Einrichtungen untergebracht gehabt, aber jedes Mal war es ihm gelungen, sich Zugang zu Tabletten zu verschaffen und sie zu schlucken. Gott allein wusste, wie. Seit vier Jahren lebte er nun in Aingle Cliff, wo sie ihn bisher unter Kontrolle hatten. So weit, so gut.
Man konnte die Situation nicht wirklich als »gut« bezeichnen. Gut stand in diesem Fall für »nicht tot«. Es war alles nur eine Frage der Perspektive.
Und nun war sie auf dem Weg zu ihrem allmonatlichen Martyrium. Das Scheckbuch griffbereit, ihr Magen schmerzhaft verkrampft. Howard wegzusperren war das Einzige, was sie für ihn tun konnte. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Sie wäre fast draufgegangen bei dem Versuch, ihm selbst zu helfen, als sie noch jung und naiv gewesen war. Sie kannte sich aus mit Sucht, Co-Abhängigkeit und all dem Kram. Sie hatte Arbeiten zu diesen Themen geschrieben und Onlineprüfungen darüber abgelegt. Im Namen anderer natürlich. Sie war ein Profi auf dem Gebiet.
Ihre Besuche schenkten Howard keinen Trost. Er bat sie nie, zu kommen. Tatsächlich flehte er sie an wegzubleiben. Das war echt aufbauend. Ihr eigener Vater bettelte sie an, ihn nicht zu besuchen.
Warum also fühlte sie sich genötigt, jeden Monat hinzufahren?
Ihre beste Freundin Nina, eine Sozialarbeiterin, die in einem Heim für misshandelte Frauen tätig war und selbstzerstörerisches Verhalten schon in jeder Variante gesehen hatte, sagte ihr immer, dass sie von Schuld getrieben wurde, aber Lily kaufte ihr das nicht ab. Wer hatte schon Zeit für Schuldgefühle?
Lily war eine dahintreibende Wolke, ein körperloses Wesen. Losgelöst und kalt, außer in Bezug auf Nina und eine ausgewählte Handvoll anderer Freunde, doch Nina war ihre Nummer eins. Dank ihr bewahrte sich Lily ein Mindestmaß an Menschlichkeit. Nicht, dass sie Zeit für ein Sozialleben gehabt hätte. Die hatte sie ebenso wenig wie für Gefühle.
Schwachsinn, hörte sie Ninas Stimme in ihrem Kopf. Deine Gefühle würden dich überrollen wie ein Sattelschlepper, wenn du sie zulassen würdest. Du hast sie nur auf Eis gelegt.
Lily dachte mit einem Anflug von Bitterkeit daran. Und wenn schon. Verleugnung war der einzig richtige Weg. Sie musste das Hamsterrad in Bewegung halten, um die Gebühren für Aingle Cliff aufzubringen, durfte keinen Gedanken an die Ironie oder an Moral verschwenden. Den schlechten Beigeschmack schluckte sie einfach runter. Sie erledigte die Aufträge, bezahlte die Rechnungen, stellte die Schecks aus.
Pass nur auf, dass du dabei nicht selbst unter die Räder kommst.
Sie waren fast am Ziel. Lily klappte den Laptop zu und betrachtete die imposante Fassade von Aingle Cliff House, als sie die gewundene Auffahrt hochfuhren.
Ein dummer Name für diese Klink. Es gab weit und breit keine Klippen. Tatsächlich schien das Gebäude in einem Kessel zu liegen. Es war nicht gerade ein beruhigender Name für eine Einrichtung, in der man suizidgefährdete Menschen unterbrachte. Als Lily das Wort »Cliff« gehört hatte, hatte ihr sofort ein Szenario vor Augen gestanden: ein Sprung mit Anlauf, ein tiefer Fall und ein Platsch beim Aufprall auf dem Boden. Solche verdrehten Gedanken waren typisch für sie.
Das Taxi stoppte. Sie blieb reglos sitzen.
»Äh … Miss?«, fragte der Fahrer. »Ist alles, ähm …?«
Lily zückte ihr Portemonnaie. »Können Sie mich in einer Stunde hier abholen?«
Der Taxifahrer willigte ein. Lily bezahlte ihn, in dem unangenehmen Bewusstsein, wie wenig Geld ihr nur noch blieb. Sie brauchte alles für den Scheck, den sie gleich unterschreiben würde, darum hatte sie kaum mehr genug, um zurück zum Bahnhof zu gelangen. Ein Trinkgeld für den Taxifahrer würde auf dem Rückweg nicht mehr drin sein. Wie peinlich.
Das Taxi fuhr davon. Lilys Sneakers knirschten auf dem Kiesweg, als sie zu dem eindrucksvollen Gebäude hinauflief. Überall tummelten sich Patienten im Freien, um die Nachmittagssonne zu genießen. Howard war nicht darunter. Patienten, die als Gefahr für sich selbst eingeschätzt wurden, waren in einer speziellen Abteilung untergebracht. Howard war diesbezüglich ein besonderer Fall. Er hatte schon achtmal versucht, sich umzubringen, womöglich sogar öfter. Die Vorfälle waren mit der Zeit in ihrer Erinnerung ineinander übergegangen.
Beim ersten Mal war Lily fünfzehn gewesen und gerade von der Schule heimgekommen, als sie ihren Vater mit blauem Gesicht und kaum mehr atmend vorgefunden hatte. Wäre sie an jenem Nachmittag wie geplant nach dem Unterricht zu ihrem Nachhilfejob gegangen, wäre er bereits tot gewesen. Das war selbstverständlich sein Plan gewesen.
An diesem Tag hatte sie aufgehört, ihn Dad zu nennen. Sie war die Erwachsene, nicht er. Sie war es schon seit einigen Jahren. Ihre Mutter war am Tag von Lilys Geburt gestorben, darum erhielt Lily aus dieser Richtung keine Unterstützung. Es waren immer nur sie und Howard gewesen. Oder Dad, wie sie ihn früher genannt hatte, bevor …
Bevor was? Diese Frage quälte sie bis heute. Es war nicht immer so gewesen. In ihren guten Zeiten hatte ihr Vater als Forschungsarzt gearbeitet, der als eine Koryphäe auf dem Gebiet künstlicher Befruchtung galt. Er war ein miserabler Koch und ein noch schlechterer Hauswirtschafter, aber man konnte so viel Spaß mit ihm haben. Er war klug und lustig.
Sie hatten sich sehr nahegestanden, waren ein Herz und eine Seele gewesen. Howard und Lily, das Comedy-Duo. Sie vertrieben sich die Samstagnachmittage damit, klassische Horrorstreifen zu gucken, Karten zu spielen und chinesisches Essen zu bestellen. Sonntags machten sie Picknicks im Park mit Sandwiches aus dem Feinkostladen, Mint-Milano-Keksen und Apfelsaft.
Lily war etwa zehn, als plötzlich alles den Bach runterging. Ihr Vater hörte von einem Tag auf den anderen auf zu arbeiten und saß stattdessen betrunken vom Bourbon nur noch in seinem Bademantel zu Hause herum. Es wurde noch schlimmer, als härtere Drogen ins Spiel kamen. Manchmal wachte sie nachts auf und sah ihn mit tränenüberströmtem Gesicht vor ihrem Bett knien. Es hatte sie jedes Mal wieder zu Tode erschreckt.
Lily trug sich ins Besucherbuch ein, dann ging sie zum Verwaltungsbüro, wo sie ihren monatlichen Bestechungsscheck gegen ihre schlimmsten Ängste ausstellte. Sie redete eine Weile belangloses Zeug mit den Angestellten, dann fiel ihr kein Grund mehr ein, wie sie noch mehr Zeit schinden könnte, darum begab sie sich zum Aufzug und fuhr in den vierten Stock hoch, wo Howards Abteilung untergebracht war.
Der vierte Stock war bewacht. Sie tauschte ein Lächeln mit dem Sicherheitsmann. Er sperrte die Tür auf und ließ sie ein.
Sie wich zurück, als Howards Zimmertür aufging und Miriam, eine seiner Krankenschwestern, herauskam. Sie war nicht gerade Lilys Favoritin, auch wenn ihre Antipathie gegen die Frau vielleicht nicht ganz fair war. Miriam Vargas, eine hellhäutige Südamerikanerin, war schön wie ein Model, mit vollen Lippen und einem Körper, der selbst in der formlosen Schwesterntracht sexy aussah. Doch das war es nicht, was Lily an ihr nervte. Miriam war einfach zu quirlig für ihren Geschmack. In ihrer Gegenwart fühlte sie sich wie ein kaltherziges Biest, weil ihr die freundliche Lebhaftigkeit der Schwester so sehr gegen den Strich ging, aber sie konnte es nicht ändern.
Miriam lächelte sie mit ihren spektakulären Zähnen strahlend an. »Hallo, Lily! Wie geht’s Ihnen?«
»Ganz gut.« Lily versuchte, das Lächeln zu erwidern. »Wie geht es ihm?«
Miriams Miene wurde ernst. »Er war die letzten paar Tage ein wenig aufgewühlt. Ich werde mit Dr. Stark darüber sprechen, sobald er eintrifft. Es könnte sein, dass wir seine Medikamente neu dosieren müssen. Aber ich bin sicher, er wird sich freuen, Sie zu sehen! Sie werden ihn bestimmt aufmuntern!«
Sehr witzig. Aber Lily würde diese Behauptung heute unkommentiert lassen. Sie seufzte tief und trat ein. Das Zimmer war freundlich eingerichtet und bot einen hübschen Ausblick über das am Waldrand gelegene Grundstück, aber Howard erfreute sich nicht an der schönen Aussicht. Stattdessen kauerte er auf dem Bett, umklammerte beide Knie und wiegte sich vor und zurück.
Lilys Alarmglocken begannen zu schrillen. Dieses obsessive Schaukeln war schon oft Vorbote eines Suizidversuchs gewesen.
»Howard?«, sprach sie ihn sanft an.
Er schaute auf. Sein blasses, ausgemergeltes Gesicht war tränenüberströmt.
»Kannst du mir jemals vergeben, Lily?«, fragte er.
Sie verkniff es sich, die Augen zu verdrehen. Howard konnte eine schnoddrige Reaktion von ihr auf seinen jämmerlichen Gemütszustand nicht gebrauchen. Sie setzte sich neben sein Bett.
»Ich habe dir bereits vergeben.« Sie fragte sich, ob das tatsächlich der Wahrheit entsprach. Woher sollte sie das wissen, solange ihre wahren Gefühle verschüttet waren?
Ach, zur Hölle damit. Es kam der Wahrheit zumindest sehr nahe. Sie hatte Howard vergeben. Es war die Entscheidung einer höheren Macht gewesen, bei der Gefühle keine Rolle spielten. Hier ging es nicht um Demokratie, sondern um Kriegsrecht.
Trotzdem schüttelte ihr Vater den Kopf. »Nein. Das könntest du niemals, wenn du Bescheid wüsstest.«
Sie seufzte in sich hinein. »Bescheid worüber? Stell mich auf die Probe.«
Howards strähniges graues Haar war so lang geworden, dass es in sein eingefallenes Gesicht fiel, als er den Kopf hin- und herbewegte.
»Nicht«, sagte er flehend. »Darum darfst du mich nicht bitten, Lily.«
Sie drehten sich wie immer im Kreis. Lily kannte dieses Spiel in- und auswendig. Es begann stets mit seinem Flehen um Vergebung, gefolgt von obskuren Andeutungen und schließlich einem beschämten Rückzieher.
»Na schön«, beschwichtigte sie ihn. »Wie du möchtest. Aber es ist alles gut.«
»Nein. Genau das ist das Problem. Es ist nicht gut. Und das wird es auch niemals sein.« Seine blutunterlaufenen Augen waren geweitet und voller Verzweiflung. »Ich ertrage es nicht mehr. Es ist, als würde meine Brust kollabieren und mir die Rippen brechen. Ich bekomme keine Luft mehr.«
Hilflos schaute Lily ihn an. Sie hatte Arbeiten über abnormale Psychen verfasst, über analytische Psychologie, über Freud. Sie hatte das esoterische Wissen aller großen Weltreligionen studiert. Man sollte eigentlich annehmen, dass sie wüsste, wie man Howards Zusammenbrüche in den Griff bekam oder ihm mit ein paar pathetischen Weisheiten Trost spenden konnte. Aber ihr Hirn war nicht gemacht für dieses vage, subjektive Zeug, auch wenn sie ausnahmslos gute Noten in diesen Fachgebieten erhielt – vielmehr bekamen ihre Klienten sie. Insgeheim war sie ein bisschen stolz auf all die Einsen.
Aber im tiefsten Inneren war sie einfach nur die praktisch veranlagte, sachliche Lily. Sie hatte weder einen Sinn für Albernheiten noch für Voodoo oder Zaubertricks oder ähnlichen Unsinn. Und auch mit Ausreden konnte man ihr nicht kommen.
Aber, Herrgott, wie sehr sie es hasste, ihren Vater leiden zu sehen.
Lily ergriff seine Hand. Sie war eiskalt. »Erzähl es mir doch einfach, Howard«, ermutigte sie ihn. »Sag mir, was dich so sehr bedrückt.«
Seine klamme Hand zuckte in ihrer. »Damit würde ich dich in Gefahr bringen.« Seine Stimme war ein kaum vernehmbares Flüstern. Sie musste sich zu ihm vorbeugen, um ihn zu verstehen. »Sie hören zu, Lily. Sie hören immer zu. Wenn ich es dir sagte, würden sie es wissen. Und dann würden sie Jagd auf dich machen.« Howards kratzige Worte gingen in ein abgehacktes Husten über. Seine Augen zuckten nach rechts, dann nach links. »Sie würden mich töten. Sie würden uns beide töten.«
Sie tätschelte seine Hand. »Nein, das werden sie nicht. Nicht hier«, beschwichtigte sie ihn. »Hier bist du in Sicherheit.« Sie bezahlte weiß Gott genug dafür.
Howards Haare fielen erneut nach vorn. »Nein. Es gibt keinen sicheren Ort«, beharrte er. »Du bist mein kleines Mädchen, Lily. Das kann ich dir nicht antun. Ich trage die Verantwortung für dich. Das war der Grund für … für alles.«
Sie krümmte sich innerlich. Verantwortung, ausgerechnet. Wegen seiner Drogenexzesse fühlte sie sich seit ihrem elften Lebensjahr wie eine Vollwaise. Denk nicht daran, Lily.
»Ich bin nicht mehr klein, Howard«, sagte sie zu ihm. »Ich kann auf mich aufpassen.«
»Glaube das nur nicht. Niemals. Wir schweben noch immer alle in Gefahr. Magda hat mich gewarnt. Sie hat gesagt, dass sie zuhören. Selbst jetzt noch, nach all den Jahren.«
»Magda?« Der Name sagte Lily nichts. Tatsächlich hatte sie keine Ahnung, ob Howard noch von anderen Menschen als ihr Besuch bekam. Er hatte sich schon vor Jahrzehnten vom Rest der Welt isoliert. »Wer ist Magda?«
»Magda Ranieri. Sie haben sie umgebracht«, wisperte er.
Lily verspürte ein unheilvolles Kribbeln im Kreuz, das rasch ihren Nacken heraufwanderte. Ihr Vater bekam Besuch aus dem Totenreich. Kein gutes Zeichen.
»Howard? Was redest du?«
Er verstärkte den Druck seiner Hand und presste ihre Finger schmerzhaft zusammen. »Magda hat versucht, sie zu stoppen«, sprudelte es aus ihm heraus. »Sie wollte meine Hilfe, aber ich hatte zu viel Angst, Lily. Um dich. Wir haben versucht, Beweise zu beschaffen, aber sie kamen uns auf die Schliche.«
»Beweise wofür?«
»Für das, was ich getan hatte – für ihn. Aber ich schwöre, Schätzchen, ich hatte keine Ahnung, was er plante. Ich wusste nicht, dass er ein … ein Dämon ist. Als ich es endlich realisierte, war es zu spät. Ich musste an dich denken, und er …«
»Er? Wer ist er?« Ihre Stimme wurde schärfer. »Und wer zum Kuckuck ist diese Marta Ranieri?«
»Du darfst den Namen nicht so laut sagen«, zischte er mit unerwarteter Schärfe. Dann bebten seine Lippen von Neuem. »Sie haben sie umgebracht, Lily. Vor meinen Augen. Sie haben sie totgeschlagen. Sie haben mich gewarnt, dass du die Nächste sein würdest, falls ich … falls ich …« Er konnte einen Moment nicht weitersprechen. »Ich sehe es noch immer vor mir. Egal, ob meine Augen offen sind oder geschlossen. All das viele Blut. Ich ertrage es nicht länger. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen, um deine Sicherheit zu garantieren. Warum sollten sie dich bestrafen, wenn ich tot bin? Aber ich war nie Manns genug, die Sache zu Ende zu bringen.« Seine Stimme ging in ein Schluchzen über, seine Hände zitterten.
Lily hielt seine Finger fest und unterdrückte ein Frösteln. Die Qual in Howards Augen war sehr real. Ob die Erinnerungen, die er schilderte, ebenfalls real waren, erschien ihr eher unwahrscheinlich, trotzdem machte das seinen Schmerz nicht geringer.
Aber eigentlich klang es nicht wie unzusammenhängendes Gefasel, sondern … echt.
Lily musterte ihn. Sie hatte Hausarbeiten für zukünftige Mediziner über posttraumatische Belastungsstörungen bei Kriegsveteranen, über Opfer von Vergewaltigungen oder von anderen gewaltsamen Übergriffen geschrieben. Und Howard hatte solche Angst vor Blut. Das war schon so, seit sie denken konnte. Könnte dies die Ursache sein …?
Nein. Ausgeschlossen. Er litt an einer mentalen Erkrankung. Sein jahrelanger Drogenmissbrauch hatte sein Hirn geschädigt. Sie würde nicht darauf reinfallen. Sie war erwachsen. Sie wusste es besser.
Aber immerhin gab Howard nun endlich Details seiner Wahnvorstellungen preis, was er nie zuvor getan hatte. Sein Psychiater, Dr. Stark, beklagte sich laufend, dass Howard sich jeder Gesprächstherapie verweigerte. Vielleicht könnte er diese Informationen für seine Behandlung nutzen. Lily durfte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, ganz gleich, wie unheimlich das Ganze war.
»Wer war diese Magda für dich?«, hakte sie nach. »Erzähl mir mehr.«
Howard schüttelte den Kopf, trotzdem sprach er weiter, als wünschte sich ein Teil von ihm verzweifelt, aus dem Käfig seiner Ängste auszubrechen.
»Magda besucht mich regelmäßig«, murmelte er. »Sie sagt, ich soll ihren Sohn aufspüren und ihn warnen. Aber ich kann nicht. Du könntest ihn ausfindig machen, Lily.«
»Wer? Ich? Wer ist Magdas Sohn? Und was soll ich ihm sagen?«
»Psst!«, zischte er und zog sie an der Hand näher, bis ihr Hintern von dem harten Stuhl runterrutschte. Sie setzte sich auf die Bettkante und beugte sich zu ihm, um sein heiseres Flüstern zu verstehen. »Du könntest es ihm sagen. Er muss es wegsperren. Darin ist der Schlüssel. Es ist der Schlüssel zu allem. Ihr Sohn wird Bescheid wissen, wenn er es öffnet.«
Er verdrehte die Augen. Seine Kraft schwand, und die Angst gewann die Oberhand. Lily fragte schnell nach, um ihn am Reden zu halten. »Wenn er was öffnet, Howard?«
»Er wird es wissen«, murmelte ihr Vater. »Magda hat gesagt, dass er verstehen wird, sobald er es öffnet und er …«
»Was um alles in der Welt ist hier los?«
Beide fuhren vor Schreck zusammen.
Miriam stand in der Tür, und ihre großen Augen funkelten vor Zorn. »Was hat das hier zu bedeuten?«, fuhr sie Lily mit rasiermesserscharfer Stimme an.
Lily bewegte tonlos die Lippen, während sie nach Worten suchte, um den unerklärbaren Zorn der Frau zu beschwichtigen. »Wir haben uns nur unterhalten …«
»Unterhalten?« Miriams Stimme traf sie wie ein Peitschenhieb. »Sehen Sie ihn doch nur an! Sie regen ihn absichtlich auf!«
Lily schaute zu ihrem Vater. Er hatte ihr seine Hand entzogen und die Arme um seine Knie geschlungen. Aus seinen fest zusammengepressten Augen rannen Tränen.
Mist. Dieser kurze, seltene Moment der Offenheit war schon wieder verflogen, und das nur wegen des beschissenen Timings dieser blöden Krankenschwester. Verdammt!
»Nein«, antwortete Lily zähneknirschend. »Es ging ihm bestens! Sie waren es, die ihn aufgeregt hat, indem Sie wie eine Furie hier reingestürzt kamen! Howard, fahr einfach fort mit deiner Geschichte über Magda und ihren …«
»Nein!« Er zuckte zurück, als hätte sie ihn geohrfeigt.«Ich habe überhaupt nichts gesagt! Ich hatte nur einen dummen Anfall! Ich bin ein verrückter alter Mann, ein paranoider Junkie! Halt dich fern von mir, bevor ich dich mit in den Abgrund reiße! Du solltest mich nicht mehr besuchen kommen! Das habe ich dir bereits gesagt! Bitte, geh jetzt!«
Ja, das hatte er. Andererseits hatte er sie nie aufgefordert, keine Schecks mehr auszustellen. Obwohl sie zugeben musste, dass es ihm womöglich nie in den Sinn gekommen war, wie sehr sie sich abrackern musste, um für seine Pflege aufzukommen. Sie hatte es ihm nie unter die Nase gerieben.
»Geh einfach. Komm nicht zurück. Vergiss all das hier. Vergiss mich. Bitte.« Von Schluchzern geschüttelt begann er abermals, sich vor- und zurückzuwiegen.
»Nun?«, blaffte Miriam. »Sie haben ihn gehört! Gehen Sie! Sofort!«
Geschockt und erzürnt sprang Lily auf. »Nein, das werde ich nicht tun. Ich bin hier, um mit meinem Vater zu sprechen, und ich verlange Privatsphäre!«
»Verlangen Sie, was Sie wollen«, gab Miriam zurück. »Während meiner Schicht trage ich die Verantwortung für ihn, und daran halte ich mich! Sie werden jetzt gehen! Auf der Stelle!«
Lily wandte sich zu Howard um und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Howard …«
»Nein! Tu das nicht!« Stöhnend und zuckend schüttelte er ihre Hand ab.
Entschlossenen Schrittes marschierte Miriam zum Bett. Noch ehe Lily kapierte, was geschah, hatte sie Howard schon eine Spritze in den Arm gestochen und den Kolben nach unten gedrückt. Er versteifte sich, dann sackte er kraftlos in sich zusammen.
»So«, verkündete Miriam mit unverhohlenem Triumph. »Jetzt kann er sich ausruhen.«
Lily war entsetzt. »Wie können Sie es wagen?« Ihre Stimme überschlug sich. »Ich arbeite mir Monat für Monat den Arsch ab, um für diese Klinik zu bezahlen!«
»Das ist nicht mein Problem. Sie können sich gern bei meinem Chef beschweren, aber ich werde noch heute einen Bericht schreiben und schildern, wie Sie Ihren Vater vor meinen Augen drangsaliert und ihn absichtlich aus der Fassung gebracht haben!«
Lily klappte die Kinnlade auf. »Drangsaliert? Wir haben uns nur unterhalten …«
»Verschwinden Sie! Sofort!«, befahl Miriam. »Andernfalls werde ich Sie unter Gewaltanwendung nach draußen eskortieren lassen! Und bilden Sie sich bloß nicht ein, ich würde bluffen!«
Lily starrte die Frau mit brennenden Wangen an. Dann sah sie zu Howard, der zusammengekrümmt auf der Seite lag. Er atmete pfeifend durch den Mund. Der Blick seiner halb geöffneten Augen war benommen, wie im Drogenrausch, so wie Lily es schon oft in ihrem Leben gesehen hatte. Er hatte sich an einen sicheren Ort geflüchtet und sie allein in der Kälte zurückgelassen. Genau wie früher.
Sie hätte der blöden Kuh am liebsten den Hals umgedreht, weil sie den einzigen wahrhaftigen Moment zerstört hatte, den sie seit Jahren mit ihrem Vater gehabt hatte. Aber das würde zu nichts führen. Howard hatte sich zurückgezogen. Er würde heute nicht mehr ansprechbar sein. Was sollte es also bringen? Sie konnte ebenso gut den offiziellen Weg gehen und sich beschweren. Das wäre zudem würdevoller. Sollte keine angemessene Reaktion erfolgen, würde sie Howard in eine andere Einrichtung verlegen lassen.
Miriam stieß sie vor sich her zur Tür der Station, schubste sie hindurch und knallte sie ihr vor der Nase zu.
Lily blieb wie vom Donner gerührt stehen, während der Wachmann sie mit einem seltsamen Blick taxierte. Zum Aufzug. Immer einen Fuß vor den anderen setzen. Sie wollte sofort Beschwerde einlegen, doch sie war so wütend und erschüttert, dass sie wie eine hysterische Idiotin wirken und es vermasseln würde. Es war besser zu warten, bis sie sich beruhigt hatte.
Ohne ein Wort zu irgendjemandem marschierte sie durch die Lobby und hinaus ins Freie. Die späte Sommersonne schien völlig fehl am Platz. Die vielen Insekten und Vögel, die zirpten und zwitscherten, das Rauschen des Windes, die Äste, die sich darin wiegten, wirkten fast provozierend friedvoll. Lilys Körper war angespannt wie eine Bogensehne.
Als wäre die nervliche Belastung nicht schon groß genug, einen selbstmordgefährdeten Drogenabhängigen zum Vater zu haben. Nun kamen auch noch Geister, ominöse Warnungen und kryptische Bitten hinzu. Und eimerweise Blut. Mordlüsterne Ganoven, die es auf Howard und auch auf Lily abgesehen hatten. Es war gespenstisch.
Sie hätte nicht gedacht, dass sich Howards Zustand noch verschlechtern könnte, aber er hatte ihr nie zuvor so viel Angst gemacht wie an diesem Tag. Sie brauchte Abstand, sonst würde sie selbst den Verstand verlieren. Im Gegensatz zu ihrem Vater hatte sie keine Verwandten, die sich freiwillig in einen finanziellen Würgegriff begeben würden, um ihr eine hübsche, sichere Einrichtung zu spendieren, wo sie in Ruhe verrückt sein konnte. Nein, sie würde ihr Leben als Wahnsinnige damit fristen müssen, wirres Zeug zu faseln und in Mülltonnen nach Lebensmitteln zu suchen. Keine verlockende Vorstellung.
Lily zitterte am ganzen Körper. Sie wollte sich wie ein verwundetes Tier unter einem Busch verkriechen. Der Himmel kam ihr so leer und seltsam bedrohlich vor.
Sie kannte die Nummer des Taxifahrers nicht. Sie hätte sich seine Karte geben lassen sollen. Theoretisch konnte sie zurück in die Lobby gehen und darum bitten, dass man ihr ein Taxi rief, doch dafür wären mentale Aufgeräumtheit, soziale Fähigkeiten und ein Mindestmaß an Ruhe erforderlich gewesen, die sie schlichtweg nicht besaß. Die andere Option bestand darin, sich auf die kleine Mauer zu hocken und vierzig Minuten zu warten.
Sie schaute zum vierten Stock hoch. Miriam stand an einem der Zimmerfenster und starrte nach unten. Dabei sprach sie in ein Handy.
Dabei ging es um Lily, ohne Zweifel. Vermutlich telefonierte sie mit ihrem Vorgesetzten, um ihm von dem Vorfall zu berichten und Lily als hysterische Ziege hinzustellen, die die Situation zu verantworten hatte. Lily verdrängte den Gedanken. Sie litt an übersteigerter Paranoia. Die ganze Welt ist hinter mir her, alle haben sich gegen mich verschworen, um mich zu zerstören.
Nein, diese Gedanken würde sie nicht zulassen – selbst dann nicht, wenn sie wahr wären.
Noch immer mit dem Handy am Ohr schaute Miriam weiter nach unten. Der Spiegeleffekt des doppelt verglasten Fensters verbarg ihren Gesichtsausdruck, trotzdem bildete Lily sich ein, die Feindseligkeit der Frau sogar noch über diese Distanz hinweg zu spüren.
Sie stand auf und schlenderte über das Grundstück, begleitet von einem vagen Gefühl der Schutzlosigkeit unter diesem leeren Himmel. Als könnte jeden Moment ein Raubvogel mit messerscharfen Krallen herabschießen, um sie in Stücke zu reißen.
Sie haben sie umgebracht, Lily. Vor meinen Augen. Sie haben sie totgeschlagen. Sie haben mich gewarnt, dass du die Nächste sein würdest …
Eine Welle der Übelkeit erfasste sie. Sie musste sich an einem Ast festhalten bei der Vorstellung, es könnte auch nur die leiseste Chance bestehen, dass Howard tatsächlich … nein.
Diese Möglichkeit durfte sie noch nicht einmal in Erwägung ziehen. Das war der Weg, der in den Wahnsinn führte. Sie verfügte nicht über die Mittel, um zwei Verrückte zu finanzieren. Andererseits zermarterte sie sich seit Jahren das Hirn, was Howards Zusammenbruch herbeigeführt hatte. Wieso sollte ein normaler, erfolgreicher, relativ glücklicher Mensch plötzlich vor Verzweiflung durchdrehen? Von einem Tag zum nächsten …
So etwas passierte nicht. Nicht ohne einen Auslöser. Aber den Mord an dieser Magda mitansehen zu müssen … das würde es erklären.
Doch ihr Wunsch nach einer logischen Erklärung war ebenfalls eine Falle. Lily war auf der Hut vor solchen Fallen, sie misstraute allem und jedem. Sogar ihren eigenen Gedankengängen.
Am Ende des akkurat gemähten Rasens ging das Grundstück in einen Wald über. Ein eisiges Frösteln in ihrem Nacken drängte sie dazu, hineinzurennen, sich zu verstecken und auf dem Boden in Deckung zu gehen. Es war ein alberner Impuls. Sie hatte kein Faible für die Natur, außerdem war niemand hinter ihr her. Die Welt schenkte ihr nicht viel Beachtung, und genau so wollte sie es haben. Sie flog unter dem Radar. So gut wie niemand wusste, womit sie ihren Lebensunterhalt verdiente, und ihre Kunden waren zwangsläufig extrem diskret. Sie arbeitete zu viel, um eine Menge Leute zu kennen – mit Ausnahme von Nina und ein paar verärgerten Männern von ihren seltenen Ausflügen in die Welt des Datings.
Sie schaute nach oben. Miriam stand noch immer am Fenster und telefonierte.
Es war ihr peinlich, hier herumzulungern wie ein Hund, den man vor die Tür gesetzt hatte, weil er auf den Teppich gepinkelt hatte, während diese schreckliche Frau sie beobachtete. Sie musste von hier verschwinden. Jetzt sofort. Zu Fuß. Zum Glück trug sie Turnschuhe. Sie konnte sich nicht verlaufen, wenn sie sich parallel zur Straße hielt und am Verkehrslärm orientierte. Ein Waldspaziergang war exakt das Richtige, um einen klaren Kopf zu bekommen. Es sei denn, ein Raubtier mit gefährlichen Reißzähnen würde sie fressen, aber sie konnte sich nicht vorstellen, dass in den Wäldern New Yorks Bären, Pumas oder Wildscheine lauerten. Zudem würde sie sich die zehn Dollar für das Taxi sparen und die Peinlichkeit umgehen, dem Fahrer kein Trinkgeld geben zu können. Das gesparte Geld könnte sie anschließend in ein Abendessen investieren. Sie würde also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Lily zwängte sich durch die Hecke und tauchte in den Wald ein.
3
»Du musst kommen und sie dir schnappen, Cal. Beeil dich.« Schwester Miriam, die in Wahrheit weder eine Krankenschwester war noch Miriam hieß, flüsterte hektisch in ihr Handy, während sie in ein unbenutztes Patientenzimmer schlüpfte.
»Hat King gesagt, was mit ihr passieren soll?« Cal klang gelangweilt.
»Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, aber wenn ich es tue, möchte ich ihm auf keinen Fall sagen müssen, dass wir ihre Spur verloren haben!«, zischte sie. »Das hätte auch für dich unschöne Konsequenzen, Cal. Ich melde mich in ein paar Minuten mit weiteren Instruktionen! Und jetzt gib Gas! Beweg deinen Arsch hierher zurück!«
Klick. Cal hatte aufgelegt. Dieser Wichser. Sie hatte ihn noch nie gemocht.
Beruhige dich, Zoe. Du musst dich konzentrieren, Zoe. Sie benutzte ihren Namen, wie King es während ihrer persönlichen Programmierungssequenzen tat, und versuchte, seine Stimme in ihren Kopf zu projizieren, um die Befehle zu wiederholen. Es half, die Botschaft tiefer zu verankern.
Die Katastrophe war noch immer abwendbar – hoffentlich. Howard hatte sie kalt erwischt, indem er mit seiner Geschichte nun doch noch herausgeplatzt war. Die Übertragungsverzögerung war länger gewesen, als sie einkalkuliert hatte. Der Sender hatte die Daten auf ihren Laptop übermittelt, dort waren sie durch das Worterkennungsprogramm gelaufen, bevor sie schließlich ein Signal auf ihrem Beeper bekommen hatte. Trotzdem war riskant viel Zeit vergangen seit dem Moment, als Howard die Schlüsselworte »Magda Ranieri« benutzt hatte. Fast vier verflixte Minuten. In der verstrichenen Zeit hatte Howard alles ausgespuckt hatte, so viel war Zoe klar, als sie sein Zimmer erreichte.
Dieser böse, böse Junge. Es würde einigen Aufwand erfordern, diese Sache wieder geradezubiegen.
Sie verstand nicht, warum King ihr nicht schon vor Jahren befohlen hatte, Howard zu töten, aber er hatte natürlich seine Gründe. Zum Beispiel wollte er seine Macht über Howard bis zum Ende behalten. Howard musste wissen, wer der Boss war. Es war nur recht und billig, dass er sich bis zu seinem Tod unterwarf und gehorchte und für seine Verfehlung bestraft wurde. Das war etwas, womit sie sich gut auskannte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!