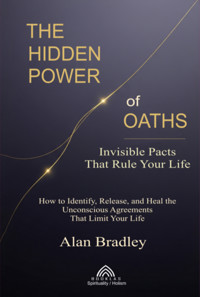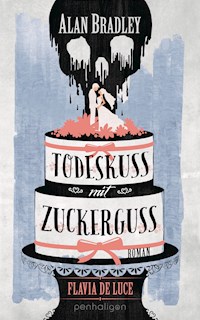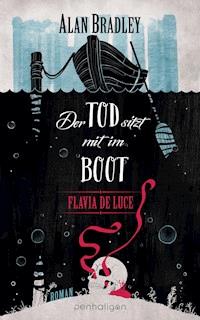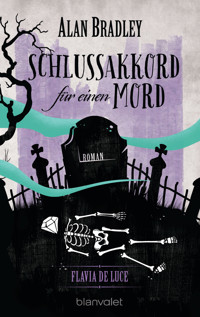9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Flavia de Luce
- Sprache: Deutsch
Wer Wednesday Addams als Ermittlerin liebt, kommt an Flavia de Luce nicht vorbei.
Es ist ein Frühlingsmorgen im Jahr 1951. Flavia de Luce hat sich mit ihrer Familie am Bahnhof von Bishop’s Lacey eingefunden, um die Heimkehr ihrer beim Bergsteigen in Tibet verschollenen Mutter Harriet zu erwarten. Als der Zug einfährt, nähert sich ein großer Fremder der elfjährigen Hobbydetektivin und flüstert ihr eine kryptische Botschaft zu. Einen Augenblick später ist der Mann tot – jemand aus der Menschenmenge hat ihn offenbar vor den Zug gestoßen. Ein neuer Fall für Flavia de Luce, die sich dieses Mal sogar in die Lüfte schwingt, um einen Killer zur Strecke zu bringen, und die endlich die Wahrheit erfährt über die Vergangenheit ihrer Mutter …
Diese außergewöhnliche All-Age-Krimireihe hat die Herzen von Lesern, Buchhändlern und Kritikern aus aller Welt im Sturm erobert!
Die »Flavia de Luce«-Reihe:
Band 1: Mord im Gurkenbeet
Band 2: Mord ist kein Kinderspiel
Band 3: Halunken, Tod und Teufel
Band 4: Vorhang auf für eine Leiche
Band 5: Schlussakkord für einen Mord
Band 6: Tote Vögel singen nicht
Band 7: Eine Leiche wirbelt Staub auf
Band 8: Mord ist nicht das letzte Wort
Band 9: Der Tod sitzt mit im Boot
Band 10: Todeskuss mit Zuckerguss
Außerdem als E-Book erhältlich:
Das Geheimnis des kupferroten Toten (»Flavia de Luce«-Short-Story)
Alle Bände sind auch einzeln lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Alan Bradley
Roman
Aus dem Englischen von Gerald Jung und Katharina Orgaß
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel The Dead in Their Vaulted Arches bei Delacorte Press, an imprint of The Random House Publishing Group, a division of Random House LLC, a Penguin Random House Company, New York
© 2014 by Alan Bradley
© der deutschsprachigen Ausgabe 2014 by Penhaligon Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Das Gedicht von Thomas Parnell stammt aus: Britannia. Eine Auswahl englischer Dichtungen alter und neuer Zeit. Ins Deutsche übersetzt von Louise von Ploennies (Frankfurt a. M., Verlag der S. Schmerber’schen Buchhandlung 1843)
Covergestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-12322-2V005
www.penhaligon.de
Geliebter Amadeus
Es hebt sich stolz des Marmors Pracht,
Wo in gewölbter Grüfte Nacht
Die Todten ruh’n, wo Pfeiler steh’n,
Wo Engel, Wappen, Schrift zu seh’n,
Die, als des Glanzes letzter Schein,
Der Großen, Reichen Grab sich weih’n.
Der Glanz, der sich geweiht dem Leben,
Muss jetzt den todten Staub erheben.
THOMAS PARNELL
Ein Nachtstück auf den Tod (1717; in der Übersetzung von Louise von Ploennies, 1843)
Prolog
Eure Mutter wurde gefunden.«
Noch eine knappe Woche nach dieser schockierenden Mitteilung hallten Vaters Worte in meinen Ohren wider.
Harriet! Man hatte Harriet gefunden! War das zu fassen?
Harriet, die bei einem Bergsteigerunfall im Himalaja ums Leben gekommen war, als ich gerade mal ein knappes Jahr alt gewesen war. Harriet, die mit eigenen Augen gesehen zu haben ich mich nicht erinnern kann.
Was ich empfand?
Nichts, muss ich gestehen.
Ich war wie vor den Kopf geschlagen, stumm und betäubt.
Ich empfand weder Freude noch Erleichterung – nicht einmal Dankbarkeit gegenüber denen, die Harriet über zehn Jahre nach ihrem Verschwinden gefunden hatten.
Ach, ich war starr und kalt, so beschämend starr und kalt, dass ich einfach nur allein sein wollte.
1
Aber fangen wir von vorn an. Es war ein makelloser englischer Morgen, einer jener strahlenden Tage Anfang April, an denen eine neugeborene Sonne plötzlich den Eindruck von Hochsommer hervorzaubert.
Ihre Strahlen brachen aus den dicken weißen Wolkenknödeln hervor, und die Schatten spielten miteinander Fangen über die grünen Felder und die wogenden Hügel hinauf. Im Wald hinter den Bahngleisen sang eine Nachtigall.
»Wie ein kolorierter Stich von Wordsworth«, sagte meine Schwester Daphne halblaut wie im Selbstgespräch. »Viel zu pittoresk.«
Meine ältere Schwester Ophelia war ein regloser, bleicher, in Gedanken versunkener Schemen.
Um die vereinbarte Zeit – es war zehn Uhr – standen wir alle mehr oder weniger gemeinsam auf dem kleinen Bahnhof von Buckshaw und warteten. Es war wohl das erste Mal in meinem Leben, dass ich Daffy ohne ein Buch in der Hand sah.
Vater stand etwas abseits, schaute alle paar Minuten auf seine Armbanduhr und spähte mit zusammengekniffenen Augen die Gleise entlang, ob womöglich in der Ferne schon Rauch zu sehen war.
Dogger hielt sich dicht hinter ihm. Die beiden Männer boten einen sonderbaren Anblick: Herr und Diener, die zusammen so schreckliche Zeiten durchgemacht hatten und nun in ihrem schönsten Sonntagsstaat auf einem entlegenen Landbahnhof herumstanden.
Früher einmal hatte der Bahnhof dazu gedient, Güter und Gäste zu dem hochherrschaftlichen Landsitz zu befördern. Die Gleise waren noch gut in Schuss, aber das Bahnhofsgebäude mit seinen verwitterten Backsteinen war schon seit Ewigkeiten mit Brettern verrammelt.
Doch in den letzten paar Tagen hatte man es für Harriets Heimkehr in aller Eile wieder hergerichtet. Man hatte gewischt und gefegt, die zerbrochenen Fensterscheiben ersetzt, das kleine Blumenbeet gejätet und neu bepflanzt.
Vater war gefragt worden, ob er nach London kommen und Harriet persönlich heimbegleiten wolle, aber er hatte darauf bestanden, sie hier am Bahnhof in Empfang zu nehmen. Hier war er Harriet vor vielen Jahren auch zum ersten Mal begegnet, als sie beide noch jung gewesen waren; so hatte er es dem Vikar erklärt.
Mir fiel auf, dass Vaters Schuhe auf Hochglanz poliert waren, woraus ich schloss, dass Doggers Verfassung sich erheblich gebessert hatte. Es gab Zeiten, in denen er nachts heulend und zähneklappernd in einer Ecke seiner kleinen Schlafkammer kauerte. Dann suchten ihn die Geister der Kriegsgefangenschaft heim, und die Dämonen der Vergangenheit folterten ihn. Zu anderen Zeiten war er so ausgeglichen und tüchtig, wie man nur sein konnte, und ich dankte Gott im Stillen, dass dieser Morgen dazugehörte.
Wir brauchten Dogger jetzt mehr denn je.
Hier und da standen Grüppchen von Dorfbewohnern auf dem Bahnsteig. Sie hielten respektvoll Abstand, unterhielten sich gedämpft und respektierten ansonsten unsere Privatsphäre. Eine größere Gruppe hatte sich um unsere Köchin, Mrs. Mullet, und ihren Gatten Alf geschart, als könnten sie auf diese Weise gleichsam wie durch Zauberei zu Mitgliedern unseres Haushalts werden.
Als der große Zeiger sich der Zwölf näherte, verstummten plötzlich alle, als hätten sie sich abgesprochen, und eine überirdische Stille senkte sich über den Bahnhof und seine ländliche Umgebung. Es war, als hätte jemand eine riesige Glasglocke über die Landschaft gestülpt und die ganze Welt hielte den Atem an. Sogar der Gesang der Nachtigall drüben im Wald riss jäh ab.
Die Luft war elektrisch aufgeladen, wie es oft vorkommt, wenn ein Zug sich nähert, aber noch nicht in Sicht ist.
Die Dorfbewohner traten beklommen von einem Fuß auf den anderen, und der Hauch unserer vereinten Atemzüge glich einem leisen Seufzer in der lauen englischen Luft.
Und dann, endlich, nach einer scheinbar nicht enden wollenden Stille, erschien am Horizont die Rauchwolke der Lokomotive.
Die Wolke kam näher und näher und brachte Harriet – meine Mutter – nach Hause.
Mir blieb die Luft weg, als die blinkende Lokomotive schnaufend in den Bahnhof einfuhr und quietschend zum Stehen kam.
Der Zug war nicht lang. Er bestand nur aus der Lokomotive und fünf, sechs Waggons. Einen Augenblick lang ruhte er sich in der Bedeutsamkeit seines wirbelnden Dampfes aus. Eine seltsame kleine Atempause entstand.
Dann stieg ein Schaffner aus dem letzten Wagen und blies dreimal kräftig in seine Trillerpfeife.
Die Türen glitten auf, und im nächsten Moment wimmelte der Bahnsteig von Uniformierten: Soldaten mit funkelnden Orden und gestutzten Schnurrbärten.
Sie bildeten rasch zwei Reihen und standen stramm.
Ein hochgewachsener, braun gebrannter Mann – der anscheinend ihr Vorgesetzter war, denn sein Brustkasten war mit Orden und bunten Bändern geradezu gepflastert – marschierte im Stechschritt auf Vater zu und salutierte so zackig, dass seine Hand wie eine Stimmgabel nachvibrierte.
Vater wirkte benommen, aber er nickte immerhin.
Aus den übrigen Waggons ergoss sich nun eine Schar Männer mit schwarzen Anzügen und steifen runden Hüten auf den Bahnsteig. Sie waren mit Spazierstöcken und zusammengeklappten Regenschirmen ausgerüstet. Auch eine Handvoll Frauen war darunter. Sie trugen strenge Kostüme, Hüte und Handschuhe, einige waren sogar in Uniform. Eine von ihnen, eine attraktive, aber furchteinflößende Dame in der Uniform der Royal Air Force sah so martialisch aus und hatte so viele Streifen am Ärmel, dass sie gut und gern Generalleutnant hätte sein können. In der langen Geschichte des Bahnhofs von Buckshaw war der Bahnsteig gewiss noch nie von einem solchen Menschensortiment bevölkert gewesen.
Zu meiner Überraschung entpuppte sich eine der Kostümträgerinnen als Vaters Schwester, Tante Felicity. Sie umarmte erst Feely, dann Daffy, dann mich und nahm dann ohne ein Wort neben Vater Aufstellung.
Auf einen knappen Befehl hin marschierten die beiden Soldatenreihen zur Spitze des Zuges, und die breite Tür des Gepäckwagens wurde aufgeschoben.
Weil die Sonne so hell schien, war es schwer, in dem finsteren Wageninneren etwas zu erkennen. Anfangs sah ich nur ein Dutzend weiße Handschuhe scheinbar körperlos durch die Dunkelheit huschen.
Dann glitt, ja schwebte eine längliche Holzkiste ins Freie und wurde von der Doppelreihe der Soldaten in Empfang genommen. Die Männer hoben die Kiste auf die Schultern und standen einen Moment lang stocksteif da wie Schnitzfiguren, die Augen geradeaus gerichtet.
Ich konnte den Blick nicht von der Kiste wenden.
Es war ein Sarg. Jetzt, da er das Dämmerlicht des Gepäckwaggons verlassen hatte, glänzte er kalt in der grellen Sonne.
In dem Sarg lag Harriet. Harriet.
Meine Mutter.
2
Was dachte ich? Was fühlte ich?
Das wüsste ich auch gern.
Trauer vielleicht, dass unsere Hoffnungen ein für alle Mal zunichte waren? Erleichterung, dass Harriet endlich heimgekehrt war?
Ihr Sarg hätte mattschwarz sein sollen. Mit kalt funkelnden Silberbeschlägen, auf denen verhüllte Urnen und todtraurige Engelchen dargestellt waren.
Stattdessen war er aus sattbraunem Eichenholz getischlert, dessen Lack so obszön glänzte, dass mir die Augen wehtaten. Ich konnte den Anblick kaum ertragen.
Seltsamerweise musste ich an den Schluss von Mrs. Nesbits Roman Die Eisenbahnkinder denken, wo sich Bobbie auf dem Bahnsteig in die Arme ihres zu Unrecht ins Gefängnis gesperrten Papas wirft.
Doch für mich war kein solch versöhnliches Ende vorgesehen und für Vater, Feely und Daffy genauso wenig. Nein, ein Happy End blieb uns versagt.
Ich schielte hilfesuchend zu Vater hinüber, doch auch er stand wie erstarrt da, als sei er in seinen ganz persönlichen Gletscher eingeschlossen, jenseits aller Trauer und aller Gefühlsausbrüche, als nun der Union Jack, die britische Flagge, über den Sarg gebreitet wurde.
Alf Mullets Hand schnellte salutierend an die Schläfe und verharrte dort.
Daffy verpasste mir einen Rippenstoß und deutete verstohlen mit dem Kinn auf das andere Ende des Bahnsteigs.
Dort stand ein wenig abseits von den anderen ein korpulenter älterer Herr im schwarzen Anzug. Ich erkannte ihn auf Anhieb.
Als sich die Träger nun gemessenen Schrittes und unter ihrer Last gebeugt in Bewegung setzten, nahm er seinen schwarzen Hut ab und behielt ihn in der Hand.
Es war Winston Churchill.
Was in aller Welt führte den ehemaligen Premierminister nach Bishop’s Lacey?
Ganz allein stand er dort und schaute zu, wie meine Mutter in der allgemeinen Grabesstille zu einem motorisierten Leichenwagen getragen wurde, der wie aus dem Nichts aufgetaucht war.
Churchill schaute zu, wie der Sarg, dem ein Offizier mit gezücktem Degen voranschritt, an Vater vorbeigetragen wurde, an Feely, an Daffy und zu guter Letzt an mir. Dann erst trat er neben Vater.
»Sie war England, verflucht noch mal«, knurrte er.
Wie jemand, der aus einem Traum erwacht, hob Vater langsam den Blick und richtete ihn auf Churchills Gesicht.
Erst nach einer ganzen Weile erwiderte er: »Sie war mehr als das, Herr Premierminister.«
Churchill nickte und fasste Vater am Ellbogen. »Wir können es uns nicht leisten, einen de Luce zu verlieren, Haviland«, sagte er.
Wie meinte er das?
So standen sie Seite an Seite wie zwei Besiegte, so schien es mir, Brüder in einem Geiste, den ich nicht begriff, ja, der meine Vorstellungskraft weit überstieg.
Als Mr. Churchill erst Vater, dann Feely, dann Daffy und sogar Tante Felicity die Hand geschüttelt hatte, kam er schließlich auch zu mir.
»Nun, junge Dame? Hast du mittlerweile auch eine Vorliebe für Fasanensandwiches entwickelt?«
Diese Frage! Wortwörtlich!
Ich hatte sie schon einmal gehört! Nein, nicht gehört – gesehen!
Mit einem Mal standen meine Haarwurzeln auf Zehenspitzen.
Churchills blauer Blick durchbohrte mich, als könnte er geradewegs in meine Seele schauen.
Was meinte er damit? Und was für eine Antwort erwartete er von mir?
Peinlicherweise wurde ich rot. Mehr brachte ich nicht zustande.
Mr. Churchill schaute mich noch einmal eindringlich an, dann ergriff er meine Hand und drückte sie sanft. Er hatte auffallend lange Finger.
»Ja«, sagte er, als führte er Selbstgespräche. »Ja, ganz bestimmt.«
Mit diesen Worten ließ er mich stehen und ging davon, den Bahnsteig entlang, bahnte sich einen Weg durch die Dorfbewohner und nickte ihnen feierlich nach rechts und links zu, bis er schließlich in seinen wartenden Wagen stieg.
Auch wenn er schon lange nicht mehr in Amt und Würden war, so besaß der untersetzte kleine Mann mit dem Bulldoggengesicht und den durchdringenden, großen blauen Augen doch immer noch eine überwältigende Ausstrahlung.
Schon stand Daffy neben mir und raunte mir ins Ohr: »Was hat er gesagt?«
»Er hat mir sein Beileid ausgesprochen«, log ich. Warum, wusste ich selbst nicht, aber es kam mir richtig vor. »Herzliches Beileid – das war alles.«
Daffy bedachte mich mit ihrem typischen Giftblick.
Wie war es nur möglich, sinnierte ich, dass wir beiden Schwestern einander sogar in Gegenwart unserer toten Mutter wegen einer harmlosen Schwindelei schier an die Gurgel gingen? Es war absurd, aber anscheinend nicht zu ändern. Wahrscheinlich ist das Leben nun mal so.
Und der Tod.
In einem Punkt war ich mir jedoch ganz sicher: Ich wollte nach Hause. Mich in meinem Zimmer einschließen und allein sein.
Vater war damit beschäftigt, allen Leuten die Hand zu schütteln, die ihm ihr Beileid bekunden wollten. Ein klagendes »ei… ei… ei…« erfüllte die Luft.
»Mein Beileid, Colonel de Luce … mein Beileid … mein Beileid«, hieß es immer und immer wieder in den verschiedensten Tonlagen. Ein Wunder, dass Vater nicht den Verstand verlor.
Fiel denn niemandem etwas Originelleres ein?
Von Daffy wusste ich, dass die englische Sprache schätzungsweise eine halbe Million Wörter umfasst. Bei dieser Auswahl hätte doch wenigstens einer der Anwesenden eine andere Formulierung als das abgedroschene »Mein Beileid« zustande bringen können.
Ich dachte noch darüber nach, als sich ein großer Mann in einem für dieses schöne Wetter viel zu langen und dicken Mantel aus der Menge löste und schnurstracks auf mich zukam.
»Miss de Luce?«, fragte er mit verblüffend sanfter Stimme.
Ich war es nicht gewohnt, als »Miss de Luce« angesprochen zu werden. Diese Anrede war üblicherweise für Daffy und Feely reserviert – und für Tante Felicity.
»Ja, ich bin Flavia de Luce«, entgegnete ich. »Und wer sind Sie?«
Dogger hatte mir eingeschärft, diese Frage sofort zu stellen, wenn mich ein Fremder ansprach. Ich linste unauffällig zu ihm hinüber. Er war Vater nicht von der Seite gewichen.
»Ich bin ein Freund«, sagte der Mann. »Ein Freund der Familie. Ich muss mit Ihnen reden.«
Ich trat einen Schritt zurück. »Tut mir leid, aber …«
»Bitte. Es ist lebenswichtig.«
Lebenswichtig? Wer in einer Alltagskonversation so ein Wort benutzte, konnte kein Dorfbewohner sein.
»Ich weiß nicht …«, sagte ich zögerlich.
»Richten Sie Ihrem Vater bitte aus, dass der Wildhüter in Gefahr ist. Er wird wissen, was gemeint ist. Ich muss ihn unbedingt sprechen. Richten Sie ihm aus, das Nest des Colchicus wird angegriff…«
Plötzlich weiteten sich seine Augen – staunend vielleicht oder eher erschrocken? Was oder wen hatte er hinter mir erblickt?
»Komm endlich, Flavia. Du hältst uns alle auf.«
Es war meine Schwester Feely. Sie nickte dem Fremden höflich zu, dann packte sie mich am Arm und zerrte übertrieben unsanft daran.
»Ich komme gleich«, erwiderte ich, duckte mich seitlich weg und entwand mich ihrem Griff.
Dogger hielt bereits den Wagenschlag von Harriets altem Rolls-Royce Phantom II auf. Er hatte das Automobil so dicht am Bahnsteig geparkt, wie es ging. Vater war auf halbem Weg zum Wagen. Er schlurfte mitleiderregend und hielt den Kopf gesenkt.
Erst in diesem Augenblick wurde mir richtig klar, was für ein vernichtender Schlag das Ganze für ihn sein musste.
Er hatte Harriet ein zweites Mal verloren.
»Flavia!«
Das war wieder Feely. Ihre blauen Augen blitzten ungeduldig. Sie fauchte mich an: »Warum musst du immer so …«
Das Pfeifen der Dampflokomotive übertönte sie, aber ich las das unverschämte Ende des Satzes von ihren Lippen ab.
Der Zug setzte sich träge in Bewegung. Bei der Vorbesprechung hatte uns der Bestattungsunternehmer erklärt, dass der Zug, sobald wir den Bahnhof verließen, zu einem nicht mehr genutzten Betriebsbahnhof nördlich von East Finching weiterfahren, dort wenden und dann nach London zurückkehren würde. Mit einem Leichenzug rückwärts zu fahren verstieß laut Mr. Sowerby von Sowerby & Söhne erstens gegen den Ehrenkodex der Bestatterzunft und brachte zweitens »außerordentliches Pech«, wie er sich ausgedrückt hatte.
Unterdessen schleifte mich Feely – im wahrsten Sinne des Wortes – in Richtung Rolls-Royce.
Ich versuchte vergeblich, mich loszureißen. Sie hatte die Finger in meinen Oberarm gekrallt, und ich stolperte keuchend hinter ihr her.
Da ertönte vom Bahnhof plötzlich ein lauter Ruf. Erst dachte ich, die Dorfbewohner würden dagegen protestieren, dass Feely mich so grausam misshandelte, dann sah ich die Leute an der Bahnsteigkante zusammenströmen.
Der Schaffner trillerte wie verrückt auf seiner Pfeife, jemand schrie, und der Zug bremste scharf. Dampfwolken quollen unter den Rädern hervor. Ich nutzte die Gelegenheit, mich zu befreien, und drängte mich unter Einsatz meiner Ellbogen durch die Menge, vorbei an der Offizierin, die wie angewurzelt dastand.
Auch die Dörfler standen wie erstarrt, viele hatten die Hände vor den Mund geschlagen.
»Jemand hat ihn geschubst«, rief eine Frauenstimme hinten in der Menge.
Vor meinen Schuhspitzen, als wollte sie danach greifen, ragte eine Hand unter den Rädern des hintersten Waggons empor. Ich kniete mich hin. Die gespreizten Finger waren mit frischer Erde beschmiert und streckten sich nach einer Hilfe aus, die nie mehr kommen würde. Das fast unanständig nackte Handgelenk war mit goldblonden Härchen bedeckt, die in der Zugluft unter dem Waggon leise hin und her wehten.
Der Geruch von erhitzter Wagenschmiere stieg mir in die Nase, doch er mischte sich mit einem strengen Kupferaroma. Wer diesen Geruch kennt, vergisst ihn nicht mehr.
So riecht Blut.
Die noch zugeknöpfte Ärmelmanschette war bis unter den reglosen Ellbogen hochgeschoben. Der Mantel war viel zu lang und dick für dieses schöne Wetter.
3
Der Rolls-Royce kroch im Schneckentempo hinter dem Leichenwagen her.
Vom Bahnhof bis zu uns nach Buckshaw war es zwar nur eine Meile, aber ich ahnte, dass diese traurige Fahrt ewig dauern würde.
Der analytische Teil meines Hirns hätte sich gern damit befasst, aus dem Geschehen am Bahnsteig schlau zu werden: dem gewaltsamen Tod eines Fremden unter den Zugrädern.
Doch mein primitives Reptiliengehirn wollte das nicht zulassen und bombardierte mich mit Ausreden, die nur allzu vernünftig klangen.
Diese kostbaren Stunden gebühren Harriet, mahnte es. Du darfst sie ihr nicht rauben. Das bist du dem Andenken deiner Mutter schuldig, Flavia. Harriet … nur an sie darfst du jetzt denken.
Ich ließ mich in die bequemen Lederpolster zurücksinken und gestattete meinen Gedanken, zu jenem Tag vor einer Woche in meinem Laboratorium zurückzukehren …
Ihre ertrunkenen Gesichter sehen nicht so weiß und fischig aus, wie man erwarten könnte. Sie treiben im blutroten Licht dicht unter der Oberfläche und haben eher die Farbe fauliger Rosen.
Trotz allem, was geschehen ist, lächelt sie noch. Sein Gesicht hat einen bestürzend jungenhaften Ausdruck.
Zwischen den beiden ringeln sich bis auf den Grund der Flüssigkeit schwarze Bänder, die wie Seetangwedel ineinander verschlungen sind.
Ich tunke den Zeigefinger ins Wasser und male ihre Initialen:
HDL
Der Mann und die Frau sind einander so eng verbunden, dass dieselben drei Buchstaben für sie beide stehen: Harriet de Luce und Haviland de Luce.
Meine Mutter und mein Vater.
Ich war durch einen seltsamen Zufall an die Bilder gekommen.
Der Dachboden von Buckshaw ist eine riesige oberirdische Unterwelt. Dort lagert das ganze Gerümpel, der ausgediente Kram, die traurigen, verstaubten Überreste all jener, die in den letzten Jahrhunderten in diesem Haus gewohnt und gewirkt haben.
Auf dem vor sich hin modernden Betstuhl zum Beispiel, auf dem die zum Jähzorn neigende Georgina de Luce einst mit frommer Miene unter ihrer Puderperücke gekniet und den geflüsterten Beichten ihrer verschüchterten Kinder gelauscht hatte, thronte das verbogene Wrack des selbst gebauten Segelfliegers, mit dem sich ihr unseliger Enkel Leopold von den Zinnen des Ostflügels in die Lüfte geschwungen hatte, um im nächsten Augenblick auf dem steinhart gefrorenen Boden des Visto aufzuschlagen, womit dieser Zweig der Familie ein jähes Ende nahm. Wenn man genau hinsah, erkannte man noch die oxidierten Blutflecken auf den zerbrechlichen, mit Leinwand bespannten Flügeln.
In einer anderen Ecke waren Porzellannachttöpfe dermaßen hoch aufgetürmt, dass sich der Stapel zu einer rückgratähnlichen Kurve bog. Noch immer hing ein schwacher, aber unverkennbarer Urinhauch in der muffigen Luft.
Tische, Stühle und Kaminsimse standen traulich Seite an Seite mit Uhren aus feuervergoldeter Bronze, griechischen Vasen in leuchtendem Orange und Schwarz, ungeliebten Schirmständern und dem traurig dreinblickenden Kopf einer schlampig ausgestopften Gazelle.
Auf diesen Friedhof ausrangierten Plunders hatte ich mich nach Vaters Offenbarung instinktiv geflüchtet.
Ich war die Treppe hochgerannt und hatte mich in einer Ecke auf den Boden fallen lassen. Weil ich nicht über das Gehörte nachdenken wollte, hatte ich mechanisch einen jener unsinnigen Kinderreime aufgesagt, zu denen wir in Zeiten großer Anspannung unsere Zuflucht nehmen, wenn wir uns keinen Rat mehr wissen.
»A war ein Arzt, der Kranken Heilung bot,
B war ein Bäcker, der Brot und Brötchen buk,
C war ein Clown, der lachte und weinte …«
Weinen? Nein, ich würde jetzt nicht weinen, verdammt noch mal! Das kam nicht in die Tüte!
Zum Teufel mit den Bäckern und Clowns! Da sagte ich doch lieber mein eigenes Gift-ABC auf.
»A wie Arsen, in die Suppe gerührt,
B wie Blausäure, die zum Herzstillstand führt …«
Ich war eben bei »C« wie »Curare« angekommen, als ich sah, wie etwas hinter einen französischen Schrank mit geschnitztem Aufsatz huschte.
Eine Maus? Oder vielleicht eine Ratte?
Gewundert hätte es mich nicht. Wie schon gesagt, der Dachboden auf Buckshaw war der reinste Müllabladeplatz. Ratten fühlten sich dort bestimmt genauso zu Hause wie ich.
Ich stand auf und schaute hinter den Schrank, aber da war nichts.
Daraufhin öffnete ich eine der dunkel gebeizten Türen des Monstrums und entdeckte sie: schwarze Transportkoffer – gleich zwei vom selben Modell. Sie waren in die hinterste Ecke geschoben, als hätte sie jemand verstecken wollen.
Ich griff in den Schrank und zog meine Fundstücke aus der Finsternis ins Schummerlicht.
Sie waren mit genarbtem Leder bezogen und besaßen glänzend vernickelte Schlösser. Die Schlüssel waren zum Glück mit ordinärer Schnur an den Handgriffen festgebunden.
Ich schloss den ersten Koffer auf und öffnete den Deckel.
Schon beim Anblick der Eisblumenlackierung des Metalls und der verstellbaren Krakenarme, die zusammengeklappt in ihren mit Samt ausgeschlagenen Fächern lagen, wusste ich, worum es sich handelte: um einen Filmprojektor.
Mr. Mitchell, der Inhaber des Fotostudios in Bishop’s Lacey, besaß ein ganz ähnliches Gerät. Ab und zu führte er darauf im Gemeindesaal von St. Tankred immer dieselben langweiligen Filme vor.
Natürlich war sein Projektor größer und mit einem Lautsprecher für den Ton ausgestattet.
Ich klappte den zweiten Koffer auf.
Auch er enthielt ein technisches Gerät. Es war kleiner als der Projektor und hatte an der Seite eine Kurbel mit Federwerk und einen drehbaren Vorsatz mit mehreren Linsen.
Eine Filmkamera.
Ich hob sie vors Auge und spähte durch den Sucher. Dann bewegte ich die Kamera langsam von rechts nach links, als würde ich etwas aufnehmen.
»Buckshaw«, verkündete ich im Tonfall der Wochenschau. »Seit undenklichen Zeiten das ehrwürdige Heim der Familie de Luce … ein zweigeteiltes Haus … ein entzweites Haus.«
Dann stellte ich die Kamera unvermittelt ab, womöglich auch ziemlich unsanft. Ich hatte plötzlich keine Lust mehr, damit weiterzuspielen.
Dabei fiel mein Blick auf die kleine Anzeige am Gehäuse. Die Skala reichte von null bis fünfzig Meter, und die Nadel stand kurz vor – aber nicht auf! – der Fünfzig.
In der Kamera war noch ein Film – nach so vielen Jahren!
Wenn ich nicht völlig danebenlag, waren ungefähr fünfundvierzig Meter des Streifens belichtet.
Belichtet, aber nicht entwickelt!
Das Herz klopfte mir bis zum Hals.
Wenn mein Verdacht begründet war, enthielt diese Kamera womöglich unbekannte Bilder meiner verstorbenen Mutter Harriet.
Es dauerte keine Stunde, dann hatte ich in meinem Chemielabor im ersten Stock des verlassenen Ostflügels von Buckshaw die erforderlichen Vorbereitungen getroffen. Das Labor war gegen Ende des viktorianischen Zeitalters von Tarquin de Luces Vater für seinen Sohn eingerichtet worden. Tarquin war Harriets Onkel gewesen, und sein spektakulärer Nervenzusammenbruch in Oxford sorgte noch heute, nach über fünfzig Jahren, für Getuschel in jenen heiligen Hallen.
In diesem sonnendurchfluteten Raum im obersten Stockwerk des Hauses hatte Onkel Tar gelebt und gearbeitet, und zu guter Letzt war er auch dort gestorben. Seine Forschungen über den Zerfall erster Ordnung von Stickstoffpentoxid waren angeblich für die Zerstörung der japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki mitverantwortlich gewesen.
Vor ein paar Jahren, als ich mich an einem verregneten Tag zu einer kleinen Entdeckungsreise aufgemacht hatte, war ich auf dieses Königreich voller eingestaubter Glasbehälter gestoßen und hatte es sogleich beschlagnahmt. Indem ich Onkel Tars Notizbücher studierte und viele der Experimente aus seiner umfangreichen Fachbibliothek nachmachte, hatte ich mich im Lauf der Zeit selbst zu einer ausgesprochen kompetenten Chemikerin ausgebildet.
Allerdings war mein Spezialgebiet nicht der Zerfall von Stickstoffpentoxid. Ich interessierte mich eher für traditionellere Gifte.
Ich zog die Kamera unter meinem Pullover hervor. Dort hatte ich sie vorsichtshalber versteckt, für den Fall, dass ich beim Abstieg vom Dachboden von einer meiner Schwestern abgefangen wurde. Feely war im Januar achtzehn geworden und somit noch ein Weilchen sieben Jahre älter als ich. Daffy – wir hatten am gleichen Tag Geburtstag – wurde bald vierzehn und ich dann eben zwölf.
Wir waren zwar Schwestern, aber deswegen noch lange keine Freundinnen. Im Gegenteil. Wir waren unablässig damit beschäftigt, uns immer neue Methoden auszudenken, wie wir einander piesacken konnten.
In der kleinen Dunkelkammer hinter dem Labor nahm ich eine braune Glasflasche aus dem Regal. METOL stand in Onkel Tars Spinnenhandschrift auf dem Etikett.
Wobei das natürlich nur ein Fantasiename für das gute alte Methylaminophenolsulfat war.
Ich hatte als Erstes ein mit dunklen Flecken übersätes Handbuch für Fotografen durchgeblättert. Einen Film zu entwickeln schien nicht weiter schwer zu sein.
Schritt eins: Der Entwickler.
Ich zog den verklebten Pfropfen aus der Flasche und goss mit angewidertem Gesicht probehalber ein paar Milliliter in einen Messbecher. Zwanzig Jahre im Regal hatten ihren Tribut gefordert. Das Metol war oxidiert und hatte sich in eine scharf riechende Brühe verwandelt, die aussah wie ein Kaffeerest vom Vorabend.
Meine Grimasse verwandelte sich in ein Grinsen.
»Haben wir irgendwo Kaffee?« Mit gelangweilter Miene schlenderte ich in die Küche.
»Kaffee?«, wiederholte Mrs. Mullet erstaunt. »Was willst du denn mit Kaffee? Das ist kein Getränk für kleine Mädchen. Davon bekommst du bloß Bauchgrimmen.«
»Ich dachte, falls wir Besuch bekommen, freut der Betreffende sich bestimmt über eine Tasse.«
Man hätte denken können, ich hätte nach Champagner gefragt.
»Und wen erwartest du, bitte schön?«
»Dieter«, log ich.
Dieter Schrantz war ein ehemaliger deutscher Kriegsgefangener. Er arbeitete auf der Culverhouse Farm und hatte sich kürzlich mit Feely verlobt.
»Ist ja auch egal«, sagte ich. »Dann muss er sich eben mit Tee begnügen. Haben wir denn noch Kekse?«
»In der Speisekammer. In der hübschen Dose mit Windsor Castle drauf.«
Ich grinste dämlich und verschwand in der Speisekammer. Meine Erinnerung hatte mich nicht getrogen. Ganz hinten auf einem hohen Regal stand ein Glas mit gemahlenem Maxwell-House-Kaffee. Ein Geschenk – trotz der Rationierung – von Carl Pendracka, der auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Leathcote stationiert war. Trotz Vaters unerschütterlicher Überzeugung, dass Carl ein Nachfahre von König Artus war, hatte Dieter beim Wettstreit um Feelys zarte Hand das Rennen gemacht.
Mit einem stummen Gebet dankte ich Gott dafür, dass altmodische Kleidung immer so schlabberig war, verstaute das Kaffeeglas unter meinem Pulli, dazu einen Großküchenschneebesen, klemmte mir ein paar Empire-Kekse zwischen die Zähne und verließ die Speisekammer wieder.
Mit gekrümmtem Rücken schlich ich aus der Küche und nuschelte über die Schulter: »Danke, Mrs. M.«
Als ich hinter meiner Labortür in Sicherheit war, schüttete ich den Kaffee in einen Papierfilter, den ich in einen Glastrichter gestellt hatte. Dann zündete ich einen Bunsenbrenner an und wartete darauf, dass das destillierte Wasser im Teekessel kochte.
Chemisch gesehen, geht es bei der Filmentwicklung schlicht darum, die Silberhalogenidkristalle zu Silber zu reduzieren. Wenn Metol das fertigbrachte, warum dann nicht auch Koffein? Vanilleextrakt hätte diesen Zweck ebenfalls erfüllt, aber wenn ich Mrs. Mullets Vanilleextrakt gemopst hätte, hätte sie mich einen Kopf kürzer gemacht. Da war der gehamsterte Kaffee doch die bessere Lösung.
Als das Wasser zwei Minuten gekocht hatte, maß ich drei Tassen ab und goss sie über das Kaffeepulver. Es roch beinahe trinkbar.
Ich rührte die braune Flüssigkeit so lange um, bis der Schaum verschwunden war, und als das Ganze einigermaßen abgekühlt war, gab ich sieben Teelöffel Natriumcarbonat dazu – gutes, altes Bleichsoda.
Der einladende Kaffeeduft verwandelte sich sofort in einen Gestank, der von Sekunde zu Sekunde beißender wurde. Genau genommen stank es, als hätte der Blitz in ein vergammeltes Caféhaus im Elendsviertel der Hölle eingeschlagen. Ich war froh, den Raum verlassen zu können, und sei es auch nur für ein paar Minuten.
Bei dem nun folgenden kurzen Ausflug auf den Dachboden holte ich mir die emaillierte Bettpfanne, die ich unter den Hinterlassenschaften der Familie de Luce entdeckt hatte. Dann konnte es weitergehen.
Schließlich räumte ich alles, was ich brauchte, in die Dunkelkammer und schloss die Tür hinter mir ab.
Ich knipste die Notbeleuchtung an. Ein roter Blitz – ein leises Popp.
Mist! Die verflixte Birne war durchgebrannt.
Ich schloss die Tür wieder auf und machte mich auf die Suche nach einer Ersatzbirne.
In regelmäßigen Abständen schimpften wir darüber, dass Vater Dogger angewiesen hatte, fast alle Glühbirnen auf Buckshaw durch solche mit nur zehn Watt zu ersetzen, weil das Strom sparte. Die Einzige, die sich nicht weiter daran störte, war Feely. Ihr genügte ein trübes Flackerlicht, um Tagebuch zu schreiben und ihr pickliges Gesicht im Spiegel zu inspizieren.
»Strom sparen hilft Siegen«, pflegte sie zu sagen, als sei der Krieg nicht schon seit sechs Jahren vorbei gewesen. »Außerdem ist es so viel romantischer.«
Ich musste also nicht lange überlegen, welche Birne ich stibitzen sollte.
Bevor man bis siebenundachtzig zählen konnte – dafür garantiere ich, denn ich zählte in Gedanken mit –, war ich wieder in meinem Labor. Meine Beute bestand aus der Birne aus Feelys Nachttischlampe sowie einem Fläschchen »Wo brennt’s?«-Nagellack, mit dem sie neuerdings ihre Finger zu verunstalten pflegte.
Wenn die Natur gewollt hätte, dass wir knallrote Fingerspitzen haben, hätte sie uns mit dem Blut auf der Haut erschaffen.
Ich malte die Birne mit dem Nagellack an, pustete wie ein hechelnder Wolf darauf, bis die Schicht trocken war, und verpasste der Birne gleich noch einen zweiten Anstrich, damit auch wirklich jeder Quadratmillimeter Glas abgedeckt war.
Bei meinem heiklen Vorhaben konnte ich nicht riskieren, dass auch nur ein einziger weißer Lichtstrahl durch den roten Lack drang.
Dann schloss ich mich wieder in der Dunkelkammer ein. Ich betätigte den Lichtschalter und wurde mit einem matten roten Schein belohnt.
Perfekt!
Ich drehte ein paar Mal an der Kurbel der Kamera, dann drückte ich auf den Knopf. In dem Gehäuse surrte es knatternd, als sich der Filmstreifen in Bewegung setzte. Nach nicht mal zehn Sekunden schlug das lose Ende träge gegen die Spule.
Ich öffnete den Verschluss, klappte das Seitenteil des Gehäuses auf und nahm die volle Spule heraus.
Jetzt wurde es knifflig.
Eine Umdrehung nach der anderen wickelte ich den Film von der Spule auf den Schneebesen. Die Enden klemmte ich mit Büroklammern fest.
Die Hälfte meines Kaffee-»Entwicklers« hatte ich schon vorher in die Bettpfanne gekippt. Nun tauchte ich den Schneebesen hinein und drehte ihn langsam … ganz, ganz langsam … wie ein Hähnchen auf dem Grillspieß.
Das Thermometer im Kaffeebad zeigte exakt zwanzig Grad Celsius.
Die im Fotografenhandbuch vorgeschriebenen zwölf Minuten zogen sich wie zäher Schleim. Als ich, den Blick auf die Uhr geheftet, wartend dastand, fiel mir ein, dass man in der Frühzeit der Fotografie Gallussäure, C7H6O5, als Entwickler verwendet hatte. Diese Flüssigkeit wurde in kleinen Mengen aus Galläpfeln gewonnen, Wucherungen, die auf den Zweigen der Galleiche, auch Färbereiche genannt, wachsen, und zwar überall dort, wo eine Gallwespe ihre Eier abgelegt hatte.
Eigentlich seltsam, dass die gleiche Gallussäure, mit Wasser verdünnt, früher auch als Gegenmittel bei Strychninvergiftungen verwendet wurde.
Was für ein schöner Gedanke, dass wir ohne die Weibchen der Gallwespe weder die Fotografie erfunden noch irgendwelche reichen Erbonkel vor Mordanschlägen gerettet hätten.
Ob auf dem Film, den ich in der Kamera entdeckt hatte, überhaupt noch irgendwelche latenten Bilder zu finden waren? Es war doch interessant, dass man mit demselben Wort – »latent« – sowohl die unsichtbaren, noch unentwickelten Gestalten und Formen auf Filmmaterial bezeichnete als auch gerade noch sichtbare Fingerabdrücke.
War auf dem Film überhaupt noch etwas zu sehen? Oder zeigte er nach so vielen sengend heißen Sommern und klirrend kalten Wintern auf dem Dachboden nur noch enttäuschenden grauen Nebel?
Gespannt beobachtete ich, wie sich auf dem Filmstreifen, zum Greifen nah, wie durch Zauberei Hunderte winziger Negative abzeichneten.
Die einzelnen Bilder waren jedoch viel zu klein, um daraus auf den Inhalt des gesamten Films zu schließen. Er würde seine Geheimnisse – falls vorhanden – erst nach der vollständigen Entwicklung preisgeben.
Zwölf Minuten waren vergangen, aber mir kam es vor, als seien die Bilder immer noch nicht fertig. Offenbar wirkte das Kaffeegebräu langsamer als Metol. Also musste ich den Schneebesen so lange weiterdrehen, bis die Bilder so dunkel waren wie normale Negative.
Noch einmal zwölf Minuten verstrichen, und mir wurde allmählich die Hand lahm.
Wenn es um Chemie geht, ist Ungeduld keine Tugend. Trotzdem ist eine halbe Stunde viel zu lang für irgendeine Betätigung, schon gar für eine, die keinen Spaß macht.
Als die Bilder endlich zufriedenstellend aussahen, war ich kurz davor, laut zu schreien.
Aber ich war noch nicht fertig. Noch lange nicht. Das hier war nur der erste Schritt.
Es folgte das erste Wässern: fünf Minuten unter laufendem Hahn.
Das Warten war die reinste Folter. Am liebsten hätte ich den halb entwickelten Film einfach in den Projektor gesteckt und es drauf ankommen lassen.
Doch nun war das Bleichbad an der Reihe. Ich hatte bereits einen viertel Teelöffel Kaliumpermanganat in einen Viertelliter Wasser eingerührt und eine zweite Lösung aus Schwefelsäure und etwas weniger Wasser hinzugefügt.
Wieder musste ich fünf Minuten warten und den Filmstreifen langsam in der Flüssigkeit drehen.
Beim zweiten Wässern zählte ich langsam sechzig Sekunden ab.
Das Klärbad: fünf Teelöffel Kaliumdisulfit in einem Viertelliter Wasser aufgelöst.
Jetzt konnte ich gefahrlos die Deckenbeleuchtung einschalten.
Das opake Silberhalogenid, also jene Stellen des Films, die später schwarz werden würden, war inzwischen buttergelb. Das Ganze sah aus, als hätte ich mit Mrs. Mullets ungenießbarem Senf auf einem Streifen Glas herumgeschmiert.
In der Draufsicht wirkten die Bilder immer noch wie Negative. Hielt ich sie aber vor die Deckenlampe, erschienen sie auf einmal als Positive.
Ich konnte schon unser Haus erkennen: aus weiter Entfernung aufgenommen, ein gelbes, gealtertes Buckshaw wie eine Behausung aus einem Traum.
Jetzt kam die Umkehrbelichtung.
Ich hielt den Schneebesen am ausgestreckten Arm mit etwa fünfundvierzig Zentimeter Abstand unter die Deckenbeleuchtung und drehte das Gerät dann wieder abgezählte sechzig Sekunden lang. Diesmal benutzte ich allerdings die Abwandlung einer Methode, die ich bei den Beatmungsübungen im Erste-Hilfe-Kurs bei den Pfadfinderinnen gelernt hatte, bevor ich (zu Unrecht) aus dem Verein hinausgeworfen wurde.
»Eins Blau-säu-re, zwei Blau-säu-re, drei Blau-säu-re« und so weiter.
Die Minute war im Nu verflogen.
Ich wickelte den Filmstreifen von dem Schneebesen ab, drehte ihn um und belichtete die Rückseite auf die gleiche Art.
Dann war wieder Kaffeezeit. Das Handbuch bezeichnete diesen Vorgang als »Zweitentwicklung«. Hierbei sollte sich alles, was noch gelb war, schwarz färben.
Noch einmal sechs Minuten Tunken und Drehen, damit auch wirklich alle Stellen des Films gleichmäßig von der stinkenden Brühe benetzt wurden.
Das nächste Wässern kam mir, obwohl es nur sechzig Sekunden dauerte, wie eine Ewigkeit vor. Meine Arme waren durch die ständige Drehbewegung völlig verkrampft, und meine Hände stanken, als hätte ich sie in … Aber lassen wir das.
Ein Fixierbad erübrigte sich. Das Bleichbad hatte das reduzierte Silber bereits aus dem ersten Entwicklungsvorgang entfernt, und die übrigen Silberhalogenid-Körnchen waren im Klärbad zu elementarem Silber reduziert worden und hatten sich in die schwarzen Partien der Filmbilder verwandelt.
Eigentlich kinderleicht, das Ganze!
Ich ließ den Streifen noch ein paar Minuten in einer flachen Schüssel mit Wasser liegen. Um die Beschichtung zu härten und kratzfest zu machen, hatte ich dem Wasser Alaun zugesetzt.
Dann nahm ich ein Ende des Streifens heraus und betrachtete es durch eine Lupe.
Es verschlug mir den Atem.
Die Bilder waren herzzerreißend scharf: Auf jedem einzelnen sah man Harriet und Vater auf einer Picknickdecke vor der Ruine auf der künstlichen Insel im künstlichen See von Buckshaw sitzen.
Ich knipste die Deckenlampe aus und ließ den Film ins Wasser zurücksinken. Die blutrote Birne war nun wieder die einzige Beleuchtung, nicht, weil es nötig gewesen wäre, sondern weil es mir irgendwie respektvoller vorkam.
Wie schon gesagt – ich malte ihre Initialen in die Wasseroberfläche:
HDL
Harriet und Haviland de Luce. Noch fühlte ich mich dem Anblick ihrer Gesichter in aller Helligkeit nicht gewachsen.
Es wäre mir so vorgekommen, als ob ich sie bespitzelte.
Schließlich zog ich den Filmstreifen ehrfurchtsvoll, ja fast widerwillig aus dem Wasser und wischte ihn mit einem Badeschwamm ab. Ich trug ihn nach nebenan ins Labor und hängte ihn in langen Girlanden zwischen dem gerahmten Periodensystem an der Westwand und dem signierten Foto von Winston Churchill an der Ostwand auf.
Anschließend wartete ich in meinem Zimmer darauf, dass der Filmstreifen trocknete. Aus dem Stapel unter meinem Bett kramte ich eine Schallplatte hervor: Rachmaninows Rhapsodie über ein Thema von Paganini, die passendste Untermalung zum Gedenken an eine große Liebe, die mir einfiel.
Ich zog mein Grammophon auf und setzte die Nadel auf die kreiselnde Schellackscheibe. Als die Musik einsetzte, hockte ich mich, das Kinn auf die angezogenen Knie gestützt, auf die breite Fensterbank. Ich ließ den Blick über den Visto schweifen, jene verwilderte Wiese, auf der Harriet einst ihre de Havilland Gypsy Moth, die Blithe Spirit, festgemacht hatte.
Ich malte mir das Motorengeknatter aus, mit dem sich Harriet in die morgendlichen Dunstschwaden emporschwang, über die Schornsteine von Buckshaw und den künstlichen See mit der Ruine, bis sie in einer Zukunft verschwand, aus der sie nie mehr zurückkehren würde.
Ihr Verschwinden – beziehungsweise ihr Tod, wie wir inzwischen wussten – lag bereits über zehn Jahre zurück. Zehn lange, schwere Jahre, von denen Vater nahezu die Hälfte in japanischer Kriegsgefangenschaft verbracht hatte. Als er endlich zurückkehrte, musste er erfahren, dass er nicht nur seine Frau, sondern außerdem sein ganzes Geld verloren hatte und dass er kurz davor stand, auch noch sein Zuhause zu verlieren.
Buckshaw hatte Harriet gehört, die es wiederum von Onkel Tar geerbt hatte, aber weil sie kein Testament hinterlassen hatte, waren »die Mächte der Finsternis« (wie Vater die grauen Herren von der Königlichen Steuerbehörde einmal genannt hatte) ihm wie die Bluthunde auf den Fersen, als wäre er kein heimgekehrter Kriegsheld, sondern ein entflohener Zuchthäusler.
Und jetzt verfiel das Anwesen. Zehn Jahre der Vernachlässigung, Trauer und Geldknappheit hatten ihre Spuren hinterlassen. Das Familiensilber war nach London geschickt und versteigert, die Ausgaben gekürzt und die Gürtel enger geschnallt worden. Aber es hatte alles nichts genützt, und seit Ostern stand Buckshaw zum Verkauf.
Vater warnte uns schon seit Jahren, dass wir unser Zuhause womöglich von jetzt auf gleich würden verlassen müssen.
Nach einem geheimnisvollen Anruf vor einigen Tagen hatte er uns drei – Feely, Daffy und mich – im Salon zusammengerufen.
Dort hatte er uns eine nach der anderen lange angeschaut, bevor er uns die Neuigkeit mitgeteilt hatte:
»Eure Mutter wurde gefunden.«
Aber nicht nur das: Sie kam nach Hause.
4
Seit jenem Augenblick, das wurde mir jetzt klar, hatte ich die Realität verdrängt. Ich hatte die unumstößlichen Tatsachen im hintersten Winkel meines Bewusstseins in einen Sack gestopft und ihn so fest zugebunden, als säße darin ein wilder Tiger.
Auch wenn es beschämend ist, das zuzugeben – ich hatte mich an die Vergangenheit geklammert, hatte mich bemüht, jeden Morgen in meiner alten Welt aufzuwachen, einer Welt, in der Harriet bequemerweise verschollen war und in der ich zumindest wusste, wo ich stand.
Ich griff nach jeder sich bietenden Gelegenheit, der Veränderung auszuweichen, so wie ein Ertrinkender nach seinen eigenen aufsteigenden Luftblasen greift.
Nicht, dass ich etwas dagegen gehabt hätte, dass Harriet heimgekehrt war. Das natürlich nicht.
Aber wie würde dieser Umstand mein Leben beeinflussen?
Der unverhofft gefundene Film war ein Gottesgeschenk. Wenn ich ihn anschaute, tat sich mir vielleicht ein neues Fenster zur Vergangenheit auf, ein Fenster, durch das ich einen klareren Blick auf die Zukunft erhaschen konnte.
Auch diese Vorstellung gehörte zu den beunruhigenden Gedanken, die mich in letzter Zeit plagten: neu, unausgegoren und noch nicht ganz zuverlässig. Manchmal kam es mir vor, als würde ich mit einem fremden Hirn denken. Es hing damit zusammen, dass ich demnächst zwölf Jahre alt sein würde, und ich war mir noch nicht ganz darüber im Klaren, ob es mir gefiel.
Ich verdunkelte mein Zimmer, indem ich Steppdecken vor die Fenster hängte und mit Reißzwecken an den Rahmen befestigte. Buckshaws zerschlissene Vorhänge boten nicht genug Schutz vor dem Sonnenlicht.
Als ich im Labor mit dem Fingernagel gegen den Filmstreifen geschnipst hatte, hatte es Tick! gemacht – die Bestätigung, dass die Beschichtung in ebenjener Sonne, die ich soeben verbannte, durchgetrocknet war. Ich hatte den Film wieder auf die Originalspule gewickelt und in mein Zimmer mitgenommen.
Hier fädelte ich den Streifen in den Projektor, den ich auf meinen Waschtisch gestellt hatte, und richtete das Objektiv auf den Kamin. Meine Zimmerwände waren mit einer scheußlichen viktorianischen Tapete beklebt (rote Blutgerinnsel auf giftigem Blau); nur der Kamin war ausgespart geblieben.
Zum Glück hatte mir Mr. Mitchell, der auf diesem Gebiet ein echter Fachmann war, anlässlich eines Filmabends im Gemeindesaal erklärt, dass man nicht unbedingt eine weiße Projektionsfläche benötigte.
»Das denken die Leute bloß, weil sie’s noch nie mit ’ner schwarzen probiert haben.«
Er hatte mir erläutert, dass ein Projektor immer jene Farbtöne liefert, die die Projektionsfläche nicht besitzt. Wenn man sich im Kino die neueste Komödie aus den Ealing-Studios anschaut, sind jene Teile der Leinwand, die in unseren Augen schwarz erscheinen, in Wirklichkeit weiß.