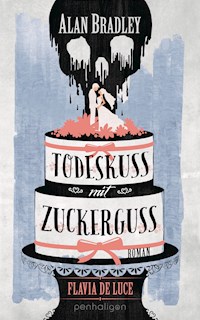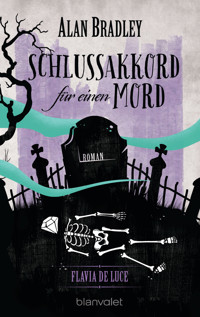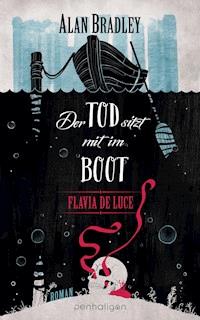
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Flavia de Luce
- Sprache: Deutsch
Wer Wednesday Addams als Ermittlerin liebt, kommt an Flavia de Luce nicht vorbei.
Wie sieht für Sie der typische Ermittler aus? Männlich, mittelalt, ein bisschen brummig, mit einer aufgeweckten jungen Kollegin an seiner Seite? Denken Sie um! Denn kaum jemand hat eine so hohe Erfolgsquote, was das Lösen von Kriminalfällen betrifft, wie Flavia de Luce: zwölf Jahre alt, auf liebenswerte Weise ein bisschen naseweiß, begnadete Chemikerin, an ihrer Seite nur ihr treues Fahrrad Gladys. Auch in diesem ungewöhnlich heißen Sommer in England kreuzt während eines Bootsausflugs mit ihrer Familie eine Leiche Flavias Weg. Der tote Mann ist in blaue Seide gehüllt und trägt einen einzelnen roten Ballettschuh. Als auch noch drei Klatschtanten in der ortsansässigen Kirche dran glauben müssen, läuft Flavias zauberhafte Spürnase erneut zu Hochtouren auf.
Diese außergewöhnliche All-Age-Krimireihe hat die Herzen von Lesern, Buchhändlern und Kritikern aus aller Welt im Sturm erobert!
Die »Flavia de Luce«-Reihe:
Band 1: Mord im Gurkenbeet
Band 2: Mord ist kein Kinderspiel
Band 3: Halunken, Tod und Teufel
Band 4: Vorhang auf für eine Leiche
Band 5: Schlussakkord für einen Mord
Band 6: Tote Vögel singen nicht
Band 7: Eine Leiche wirbelt Staub auf
Band 8: Mord ist nicht das letzte Wort
Band 9: Der Tod sitzt mit im Boot
Band 10: Todeskuss mit Zuckerguss
Außerdem (nur) als E-Book erhältlich:
Das Geheimnis des kupferroten Toten (»Flavia de Luce«-Short-Story)
Alle Bände sind auch einzeln lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Es ist ein heißer Sommer in England, und um die leeren Tage zu füllen, organisiert der treue Diener Dogger einen Bootsausflug für Flavia und ihre Schwestern. Träge liegt Flavia an Bord und lässt ihre Hand ins kühle Wasser baumeln, da hat sie plötzlich eine Leiche am Haken – beziehungsweise am Finger. Der tote Mann ist in blaue Seide gehüllt und trägt einen einzelnen roten Ballettschuh. Doch dies ist nicht der einzige mysteriöse Todesfall. Unweit vom Fundort der Leiche mussten vor einiger Zeit drei Klatschtanten in der ortsansässigen Kirche ebenfalls dran glauben. Flavias Spürnase läuft zur Hochform auf, denn die kleine Hobbydetektivin muss nicht nur eine Vielzahl verwirrender Hinweise entschlüsseln, sondern auch ihre Schwestern vor einer großen Gefahr beschützen.
Autor
Alan Bradley wurde 1938 in der kanadischen Provinz Ontario geboren. Nach einer Laufbahn als Elektrotechniker, zuletzt als Direktor für Fernsehtechnik an der Universität von Saskatchewan, zog Alan Bradley sich 1994 aus dem aktiven Berufsleben zurück, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Mord im Gurkenbeet war sein erster Roman und der viel umjubelte Auftakt zu seiner weltweit erfolgreichen Serie um die außergewöhnliche Detektivin Flavia de Luce. Alan Bradley lebt zusammen mit seiner Frau Shirley auf der Isle of Man.
Von Alan Bradley bereits erschienen
Mord im Gurkenbeet · Mord ist kein Kinderspiel · Halunken, Tod und Teufel · Vorhang auf für eine Leiche · Schlussakkord für einen Mord · Tote Vögel singen nicht · Eine Leiche wirbelt Staub auf · Mord ist nicht das letzte Wort
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
´
ALAN BRADLEY
FLAVIA DE LUCE
Roman
Deutsch von Gerald Jung und Katharina Orgaß
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Grave’s a Fine and Private Place« bei Delacorte Press, New York.Der Vers aus dem Gedicht »An seine spröde Geliebte« von Andrew Marvell auf S. 7 wird in der deutschen Übersetzung von Werner Vordtriede wiedergegeben (in: Englische und amerikanische Dichtung, hrsg. von Friedhelm Kemp und Werner von Koppenfels, dtv, München 2000).Das Zitat aus Dr. Samuel Johnson: Leben und Meinungen von James Boswell auf S. 330 folgt der Übersetzung von Fritz Güttinger, Diogenes, Zürich 2008.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Alan Bradley
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2018 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung und -illustration: Melanie Korte, Inkcraft
AF · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21619-1V002www.penhaligon.de
Für Shirley, meine Inspiration
Das Grab ist ein verschwiegner Ort,
Doch niemand, glaub ich, küsst sich dort.
ANDREW MARVELL »An seine spröde Geliebte« (1681)
1
Ich liege auf dem Sterbebett.
Wieder einmal.
Ich habe getan, was in meiner Macht stand, um weiterzuleben, aber es gibt Grenzen dessen, was ein Mensch ertragen kann.
Von schmerzlichen Erinnerungen überwältigt, drehe ich das Gesicht zur Wand.
Vater war an Weihnachten unerwartet gestorben. Sein Tod hatte eine Lücke gerissen, die nie mehr geschlossen werden würde – nein, nie mehr geschlossen werden konnte. Letztendlich war er, in welcher Weise auch immer, der Klebstoff gewesen, der uns alle zusammengehalten hatte, und nach seinem Tod waren meine Schwestern und ich, die wir ohnehin noch nie sonderlich gut miteinander ausgekommen waren, auf unerklärliche Weise zu erbitterten Todfeindinnen geworden.
Jede von uns wollte in ihrer Verzweiflung über die anderen bestimmen und so womöglich ihr zerrüttetes Leben wieder in den Griff bekommen. Wir gerieten bei jeder sich bietenden Gelegenheit aneinander.
Ohne Rücksicht auf Verluste warfen wir uns böse Worte und gelegentlich auch Geschirr an den Kopf.
Nachdem unsere Familie dergestalt auseinanderzubrechen drohte, war Tante Felicity aus London herbeigeeilt, um die Wogen zu glätten.
Das behauptete sie jedenfalls.
Unsere liebe Tante rief uns schnell wieder in Erinnerung, dass sie eine Frau war, die der Stimme ihres Herzens folgte (nicht, dass wir das vergessen hätten).
Soll heißen, sie war bestenfalls eine starrsinnige Alte und schlimmstenfalls ein Drachen und eine Tyrannin.
Sie bestand darauf, Buckshaw unverzüglich zu verkaufen, auch wenn das Anwesen jetzt nach Recht und Gesetz mir gehörte. Feely wiederum sollte sofort (oder doch wenigstens so rasch wie irgend möglich) ihren Verlobten Dieter Schrantz heiraten, sobald die angemessene Trauerzeit verstrichen war.
Daffy sollte nach Oxford gehen und Englisch studieren.
»Wer weiß – wenn du dich anstrengst, wirst du ja vielleicht mal eine gute Lehrerin«, hatte Tante Felicity gemeint, worauf Daffy ihre Teetasse samt Untertasse in den Kamin gepfeffert hatte und aus dem Salon gestürmt war.
Wutanfälle seien sinnlos, hatte uns Tante Felicity daraufhin ungerührt erklärt. Sie lösten keine Probleme, sondern schufen nur neue.
Was mich anging, so sollten meine Cousine Undine und ich Tante Felicity nach London begleiten und so lange bei ihr bleiben, bis sie über unsere Zukunft entschieden hatte. Mir war klar, was das bedeutete. Sie wollte mich irgendwo hinschicken, wo ich die Ausbildung fortsetzen sollte, die durch meinen Hinauswurf aus Miss Bodycotes Höherer Mädchenschule in Kanada unterbrochen worden war.
Aber was war mit Dogger und Mrs Mullet? Was sollte aus ihnen werden?
»Die beiden werden entlassen und erhalten entsprechend der Dauer ihrer Dienstzeit eine kleine Abfindung«, hatte Tante Felicity verfügt. »Sie werden diese Großzügigkeit sicherlich zu würdigen wissen.«
Dogger sollte mit einer Abfindung abgespeist werden? Undenkbar! Er hatte uns praktisch sein ganzes Leben geopfert, erst meinem Vater, dann auch meiner Mutter und schließlich mir und meinen Schwestern.
Ich stellte mir vor, wie er in einer geflickten Rentnerjoppe an irgendeinem Fluss auf einer malerischen Holzbank hockte und gezwungen war, die vorbeikommenden Touristen, die ihn fotografierten und die Bilder irgendwelchen Kretins in ihrer Verwandtschaft schickten, um Brot anzubetteln.
Das hatte er nicht verdient!
Und Mrs Mullet?
Wenn sie gezwungen wäre, für Wildfremde zu kochen, würde sie wie eine Primel eingehen und sterben – und das durch unsere Schuld.
Unsere Aussichten waren wahrhaftig düster.
Zu allem Übel war Anfang Februar auch noch König George gestorben. Der liebenswürdige George VI., der einst in unserem Salon gesessen und so ungezwungen mit mir geplaudert hatte, als wäre ich seine eigene Tochter. Sein Dahinscheiden erschütterte ganz England, ja das gesamte britische Weltreich, wenn nicht gar die ganze Welt – genauso wie Vaters Verlust unsere Familie erschütterte. Alle waren wir in Trauer vereint.
Und ich? Was war mit Flavia de Luce?
Ich beschloss, meinem Vater nachzufolgen.
Statt mein restliches Leben an einem taubenverseuchten Londoner Platz in der Obhut einer Tante zu verbringen, die den Dienst am Vaterland über die Sorge für ihr eigenes Fleisch und Blut stellte, würde ich einfach sterben.
Als Expertin für Gifte wusste ich auch, wie ich das anzustellen hatte.
Aber nicht mit Zyankali – nein danke!
Die Symptome einer Zyankalivergiftung kannte ich nur allzu gut: erst Schwindel und Benommenheit, dann Brennen in Kehle und Magen, danach Lähmung des Vagusnervs und in der Folge Atemprobleme, schließlich Schweißausbrüche, Herzrasen, allgemeine Lähmung, verlangsamter Puls, Sabbern …
Mehr als alles andere schreckte mich das Sabbern von dieser Variante ab. Welche junge Dame, die etwas auf sich hält, möchte schon tot in ihrer eigenen Spucke aufgefunden werden?
Da gab es doch appetitlichere Mittel und Wege, sich den himmlischen Heerscharen anzuschließen.
Und darum liege ich jetzt gemütlich auf meinem Sterbelager und lasse mit halb geschlossenen Augen ein letztes Mal den Blick über meine scheußliche senfgelbe Tapete mit den roten Würmern wandern.
Ich schlafe einfach für immer ein und hinterlasse auch nicht den allerkleinsten Hinweis auf die Ursache meines Ablebens. Wie klug von mir, dass mir diese Methode rechtzeitig eingefallen war!
Dann wird es ihnen leidtun, dachte ich. Sie werden bitterlich um mich weinen.
Doch nein! So durfte es nicht enden. Nicht mit so einem platten Klischee. Mit derlei letzten Gedanken entschliefen Stallmägde oder Andersens Mädchen mit den Schwefelhölzern.
Flavia de Luces Tod dagegen verlangte nach Größerem: nach bedeutsamen, hochherzigen Worten für die Ewigkeit, die ich mir in Erinnerung rufen konnte, wenn ich durch die Himmelspforte schritt.
Aber wie sollten diese Worte lauten?
Alles Religiöse war viel zu abgedroschen.
Vielleicht sollte mein letzter Gedanke lieber den merkwürdigen Bindungsverhältnissen des Diborans (B2H6) oder der noch ungeklärten Valenzelektronenstruktur des Zeise-Salzes gelten.
Ja, das war’s!
Das Paradies würde mich mit offenen Armen empfangen. »Gut gemacht, de Luce!«, würden die riesigen, mit kaltem Feuer brennenden Kristallengel anerkennend ausrufen, wenn ich über die Schwelle trat.
Ich schlang die Arme um mich und kuschelte mich in meine eigene Körperwärme.
Wie schön Sterben doch sein kann, wenn man es nur richtig anstellt!
»Miss Flavia?«, riss mich Dogger aus meinen erbaulichen Gedanken. Er hatte aufgehört zu rudern und zeigte auf etwas.
Blitzschnell schüttelte ich meinen Tagtraum ab. Wäre es nicht Dogger gewesen, hätte ich mir deutlich mehr Zeit gelassen.
»Dort drüben ist Volesthorpe«, sagte er, »und St. Mildred liegt gleich links neben der höchsten Ulme.«
Dogger wusste genau, dass ich diesen Anblick nicht verpassen wollte. In der kleinen Kirche hatte Pfarrer Whitbread, auch »der Giftpfaffe« genannt, erst vor zwei Jahren etliche seiner weiblichen Gemeindemitglieder mithilfe einer Dosis Zyankali im Messwein vom Leben zum Tode befördert.
Aus verschmähter Liebe natürlich. Gift und gekränkte Gefühle sind meiner Erfahrung nach ebenso unzertrennlich wie Laurel und Hardy.
»Sieht eigentlich ganz idyllisch aus«, sagte ich. »Wie aus einem Bildband Unsere schöne Heimat.«
»Stimmt«, pflichtete Dogger mir bei. »Das ist oft so. Eine hübsche äußere Erscheinung verstärkt oft noch die Gefühlsleere, die nach einem Gewaltverbrechen zurückbleibt.«
Er ließ den Blick übers Wasser schweifen, und ich wusste, dass er an das japanische Kriegsgefangenenlager dachte, in dem Vater und er so furchtbar gelitten hatten.
Wie schon gesagt – Vaters Tod vor einem halben Jahr war der Anlass, dass wir hier und jetzt über die Themse glitten: meine Schwestern Ophelia und Daphne und natürlich ich selbst, Flavia.
Undine war bereits, wie ursprünglich geplant, mit Tante Felicity nach London abgereist.
Feely rekelte sich, das Gesicht dick mit Mückenschutzmittel eingeschmiert, im Bug des Bootes auf einem Berg gestreifter Kissen und bewunderte ihr Ebenbild in der spiegelnden Wasserfläche. Seit unserem Aufbruch heute früh hatte sie kein Wort gesprochen. Ihre Finger trommelten auf den Bootsrand – am Rhythmus erkannte ich eines von Mendelssohns Liedern ohne Worte –, doch ihre Miene war völlig ausdruckslos.
Daffy thronte auf der Sitzbank, steckte die Nase in ein Buch – Robert Burtons Anatomie der Melancholie – und würdigte die liebliche englische Landschaft, die rechts und links vorüberzog, keines Blickes.
Vaters jäher Tod hatte unsere Familie in eine Art Schockstarre versetzt, was, so vermute ich, auch damit zu tun hatte, dass wir de Luces von Natur aus unfähig sind, unserem Kummer Ausdruck zu verleihen.
Einzig Dogger war zusammengebrochen. In der ersten Nacht hatte er so schauerlich geheult wie ein Hund bei Vollmond und war in den folgenden Tagen teilnahmslos und nicht ansprechbar gewesen.
Es war herzzerreißend.
Die Beerdigung war chaotisch verlaufen. Denwyn Richardson, der Vikar unserer Gemeinde und einer von Vaters ältesten und engsten Freunden, war gleich zu Anfang in hemmungsloses Schluchzen ausgebrochen, weshalb der Gottesdienst so lange unterbrochen werden musste, bis ein anderer Geistlicher für ihn einsprang. Man hatte den armen alten Vikar Walpole aus dem Nachbardorf vom Krankenlager geholt und nach St. Tankred geschleift, wo er zu Ende brachte, was sein Kollege begonnen hatte. Seine Hustenanfälle am Grab hatten wie hundert bellende Bluthunde geklungen.
Ein echter Albtraum.
Wie schon erwähnt war auch Tante Felicity pflichtschuldigst aus London angerauscht. Der Tod ihres einzigen – und auch noch jüngeren – Bruders brachte sie so in Rage, dass sie uns herumkommandierte wie eine Schar besonders begriffsstutziger Sklaven. Ständig schnauzte sie uns an: »Du räumst die Zeitschriften auf, Flavia! Und zwar alphabetisch geordnet und dann nach Jahrgängen – und richtig herum ins Regal stellen! Der Salon von Buckshaw ist schließlich kein Saustall. Und du, Ophelia, holst einen Besen und entfernst die Spinnweben. Das Zimmer ist ja die reinste Gruft!«
Als ihr aufging, was sie da gesagt hatte, war sie vor lauter Scham noch aufgebrachter geworden und hatte noch verletzendere Bemerkungen abgefeuert, die ich hier nicht wiedergeben möchte. Womöglich liest sie diese Zeilen eines Tages und nimmt grausame Rache an mir.
Ob ich da nicht ein bisschen übertreibe? Eigentlich nicht.
»Ihr lasst euch gehen!«, hatte sie uns an den Kopf geworfen. »Ihr gehört mal tüchtig durchgepustet!«
Und so wurde beschlossen – von wem, kann ich immer noch nicht mit letzter Gewissheit sagen –, dass wir dringend Ferien brauchten. Wir sollten irgendwohin fahren, wo es Kutschausflüge und fröhlich bunte Strandkörbe gab oder wenigstens jede Menge freie Natur.
Ich glaube, letztendlich kam Dogger auf die Idee mit der Bootstour: friedliche Tage auf der Themse, Picknickkörbe mit belegten Broten, Limonade von Fortnum & Mason, weiche Daunendecken und am Abend Schmorbraten in wechselnden Landgasthöfen.
»Denk doch mal an Huckleberry Finn, Flavia«, hatte Daffy gemeint. »Wer weiß? Vielleicht entdeckst du ja sogar ein weggeschwemmtes Haus mit einer Leiche drin.«
Diesbezüglich war ich zwar skeptisch, aber alles war besser, als auf Buckshaw herumzusitzen, das von nun an vermutlich bis ans Ende aller Tage ein Haus der Trauer und der Trübsal bleiben würde.
Mein geliebtes Buckshaw kam mir auf einmal seltsam verstaubt und unwirtlich vor, und es roch so muffig, als hätte man die Asche von Generationen längst verblichener de Luces aus einem Staubsaugerbeutel gekippt und überall verteilt. Genau genommen war es Daffy gewesen, die mich darauf aufmerksam gemacht hatte.
»Wie in der kleinen Kirche im Park von Dickens’ Bleak House«, hatte sie erschauernd gesagt und die Strickjacke fester um sich gezogen. Sie spielte auf jenes Buch an, das sie angeblich schon als Wickelkind wieder und wieder gelesen und jedes Mal von vorn angefangen hatte, wenn sie am Ende angekommen war. »Es riecht modrig wie ein Grab. Bäh!«
Das »Bäh!« stammte allerdings von Daffy, nicht von Dickens.
Feelys Hochzeit mit Dieter Schrantz, die eigentlich schon im Juni hatte stattfinden sollen, hatte man wegen Vaters Tod verschoben. Deswegen war Porzellan zu Bruch gegangen, waren Tapeten von der Wand gefetzt und die Füllung aus Polstern gerupft worden, aber vergebens.
»Verstirbt ein Elternteil, ist eine Trauerzeit von mindestens einem halben Jahr einzuhalten – keinen Tag weniger!«, hatte Tante Felicity kategorisch verkündet und damit verraten, dass sie eine militärische Ausbildung genossen hatte, was eigentlich streng geheim war. »Da kannst du toben und heulen, so viel du willst.«
Und damit basta.
Was eine Zeit bräutlicher Vorfreude hätte sein sollen, hatte sich in einen bösen Traum verwandelt, denn Feelys Anspannung, Angst und Wut hatten jegliche Vernunft an der Kehle gepackt und so lange durchgeschüttelt, bis sie erstickt war. Sie hatte sich mehrfach auf spektakuläre Weise mit Dieter verkracht und anschließend tränenreich wieder versöhnt, und die daraufhin erneut ausbrechenden Feindseligkeiten hätten sogar einem Dschingis Khan die Schamesröte ins Gesicht getrieben.
Dieter hatte das alles mit unerschütterlicher Ruhe über sich ergehen lassen, sich dann aber, wie alle Helden über kurz oder lang, zurückgezogen, um seine Wunden zu lecken.
So kam es, dass wir drei Schwestern erstaunlicherweise ohne viel Federlesens unsere Taschen gepackt (Dogger war natürlich wie immer auf alles vorbereitet gewesen) und eine Reise angetreten hatten, die unserer seelischen Genesung dienen sollte.
Doch wie so oft kam es anders als gedacht.
Als wir Buckshaw endlich verließen, lag Vaters Tod schon fast ein halbes Jahr zurück. Zu Beginn dieses halben Jahres hatte es noch ausgesehen, als würde sich Dogger nie mehr von diesem Schlag erholen, doch im Lauf der Zeit hatte zumindest ich begriffen, dass das mitnichten der Fall war. Im Gegenteil.
Vor allem in den letzten paar Wochen war Dogger förmlich aufgeblüht. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich tue mein Möglichstes.
Was an ihm auffiel, war nichts Oberflächliches – nicht so, als hätte er sich einfach nur rasiert und die Wangen mit belebendem Rasierwasser betupft. Auf derlei Dinge legte Dogger ohnehin keinen Wert.
Nein, es war eher, als sei er auf einmal von einem Heiligenschein umgeben, jenem goldfarbenen Schimmer, der auf mittelalterlichen Gemälden die Köpfe von Heiligen einrahmt – als hätten sich die Betreffenden einen umgedrehten Kupferkessel übergestülpt.
Erstaunlicherweise kommen Heiligenscheine in der Bibel nirgendwo vor – wie übrigens auch keine Katzen und Ziehharmonikas. Will man etwas über Heiligenscheine nachschlagen, muss man zum guten alten Konversationslexikon greifen, wo man sie irgendwo zwischen »Heilanstalt« und »Heilschlamm« findet. Sie haben auch nichts mit jenem Schimmer zu tun, den man um Sonne oder Mond herum beobachten kann und der bekanntlich dadurch verursacht wird, dass sich das Licht in Eiskristallen bricht, die in der Atmosphäre schweben. Die Ursache für das Leuchten rings um die Köpfe von Heiligen ist unbekannt – auch wenn man sich natürlich sein Teil denken kann. Mir jedenfalls fällt das nicht schwer.
In Doggers Fall manifestierte sich dieses Leuchten, dieser Glorienschein, erst nach und nach. Ich hatte mir angewöhnt, jeden Morgen als Erstes in die Küche zu spazieren und nachzuschauen, auch wenn ich dabei natürlich diskret vorging.
Als Erstes war mir aufgefallen, dass Doggers Wangen immer rosiger wurden, und ich hatte erschrocken an eine Stechapfelvergiftung oder an die Pest gedacht. Aber Dogger war natürlich nicht so dumm, die eingetopfte Stechapfelpflanze (Datura stramonium) anzufassen, die in meinem Labor stand, und der Schwarze Tod hatte in England nachweislich zuletzt im Jahre 1918 zugeschlagen, als er in der Nähe von Ipswich eine gewisse Mrs Bugg dahingerafft hatte. Daraufhin kam ich zu dem Schluss, dass Doggers zunehmendes Leuchten eigentlich nur ein gutes Zeichen sein konnte.
Und so war es auch. So wie Dogger an diesem Junimorgen in der Mitte des Bootes saß und die Ruder stetig durchs lauwarme, brackige Wasser zog, sah er so gut und gesund aus, wie ich ihn noch nie erlebt hatte. Er hätte ein Filmstar sein können! Wäre es nicht das richtige Leben, sondern ein Film gewesen, hätte zum Beispiel John Mills seine Rolle übernehmen und lächelnd in die Sonne blinzeln können, als ahne er bereits, was hinter der nächsten Biegung lag. Was ja vielleicht auch der Fall war.
»Warst du schon mal hier, Dogger?«, erkundigte ich mich. »Ich meine, hier auf diesem Abschnitt der Themse?«
»Vor vielen, vielen Jahren, Miss Flavia. Aber das war in einem anderen Leben.«
Ich war so klug, nicht weiter nachzufragen.
Stattdessen ließ ich den Blick zu dem verlockend grünen, schattigen Friedhof der kleinen Kirche hinüberschweifen.
Die meisten Leute denken nie darüber nach, warum die Pflanzen gerade auf Friedhöfen so üppig wachsen und gedeihen. Sonst würden sie vielleicht selbst grasgrün im Gesicht, wenn ihnen einfallen würde, was sich unter dem Rasen, den malerischen Moospolstern und den verwitterten Grabsteinen befindet. Ich spreche von dem speziellen Eintopf, der in der dunklen Erde vor sich hin brodelt und blubbert, wenn unsere Vorfahren und Nachbarn mit ein wenig chemischer Unterstützung zu ihrem Schöpfer zurückkehren.
»Aus Staub seid ihr gemacht, und zu Staub sollt ihr wieder werden«, sagt die Bibel zu diesem Thema.
»Asche zu Asche, Staub zu Staub«, heißt es in der Liturgie.
Wobei beide Texte, die überwiegend die Grenzen des guten Geschmacks einhalten, sich davor drücken, die Phasen des stinkenden Glibbers, der austretenden Körperflüssigkeiten und der entweichenden Fäulnisgase zu beschreiben, die wir alle auf unserem Weg ins Jenseits durchlaufen müssen.
Im Grunde ist so ein Friedhof nichts anderes als ein hocheffizienter Fleischklopfer.
Schockierend, mag sein, aber wahr.
In einer älteren Ausgabe der Londoner Illustrierten Nachrichten, die im Salon unter ein Sofa gerutscht und dort vergessen worden war, hatte ich einen Bericht darüber entdeckt, dass man mithilfe eines Extraktes aus Papayafrüchten Steaks zarter machen konnte.
Was für eine Vergeudung!, war es mir durch den Kopf geschossen. Wie viel einfacher und wirkungsvoller wäre es doch, die Steaks schlicht und ergreifend …
Unterdessen glitt unser Boot bereits dicht am Friedhof entlang. Über uns ragte die Kirche auf. Ihr gedrungener Turm warf einen schwarzen Schatten, und trotz der strahlenden Morgensonne fröstelte ich plötzlich, was nicht nur an der frischen Brise lag, die jetzt einen Wetterumschwung ankündigte.
»Hat Pfarrer Whitbread den vergifteten Messkelch nicht hier, an dem alten Steg, in den Fluss geworfen?«, wandte ich mich an Dogger.
Wobei ich mir fast sicher war, denn ich hatte mir die Fotografien in der News of the World seinerzeit in allen Einzelheiten eingeprägt: den Weg zum Ufer hinunter, den Steg, die Böschung, das Schilf – alles fein säuberlich mit Pfeilen beschriftet, um die Fantasie der blutlüsternen Leser zu befriedigen.
Der schurkische Geistliche hatte den Messkelch in der Hoffnung in der Themse versenkt, dass er untergehen und bis zum Jüngsten Tag im Schlamm ruhen möge. Er hatte nicht bedacht, dass irgendwann ein abgefeimter Küster das originale Silbergefäß gegen eine lediglich silberbeschichtete Fälschung ausgetauscht hatte, die dummerweise zu leicht war und nicht unterging. Weshalb sie bald darauf von einem Bauernjungen entdeckt wurde.
»Er hätte sich eben keine mondlose Nacht aussuchen sollen«, sagte ich.
»Ganz recht, Miss Flavia«, gab Dogger zurück, der natürlich wusste, woran ich dachte. »Dann hätte er gesehen, dass das Ding nicht sinkt.«
»Oder ja vielleicht doch«, spann ich den Faden eifrig weiter. »Vielleicht hat sich der Kelch ja auch an einem Ruder oder einer Stakstange verfangen und ist so wieder zum Vorschein gekommen.«
»Möglich«, erwiderte Dogger, »aber eher unwahrscheinlich. Die Polizei hat diese Überlegung jedenfalls wieder verworfen. Die dünne Wand der Fälschung war nicht eingedrückt.«
»Schon komisch, dass Whitbread nie aufgefallen ist, dass der Kelch auf einmal viel leichter war.«
»Vielleicht hat er ihn ja selbst ausgetauscht.«
Die Vorstellung, dass das geweihte Gefäß womöglich immer noch auf dem Grund des Flusses lag, vielleicht sogar direkt unter uns (wenn auch natürlich alle Spuren von Strychnin und Zyankali längst weggespült waren), entzückte mich so, dass ich mit der flachen Hand aufs Wasser klatschte. Vielleicht schwammen hier ja noch ein paar Giftmoleküle herum – natürlich stark verdünnt, aber, wenn man Samuel Hahnemann, dem Begründer der Homöopathie, glauben durfte, trotzdem tödlich.
»Flavia, du Dämlack!«, zeterte Daffy. »Jetzt ist mein Buch nass geworden!«
Wenn Daffy so richtig sauer wird, lässt ihre gewählte Ausdrucksweise sie im Stich.
Sie klappte das Buch mit einem wütenden Knall zu und stopfte es in den Picknickkorb.
Anschließend trat eine segensreiche – wenn auch leicht angespannte – Stille ein. Wir glitten unter den Trauerweiden hindurch, und ab und zu kräuselten die Luftblasen von Fischen die spiegelglatte Wasseroberfläche. (Ob Fische auch furzen?, ging es mir durch den Kopf.)
Wir waren nicht mehr weit von einer der großen Universitäten entfernt. Dort hätte mir bestimmt jemand meine Frage beantworten können. Irgendein berühmter Wissenschaftler oder ein junger, vielversprechender Fischkundler – mit markantem Kinn, blonden Locken, blitzblauen Augen und einer Pfeife im Mund. Ich könnte doch einfach in sein Büro platzen und ihm eine knifflige Chemiefrage stellen … eine so knifflige Frage, dass er sofort merken würde, dass ich kein blutiger Laie war. Die Verteilung von Strychnin und Zyankali in fischreichen Flüssen … Ja! Das klang gut!
Roger würde er heißen. Roger de Irgendwas, damit es zu meinem eigenen Nachnamen passte. Er käme aus einer alten Adelsfamilie normannischen Ursprungs, einer Familie mit so vielen prächtigen Wappen und Wimpeln, dass sich jeder Gebrauchtwagenhändler daneben verstecken konnte.
»Roger …«, würde ich sagen.
Aber halt! Roger war dann doch zu gewöhnlich. Ein Hundename. Nein, mein Fischkundler musste Llewellyn heißen, und der Name musste original walisisch ausgesprochen werden: Lu-Ellin.
Ja, Llewellyn – das war’s.
»Llewellyn«, würde ich sagen, »wenn Sie es jemals mit vergifteten Fischen zu tun bekommen, können Sie sich gern an mich wenden.«
Oder war das zu direkt?
Ich hatte noch nie einen Fisch seziert, aber es konnte auch nicht viel schwerer sein, als beim Frühstück die Räucherheringe zu filetieren.
Ich seufzte genießerisch und ließ die Hand träge ins Wasser hängen.
Als etwas meine Finger streifte, packte ich instinktiv zu.
War das ein Fisch? Hatte ich allen Ernstes mit bloßer Hand einen Fisch gefangen?
Hatte ein minderbemittelter Barsch oder Hecht meine Finger für etwas Fressbares gehalten?
Weil ich die Gelegenheit, als »Angelhaken-Flavia« in die Geschichte einzugehen, auf keinen Fall verpassen wollte, hielt ich meine Beute eisern fest und bohrte die Finger so tief hinein, bis ich harte Gräten spürte. Dieser Fang würde mir nicht durch die Lappen gehen!
»Halt doch mal eben an, Dogger«, sagte ich betont beiläufig. Weil diese Geschichte über Generationen hinweg überliefert werden würde, sollte darin unbedingt Erwähnung finden, was ich für einen erstaunlich kühlen Kopf bewahrte. »Ich glaube, ich habe da etwas gefangen.«
Dogger hörte auf zu rudern und ließ das Boot treiben. Mein Arm wurde schon lahm, so schwer war meine Beute. Es musste einer dieser Riesenfische sein, die hundert Jahre und länger auf dem Grund eines Gewässers leben und zum Mythos werden. »Unser Methusalem« oder so ähnlich würden ihn die Dörfler liebevoll nennen. Würden sie böse werden, wenn sie hörten, dass ich ihr geliebtes Ungeheuer mit bloßen Händen gefangen hatte?
Ich musste schmunzeln.
Auf jeden Fall wehrte sich der Fisch nicht groß.
Feely und Daffy taten desinteressiert, schielten aber verstohlen zu mir herüber.
Ich packte noch fester zu und schüttelte den ausgestreckten Arm ein paarmal kräftig.
Ich kannte Fotografien des amerikanischen Schriftstellers Hemingway, auf denen er mit einem gewaltigen Speerfisch kämpfte, der an einer lächerlich dünnen Angel hing. Wetten, sogar Mr Hemingway hatte noch nie ein solches Exemplar mit der Hand gefangen?
Flavia, schoss es mir durch den Kopf, jetzt wirst du berühmt.
Als das Boot langsamer und das Wasser klarer wurde, erschienen unter der Oberfläche erst ein dunkler Schatten und dann ein hellerer Fleck. Ein Fischbauch? Die Farbe stimmte schon mal.
Ich zog meinen Fang zu mir heran.
Er lag zwar verkehrt herum im Wasser, aber jetzt konnte ich ihn gut erkennen.
Es war ein menschlicher Kopf … mit einem Körper dran.
Ich hatte die Finger in den offenen Mund der Leiche gekrallt, gleich hinter die Schneidezähne.
»Äh, Dogger …«, sagte ich, »… ich glaube, wir rudern lieber zum Steg rüber.«
2
An dem alten Steg hinter der Kirche anzulegen war gar nicht so einfach, wie es sich anhört.
Unter anderem deshalb, weil Daffy über der Bootswand hing und sich übergab. Sie spuckte alles aus, was sie seit dem vorletzten Donnerstag zu sich genommen hatte. Wenn du schon mal in der Kinowochenschau gesehen hast, wie ein Fischkutter seine Netze ausleert, weißt du, wovon ich spreche. Daffy war nicht einfach nur schlecht, sie reiherte sich buchstäblich die Seele aus dem Leib. Offen gestanden war es ziemlich beeindruckend.
Wäre die Lage nicht so ernst gewesen, wäre es sogar ziemlich lustig gewesen.
Man muss Dogger lassen, dass er kein überflüssiges Wort verlor. Er drehte sich nur kurz nach mir um und reagierte sofort. Mit gleichmäßigen Ruderschlägen lenkte er das Boot zum Ufer hinüber. Das einzige störende Geräusch waren Daffys Würgelaute.
Die Leute in den anderen Booten, von denen mehrere unterwegs waren, dachten bestimmt, dass die junge Dame etwas Falsches gegessen hatte. Ein angeschimmeltes Sandwich mit Fischpaste oder eine verdorbene Scheibe Zunge vielleicht. Da gehörte es sich nicht zu glotzen, und das tat dann auch niemand. Und was ich da am offenen Kiefer durchs Wasser zog, sah erst recht niemand.
Als die Bootswand gegen den Steg stieß, hielt Dogger mir wortlos die karierte Decke hin, auf der wir unser Picknick hatten verzehren wollen. Ich wusste sofort, was er von mir wollte.
Ohne unnötiges Aufsehen zu erregen, nahm ich die gefaltete Decke in die linke Hand, schüttelte sie auf und ließ sie auf die schwimmende Leiche gleiten. Dogger hatte inzwischen das Boot festgemacht. Er stieg ins flache Wasser, packte die verhüllte Gestalt, nahm sie behutsam auf die Arme und watete mit ihr ans grasbewachsene Ufer.
Kurz darauf lag der Tote auch schon auf der Wiese am Rand des Kirchhofs.
Mir fiel sofort der Bluterguss an seinem Hinterkopf auf. Es sah aus, als wäre der Mann gestolpert, hätte sich den Kopf angeschlagen und sei dann ins Wasser gestürzt. Tote bekamen, wie mir einfiel, keine Blutergüsse.
Ich rief mich zur Ordnung. »Wiederbelebung?«, fragte ich sachlich.
Dogger hatte Jiu-Jitsu nach der Methode von Professor Kano gelernt und wusste, dass man Ertrunkene wieder zum Leben erweckte, indem man ihnen kräftig auf die Fußsohlen schlug.
Doch nachdem er die Decke kurz gelüftet hatte, erwiderte er: »Das bringt wohl nichts mehr, Miss. Die Fische haben den armen Kerl schon angefressen.«
Tatsächlich waren Nase und Ohrläppchen ein bisschen angeknabbert.
Davon abgesehen musste der Tote recht gut aussehend gewesen sein. Bestimmt hatten sich die langen roten Locken, die ihm jetzt feucht und schlaff am Kopf klebten, verführerisch über dem Kragen seines gerüschten Seidenhemdes gekringelt.
Nein, das ist jetzt nicht erfunden. Das Hemd des Toten war tatsächlich aus Seide, ebenso die blaue Kniebundhose, die oben mit Knöpfen geschlossen und unten mit Seidenbändern zugebunden war.
Ich hatte das eigenartige Gefühl, dass ein Zeitreisender aus dem achtzehnten Jahrhundert vor mir lag, jemand, der in den Tagen von George III. ins Wasser gehüpft war und auf einmal beschlossen hatte, wieder aufzutauchen.
Mein nächster Gedanke lautete: War jemand nach einem Kostümball vermisst worden? Oder war ein Schauspieler aus einem Historienfilm verschollen?
So etwas wäre bestimmt durch alle Zeitungen gegangen. Trotzdem lag hier dieser attraktive Jüngling (nur dass er leider tot war) ganz selbstverständlich vor mir im Gras, als wäre er nur eine geangelte Forelle.
Er war fast zu attraktiv. Ich fand, er ähnelte dem berühmten Gemälde Knabe in Blau von Gainsborough, nur dass er deutlich blasser war.
Moment mal! Ja, er erinnerte mich tatsächlich an ein Gemälde, aber nicht an einen Gainsborough, sondern an das Werk eines weit weniger bekannten Malers namens Henry Wallis.
Der Tod Chattertons hieß das Bild, und es zeigte den Leichnam jenes bedauernswerten jungen Dichters, der sich um 1770 im Alter von nur siebzehn Jahren vergiftet hatte, weil man ihn der literarischen Fälschung beschuldigte.
Darauf hätte ich auch gleich kommen können – zumal eine große gerahmte Reproduktion des Gemäldes jahrelang auf dem Ehrenplatz über meinem Bett gehangen hatte.
Ich gestehe, dass Der Tod Chattertons zu meinen Lieblingskunstwerken zählt.
Chatterton, weiß wie ein Fischbauch, liegt in seiner gemieteten Dachkammer auf dem schäbigen Bett. Mit der linken Hand zieht er das Hemd von seiner Brust zurück, in der eben noch sein Herz geschlagen hat.
Die rechte Hand hängt verkrampft herab, und nicht weit davon liegt das leere Arsenfläschchen auf dem Boden.
Warum können nicht alle Kunstwerke so faszinierend sein?
»Bitte bleiben Sie, wo Sie sind, Miss Ophelia und Miss Daphne«, riss mich Dogger aus meinen Gedanken. »Behalten Sie den Fluss im Auge, ob jemand kommt.«
Ganz schön schlau, dachte ich. Dogger wollte die beiden beschäftigen, damit sie nicht hysterisch wurden und womöglich Beweismaterial beschädigten.
Es ist doch immer wieder erstaunlich, dass man Anweisungen, die am Schauplatz einer Tragödie mit fester Stimme erteilt werden, stets Folge leistet.
»Und wenn du dir zutraust hierzubleiben, Miss Flavia«, setzte er hinzu, »dann würde ich losgehen und die Polizei holen.«
Ich nickte kurz, und er erklomm die steile Uferböschung. Die nassen Hosenbeine schlackerten ihm um die Knöchel, ohne seine Würde im Geringsten zu beeinträchtigen.
Kaum war er außer Sichtweite, schlug ich die Decke über der Leiche zurück.
Die halb offenen blauen Augen mit den erweiterten Pupillen blickten mich überrascht an, als hätte ich einem Dösenden das Sofakissen weggezogen. Die Lippen hatten das gleiche Blau wie die Bänder der Kniebundhose.
Ich beschnupperte den Mund des Toten und streifte ihn dabei mit der Nasenspitze, konnte aber nur den brackigen Geruch von Flusswasser ausmachen.
Daraufhin beugte ich mich noch weiter vor und schnüffelte an den Augen.
Ich hatte schon fast damit gerechnet. Sie rochen nach Marzipan.
Kaliumzyanid, beziehungsweise Zyankali, ist so gut wie geruchlos, außer man gibt es in Wasser. Dann bildet es eine leicht alkalische Lösung, aus der sich Blausäure entwickelt, die sich wiederum aus der Lösung verflüchtigt und charakteristisch riecht.
Weil die Augen von allen Körperteilen aus dem weichsten und empfindlichsten Gewebe bestehen, nehmen sie nicht nur chemische Gerüche am schnellsten an, sondern verströmen sie auch länger. Wenn du mir nicht glaubst, dann riech doch mal eine halbe Stunde nach dem Zwiebelschälen an deiner Tränenflüssigkeit.
Und weil die Augen des Toten zudem halb geschlossen waren, war nicht so viel Wasser darüber hinweggespült wie über Mund und Nase.
Die übrige Haut dagegen war … sagen wir, sie war in einer interessanten Verfassung. Das Gesicht war ein bisschen aufgedunsen, wies aber erstaunlich wenige Totenflecken auf. Das konnte nur bedeuten, dass der Verstorbene entweder noch nicht lange im Fluss trieb oder aber mehrere Tage unten auf dem Grund gelegen hatte, wo das Wasser kälter war. Dass er dann an die Oberfläche gekommen war, lag vermutlich an den Fäulnisgasen. Mir fielen zwar auch noch andere Ursachen dafür ein, aber diese war die wahrscheinlichste.
Natürlich hätte ich die Leiche noch eingehender untersuchen können und wäre sicherlich auf weitere Hinweise gestoßen, aber dazu hätte ich den Toten entkleiden müssen, und das fand ich dann doch ein bisschen respektlos. Außerdem konnte Dogger jeden Augenblick mit einem Polizeibeamten im Schlepptau zurückkommen.
Ohnehin sind es bei Ertrunkenen oft innerliche Indizien, die einen auf die entscheidende Spur bringen, und hier auf der Wiese konnte ich natürlich keine umfassende Obduktion vornehmen. Darum beschränkte ich mich auf das Nächstliegende.
Ich kreuzte dem Toten die Hände über der Brust, streckte dann selbst beide Arme steif vor und drückte fest auf seinen Brustkorb.
Ich wurde reich belohnt. Den bläulichen Lippen entströmte eine erstaunliche Menge einer trüben Flüssigkeit, gefolgt von einer klareren, bei der es sich vermutlich um Wasser handelte.
Rasch nahm ich mein Taschentuch und tupfte die Bescherung damit auf. Dann knüllte ich das Tuch zu einer Kugel zusammen, um Verunreinigungen vorzubeugen, und steckte es wieder weg.
Gewisse Leute – Mrs Mullet zum Beispiel – schärfen einem immer wieder ein, wie wichtig es ist, stets ein sauberes Taschentuch dabeizuhaben, und diesmal musste ich ihnen ausnahmsweise recht geben.
Ich schaute mich rasch um, aber niemand hatte mich beobachtet.
Daraufhin widmete ich mich wieder der äußerlichen Untersuchung des Toten und befühlte seine Handflächen. Wäre die Haut dort lose gewesen – der sogenannte »Handschuheffekt« –, wäre das ein Hinweis darauf gewesen, dass er länger im Wasser gelegen hatte, aber die Haut war noch straff.
Spontan führte ich meine eigene Hand an die Nase.
Schon komisch, wie selten wir Gerüche bewusst wahrnehmen – es sei denn, es »duftet« im einen oder anderen Sinne extrem: süß oder faulig, nach Veilchen oder nach Verwesung. Der menschliche Geruchssinn hat sich angewöhnt, alles Unwichtige zu ignorieren.
Ich beschnupperte meine Finger.
Aha! Eigentlich hatte ich gar nicht mit etwas Auffälligem gerechnet, doch meine Nase identifizierte einen unverwechselbaren Geruch.
Paraldehyd, bei allem, was heilig war! Das gute, alte (CH3CHO)3 – eine widerlich riechende, widerlich schmeckende, farblose Flüssigkeit, die man leicht gewinnen kann, indem man Ethanal mit Salz- oder Schwefelsäure reagieren lässt. Zum ersten Mal wurde die Substanz im Jahre 1829 gewonnen. Man kombinierte sie mit Vanilleextrakt, Himbeersirup und Chloroform, um Schlaflosigkeit zu behandeln. Außerdem mischte man sie zu gleichen Teilen mit dem Saft von Kirschlorbeerblättern und spritzte diese Lösung unruhigen Geisteskranken.
Weil aber der Atem der Patienten davon so schauerlich stank, wurde Paraldehyd seit ungefähr hundert Jahren nicht mehr verwendet. Allerdings hatte ich mal aufgeschnappt, dass es immer noch Leute gab, vor allem in Adelskreisen, die damit den Alkohol überwunden und stattdessen von dem Zeug abhängig geworden waren.
Um mich zu vergewissern, dass ich mich nicht irrte, roch ich noch einmal an meinen Fingern.
Allerdings führte eine Paraldehydvergiftung, wenn ich mich recht entsann, zu einer Verengung der Pupillen, nicht zur Erweiterung, wie es bei dem armen Jüngling der Fall war. Es passte alles nicht richtig zusammen, machte sozusagen nicht klick!
Doch die Zeit drängte. Ich würde mich später noch einmal mit dieser Frage befassen müssen.
Ich wandte mich der unteren Körperhälfte des Toten zu.
An dem einen Fuß, der unter der Decke hervorlugte, trug er einen Schuh, den man nur als rotes Ballettschläppchen beschreiben konnte, der andere Fuß war nackt. Der junge Mann war nicht besonders hochgewachsen, ich schätzte ihn auf höchstens eins siebzig. Allerdings lag er auf dem Rücken und war teilweise zugedeckt, weshalb die Größe nicht so gut zu erkennen war.
Der Tote war ein Tänzer! Das erklärte auch die unzeitgemäße Kostümierung.
Ich war stolz auf mich. Vielleicht hatte er sich ja abends ans Flussufer geschlichen, um im Schutz der Dunkelheit seine Sprünge und Pirouetten zu üben. Für einen Auftritt in Schwanensee zum Beispiel.
Was für einen Anblick musste er unter den Trauerweiden am Ufer des träge dahinströmenden Flusses geboten haben – bis er gestolpert war oder aber einen Sprung falsch eingeschätzt hatte und in die schwarzen Fluten gestürzt war.
Gestürzt war … oder gestoßen worden.
War er im Schilf oder zwischen Wasserpflanzen gelandet? Ich schlug die Decke noch weiter zurück, aber außen an seinem Körper klebten keine Pflanzenreste.
Und in der Kleidung? Ich beschloss, ihn zu durchsuchen.
Hast du schon mal einem Toten in die Tasche gefasst? Vermutlich nicht. Selbst ich war nur ein paarmal dazu gezwungen und kann dir versichern, dass es erfreulichere Beschäftigungen gibt.
Wer ahnt schon, was alles in den Tiefen der Kleidung lauert? Hat man es mit Ertrunkenen zu tun, muss man mit Aalen, Wasserschlangen, Krebsen und so weiter rechnen, und ich versuchte, mich zu erinnern, welche dieser Spezies – wie zum Beispiel die Wollhandkrabbe – sich von der Themsemündung flussaufwärts vorgearbeitet hatten. Wenn es um Tiere mit Scheren vorne dran geht, kann man nicht vorsichtig genug sein.
Doch meine Sorge war unbegründet. Abgesehen von ein paar durchweichten Flusen und einem gefalteten, blau linierten, triefenden Papierfetzen waren die Taschen des Toten leer. Ich zog den Papierfetzen mit spitzen Fingern heraus und nahm mir vor, mir später gründlich den Schmadder von den Händen zu schrubben.
Dann strich ich das Papier behutsam mit dem Daumen glatt, damit es nicht zerkrümelte. Ein paar Zahlen waren mit Bleistift daraufgeschrieben:
54, 6, 7, 8, 9
War das ein Datum oder ein Termin? Bezog sich die 54 auf das Jahr 1954, und 6,7,8 und 9 standen für die Monate Juni, Juli, August und September? Aber bis 1954 waren es noch zwei Jahre hin, denn wir hatten erst Juni 1952.
Die wenigsten Leute treffen ihre Verabredungen so weit im Voraus.
Oder handelte es sich um die Zahlenkombination für einen Safe oder dergleichen? Unwahrscheinlich. Es ist viel zu fehlerträchtig, vier einstellige, aufeinanderfolgende Zahlen einzustellen, wenn überhaupt. Wie mir Dogger in einer unserer Lehrstunden zum Thema »Die Kunst des Schlösserknackens« erläutert hatte, enthalten solche Kombinationen im Allgemeinen mindestens zwei weit auseinanderliegende Zahlen.
Dann vielleicht eine Telefonnummer?
Auf welches Fernsprechamt sich die ersten beiden Ziffern bezogen, wusste ich zwar nicht, aber ich konnte die Nummer ja einfach wählen und abwarten, wer abnahm.
So viele Möglichkeiten … was alles nur noch spannender machte. Denn Möglichkeiten sind immer aufregender als Gewissheiten, finde ich jedenfalls.
Ich wollte den feuchten Wisch schon wieder zurückstecken, als plötzlich ein Schatten über mich und den Toten fiel. Mir fuhr ein eisiger Stromstoß durch die Knochen.
Ich drehte mich um und hielt zum Schutz gegen die Sonne die Hand über die Augen, erkannte aber nur eine schwarze Silhouette.
»Was machst du da mit Orlando?«, fragte eine so barsche Stimme, dass mir vor Schreck beinahe das Herz stehen blieb. Die Sprecherin saß in einem altmodischen Korbrollstuhl und war so lautlos herangefahren, dass ich nichts gehört hatte.
»Was soll der Unsinn, Orlando? Findest du das lustig oder was? Steh sofort auf! Du machst ja dein Seidenkostüm schmutzig.«
Ich rappelte mich hastig hoch. »Entschuldigung, aber ich fürchte …«
»Du hast auch allen Grund, dich zu fürchten, du schamloses Ding! Was treibst du da? Antworte!«
Das Erste, was mir an der Frau auffiel, war ihre Nase, die an den Bug eines Schlachtkreuzers erinnerte. Sie ragte dermaßen spitz aus dem Gesicht hervor, dass sie jedes feindliche Großkampfschiff wie einen Weichkäse durchbohrt hätte.
Das schneeweiße Haar hatte sie am Hinterkopf so straff zu einem dicken Dutt zusammengezurrt, dass ihr Gesicht einem zum Platzen gefüllten Pickel glich.
Über ihren Knien lag eine Reisedecke, unter der die Spitze eines Reitstiefels hervorlugte, und ihr Tweedjackett klaffte über einem mächtigen Busen auf, den zusätzlich eine alte Schulkrawatte zierte. Ein sonderbares Sammelsurium von Kleidungsstücken.
»Was glotzt du so?«, fuhr sie mich an. »Haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht?«
Das brachte mich wieder zur Besinnung. Meine Eltern – sie mögen beide in Frieden ruhen – hatten mir etwas viel Wichtigeres beigebracht, nämlich, sich niemals einschüchtern zu lassen!
Mir war klar, dass ich angesichts des Verstorbenen eigentlich ein Brunnquell der Beileidsbekundungen hätte sein sollen, ein Fels in der Brandung der Trauer, doch die Frau war zu weit gegangen. Ich konnte mich nicht überwinden, sie anzufassen, geschweige denn in den Arm zu nehmen.
»Orlando ist tot«, sagte ich knapp. »Er ist ertrunken. Wir haben ihn aus dem Fluss gezogen.«
Sie hörte überhaupt nicht zu.
»Steh sofort auf, Orlando!«, blaffte sie. »In einer Stunde kommen die Hawthorne-Wests, und du weißt doch, dass Parthia nicht gern wartet!«
Vor dem Hintergrund der leuchtend grünen Wiese wirkte Orlandos blasses Gesicht noch fahler. Die Löwenzahnblüten neben seinen Ohren warfen gelbliche Schatten wie ranzige Butterkleckse auf seine Wangen.
»Es reicht!« Die Frau streckte den Fuß unter der Reisedecke hervor und versetzte der Schulter des Toten einen Stoß. »Steh endlich auf und komm mit.«
Nun packte ich sie doch am Arm. »Lassen Sie das bitte«, sagte ich. »Er ist tot. Die Polizei ist schon verständigt.«
Sie sah erst mich an, dann die Leiche und dann wieder mich. Auf einmal wurden ihre Augen ganz groß, und sie zog die wulstige, leicht schnurrbärtige Oberlippe zurück. Dann zerriss ein grausiger, an- und abschwellender Klagelaut die friedliche Stille wie das Jaulen einer geisteskranken Luftschutzsirene.
Das ohrenbetäubende Geheul brachte Feely und Daffy dazu, sich umzudrehen, doch sie blickten nur kurz zu uns herüber, dann widmeten sie sich, wie von Dogger befohlen, wieder der Beobachtung des Flusses.
»Nichts sehen und nichts hören«, lautete ihr Motto, und irgendwie konnte ich es ihnen nicht verdenken. Der Umgang mit Leichen ist eben nicht jedermanns Sache.
Wegschauen ist immer das Einfachste, aber dem Tod direkt ins Gesicht zu sehen erfordert mehr als einen Pferdemagen.
Unterdessen kam auch schon Dogger in Begleitung zweier Herren über den Kirchhof. Der eine war an seiner Uniform als Dorfpolizist zu erkennen, der andere – ein kugelrunder, gutmütig aussehender Bursche – an seinem weißen Kragen als der Vikar des Örtchens.
Gott sei Dank! Jetzt musste ich mich nicht mehr allein mit dieser heulenden Harpyie herumschlagen.
»Zurücktreten, bitte!«, kommandierte der Polizist erwartungsgemäß. Ich gehorchte erleichtert und entfernte mich ein gutes Stück, damit ich alles Weitere beobachten konnte, ohne selbst beobachtet zu werden. Solche kleinen Tricks sind das Erfolgsgeheimnis aller großen Ermittler.
Es klingt läppisch, ich weiß, aber so ist es nun mal.
Der Wachtmeister hob die Picknickdecke zögerlich an und spähte darunter. Als er sich vergewissert hatte, dass er es zweifelsfrei mit einem Toten zu tun hatte, zupfte er seine Uniformjacke zurecht, richtete seine Krawatte, drehte sich zu Dogger und mir um und sagte: »Tja, dann …«
Er deutete mit dem Daumen in Richtung Kirche und vermutlich auch in Richtung Dorf.
»Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich alle ins Fasan und Eiche begeben würden. Falls Ihnen danach ist – der Wirt macht Ihnen gern etwas zu essen. Ich komme dann nach.«
Falls Ihnen danach ist? War das rücksichtsvoll gemeint? Oder eher scherzhaft? Wollte dieser Dorftrottel uns veralbern?
Am liebsten hätte ich erwidert, dass ich bei der Untersuchung aufgedunsener Leichen mit Vorliebe kalten Braten mampfte.
Gerade noch rechtzeitig fing ich Doggers warnenden Blick auf.
»Sehr fürsorglich von Ihnen, Wachtmeister«, erwiderte ich, »aber ich glaube, ich könnte eher etwas Riechsalz gebrauchen.«
Damit lächelte ich ihn, wie es von einem Mädchen meines Alters erwartet wurde, schüchtern an und überließ es ihm, sich sein Teil dabei zu denken.
»Haben wir genug gesehen?«, zischelte ich Dogger unauffällig zu, als wir zum Boot gingen, um Feely und Daffy zu holen.
»Und ob, Miss Flavia«, entgegnete er. »Mehr als genug.«
3
Wie abscheulich!«, jammerte Daffy, als wir um den Tisch im Hinterzimmer des Fasan und Eiche Platz nahmen.
Ich hatte keinen blassen Schimmer, ob sie den Gasthof, die Leiche oder die heulende Frau im Rollstuhl meinte, die wir in der Obhut des Wachtmeisters zurückgelassen hatten.
Aber es war mir auch egal.
Feely rutschte auf der Stuhlkante herum und ließ den Blick durch den Raum huschen. Mir war sofort klar, dass es ihr gar nicht behagte, mit einem Dienstboten am selben Tisch zu sitzen.
Keine Ahnung, was sie damit für ein Problem hatte. Die einzigen anderen Anwesenden waren ein paar schäbig gekleidete Männer von unterschiedlicher Statur, die bunte Tücher um den Hals geknotet hatten und damit beschäftigt waren, einander auf die Schultern zu hauen und unter schallendem Gelächter Witze zum Besten zu geben.
Dogger hingegen schien das alles nichts auszumachen. Wir waren hier im Urlaub, und er ebenso. Da spielten Rang und Stellung keine Rolle mehr, zumindest hätte es so sein sollen. Seit dem Krieg hatte sich vieles geändert, doch Feely war noch in einer anderen Welt aufgewachsen, und das machte sich jetzt bemerkbar.
Meine Schwester tat mir leid. Sie hatte es nicht leicht – vor allem in letzter Zeit nicht. Sie trauerte nicht nur um unseren Vater, sondern auch um ihre immer wieder verschobene Hochzeit. Für jemanden, der es gewohnt war, stets seinen Willen durchzusetzen, musste so etwas dem Weltuntergang ziemlich nahe kommen.
»Was darf’s sein?«, fragte der Wirt mit gezücktem Bleistift. »Viermal Bauernfrühstück?« Mit seiner Schürze und den hochgekrempelten Hemdsärmeln glich er der Karikatur eines Gastwirtes im Punch.
»Ein Guinness, bitte«, sagte Feely, und ich kippte fast vom Stuhl. Es war das erste Mal, dass sie seit dem Frühstück den Mund aufmachte.
»Sind Sie denn schon über achtzehn, Miss?«, erkundigte sich der Wirt. »Nichts für ungut, aber ich muss das fragen.«
»Ich kann mich für sie verbürgen«, sagte Dogger.
»Ich nehme das Gleiche«, platzte Daffy heraus, und der Mann war zu verdutzt, um seine Frage zu wiederholen. Anscheinend hatte auch Daffy der Fund der Leiche mehr zugesetzt, als ich angenommen hatte.
»Für mich eine Limonade«, sagte ich rasch. »Und wenn es nicht zu viel Mühe macht, wäre es nett, wenn Sie das Glas vor dem Einschenken drei Minuten lang auf dem Herd anwärmen könnten.«
Es ist immer gut, jemandem eine absurde Aufgabe aufzutragen. Dann weiß derjenige gleich, dass man nicht irgendwer ist.
Im Zuge der laufenden Ermittlung würden wir garantiert einige Zeit in diesem Kaff verbringen müssen, und da wollte ich gleich zu Anfang klare Fronten schaffen. Wenn man damit zu lange wartet, wird es meist schwer, nachträglich Respekt einzufordern, zumal wenn man es mit Wildfremden zu tun hat.
Der Wirt musterte mich skeptisch, notierte meine Bestellung aber.
»Und Sie, Sir?«, wandte er sich an Dogger.
»Milch, bitte«, antwortete Dogger. »Ein kleines Glas. Die Milch ist doch pasteurisiert, oder?«
»Pasteurisiert und vom Pastor gesegnet!«, gab der Wirt lachend zurück und klatschte sich aufs Knie. »So was Pasteurisiertes haben Sie Ihr Lebtag noch nicht getrunken. Grad gestern hab ich noch zu Mr Clemm, unsrem Vikar, gesagt: ›Unsre Küche beschert Ihnen keine Kunden!‹ – für den Friedhof, mein ich. Er war überhaupt nicht amüsiert – ganz wie die gute alte Königin Victoria.«
Ich hörte nicht mehr hin. Die Gefahren nicht pasteurisierter Milch waren mir nur allzu bekannt.
Schließlich war der Chemiker Louis Pasteur einer meiner Helden. Ich hatte mir die Symptome der Tuberkulose – auch Schwindsucht oder Auszehrung genannt – eifrig eingeprägt und konnte jederzeit erklären, wie der Erreger das Lungengewebe des Opfers in Käse verwandelte. Der Kranke läuft blau an, weil das Blut zu viel Kohlendioxid enthält, er bekommt hohes Fieber und leidet unter rasselndem Husten, Herzrasen, Muskelschwund, Nachtschweiß und Krampfanfällen – wobei er, was besonders grausam ist, fast bis zum Schluss geistig klar bleibt.
Nachdem ich das erste Mal von diesen schrecklichen Symptomen gelesen hatte, hatte ich keinen Tropfen Milch mehr angerührt, den ich nicht zuvor in meinem Labor persönlich pasteurisiert und anschließend unter dem Mikroskop gründlich auf gefährliche Bazillen untersucht hatte.