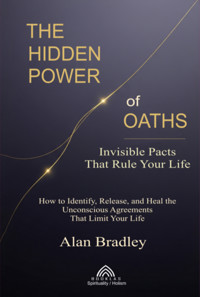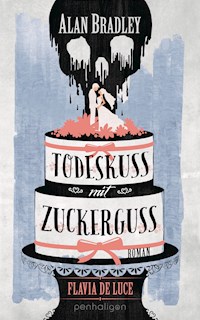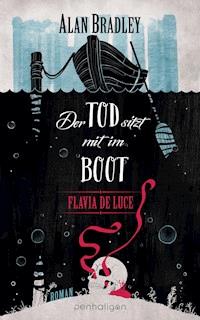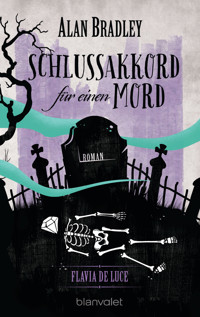9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Flavia de Luce
- Sprache: Deutsch
Wer Wednesday Addams als Ermittlerin liebt, kommt an Flavia de Luce nicht vorbei.
Endlich kehrt Flavia vom Internat in Kanada zurück nach Buckshaw, nur um dort zu erfahren, dass ihr Vater im Krankenhaus liegt und keinen Besuch empfangen darf. Um ihren boshaften Schwestern zu entkommen, schwingt Flavia sich auf ihr Fahrrad: Sie soll für die Frau des Pfarrers eine Nachricht an den abgeschieden lebenden Holzbildhauer Mr. Sambridge überbringen. Doch niemand öffnet. Neugierig betritt Flavia die Hütte und ist überrascht, einen Stapel Kinderbücher im Zuhause des ruppigen Junggesellen zu entdecken. Und noch ein unerwarteter Fund steht Flavia bevor – denn an der Schlafzimmertür hängt, kopfüber gekreuzigt, der tote Mr. Sambridge …
Diese außergewöhnliche All-Age-Krimireihe hat die Herzen von Lesern, Buchhändlern und Kritikern aus aller Welt im Sturm erobert!
Die »Flavia de Luce«-Reihe:
Band 1: Mord im Gurkenbeet
Band 2: Mord ist kein Kinderspiel
Band 3: Halunken, Tod und Teufel
Band 4: Vorhang auf für eine Leiche
Band 5: Schlussakkord für einen Mord
Band 6: Tote Vögel singen nicht
Band 7: Eine Leiche wirbelt Staub auf
Band 8: Mord ist nicht das letzte Wort
Band 9: Der Tod sitzt mit im Boot
Band 10: Todeskuss mit Zuckerguss
Außerdem (nur) als E-Book erhältlich:
Das Geheimnis des kupferroten Toten (»Flavia de Luce«-Short-Story)
Alle Bände sind auch einzeln lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Endlich kehrt Flavia vom Internat in Kanada zurück nach Buckshaw, nur um dort zu erfahren, dass ihr Vater im Krankenhaus liegt und keinen Besuch empfangen darf. Um ihren boshaften Schwestern zu entkommen, schwingt Flavia sich auf ihr Fahrrad: Sie soll für die Frau des Pfarrers eine Nachricht an den abgeschieden lebenden Holzbildhauer Mr. Sambridge überbringen. Doch niemand öffnet. Neugierig betritt Flavia die Hütte und ist überrascht, einen Stapel Kinderbücher im Zuhause des ruppigen Junggesellen zu entdecken. Und noch ein unerwarteter Fund steht Flavia bevor – denn an der Schlafzimmertür hängt, kopfüber gekreuzigt, der tote Mr. Sambridge …
Autor
Alan Bradley wurde 1938 in der kanadischen Provinz Ontario geboren. Nach einer Laufbahn als Elektrotechniker, zuletzt als Direktor für Fernsehtechnik an der Universität von Saskatchewan, zog Alan Bradley sich 1994 aus dem aktiven Berufsleben zurück, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Mord im Gurkenbeet war sein erster Roman und der viel umjubelte Auftakt zu seiner weltweit erfolgreichen Serie um die außergewöhnliche Detektivin Flavia de Luce. Alan Bradley lebt zusammen mit seiner Frau Shirley auf der Isle of Man.
Von Alan Bradley bereits erschienen
Mord im Gurkenbeet · Mord ist kein Kinderspiel · Halunken, Tod und Teufel · Vorhang auf für eine Leiche · Schlussakkord für einen Mord · Tote Vögel singen nicht · Eine Leiche wirbelt Staub auf · Der Tod sitzt mit im Boot · Todeskuss mit Zuckerguss
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
ALAN BRADLEY
FLAVIA DE LUCE
Roman
Deutsch von Gerald Jung und Katharina Orgaß
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Thrice the Brinded Cat Hath Mew’d« bei Delacorte Press, New York.
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Alan Bradley Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: Dr. Rainer Schöttle Covergestaltung und -illustration: Isabelle Hirtz, Inkcraft AF · Herstellung: sam Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-20362-7 V003 www.penhaligon-verlag.de
Für Shirley – damals, jetzt und immer
Die scheckige Katz’ hat dreimal miaut.
Dreimal und einmal der Igel gequiekt.
Die Harpyie schreit: – ’s ist Zeit.
Um den Kessel dreht euch rund,
Werft das Gift in seinen Schlund.
Kröte, die im kalten Stein
Tag’ und Nächte, dreimal neun,
Zähen Schleim im Schlaf gegoren,
Sollst zuerst im Kessel schmoren!
Mischt, ihr alle, mischt am Schwalle!
Feuer, brenn’, und Kessel, walle!
Sumpf’ger Schlange Schweif und Kopf
Brat’ und koch’ im Zaubertopf;
Molchesaug’ und Unkenzehe,
Hundemaul und Hirn der Krähe;
Zäher Saft des Bilsenkrauts,
Eidechsbein und Flaum vom Kauz;
Mächt’ger Zauber würzt die Brühe,
Höllenbrei im Kessel glühe!
Mischt, ihr alle, mischt am Schwalle!
Feuer, brenn’, und Kessel, walle!
WILLIAM SHAKESPEARE,Macbeth, vierter Aufzug, erste Szene
1
Der Winterregen peitscht mir wie eisige Rasierklingen ins Gesicht, doch das kümmert mich nicht. Ich senke den Kopf, vergrabe das Kinn im Kragen meines Regenmantels und strample wie eine Irre gegen die wütenden Windböen an.
Ich radle ins Dorf, nach Bishop’s Lacey, als wären mir sämtliche Teufel der Hölle auf den Fersen.
Die vergangenen vierundzwanzig Stunden waren ein einziger Albtraum. Ich will nur noch weg von Buckshaw.
Unter uns ächzen Gladys’ Reifen schauerlich. Die schneidende Kälte ist ihr in die stählernen Knochen und die Sehnen ihrer Bremszüge gekrochen. Sie hüpft halsbrecherisch über den nassen Asphalt, droht von der Straße abzukommen und mich in den kalten Graben zu werfen.
Am liebsten würde ich einfach in den Wind hineinschreien, aber ich beherrsche mich. Wenigstens eine von uns beiden muss bei Verstand bleiben.
Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen.
Obwohl ich erst nach Kanada auf Miss Bodycotes Höhere Mädchenschule verbannt und anschließend von dort wieder nach Hause zurückgeschickt wurde – was man, wenn man will, als doppelte Schande sehen kann –, gestehe ich, dass ich mich darauf gefreut hatte, wieder mit meiner Familie vereint zu sein: mit Vater, meinen beiden älteren Schwestern Feely und Daffy, unserer Köchin und Haushälterin Mrs. Mullet und vor allem mit Dogger, Vaters treuem Faktotum und rechter Hand in allen Belangen.
Wie wohl jeder Reisende, der den Atlantik überquert, hatte ich mir meine Rückkehr nach England in den leuchtendsten Farben ausgemalt. Vater, Feely und Daffy würden mich am Hafen erwarten, vielleicht hatte sich sogar Tante Felicity dem Begrüßungskomitee angeschlossen. »WILLKOMMENZUHAUSE, FLAVIA!«-Transparente würden entfaltet, dazu ein paar Luftballons und was sonst noch dazugehört. Natürlich alles sehr diskret, denn wie ich selbst auch neigt keiner von uns de Luces zu übertriebenen Gefühlsbekundungen.
Doch als unser Schiff endlich in Southampton anlegte, bestand das Begrüßungskomitee lediglich aus Dogger, der reglos unter einem tropfenden schwarzen Regenschirm stand.
Ein bisschen verlegen nach der langen Trennung, hatte ich ihm die Hand geschüttelt, statt meinem Instinkt nachzugeben und ihm stürmisch um den Hals zu fallen. Ich bereute es sofort, doch da war es schon zu spät: Der Augenblick war vorbei, die Gelegenheit ungenutzt verstrichen.
»Ich muss Ihnen leider eine schlechte Nachricht überbringen, Miss Flavia«, hatte Dogger gesagt. »Colonel de Luce geht es nicht gut. Er hat eine Lungenentzündung und liegt im Krankenhaus.«
»Vater? Im Krankenhaus? In Hinley?«
»Leider ja.«
»Wir müssen sofort zu ihm!«, sagte ich. »Wann können wir dort sein?«
Wie mir Dogger erläuterte, hatten wir noch eine lange Reise vor uns. Der Zug um zwanzig nach fünf würde uns von Southampton nach London zum Bahnhof Waterloo bringen. Wenn wir dort gegen sieben Uhr abends ankämen, mussten wir mit dem Taxi eilig quer durch die Stadt zu einem anderen Bahnhof brausen, um den Anschlusszug noch zu erwischen.
Bis wir am späten Abend in Doddingsley eingetroffen wären, und noch später in Bishop’s Lacey, Hinley und im Krankenhaus, wäre die Besuchszeit längst um.
»Aber Dr. Darby kann doch bestimmt …«, setzte ich an.
Dogger schüttelte nur betrübt den Kopf, und erst da begriff ich, wie ernst es um Vater stehen musste.
Dogger gehörte nicht zu den Menschen, die einem einreden wollen, dass alles gut wird, wenn sie genau wissen, dass es nicht stimmt. Sein Schweigen sagte alles.
Obwohl wir so viel zu bereden gehabt hätten, wechselten wir während der Zugfahrt kaum ein Wort miteinander. Wir schauten mit ausdruckslosen Mienen durch die von Regenrinnsalen gestreiften Fenster auf die vorbeigleitende Landschaft, die in der anbrechenden Dämmerung bläulich wie ein verblassender Bluterguss aussah.
Zwischendurch schielte ich verstohlen zu Dogger hinüber, hatte aber offenbar die Fähigkeit eingebüßt, seinen Gesichtsausdruck zu deuten.
Dogger und Vater hatten in japanischer Kriegsgefangenschaft Schreckliches durchgemacht, und die Erinnerung daran überfiel Dogger immer noch ab und zu mit solcher Macht, dass er sich in ein wimmerndes Häufchen Elend verwandelte.
Ich hatte ihn mal gefragt, wie Vater und er es damals geschafft hatten, am Leben zu bleiben.
»Indem wir uns zusammengerissen haben«, hatte seine Antwort gelautet.
Während meiner Abwesenheit hatte ich mir fast die ganze Zeit Sorgen um Dogger gemacht, doch nach dem, was er schrieb, schien es ihm im Großen und Ganzen gut zu gehen, auch wenn ich ihm offenbar fehlte. Dogger war übrigens der Einzige, der mir während meiner Kerkerhaft in Kanada überhaupt geschrieben hatte – was einiges über die Innigkeit der Beziehungen innerhalb der Familie de Luce aussagt.
Ach ja, und da gab es noch diese unbedeutende Randerscheinung in Gestalt meiner wie aus dem Nichts aufgetauchten Cousine Undine, die durch das Schicksal sowie den grausigen Tod ihrer Mutter auf der Schwelle von Buckshaw ausgesetzt worden war. Welche Stellung sie in der Familie einnehmen würde, musste sich erst noch zeigen, aber ich machte mir diesbezüglich keine großen Hoffnungen. Sie war noch ein Kind, deshalb freute ich, die ich schon zwölf war und wusste, wie es auf der Welt zuging, mich nicht besonders darauf, unsere kurze Bekanntschaft zu erneuern. Sollte ich aber feststellen müssen, dass sie in der Zwischenzeit in meinen Sachen herumgewühlt hatte, dann würde unser beschauliches Herrenhaus einen noch nie da gewesenen Aufstand erleben.
Es war schon längst dunkel, als der Zug endlich in den Bahnhof von Doddingsley rollte, wo Clarence Mundys Taxi schon auf uns wartete, um uns im strömenden Regen nach Buckshaw zu befördern. Die feuchtkalte Luft kroch durch die Kleidung, und die trübe Bahnhofsbeleuchtung verströmte einen dunstig trüben, gespenstisch gelben Schein, sodass es mir vorkam, als hätte ich Tränen in den Augen.
»Schön, dass Sie wieder da sind, Miss«, raunte mir Clarence beim Einsteigen zu und tippte sich an den Mützenschirm. Das war alles, was er sagte – als wäre ich eine Schauspielerin, die geschminkt und kostümiert gleich die Bühne betreten wird und schon in ihrer Rolle ist, und er der Inspizient des Theaters, der respektvoll und professionell Abstand wahrt.
In allgemeinem Schweigen fuhren wir durch Bishop’s Lacey und weiter nach Buckshaw. Dogger sah stur geradeaus, und ich spähte so angestrengt aus dem Fenster, als könnte ich die Dunkelheit mit meinen Blicken durchdringen.
Meine Heimkehr hatte ich mir wahrlich anders vorgestellt.
Mrs. Mullet wartete schon an der Haustür und zog mich an ihren mächtigen Busen. »Ich hab dir ein paar Brote geschmiert«, verkündete sie mit so untypisch belegter Stimme, dass ich sie kaum verstand. »Mit Kopfsalat und kaltem Braten, die magst du doch am liebsten. Sie stehen auf der Kommode neben deinem Bett. Du bist bestimmt todmüde.«
»Vielen Dank, Mrs. Mullet«, hörte ich mich erwidern. »Sehr aufmerksam von Ihnen.«
War das wirklich Flavia de Luce, die da sprach? Ausgeschlossen! In meiner momentanen Verfassung konnte ich mir kaum etwas Ekelerregenderes vorstellen als Scheiben von totem Rind, garniert mit Blättern der hiesigen Vegetation, doch aus irgendeinem Grund biss ich mir auf die Zunge, statt dieses Thema weiter zu vertiefen.
»Die anderen sind schon im Bett«, setzte Mrs. Mullet hinzu, und meinte damit Feely, Daffy und vermutlich auch Undine. »Es war ein sehr anstrengender Tag.«
Ich nickte und musste plötzlich an meine nächtliche Ankunft in Miss Bodycotes Höherer Mädchenschule denken. Das wurde anscheinend zur Gewohnheit.
War es nicht merkwürdig, dass mein eigen Fleisch und Blut nicht wach geblieben war, um mich zu begrüßen? Oder erwartete ich einfach zu viel? Ich war erst seit September weg, das schon, aber trotzdem … Wenigstens eine von ihnen …
Ich verscheuchte den Gedanken.
War denn wirklich gar niemand aufgeblieben, um mich willkommen zu heißen? Jetzt hätte ich mich sogar über Undines rausgestreckte Zunge gefreut! Aber sie war bestimmt längst ins Bett geschickt worden und in das Reich ihrer boshaften Träume übergewechselt, die sie im Wachzustand beflügelten.
Dann fiel mir Esmeralda ein. Esmeralda!
Die reizende Esmeralda, mein Stolz und meine Freude. Dass sie eine Buff-Orpington-Henne war, tat dem keinen Abbruch. Liebe ist Liebe, ganz gleich, auf wen sie sich richtet – selbst wenn es nur ein Federvieh ist.
»Bin gleich wieder da«, sagte ich zu Mrs. M. »Ich will nur eben Esmeralda Hallo und Gute Nacht sagen.«
Mrs. Mullet hielt mich am Ellbogen fest. »Es ist schon spät, Schätzchen. Du willst doch morgen früh ausgeschlafen sein, wenn du deinen Vater besuchst.«
»Nein«, erwiderte ich, »ich will zu Esmeralda«, und ich riss mich los.
»Miss Flavia …!«, rief sie mir nach, als ich mit großen Schritten die Eingangshalle durchquerte. Als ich mich flüchtig umdrehte, sah ich Dogger den Kopf schütteln, als wollte er sie zum Schweigen bringen.
Im Garten war es nass und dunkel, aber den Weg zum Gewächshaus hätte ich auch blind gefunden.
»Esmeralda!«, rief ich schon von Weitem, um sie nicht unvermittelt aus dem Schlaf zu reißen. »Rate mal, wer wieder da ist! Ich bin’s – Flavia!«
Ich öffnete die verglaste Tür und tastete nach dem Lichtschalter. Die nackte Glühbirne an der Decke flammte auf und blendete mich kurz.
Esmeraldas Käfig in der Ecke war leer.
Wenn man überrascht und überrumpelt ist, versagt der menschliche Verstand manchmal, und man verhält sich völlig abwegig. Das erklärt, weshalb ich den Käfig hochhob und darunterspähte – als könnte es Esmeralda gelungen sein, sich dünn wie ein Blatt Papier zu machen und schelmisch glucksend unter ihrer Behausung zu verstecken, um mir zur Begrüßung einen Streich zu spielen.
Eine Staubwolke stieg auf und wurde von dem Luftzug, der durch die offene Tür kam, davongeweht. Der Käfig war eindeutig schon länger nicht mehr von der Stelle bewegt worden.
»Esmeralda?«
Meine Nackenhaare sträubten sich, meine Stimme klang nach Panik.
»Esmeralda!«
»Es tut uns so leid, Schätzchen. Wir wollten es dir eigentlich sagen, aber …«
Als ich wie angestochen herumfuhr, sah ich Mrs. Mullet und Dogger in der Tür stehen.
»Was haben Sie mit ihr gemacht?«, rief ich, doch ich ahnte die Antwort schon, ehe mir die Frage richtig über die Lippen gekommen war.
»Sie haben sie geschlachtet, stimmt’s?« Meine Stimme war jetzt kalt vor Zorn. Ich blickte von der einen zu dem anderen und hoffte verzweifelt auf ein »Nein«, auf eine einfache, nachvollziehbare, harmlose Erklärung.
Doch sie blieb aus. Was im Grunde egal war, denn ich hätte sie den beiden sowieso nicht abgenommen.
Mrs. M. schlang die Arme um sich, halb, um sich zu wärmen, und halb, um sich zu schützen.
»Wir wollten es dir sagen, Schätzchen«, wiederholte sie.
Doch die beiden brauchten nichts mehr zu sagen. Es war offensichtlich. Ich konnte es mir nur allzu lebhaft vorstellen: wie die Käfigtür aufgerissen und der warme, gefiederte Rumpf gepackt wurde, das panische Gackern, die Todesangst, die Axt, der Hackklotz, das Blut, das Rupfen, das Ausnehmen, das Füllen, das Zunähen, das Braten, das Zerlegen, das Auftragen … das Verzehren …
Kannibalen.
Kannibalen!
Ich drängelte mich unsanft zwischen den beiden hindurch und floh ins Haus.
Das Zimmer, das ich mir zum Schlafzimmer erkoren hatte, lag am äußersten Ende des unbeheizten Ostflügels, gleich neben meinem Chemielabor, das noch zu Königin Viktorias Zeiten für meinen verstorbenen Großonkel Tarquin de Luce eingerichtet worden war. Obwohl Onkel Tar schon über zwanzig Jahre tot war, hätte sein Labor sämtliche Chemiker der Welt vor Neid erblassen lassen – wenn sie denn davon gewusst hätten.
Zu meinem großen Glück war der Raum samt all seinen Wundern völlig in Vergessenheit geraten, bis ich ihn beschlagnahmt und mich darangemacht hatte, mir das Handwerkszeug des Chemikers im Selbststudium anzueignen.
Ich stieg auf mein Bett und holte den Laborschlüssel aus seinem Versteck, das aus einer Tapetenbeule bestand, die sich von der Decke gelöst hatte. Dann schnappte ich mir eine altmodische Kautschukwärmflasche von der ebenso altmodischen Kommode, schloss die Labortür auf und trat ein.
Ich hielt ein Streichholz an einen Bunsenbrenner, füllte Wasser in einen Glaskolben, setzte mich auf einen Hocker und wartete darauf, dass das Wasser kochte.
Erst dann gestattete ich mir, in heiße, bittere Tränen auszubrechen.
Wie oft hatte Esmeralda hier gesessen, an eben dieser Stelle, und mir von einem Reagenzgläserständer aus dabei zugeschaut, wie ich in einem Becherglas eins ihrer Eier als kleinen Imbiss weich gekocht hatte.
Sicherlich gibt es Menschen, die meine innige Zuneigung zu einem Huhn als kindisch abtun würden, aber denen kann ich nur entgegenschleudern: »Ihr könnt mich mal!« Ein geliebtes Tier enttäuscht einen nie, ganz anders als unsere eigenen elenden Artgenossen.
Ich dachte daran, wie sich Esmeralda kurz vor ihrem Ende gefühlt haben musste. Diese Vorstellung war so herzzerreißend, dass ich sie schließlich verdrängte und stattdessen an ein anderes Huhn dachte, das ich einmal in der Nähe von Bishop’s Lacey vom Fahrrad aus dabei beobachtet hatte, wie es vor dem Hackklotz geflüchtet war.
Ich konzentrierte mich noch auf dieses Bild, als es leise klopfte. Ich trocknete mir mit dem Rocksaum rasch die Augen, putzte mir die Nase und rief: »Wer ist da?«
»Dogger, Miss.«
»Herein«, sagte ich und hoffte, dass mein Ton nicht allzu eisig war.
Dogger trat lautlos ein und ersparte es mir, etwas zu sagen, indem er als Erster das Wort ergriff.
»Was Esmeralda betrifft …«, sagte er und wartete ab, wie ich reagieren würde.
Ich schluckte, beherrschte mich aber insoweit, dass mein Kinn nicht zitterte.
»Colonel de Luce musste nach London fahren, um mit der Steuerbehörde zu verhandeln. Im Zug muss er sich mit dem Grippevirus angesteckt haben. Dieses Jahr gibt es besonders viele Erkrankte, in manchen Gegenden sogar noch mehr als während der großen Grippewelle neunzehnhundertachtzehn. Sein Zustand verschlechterte sich rasch, und aus der Grippe wurde eine Lungenentzündung. Dein Vater brauchte dringend eine heiße, stärkende Brühe, denn er war so krank, dass er nichts anderes bei sich behalten konnte. Ich übernehme die volle Verantwortung, Miss Flavia, aber ich habe darauf geachtet, dass Esmeralda nicht leiden musste. Ich habe sie in den seligen Trancezustand versetzt, in den sie immer verfiel, wenn man sie unter dem Kinn gekrault hat. Und es tut mir ehrlich leid.«
Als die Wut von mir wich, fiel ich in mich zusammen wie ein durchlöcherter Luftballon. Wie konnte ich jemanden hassen, der meinem Vater höchstwahrscheinlich das Leben gerettet hatte?
Weil ich aber keine passenden Worte fand, schwieg ich weiter.
»Unsere Welt verändert sich unaufhaltsam«, sagte Dogger nach einer längeren Pause, »und leider nicht unbedingt zum Besseren.«
Ich gab mir Mühe, zwischen den Zeilen dieser Bemerkung zu lesen und eine angemessene Erwiderung zu finden.
»Vater …«, sagte ich schließlich, »… wie geht es ihm jetzt? Die Wahrheit bitte.«
Ein Schatten huschte über Doggers Gesicht, der Geist eines unliebsamen Gedankens. Aus den spärlichen Brocken, die ich ihm über seine Vergangenheit hatte entlocken können, hatte ich geschlossen, dass er großes medizinisches Fachwissen besaß, doch seit der Kriegsgefangenschaft war er ein gebrochener Mann. Trotzdem war er nicht fähig, eine ehrliche Frage nicht ehrlich zu beantworten, koste es, was es wolle, und das rechnete ich ihm hoch an.
»Er ist sehr krank«, lautete die Antwort. »Als er aus der Stadt zurückkam, hatte er schon Husten und neununddreißig Grad Fieber, typisch für eine Grippeinfektion. Das Virus tötet außerdem die natürlichen Bakterien in den Nasenschleimhäuten ab, sodass auch die Lungen angegriffen werden. Eine Lungenentzündung ist die Folge.«
»Danke, Dogger«, sagte ich. »Ich weiß deine Ehrlichkeit zu schätzen. Muss er sterben?«
»Das weiß ich nicht, Miss Flavia. Niemand weiß das. Dr. Darby ist ein guter Arzt. Er tut sein Möglichstes.«
»Nämlich?« Wenn es sein muss, bin ich unerbittlich.
»Es gibt da ein neues Medikament. Es kommt aus Amerika und heißt Aureomycin.«
»Chlortetracyclin!«, rief ich aus. »Das ist ein Antibiotikum!«
Die Entdeckung und Gewinnung von Chlortetracyclin aus einer Bodenprobe aus Missouri hatte in einer Ausgabe von Neueste Erkenntnisse und Methoden in der Chemie Erwähnung gefunden, einer Fachzeitschrift, die aufgrund von Onkel Tars lebenslangem Abonnement und des Versäumnisses meiner Familie, den Verlag von seinem Dahinscheiden in Kenntnis zu setzen, immer noch pünktlich wie ein chemisches Uhrwerk in Buckshaw eintraf, obwohl ihr ursprünglicher Leser schon über zwanzig Jahre tot war.
»Danke!«, entschlüpfte es mir, denn ich war sicher, dass Dogger bei Vaters Behandlung mit diesem Medikament irgendwie die Hand im Spiel gehabt hatte.
»Bedank dich lieber bei Dr. Darby. Und natürlich beim Entdecker des Wirkstoffs.«
»Bei den beiden auch!«
Ich nahm mir im Stillen vor, Dr. Duggar – hieß er nicht so? – künftig in mein Nachtgebet einzuschließen, jenen amerikanischen Botaniker, der den Wirkstoff aus einer Handvoll Gartenerde gewonnen hatte.
»Warum hat er die Substanz eigentlich ›Aureomycin‹ getauft?«, wandte ich mich wieder an Dogger.
»Wegen ihrer goldgelben Färbung. ›Aureus‹ heißt auf Griechisch ›golden‹, und ›mykes‹ bedeutet ›Pilz‹.«
Wie einfach das doch im Grunde alles war! Warum konnte nicht das ganze Leben so logisch sein wie der Mann aus Missouri mit seinem Mikroskop?
Mir drohten die Augen zuzufallen. Bleierne Lider, ging es mir durch den Kopf, und ich unterdrückte ein Gähnen.
Ich hatte schon seit Ewigkeiten nicht mehr richtig geschlafen. Und wer wusste schon, wann ich wieder Gelegenheit dazu haben würde?
»Gute Nacht, Dogger«, sagte ich und füllte das heiße Wasser in die Wärmflasche. »Und noch mal Danke.«
»Gute Nacht, Miss Flavia.«
Als ich am nächsten Morgen die geröteten Augen aufschlug, erblickte ich als Erstes das zugedeckte Sandwich, das immer noch vorwurfsvoll auf der Kommode thronte.
Vielleicht sollte ich meinen Widerwillen überwinden und es einfach essen, ging es mir durch den Kopf. Ich hatte mir schon so viele Predigten darüber anhören müssen, dass man in Zeiten der Lebensmittelrationierung kein Essen vergeuden durfte, dass ich ganz automatisch ein schlechtes Gewissen bekam – es schaltete sich so zuverlässig ein wie eine Alarmanlage bei einem Einbruch.
Ich unterdrückte ein Würgen, ergriff den Teller und zog das Geschirrtuch weg. Darunter lagen zwei noch warme, getoastete Hefebrötchen, die aufgeschnitten und mit Honig bestrichen waren, ganz so, wie ich es am liebsten hatte.
»Du bist unbezahlbar, Dogger«, sagte ich laut, als ich mich im Bett aufsetzte und mir ein Kissen in den Rücken stopfte. »Du bist die Crème de la Crème – einfach der Allerbeste.«
Während ich kaute, kam mein Zustand dem der Zufriedenheit ziemlich nahe, und ich ließ den Blick durchs Zimmer schweifen. Es war schön, wieder zu Hause zu sein, im eigenen Bett zu sitzen, dem vertrauten Tick-Tack meines eigenen ramponierten Weckers zu lauschen und die Flecken auf der hässlichen, altmodischen gelben Tapete zu betrachten, in deren rötlichem Schnörkelmuster man – wenn man die Augen ein bisschen zusammenkniff – einen Senftopf erkennen konnte, aus dem ein Teufel hervorlugte.
Das alles gehörte jetzt mir, beziehungsweise würde bald mir gehören, und ich konnte damit nach Belieben verfahren. Schwer zu glauben, aber wahr. Als das Testament meiner Mutter Harriet zehn Jahre nach ihrem Tod aufgetaucht war, hatten alle – nicht zuletzt ich selbst – mit äußerster Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass sie Buckshaw mir vermacht hatte.
Das ganze große Haus.
Mit allem Drum und Dran.
Zwar musste noch einiges geregelt und wahrscheinlich noch tonnenweise Papierkram erledigt werden, aber über kurz oder lang wäre ich die Besitzerin des Hauses.
Was ich jetzt sage, mag herzlos klingen, aber ich hatte das ganze letzte Jahr versucht, den Gedanken an die Verantwortung zu verdrängen, die dann auf meinen Schultern lasten würde – ab jenem Tag, an dem alles in trockenen Tüchern und ich die Burggräfin, die Herrin über Buckshaw wäre.
Die Beziehung zu meinen Schwestern war nicht die allerbeste, nicht mal in guten Zeiten. Bei der bloßen Vorstellung, wie sich diese Beziehung erst gestalten würde, wenn mir die Betten gehörten, in denen sie schliefen, ja sogar die Löffel, mit denen sie aßen, überlief es mich eiskalt.
Feely war allerdings mit Dieter Schrantz verlobt und würde bald ausziehen, vielleicht sogar schon im Sommer. Aber Daffy, ausgerechnet Daffy, vor der ich mich am meisten fürchtete, war eine nicht zu unterschätzende Gegnerin.
Sie war genauso hinterlistig wie ich. Und weil wir Schwestern waren, kannte sie keine Gnade.
Bei meiner gestrigen Ankunft waren beide schon im Bett gewesen, weshalb sich noch herausstellen musste, was für einen Empfang sie mir bereiten würden. Das Frühstück würde zum Schlachtfeld werden.
Ich musste Augen und Ohren offen halten und auf alles gefasst sein.
Ich stand auf, zog mich an, wusch mir das Gesicht und flocht mir die Zöpfe so ordentlich, wie ich nur konnte. Der erste Eindruck war entscheidend. Ich musste Feely und Daffy demonstrieren, dass ich auf Miss Bodycotes Höherer Mädchenschule etwas gelernt hatte – dass ich nicht mehr die einfältige kleine Schwester war, die man im September in die Fremde geschickt hatte.
Ich durfte den beiden keinen Angriffspunkt liefern.
Sollte ich mir eine Blume ins Haar stecken? Doch kaum war mir der Gedanke gekommen, verwarf ich ihn schon wieder. Vater lag im Krankenhaus, da wären Blumen taktlos. Außerdem hatten wir Dezember, und Blumen waren dünn gesät. Ich hatte zwar in der Eingangshalle einen Topf mit einem Weihnachtsstern erspäht, aber seine blutroten Blätter passten nicht zum Ernst der Lage.
Vielleicht sollte ich einfach lässig hereinschlendern, mich an den Frühstücktisch setzen und mir eine Zigarette anzünden. Dann würden alle sofort begreifen, dass ich inzwischen erwachsen geworden war.
Dumm nur, dass ich nicht rauchte. Rauchen war eine abscheuliche Angewohnheit. Und Zigaretten hatte ich auch keine.
Würdevoll schritt ich die Ostflügeltreppe hinunter, mit gestrafften Schultern und erhobenem Kinn, als balancierte ich eine unsichtbare Bibel auf dem Kopf.
Haltung und Schicklichkeit – Feelys Lieblingsthema, über das sie sich endlos auslassen konnte. Ein paar zusätzliche Tipps hatte ich einer zerlesenen Ausgabe von Die Dame von heute entnommen, in der ich vor meiner Abreise nach Kanada im Wartezimmer des Zahnarztes geblättert hatte.
»Haltung« hieß, dass man Knie und Lippen geschlossen hielt und weder die Stirn noch die Nase krauszog.
»Schicklichkeit« hieß: Klappe halten.
Ich hätte mir die Mühe sparen können. Kein Mensch war zu sehen.
Einen Augenblick stand ich ganz allein mitten in der Eingangshalle, die mir irgendwie größer und leerer vorkam als sonst. Verlassen traf es am besten. Trostlos. Der ganze Raum strahlte eine ungewohnte Kälte aus.
Normalerweise hätte um diese Jahreszeit hier ein Weihnachtsbaum gestanden. Natürlich kein so prächtiger wie im Salon, aber doch immerhin ein festliches Willkommen für eventuelle Besucher. Die Halle wäre mit Papiergirlanden, Stechpalmenkränzen und Mistelzweigen geschmückt gewesen, der Duft von Rosmarin, Orangen und Nelken hätte die warme, staubige Luft belebt.
Doch wohin ich auch blickte, in diesem Jahr konnte ich auf Buckshaw nirgends auch nur einen Hauch von Weihnachten entdecken. Als läge ein Fluch, ein uralter Familienfluch, über dem Haus, wie in den Geschichten von Edgar Allan Poe.
Ich erschauerte unwillkürlich.
Jetzt krieg dich mal wieder ein, Flavia, ermahnte ich mich dann. Es war wirklich nicht der rechte Zeitpunkt für Sentimentalitäten. In wenigen Sekunden würde ich meiner Familie gegenübertreten! Also: Worüber hatte ich nachgedacht, als ich die Treppe heruntergekommen war?
Ach richtig, über Haltung und Schicklichkeit. Kühl und unnahbar wie ein Eisblock musste ich sein.
Ich schlenderte lässig und zugleich zielstrebig ins Esszimmer, zog meinen Stuhl zurück, ohne dass er über den Boden scharrte, nahm Platz und breitete die Leinenserviette sorgfältig über meinen Schoß.
Makellose Perfektion. Ich war stolz auf mich.
Daffy steckte wie üblich die Nase in ein Buch – es handelte sich um Die Parasiten von Daphne du Maurier, wie ich unwillkürlich feststellte –, Feely hingegen bewunderte offenbar ihr eigenes Spiegelbild in ihrem auf Hochglanz polierten Daumennagel.
Ich legte einen lauwarmen Räucherhering auf meinen Teller.
»Guten Morgen, geliebte Schwestern«, sagte ich dann mit nur einer klitzekleinen Spur Ironie.
Wie zwei kränkliche Sonnen, die gleichzeitig am Horizont emporstiegen, erhoben sich Daffys Augen von der Buchseite. Man sah ihr an, dass sie eine schlaflose Nacht hinter sich hatte.
»Nanu, was haben wir denn da für eine Vogelscheuche?«, sagte sie.
Ich ließ mich nicht aus der Fassung bringen. »Wie geht es Vater?«, erkundigte ich mich. »Gibt es etwas Neues?«
»Frag nicht so blöd! Du weißt doch, dass er im Krankenhaus liegt!«, fauchte Daffy. »Und das alles nur, weil er gezwungen war, nach London zu fahren.«
»Dafür kann ich nichts!«, fauchte ich zurück. »Mir wurde gesagt, er hätte sich die Lungenentzündung im Zug geholt.«
Ich war noch nicht mal eine Minute im Zimmer, und schon wurden die Messer gewetzt.
»Von wegen!« Daffy war außer sich. »Von wegen! Dein Vater ringt mit dem Tod, und du sitzt hier und plapperst dummes Zeug!«
»Daphne …!«, sagte Feely mit dieser Stimme, mit der sie auch einen Panzer zum Stehen gebracht hätte.
Mrs. Mullet war hereingekommen und machte sich an der Anrichte zu schaffen. Sie versuchte, so zu tun, als sei alles in bester Ordnung, was natürlich nicht der Fall war.
»Der Schinkenspeck ist gleich fertig«, sagte sie. »Wenn der Herd über Nacht aus war, dauert es immer ein bissel länger. Hab vor lauter Sorgen um den Colonel nicht dran gedacht.«
Ich schaute auf eine imaginäre Armbanduhr. »Wann kommt denn Clarence mit dem Taxi? Ich möchte so bald wie möglich zu Vater.«
»Frühestens um halb eins«, antwortete Mrs. Mullet. »Besuchszeit ist erst ab zwei. Jetzt zieh nicht so’n Flunsch, Schätzchen, sonst friert dir noch das Gesicht ein, und was soll dann aus dir werden?«
Damit waren all meine Hoffnungen, unverzüglich an Vaters Bett zu eilen, auf einen Schlag zunichtegemacht. Ich gab mir Mühe, mir meine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen.
»Wie geht’s Dieter?«, wandte ich mich im abermaligen Bemühen, eine zivilisierte Unterhaltung zu beginnen, an Feely.
»Woher soll ich das wissen?«, erwiderte sie genauso gereizt wie vorher Daffy, warf ihre Serviette auf den Tisch, sprang auf und stürmte hinaus.
In der Tür wäre sie fast mit Undine zusammengestoßen. Sie drängte sich unsanft an ihr vorbei, und Undine blieb stehen, hielt die Hand ans Ohr und tat so, als lauschte sie Feelys verhallenden Schritten.
»Cousine Ophelia ist überreizt«, verkündete sie dann mit ihrer quäkigen Froschstimme. »Sie hat sich schrecklich mit Dieter gestritten. Bestimmt ging es ums Kinderkriegen. Tag, Flavia. Willkommen zu Hause. Wie ist es dir in Kanada ergangen?«
Sie kam angetrampelt und streckte mir die Hand hin. Ich hätte sie natürlich auch mit dem Buttermesser erstechen können, rang mich aber dazu durch, die Hand zu ergreifen und flüchtig und schlaff zu schütteln.
Undine blieb vor mir stehen und glotzte mich mit ihren wasserblauen Glupschaugen in dem weißen Mondgesicht so erwartungsvoll an, als erwartete sie eine Ansprache von mir. Die dicke schwarze Brille rahmte ihre Augen ein und vergrößerte sie zugleich, was ihr ein sonderbar altersloses Aussehen verlieh. Sie hätte genauso gut acht wie hundertacht Jahre alt sein können. Sie sah aus, als hätte ein ungeschicktes Kind mit Wachsmalstift eine de Luce zu zeichnen versucht.
Als ich auf ihre Frage nicht einging, beugte sie sich vor und schnappte sich den Rest meines Herings.
»Wir haben Onkel Haviland gestern besucht«, sagte sie und meinte damit Vater. »Er sah furchtbar aus.«
Bevor mein Hirn diese Mitteilung verarbeiten konnte, war ich schon aufgestanden.
Dass Undine – eine entfernte Cousine x-ten Grades – Vater besuchen durfte und ich nicht, war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.
Wie in Trance verließ ich das Esszimmer.
Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einfach vor einer Situation davonlief, und, ehrlich gesagt, fühlte es sich verdammt gut an.
Womit erklärt wäre, weshalb ich im eisigen Regen nach Bishop’s Lacey radle.
Ich halte es in Buckshaw nicht mehr aus. Ich halte es mit meiner Familie nicht mehr aus! Mein Ziel ist das Pfarrhaus, und der Mensch, mit dem ich reden will, ist Cynthia Richardson.
Wer hätte das gedacht?
Cynthia und ich hatten seit Jahren eine instinktive Abneigung füreinander gehegt. Der Auslöser dafür war die Tracht Prügel gewesen, die sie mir verpasst hatte, als ich von den mittelalterlichen Buntglasfenstern in St. Tankred Proben für ein chemisches Experiment abgekratzt hatte.
Unser Verhältnis hatte sich erst gewandelt – glaube ich jedenfalls –, als ich herausfand, dass sie und ihr Ehemann Denwyn, der Vikar unserer Gemeinde, ihr einziges Kind, eine Tochter, bei einem tragischen Unglück am Bahnhof Doddingsley verloren hatten, wo das Mädchen unter den einfahrenden Zug geraten war. Inzwischen waren Cynthia und ich dicke Freundinnen.
Manchmal kann einem selbst die eigene Familie nicht helfen, und Gespräche mit dem eigenen Fleisch und Blut sind sinnlos.
Außerdem sind solche Gespräche, wenn ich es recht bedenke, die gottgegebene Aufgabe von Pfarrersfrauen.
Ich stieg ab und lehnte Gladys an die Friedhofsmauer. Hier war sie gut aufgehoben, bis ich sie wieder abholte, um nach Hause zu fahren. Außerdem liebte Gladys Friedhöfe, sodass die Wartezeit trotz des Regens für sie geradezu ein Vergnügen war.
»Es ist schön, wieder zu Hause zu sein«, raunte ich ihr zu und tätschelte ihren Sattel, aber eher sachlich als rührselig. »Amüsier dich gut.«
Dann stapfte ich durchs nasse Gras, trat mir auf der Fußmatte die Schuhe ab und betätigte den Klingelzug. In den Tiefen des Pfarrhauses ertönte ein gedämpftes Läuten.
Ich wartete. Niemand kam.
Ich zählte langsam bis vierzig, eine Zeitspanne, die mir angemessen schien. Nicht so kurz, dass es aufdringlich wirkte, aber auch nicht so lang, dass der Hausbewohner annehmen musste, der Ankömmling sei wieder weggegangen.
Der zweite Ruck am Klingelzug löste das gleiche gedämpfte Geschepper aus.
Das Haus hörte sich leer an.
Vielleicht war Cynthia in der Kirche. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Sie verbrachte viel Zeit mit Blumen, Faltblättern, Chorhemden, Gesangbüchern, Metallpolitur und Kerzen, ganz zu schweigen von Besuchen bei Gemeindemitgliedern, den Treffen des Frauenvereins, der Müttergruppe, des Altardienstes, den Wichteln (die Nachwuchspfadfinderinnen), den älteren Pfadfinderinnen (deren Gruppe sie leitete), den Wölflingen (die männlichen Nachwuchspfadfinder, bei denen sie manchmal die Leitwölfin spielte), den älteren Pfadfindern, dem Restaurierungskomitee (dessen Vorsitzende sie war) und dem Gemeinderat (für den sie das Sekretariat übernommen hatte).
Also stapfte ich wieder zurück, doch auch in der Kirche war niemand. Mittlerweile goss es wie aus Kübeln, meine Schuhe waren völlig durchweicht.
Als ich zu Gladys zurückging, hörte ich plötzlich meinen Namen. Der Ruf kam vom Pfarrhaus her.
»Flavia! Ju-huu! Flavia!«
Die Stimme klang zwar nicht nach Cynthia, doch wie sich herausstellte, war sie es trotzdem.
Sie versteckte sich hinter der Haustür, die sie nur einen Spaltweit geöffnet hatte. Als ich unter dem Vordach stand, sah ich, dass sie einen abgetragenen rosa Morgenmantel über der Brust zusammenhielt.
Sie sah grauenvoll aus.
»Willkommen zu Hause!«, krächzte sie heiser. »Ich bin schrecklich erkältet, deswegen umarme ich dich nicht. Denwyn und ich haben schon gehört, dass dein Vater krank ist, und es tut uns sehr leid. Wie geht es ihm denn?«
»Keine Ahnung«, sagte ich. »Wir besuchen ihn heute Nachmittag.«
»Komm rein … komm rein!«, sagte Cynthia und öffnete die Tür ein bisschen weiter, damit ich hindurchschlüpfen konnte. »Ich setze Wasser auf, und wir trinken einen schönen Tee.«
Das war typisch Cynthia. Sie hakte alle wichtigen Punkte nacheinander ab: Begrüßung, Umarmung (ausgeführt oder auch nicht), Erklärung, Beileidsbekundung und Tee. In dieser Reihenfolge.
Taktvollerweise hatte sie sich die Beileidsbekundung fast bis zum Ende aufgespart, damit es sich nicht ganz so ernst anhörte.
Weil ich diese Taktik – das Unerfreuliche unauffällig in das Erfreuliche einzustreuen – selbst schon angewandt hatte, wusste ich ihre Rücksichtnahme zu schätzen.
»Milch und zwei Stück Zucker, stimmt’s?«, fragte sie, als sie den Tee aufgegossen hatte. »Aber deine Schuhe und Strümpfe sind ja klatschnass! Zieh sie aus, dann lege ich sie auf den Herd.«
Ich tat wie geheißen und zupfte mir ein paar nasse Grashalme aus den Zehen.
»Und wie war’s in Kanada?« Cynthia unterdrückte ein Niesen. »So wie man es sich vorstellt? Überall Seen, Elche und Holzfäller?«
Das war eine Art Privatscherz zwischen uns. Vor meiner Abreise hatte sie mir anvertraut, dass ihr Vater früher Flößer auf dem Ottawa gewesen war und dass sie manchmal daran dachte, in seine genagelten Stiefelstapfen zu treten.
»So ungefähr«, antwortete ich nur. »Aber wie geht es Ihnen?«, schob ich rasch nach. »Sie sehen schrecklich aus.«
Wir waren gut genug befreundet, dass ich so etwas sagen durfte.
»So fühle ich mich auch«, gab sie zurück. »Wie eine Vogelscheuche.«
Genauso hat Daffy mich genannt, ging es mir durch den Kopf.
»Hoffentlich sind Sie nicht ansteckend.«
»Um Himmels willen, nein! Dr. Darby war so nett, nach mir zu schauen. Er meinte, über dieses Stadium sei ich schon hinaus. Das ist auch gut so. Um halb fünf muss ich nämlich zu den Wölflingen und um sieben zu den älteren Jungs. Bete für mich, Flavia!«
»Sie gehören ins Bett!«, sagte ich streng. »Dick eingepackt, dazu ein schöner heißer Grog mit einem Schuss Milch!«
Letztere Arznei hatte Mrs. Mullets Gatte Alf mal Vater empfohlen. »Ein unschlagbares Heilmittel«, hatte Alf gemeint. »Hilft gegen alles, und zwar jedem, egal ob Mensch, Tier oder Engel.«
Vater hatte hinterher gesagt, Alfs Empfehlungen seien zwar doppelsinnig, aber gut gemeint.
»Haben Sie Rum oder Weinbrand im Haus?«
»Leider nein. Messwein ist das Stärkste, was ich zu mir nehme.« Sie kicherte verlegen, als hätte sie mir ein großes Geheimnis anvertraut.
»Ich könnte zum Dreizehn Erpel rüberlaufen und eine Flasche Rum holen«, bot ich an. »Mr. Stoker ist bestimmt einverstanden, dass ich anschreiben lasse. Es ist ja nicht so, als würde …«
»Das ist sehr lieb von dir, Flavia, aber lass nur. Ich habe so viel zu tun, dass ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht.«
Worauf sie zu meiner Bestürzung in Tränen ausbrach. Ich gab ihr ein sauberes Taschentuch und wartete darauf, dass sie sich wieder beruhigen würde. Manchmal ist es sinnlos, jemanden zu drängen.
Nach einer Weile verwandelte sich das Schluchzen in Schniefen, und aus dem Schniefen wurde ein mattes Grinsen.
»Oje! Was denkst du jetzt bloß von mir?«
»Dass Sie überarbeitet sind«, sagte ich. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Gar nicht. Ich muss einfach ein paar meiner Verpflichtungen sausen lassen. Am besten rufe ich bei den Pfadfindern an und sage, wie es ist: Dass der Vikar nicht da ist, und dass ich krank bin.«
»Der Vikar ist nicht da? Das wusste ich nicht. Das ist ja gar nicht schön für Sie.«
»Der Bischof führt wieder mal eine seiner unangekündigten Inspektionen durch. ›Rat der Weisen‹ pflegt er das scherzhaft zu nennen, und es findet natürlich im Diözesanbüro statt. Denwyn kommt erst spätabends wieder.«
»Und ich kann Ihnen wirklich nicht irgendwas abnehmen?«
»Leider nein«, sagte sie bedauernd. »Die Pflichten eines Landgeistlichen und seiner Kirchenmaus von Ehefrau können nur von … halt … eine Sache fällt mir doch ein.«
»Ich mach’s!«, sagte ich sofort, noch ohne zu wissen, worum es sich handelte.
»Allerdings müsste ich dich dafür noch mal in den Regen rausschicken. Unser Auto ist nämlich kaputt – ein Kolben ist gebrochen oder eine Pleuelstange oder sonst irgendwas, und Bert Archer meinte, er kann es frühestens bis nächsten Mittwoch reparieren. Aber nein … das kann ich dir nicht zumuten.«
»Kein Problem«, sagte ich. »Ich mag Regen.«
Was nicht gelogen war. Bei feuchtem Wetter ist das menschliche Gehirn deutlich leistungsstärker als bei Hitze oder trockener Kälte. Meiner Theorie zufolge ist das ein Erbteil unserer fischigen Vorfahren, die im Meer lebten und Wasser atmeten. Falls ich irgendwann mal dazu komme, verfasse ich eine wissenschaftliche Abhandlung darüber.
»Weißt du, wo Stowe Pontefract ist?«, riss mich Cynthia aus meinen Gedanken.
Klar wusste ich das. Stowe Pontefract lag Luftlinie höchstens eine Meile von Bishop’s Lacey entfernt, und wenn man kein Vogel war, sondern mit dem Rad fahren und sich an Straßen und Wege halten musste, vielleicht zwei Meilen. Trotz der Schreibweise sprach man den Ort »Stau Pomfritt« aus, und in Bishop’s Lacey machte man sich immer darüber lustig.
»So was nennt man einen ›Weiler‹«, hatte mir Daffy mal erklärt. »Zu klein für ein Dorf – aber größer als ein Pfannkuchen.«
»Etwas auf Stau-Pomfritt-Art erledigen«, sagten die Einwohner von Bishop’s Lacey, wenn sie meinten: selten, mangelhaft oder gar nicht.
»Ja, den Weiler kenne ich«, sagte ich daher. »Er liegt zwischen hier und East Finching. Die erste Abzweigung nach rechts, ganz oben auf der Denham-Höhe. Gleich hinter der Almosenquelle.«
»Richtig!«, sagte Cynthia. »Und Gut Thornfield ist nur eine Viertelmeile weiter.«
»Gut Thornfield?«
»So heißt das Haus von Mr. Sambridge. Leider ist es nicht ganz so herrschaftlich wie sein Name.«
»Ich finde es schon«, versicherte ich.
Es war noch früh am Tag, ich konnte in einer Stunde wieder zurück sein. Hinterher war noch mehr als genug Zeit, um mich zu Hause für meinen ersten Besuch bei Vater fein zu machen.
»Und was soll ich dort tun?«, fragte ich.
»Einfach nur Mr. Sambridge diesen Briefumschlag geben, Liebes. Er ist Tischler und ein sehr talentierter Schnitzer, ja fast schon ein Künstler. Denwyn möchte ihn dazu bewegen, dass er einige der Engel an der Balkendecke der Kirche ersetzt oder zumindest restauriert. Aber der arme Mann hat schlimme Arthritis – genau genommen ist er steif wie ein Brett –, und darum trauen wir uns kaum, ihn zu bitten, noch mal herzukommen. Andererseits sagt Dr. Darby, dass es das Beste für ihn sei, tätig zu bleiben. Schlimm, was der Klopfkäfer anrichten kann, wenn er sich erst mal in altem Gebälk ausgebreitet hat. Und es macht dir auch wirklich nichts aus?«
Mir war nicht ganz klar, ob Cynthia mit »altem Gebälk« Mr. Sambridges Gelenke oder die geschnitzten Engel meinte, aber ich mochte nicht nachfragen.
»I wo«, sagte ich. »Ich helfe gern.«
Was der Wahrheit entsprach, auch wenn es mich fast noch mehr freute, dass ich damit einen Vorwand hatte, Buckshaw, Undine und meinen verfluchten Schwestern fernzubleiben, wenn auch nur für ein paar Stunden. Eine Radtour im Regen würde mir guttun und die Spinnweben fortpusten, die sich seit einiger Zeit in meinem Schädel eingenistet hatten.
Nördlich von Bishop’s Lacey steigt die Straße wellenartig steil an. Ich stellte mich in Gladys’ Pedalen auf und trat, so kräftig ich konnte. Es waren keine Autos unterwegs, aber wenn doch, dann hätten die Fahrer ein Mädchen mit rotem Gesicht und gelbem Regenmantel erblickt, das schwankend und schlingernd gegen die Steigung und den Sturm ankämpfte.
Genau wie ein Flugzeug kann auch ein Fahrrad bei zu geringer Geschwindigkeit ins Trudeln kommen, sodass man jederzeit darauf gefasst sein sollte, absteigen und schieben zu müssen. Ich hatte zwar den niedrigsten Gang eingelegt, aber es war trotzdem eine arge Schinderei.
»Tut mir leid, Gladys!«, schnaufte ich. »Ich kann dir nur versprechen, dass es auf dem Rückweg die ganze Zeit bergab geht.«
Gladys stieß einen Freudenquietscher aus. Genau wie ich fand sie Leerlauf toll, und wenn nachher immer noch niemand zu sehen war, würde ich vielleicht sogar die Füße auf den Lenker legen – ein Kunststück, das ihr jedes Mal zusätzliches Vergnügen bereitete.
Die Abzweigung kam früher als erwartet in Sicht. Ein verwitterter Wegweiser zeigte nach Osten in Richtung Stowe Pontefract. Die Straße war hier zwar nur noch ein schmaler, holpriger Weg, aber wenigstens ging es nicht mehr bergauf. Zu beiden Seiten wuchsen dichte, verwilderte Stechpalmenhecken, deren scharlachrote Früchte trotz des grauen, diesigen Wetters fröhlich leuchteten. Sofort fiel mir ein, dass diese hübschen, giftigen Beeren unter anderem folgende Substanzen enthielten: Kaffeesäure, Chinasäure, Chlorogensäure, Kaempferol, Koffein, Quercetin, Rutin und Theobromin. »Theobromin« bedeutet wörtlich übersetzt »Speise der Götter« und ist das bittere Alkaloid, das auch in Tee, Kaffee und Schokolade vorkommt. Eine Überdosis davon kann tödlich sein.
Der Tod durch den Verzehr einer riesigen Schachtel Pralinen, die einer reichen, alten Erbtante anonym zugeschickt wurde, kam nicht nur in Kriminalromanen vor. Ganz im Gegenteil! Es konnte kein Zufall sein, dass gerade in der Weihnachtszeit sowohl Stechpalmenzweige als auch Schokolade gehäuft auftraten und dass ziemlich genau um diese Zeit die Sterberate älterer Menschen ihren Höhepunkt erreichte.
Zwei zerfallene Ziegelpfeiler, die links von mir auftauchten, rissen mich aus diesen beschaulichen Überlegungen. Ein rissiges Holzschild, dessen Schrift sich wie ein Ekzem abpellte, verkündete: GUTTHORNFIELD. Ich bremste und stieg ab.
Von dem einst herrschaftlichen Anwesen war nur noch eine Jagdhütte im gotischen Stil übrig, und auch die war reichlich baufällig. Ein Teppich aus grünem und schwarzem Moos überzog das durchhängende Dach, die Türrahmen waren morsch und die Fenster so stumpf wie Leichenaugen. Von den traurigen Überresten der zerbrochenen Regenrinne ertönte ein trostloses Tropf-tropf-tropf.
Was für eine unpassende Behausung für einen Tischler und angeblichen Schnitzkünstler!, ging es mir durch den Kopf. Offenbar war an dem alten Sprichwort etwas dran: Lehrers Kinder und Müllers Vieh gedeihen selten oder nie.
Und was ist mit Colonel Haviland de Luces Kindern?
Dieser Gedanke verflüchtigte sich zum Glück von ganz allein wieder.
Unter den Bäumen parkte ein klappriger Austin. Die freigebig darüber verteilte Vogelkacke ließ vermuten, dass er schon länger nicht mehr von der Stelle bewegt worden war. Ich spähte durch die gesprenkelten Fenster, konnte aber nur zwei Autohandschuhe aus weichem Leder erkennen, einen auf dem Fahrersitz, den anderen auf dem Boden. Sonst nichts.
Ich wandte mich ab und stapfte durch das nasse Laub zum Haus.
Dort betätigte ich die altmodische Klingel – ein Elfenbeinknopf auf einer Messingplatte –, worauf im Inneren des Hauses ein überraschend helles, klares Läuten erscholl.
Für den Fall, dass mich jemand durch den Türspion beobachtete, zog ich den Briefumschlag unter dem Regenmantel hervor und nahm eine Pose ein, die eifrige Dienstfertigkeit ausdrücken sollte: einen Ellbogen angewinkelt und leicht angehoben, andeutungsweise gerunzelte Stirn, leicht geschürzte Lippen – eine Kreuzung aus einem Telegrammboten und dem weißen Kaninchen aus Alice im Wunderland.
Die Regenrinne tropfte.
Ich klingelte noch einmal.
»Mr. Sambridge?«, rief ich. »Sind Sie zu Hause?«
Keine Antwort.
»Hier ist Flavia de Luce. Ich soll etwas vom Pfarrhaus bei Ihnen abgeben.«
»Etwas« klang spannender als »Brief«. »Etwas« konnte zum Beispiel auch Geld sein, wobei natürlich auch ein Brief Geld enthalten konnte.
Doch meine sorgfältige Wortwahl zeigte keine Wirkung. Mr. Sambridge machte nicht auf.
Ich hätte den Umschlag natürlich auch durch den Briefschlitz stecken können, aber so etwas passt nicht zu einer Flavia de Luce. Cynthia hatte mir einen Auftrag erteilt, und den würde ich ausführen, komme, was wolle. Das war schlicht eine Frage der Ehre – und, ich geb’s ja zu, der Neugier.
Ich hob die Briefschlitzklappe an und spähte mit zusammengekniffenen Augen durch die Öffnung. Ich erblickte eine getünchte Backsteinwand mit einem einzelnen Kleiderhaken daran, an dem eine Tweedjacke hing, wie sie von Wildhütern getragen wird.
»Hallo?«, rief ich durch den Briefschlitz. »Mr. Sambridge?«
Obwohl mir klar war, dass es keinen Sinn hatte, drückte ich probehalber die Türklinke herunter. Doch erstaunlicherweise ließ sich die Tür mühelos öffnen, und ich trat ein.
Abgesehen von der engen Diele, die den Wind von draußen abhalten sollte, bestand das Erdgeschoss aus einem einzigen großen Raum, in dem, wie auf den ersten Blick zu erkennen war, Mr. Sambridges Tischlerwerkstatt untergebracht war. Es roch nach frischen Hobelspänen und würzigem Baumharz.
Am Fenster stand eine Werkbank, die mit Werkzeug übersät war: Hobel, Sägen und Feilen, dazu die verschiedensten Schnitzmesser. Manche hatten flache Klingen, andere gebogene und wieder andere v-förmige. Es gab auch einen Schraubstock sowie Holz- und Gummihämmer in diversen Größen.