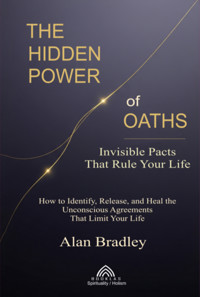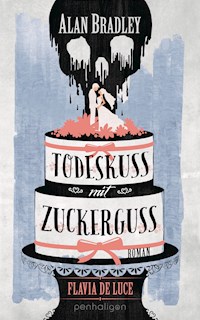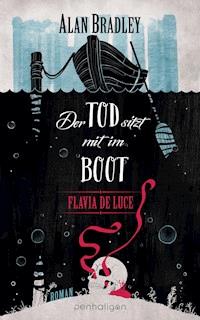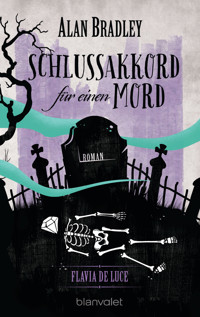9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon
- Kategorie: Krimi
- Serie: Flavia de Luce
- Sprache: Deutsch
Wer Wednesday Addams als Ermittlerin liebt, kommt an Flavia de Luce nicht vorbei.
Verbannt – so empfindet Flavia ihr Schicksal, als ihr Vater und ihre Tante Felicity sie auf ein Schiff nach Kanada verfrachten. Dort, in Toronto, soll sie Miss Bodycotes Female Academy besuchen, das Mädcheninternat, an dem auch schon Flavias Mutter Schülerin war. Noch in ihrer ersten Nacht »in Gefangenschaft« landet ein unerwartetes Geschenk zu Flavias Füßen: eine verkohlte, mumifizierte Leiche, die aus dem Kamin in ihrem Zimmer purzelt – der Beginn einer Reihe von Nachforschungen, bei denen Flavia auf zahlreiche mysteriöse Vorkommnisse in Miss Bodycotes Akademie stößt. Doch wenn es darum geht, Rätsel zu lösen, ist Flavia in ihrem Element …
Diese außergewöhnliche All-Age-Krimireihe hat die Herzen von Lesern, Buchhändlern und Kritikern aus aller Welt im Sturm erobert!
Die »Flavia de Luce«-Reihe:
Band 1: Mord im Gurkenbeet
Band 2: Mord ist kein Kinderspiel
Band 3: Halunken, Tod und Teufel
Band 4: Vorhang auf für eine Leiche
Band 5: Schlussakkord für einen Mord
Band 6: Tote Vögel singen nicht
Band 7: Eine Leiche wirbelt Staub auf
Band 8: Mord ist nicht das letzte Wort
Band 9: Der Tod sitzt mit im Boot
Band 10: Todeskuss mit Zuckerguss
Außerdem (nur) als E-Book erhältlich:
Das Geheimnis des kupferroten Toten (»Flavia de Luce«-Short-Story)
Alle Bände sind auch einzeln lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Alan Bradley
Roman
Aus dem Englischen von Gerald Jung und Katharina Orgaß
Für Shirley, in Liebe und Dankbarkeit
Fürchte nicht mehr Sonnenglut,
Noch des Winters grimmen Hohn!
Jetzt dein irdisch Treiben ruht,
Heim gehst, nahmst den Tageslohn:
Goldne Burschen und Mägdlein werden
Wie die Essenkehrer zu Erden.
WILLIAM SHAKESPEARE
Cymbelin (vierter Aufzug, zweite Szene)
Prolog
Wenn wir beide uns auch nur ansatzweise ähnlich sind, dann schwärmen Sie ebenso wie ich für Fäulnis und Zersetzung. Es ist doch immer wieder ein erhebender Gedanke, dass Verfall und Verwesung die entscheidenden Kräfte sind, die die Welt in Gang halten.
Stürzt beispielsweise im Wald eine uralte Eiche um, machen sich praktisch im selben Augenblick unsichtbare Räuberhorden über sie her. Diese hoch spezialisierten Bakterienscharen bestürmen ihr Opfer so strategisch wie ein Barbarenheer eine feindliche Festung. Die erste Angriffswelle dient dazu, die verschiedenen Eiweiße des geschwächten Holzes zu Ammoniak zu zersetzen, mit dem wiederum die zweite Angriffswelle leicht fertig wird, indem sie das übel riechende Ammoniak in Nitrit umwandelt. Anschließend verwandeln die Invasoren durch Oxidation das Nitrit zu Nitrat, das wiederum das Erdreich düngt, auf dem sodann neue Eichenschösslinge wachsen können.
Durch das Wunder der Chemie zerlegen mikroskopisch kleine Lebensformen einen Koloss in seine wesentlichen Bestandteile. Wälder entstehen und sterben, kommen und gehen, wie eine sich wirbelnd drehende Münze, die man in die Luft geschnippt hat: Kopf … Zahl … Leben … Tod … Leben … Tod … und immer so weiter, vom Anbeginn der Schöpfung bis ans Ende aller Zeiten.
Einfach fabelhaft, wenn Sie mich fragen.
Übergibt man einen menschlichen Leichnam der Erde, durchläuft er den gleichen grundlegenden 1-2-3-Prozess: Fleisch – Ammoniak – Nitrat.
Wird eine Leiche jedoch in eine schmutzige Fahne eingewickelt und in einen Kaminschacht gestopft, wo Hitze und Rauch sie über Jahrzehnte hinweg mumifizieren … dann ist das natürlich etwas ganz anderes.
1
VERBANNT!«, kreischte der Wind, der mir ins Gesicht peitschte.
»Verbannt!«, tosten die entfesselten Wellen, die mich mit eiskalten Güssen überschütteten.
»Verbannt!«, heulte alles um mich herum. »Verbannt!«
Unsere Sprache kennt wohl kein trostloseres Wort. Allein der Klang – wie schmiedeeiserne Tore, die krachend hinter einem ins Schloss fallen, wie stählerne Riegel, die donnernd zugeschoben werden – lässt einem unweigerlich die Haare zu Berge stehen, oder?
»Verbannt!«
Ich schrie das Wort in den Sturm hinaus, und der Sturm spie es mir wieder ins Gesicht.
»Verbannt!«
Ich stand am schwankenden Bug der R.M.S.Scythia und sperrte den Mund weit auf, weil ich hoffte, die salzige Gischt könnte den schlechten Geschmack auf meiner Zunge abwaschen – den Geschmack meines bisherigen Lebens.
Irgendwo hinter dem östlichen Horizont, Tausende Meilen entfernt, lagen das Dorf Bishop’s Lacey und nicht weit davon Buckshaw, mein einstiges Zuhause. Dort führten mein Vater, Colonel Haviland de Luce, und meine beiden Schwestern Ophelia und Daphne aller Wahrscheinlichkeit nach ihr Leben fröhlich weiter, als hätte es mich nie gegeben.
Sie hatten mich längst vergessen. Dessen war ich ganz sicher.
Lediglich die treuen Bediensteten der Familie, Dogger und Mrs. Mullet, würden bei meiner Abreise eine verstohlene Träne vergossen haben, doch auch sie würden sich schon bald nur noch nebelhaft an Flavia erinnern.
Hier draußen auf dem Atlantik hob sich der Bug der Scythia höher … und höher … und noch höher aus den Wogen, stieg Übelkeit erregend himmelwärts, um dann mit schaurig hohlem Dröhnen in die Tiefe zu stürzen und zu beiden Seiten von Bug und Heck gewaltige weiße Gischtschwingen auszubreiten. Es war, als ritte man ohne Sattel auf einem riesigen Engel aus Stahl, der gerade Brustschwimmen übte.
Obwohl es erst Anfang September war, toste und tobte das Meer ringsum in wildem Aufruhr. Wir waren in die Ausläufer eines Tropensturms geraten und wurden schon seit über zwei Tagen wie ein Flaschenkorken hin- und hergeworfen.
Allem Anschein nach hatten sich alle außer dem Kapitän und mir in ihre Kabinen verkrochen, sodass man, wenn man auf dem Weg zum Abendessen durch die Gänge taumelte, nur das metallische Ächzen des gemarterten Schiffsrumpfes hörte und hinter den geschlossenen Türen links und rechts die Würgelaute, mit denen sich unzählige Mägen entleerten. Bei fast neunhundert Passagieren an Bord war das eine ernüchternde Geräuschkulisse.
Ich selbst bin offenbar mit einer natürlichen Immunität gegen Seekrankheit gesegnet, was ich vermutlich meinen zur See fahrenden Ahnen wie zum Beispiel Thaddeus de Luce zu verdanken habe, der, wie es heißt, als blutjunger Bursche bei der Schlacht von Trafalgar dem sterbenden Admiral Nelson Zitronenwasser gebracht und ihm die feuchtkalte Hand gehalten hatte.
Tatsächlich lauteten Nelsons letzte Worte nicht, wie so oft zitiert, »Küss mich, Hardy« und waren an Thomas Hardy, den Kapitän der Victory, gerichtet, vielmehr wandte er sich mit der flehentlich geflüsterten Aufforderung »Trinken, trinken … fächeln, fächeln … massieren, massieren« an den verdutzten jungen Thaddeus, der beim Anblick seines tödlich verwundeten Helden tapfer mit den Tränen kämpfte und sein Möglichstes tat, den Kreislauf des großen Mannes in Gang zu halten.
Der Wind riss an meinen Haaren und zerrte an meinem dünnen Herbstmantel. Ich sog die salzige Luft so tief in die Lunge, wie ich mich traute. Die Gischt lief mir in Sturzbächen übers Gesicht.
Da packte mich jemand unsanft am Arm.
»Bist du verrückt geworden? Was hast du hier draußen zu suchen?«
Ich fuhr erschrocken herum und versuchte mich loszureißen.
Es war Ryerson Rainsmith – wer sonst?
»Was zum Teufel hast du hier draußen zu suchen?«, wiederholte er barsch. Er gehörte zu jenen Leuten, die glaubten, dass sie überzeugender wirkten, wenn sie jede Frage zweimal stellten.
Darauf reagierte man am besten, indem man ihnen einfach nicht antwortete.
»Ich habe dich überall gesucht. Dorsey ist außer sich vor Sorge.«
»Soll das heißen, dass ich jetzt zwei Dorseys ertragen muss?«, hätte ich am liebsten gefragt, beherrschte mich aber.
Wenn eine Frau mit Vornamen »Dorsey« heißt, braucht sie sich nicht zu wundern, wenn der eigene Ehemann sie zärtlich »Dödelchen« nennt – zumindest, wenn er sich unbeobachtet glaubt.
»Wir hatten schon Angst, du wärst über Bord gefallen. Komm sofort mit unter Deck und zieh dir in deiner Kabine trockene Sachen an. Du siehst ja aus wie eine ertrunkene Ratte.«
Das ging jetzt aber eindeutig zu weit!
Ryerson Rainsmith, dachte ich voller Ingrimm, deine Tage – ja, deine Stunden – sind gezählt!
Ich würde den jungen, gut aussehenden Schiffsarzt aufsuchen, dessen Bekanntschaft ich gestern beim Abendessen gemacht hatte, und ihn unter dem Vorwand, ich hätte eine Magenverstimmung, um ein Fläschchen Natriumhydrogencarbonat, also Natron, bitten. Eine tüchtige Dosis von dem Zeug in Rainsmiths unvermeidlicher Champagnerflasche würde ihre Wirkung nicht verfehlen.
Auf vollen Magen eingenommen – worauf man sich bei Ryerson Rainsmith stets verlassen konnte! – war Natron in Kombination mit schäumendem Alkohol potenziell tödlich. Zuerst setzten Kopfschmerzen ein, die von Minute zu Minute schlimmer wurden, dann verwirrte sich der Geist und der Betreffende bekam heftige Magenschmerzen. Es folgten Muskelschwäche und kaffeesatzähnlicher Durchfall sowie Zittern und Krämpfe – die klassischen Symptome einer Alkalose. Ich würde darauf bestehen, mit Ryerson an Deck zu gehen, und behaupten, etwas Bewegung im Freien werde ihm guttun. In Wahrheit würden die körperliche Anstrengung und das hastige Einatmen der kalten, belebenden Luft den Prozess noch beschleunigen, als würde man Petroleum ins Feuer kippen.
Wenn es mir gelang, den pH-Wert seines arteriellen Blutes auf 7,65 hochzutreiben, standen seine Überlebenschancen ungefähr so gut wie die eines Schneemanns in der Hölle. Er würde einen qualvollen Tod sterben.
»Ich komme«, sagte ich mürrisch und folgte ihm im Tempo einer schläfrigen Schnecke über das krängende Vorderdeck.
Kaum zu glauben, ging es mir dabei durch den Kopf, dass man mich allen Ernstes diesem abstoßenden Vertreter des Menschengeschlechts anvertraut hatte. Allerdings konnte ich mich nur allzu gut daran erinnern, wie es dazu gekommen war.
Alles hatte mit jener schrecklichen Geschichte um meine Mutter angefangen. Nachdem sie zehn Jahre lang im tibetischen Himalajagebirge verschollen gewesen war, war Harriet unter so schmerzlichen Begleitumständen nach Buckshaw zurückgekehrt, dass mir mein Hirn immer noch untersagte, länger als ein paar Sekunden am Stück daran zu denken. Eine Sekunde zu viel, und mein innerer Zensor schnitt den Erinnerungsfaden so energisch durch, wie Atropos, die gefürchtete älteste Schwester der drei griechischen Schicksalsgöttinnen, den Lebensfaden jener Menschen durchtrennt haben soll, deren Zeit abgelaufen war.
Das Ende vom Lied war, dass ich auf Miss Bodycotes Höhere Mädchenschule in Kanada geschickt werden sollte, die auch Harriet einst besucht hatte. Dort sollte ich auf eine in unserer Familie seit Generationen überlieferte Aufgabe vorbereitet werden, über die man mich immer noch weitestgehend im Dunkeln ließ.
»Du wirst ganz einfach lernen, in deine Rolle hineinzuwachsen«, hatte Tante Felicity gesagt. »Im Lauf der Zeit begreifst du dann schon, dass die Pflicht die beste und klügste Lehrmeisterin ist.«
Mir war zwar nicht ganz klar, was sie damit meinte, aber da meine Tante bei diesem mysteriösen Was-auch-immer ziemlich weit oben mitmischte, verbot sich jede Diskussion.
»Es ist so ähnlich wie mit der ›Firma‹, oder?«, hatte ich gefragt. Diesen Spitznamen hatte sich das englische Königshaus selbst gegeben.
»So ähnlich«, hatte Tante Felicity erwidert, »aber mit einem entscheidenden Unterschied: Ein Mitglied des Königshauses kann abdanken. Unsereiner nicht.«
Meiner Tante hatte ich es auch zu verdanken, dass ich wie ein Bündel alter Lumpen verpackt und auf ein Schiff nach Kanada verfrachtet wurde.
Natürlich waren Einwände dagegen laut geworden, dass ich allein reiste, vor allem von Seiten des Vikars und seiner Frau. Daraufhin hatte man zunächst erwogen, dass Feely und ihr Verlobter Dieter Schrantz mich bei meiner Atlantiküberquerung begleiten sollten. Dieser Einfall wurde jedoch gleich wieder fallen gelassen, und zwar nicht nur aus Gründen des Anstands, sondern vor allem deshalb, weil Feely als Organistin in St. Tankred unabkömmlich war.
Daraufhin hatte sich Cynthia Richardson, die Frau des Vikars, höchstpersönlich als meine Begleiterin ins Spiel gebracht. Unsere Beziehung hatte so einige Höhen und Tiefen erlebt, doch in letzter Zeit waren wir gute Freundinnen geworden – eine mir noch immer schleierhafte und höchst unerwartete Wendung meines Lebens. In Abwesenheit ihres Gatten sprudelte Cynthia vor Ausgelassenheit förmlich über und wurde unversehens wieder zu einem jungen Mädchen. Der Vikar wäre entsetzt gewesen, hätte er gewusst, wie viel Tee wir schon unter hysterischem Gelächter auf den Schieferfußboden der Pfarrhausküche geprustet hatten.
Leider war auch Cynthia schon nach kurzer Zeit wieder aus dem Rennen gewesen. Bishop’s Lacey konnte genauso wenig auf sie verzichten wie auf Feely. Ohne Cynthia hätte es kein Gemeindeblatt gegeben, keine Hausbesuche, keine Pfadfinderinnentreffen, keine gestärkten Talare und Chorhemden, keine warmen Mahlzeiten für den Vikar – eine nicht enden wollende Liste.
Ich wusste, dass sie enttäuscht war. Sie hatte es mir selbst gesagt.
»Ich hätte mir Kanada furchtbar gern einmal angesehen«, hatte sie mir gestanden. »Mein Vater war als junger Mann Flößer auf dem Ottawa. Statt Gutenachtgeschichten hat er mir immer Schauermärchen vom Loup-Garou erzählt, dem Werwolf der kanadischen Wälder … und davon, wie er Ole Bull und Big Jacques Laroque beim Baumstammrollen über die Rapides des Alumettes nass gemacht hat, und zwar beide am selben Vormittag. Ich habe immer davon geträumt, mir eines Tages selbst ein Paar genagelte Flößerstiefel zu schnüren und es auch mal zu versuchen«, hatte sie wehmütig hinzugesetzt. »Aber dazu werde ich jetzt wohl keine Gelegenheit mehr haben.«
Ich hätte heulen können, wie ich sie so am Küchentisch des Pfarrhauses sitzen sah, den tränenfeuchten Blick in die Vergangenheit gerichtet.
»Es ist bestimmt nicht weniger tollkühn, die Damen der Gemeinde für den Blumenschmuck auf dem Altar einzuteilen«, hatte ich spaßhaft gesagt und gehofft, sie damit aufmuntern zu können, aber ich glaube, sie hörte gar nicht hin.
Am selben Nachmittag hatte Tante Felicity verkündet, das Problem sei nunmehr gelöst. Sie hatte erfahren, dass sich der Vorsitzende des Beirates von Miss Bodycotes Schule, der den Sommer in England verbracht hatte, im September wieder nach Kanada einschiffen würde.
Er war für einen kurzen Jagdurlaub zu Gast bei unserem Nachbarn Lord Crowsborough gewesen und hatte versichert, es mache ihm überhaupt nichts aus, vor seiner Abreise bei uns vorbeizukommen und mich mitzunehmen – als wäre ich eine leere Milchflasche.
Nie werde ich den Tag vergessen, an dem er in seinem geliehenen Bentley auf Buckshaw eintraf, mit anderthalb Stunden Verspätung übrigens. Er war aus dem Wagen gesprungen und auf die andere Seite gerannt, um Dorsey, der Königin von Saba, die Tür aufzuhalten. Sie hatte sich aus dem Fahrzeug entfaltet wie ein Storch aus der Eierschale, bis sie funkelnd in der Septembersonne stand, als wäre sie eben erst aus einer Hypnosetrance erwacht. Sie war in ein türkisfarbenes Seidengewand gehüllt, hatte ein farblich passendes Tuch um den Kopf gewunden und entschieden zu viel blaustichigen Lippenstift aufgetragen. Muss ich noch weiter ausholen?
»Oh, Ryerson«, hatte sie beim Anblick unseres ehrwürdigen Stammsitzes gesäuselt, »es ist genauso reizend – so malerisch heruntergekommen –, wie du es mir beschrieben hast.«
Ryerson Rainsmith, der einen Sommeranzug in der Farbe kalten Kaffees mit geronnener Milch trug, hatte die Daumen in seine gelbe Weste gesteckt, mit den übrigen Fingern auf seinen feisten Wanst getrommelt und sich selbstzufrieden umgeschaut. Ich musste unwillkürlich an ein wohlgenährtes Rebhuhn denken.
Vater, der zur Vordertür gekommen war, um ihn zu begrüßen, trat nun auf den kiesbestreuten Vorplatz hinaus und schüttelte ihm die Hand.
»Colonel de Luce, nehme ich an«, sagte Rainsmith, als hätte er soeben eins der großen Welträtsel gelöst. »Darf ich Ihnen meine Frau Dorsey vorstellen? Komm her und schüttele dem Colonel die Hand, Schatz. So eine Gelegenheit hat man nicht alle Tage.«
Nach einer kleinen Pause setzte er ein humorloses »Ha-ha-ha« hinzu und krähte dann: »Und das hier muss unsere kleine Flavia sein!«
Der Mann war so gut wie tot.
»Mr. Rainsmith«, sagte er und hielt mir die schweißfeuchte Hand unter die Nase.
Dogger hatte mich vor jedem Mann gewarnt, der sich selbst als »Mister« vorstellte. »Mister« sei ein Ehrentitel, hatte er gemeint, eine Anrede, mit der einem andere Menschen ihren Respekt bezeugten, aber niemals, absolut niemals sprach man selbst in dieser Form von sich.
Ich übersah die ausgestreckte Hand geflissentlich.
»Wie geht’s, wie steht’s?«, sagte ich stattdessen.
Vater zuckte zusammen. Ich wusste genau, was in ihm vorging.
Mein Vater stammte noch aus einer Epoche, in der Höflichkeit für einen Gentleman das höchste Gut war und man sich unter keinen Umständen die Blöße gab, die Haltung zu verlieren und sich anmerken zu lassen, dass man gekränkt war. In den Jahren, die er in einem japanischen Kriegsgefangenenlager verbracht hatte, hatte er die Fähigkeit, jede Beleidigung reglos wie ein steinernes Standbild über sich ergehen zu lassen, geradezu zur Kunstform erhoben.
»Treten Sie bitte ein«, sagte er nun und wies auf die offene Tür. Am liebsten hätte ich ihn vors Schienbein getreten … und gleichzeitig wollte ich ihn umarmen. Der Stolz auf die eigenen Eltern nimmt manchmal seltsame Formen an.
»Was für eine entzückende Eingangshalle!«, rief Dorsey Rainsmith aus. Ihr Tonfall war beißend wie alter Käse, und ihre Worte hallten misstönend von der dunklen Deckenvertäfelung wider. »In unserem Empfangszimmer zu Hause in Toronto haben wir den gleichen Ärger mit abblätterndem Lack, nicht wahr, Ryerson? Smithers, unser Hausmeister, meint, die Ursache sei entweder übergroße Hitze oder übergroße Kälte.«
»Oder das Alter«, warf ich ein.
Vater sah mich scharf an, sagte aber nichts. Ich wusste auch so, was er meinte.
Im Salon ließen sich die Rainsmiths unaufgefordert in den bequemsten Sesseln nieder, während Vater und ich auf den Vorderkanten der verbliebenen Stühle hockten.
Nach einer perfekt bemessenen kleinen Pause erschien Dogger und servierte Tee. Die Rainsmiths waren sichtlich beeindruckt.
»Danke schön, Dogger«, sagte ich. »Und richte bitte auch Mrs. Mullet unseren Dank aus.«
Es war ein Spiel zwischen Dogger und mir. Ein Spiel, dessen Regeln so verzwickt waren, dass niemand, der nicht zur Familie gehörte, es jemals durchschauen würde.
»Keine Ursache, Miss Flavia«, gab Dogger zurück. »Wir sind Ihnen mit dem größten Vergnügen zu Diensten.«
»Ja, vielen Dank, Dogger«, sagte daraufhin auch Ryerson Rainsmith. Er war mit der Situation heillos überfordert, strampelte aber tapfer, um sich über Wasser zu halten.
»Und schönen Dank auch an Mrs. Mullet«, schloss seine Frau sich ihm an.
Dogger schenkte den beiden ein dreiprozentiges Lächeln und löste sich auf seine unnachahmliche Art in Luft auf.
Nach einer Weile gesellten sich Daffy und Feely zu uns. Sie taten so, als seien sie untröstlich bei der Vorstellung, mich zu verlieren, und plauderten aufreizend höflich mit den Rainsmiths, bis sie sich schließlich wieder hinter ihr Buch beziehungsweise ihren Spiegel zurückzogen.
Aber es hat keinen Sinn, jetzt noch in der Asche jenes unseligen Nachmittags herumzustochern.
Man kam überein, dass die Rainsmiths auf der Reise nach Kanada meine Aufpasser sein und mich wohlbehalten auf der Schwelle von Miss Bodycotes Höherer Mädchenschule absetzen sollten.
»Aufpasser?«, meinte Daffy, als die beiden gegangen waren. »Fremdenführer meinst du wohl! Flavia auf Weltreise – nicht zu fassen! Hoffentlich weißt du das auch zu würdigen, du elender Glückspilz. Ich würde alles dafür geben, in deinen Turnschuhen zu stecken.«
Ich griff mir einen herumliegenden Tennisschläger und warf ihn nach ihr, traf aber leider nicht.
Trotzdem fehlte mir Daffy, als ich jetzt im Schlepptau von Ryerson Rainsmith über das abschüssige Deck trottete. Immerhin war sie mein eigen Fleisch und Blut, und man konnte sich ihr widersetzen, ohne dass man dauerhaften Schaden anrichtete. Im Gegensatz dazu würde Ryerson Rainsmith diesen Augenblick wohl sein Lebtag nicht vergessen. Wahrscheinlich würde er noch seinen grässlichen Enkeln davon erzählen, wenn er selbst schon als verschrumpelter Mummelgreis im Rollstuhl saß.
»Und da war sie … endlich hatte ich sie gefunden«, würde er mit zittriger, brüchiger Stimme verkünden. »Sie stand ganz vorn im Bug des Schiffes, und die Wellen schlugen über ihrem Kopf zusammen.«
Im Gegensatz dazu sprach er jetzt kein Wort, bis wir wieder unter Deck waren und wie ungelenke Aufziehpuppen durch die schwankenden Gänge zur Luxuskabine der Rainsmiths torkelten. Anscheinend hatte er schon wieder vergessen, dass er mir aufgetragen hatte, mich sofort umzuziehen. Oder aber er lieferte mich absichtlich triefnass bei seiner Gattin ab.
»Ich geb dir einen guten Rat«, flüsterte er verschwörerisch, als wären wir mit einem Mal alte Freunde. »Reize sie nicht.«
Er klopfte, dann öffnete er die Tür und bedeutete mir, als Erste hineinzugehen.
So wie Dorsey Rainsmith mich ansah, hätte ich eine Kobra sein können, die ihr jemand unter die Nase hielt.
»Was hast du denn gemacht?«, fragte sie. »Jetzt schau dich bloß mal an!«
Mädchen meines Alters müssen sich diese Aufforderung ziemlich oft anhören, ohne dass sich jemand klarmacht, wie schwer sie eigentlich umzusetzen ist.
Ich schielte an mir herunter, aber falls sie es überhaupt mitbekam, war die Anspielung zu hoch für sie.
»Wo hast du denn gesteckt?«, wollte sie wissen.
»An Deck.«
»Wozu?«
»Frische Luft.«
»Du hättest über Bord gehen können. Hast du daran gar nicht gedacht?«
»Nein«, antwortete ich wahrheitsgemäß. Mir hätte natürlich auch ein abstürzender Albatros auf die Birne fallen und mich erschlagen können, aber das sagte ich nicht.
Was hatte die Frau bloß an sich, dass sie mir so entsetzlich auf die Nerven ging? Eigentlich bin ich ein sehr toleranter Mensch, aber Dorsey Rainsmith brachte in mir das genaue Gegenteil zum Vorschein.
Ich glaube, es lag daran, dass sie ihren Ehemann auf weniger als ein Komma reduziert hatte.
Es gibt ein Wort, das meine Schwester Daffy benutzt, wenn sie besonders vernichtend über jemanden urteilt: »servil«. Dieses Wort hätte eigens erfunden sein können, um das Verhalten zu beschreiben, das Ryerson Rainsmith gegenüber seiner Gattin an den Tag legte. Er schleimte und katzbuckelte, dass einem übel werden konnte.
Ich drehte mich nach ihm um. Er stand immer noch in der Kabinentür, als fürchtete er sich vor seiner Frau und traute sich nicht einzutreten. Er hatte mich ihr abgeliefert, wie eine Katze ihrem Frauchen einen toten Vogel zu Füßen legt. Jetzt wartete er darauf, dass sie ihm das Köpfchen tätschelte – oder ihm ein Schüsselchen Rahm vorsetzte.
Sie tat weder das eine noch das andere.
»Was machen wir bloß mit dir?«, seufzte sie, als lastete das Gewicht des gesamten britischen Weltreichs auf ihren Schultern.
Ich tat, was von mir erwartet wurde. Ich zuckte die Achseln.
»Dr. Rainsmith ist tief enttäuscht von dir«, fuhr sie fort, als wäre er überhaupt nicht anwesend. »Und Dr. Rainsmith kann nicht zulassen, dass man ihn so enttäuscht.«
Dr. Rainsmith? Er hatte sich mir doch als »Mr.« vorgestellt! Als Beiratsvorsitzender von Miss Bodycotes Schule konnte er natürlich Doktor der Pädagogik sein, vielleicht auch Doktor der Theologie. Jedenfalls hatte ich nicht vor, ihn mit irgendeinem albernen Titel anzureden.
»Geh in deine Kabine und zieh dich um. Und bleib dort, bis dich jemand holen kommt.«
Geh auf dein Zimmer. Die klassische Reaktion eines Erwachsenen, der mit seinem Latein am Ende ist.
Schachmatt! Halleluja! Spiel, Satz und Sieg!
Ich hatte gewonnen.
Am nächsten Morgen stand ich am Bug, genauer gesagt vorne an der Steuerbordreling, schwenkte meinen Hut im Wind und sang, um mich aufzumuntern, lauthals: »Wir lieben die Stürme, die brausenden Wogen«, als ich aus dem Augenwinkel Ryerson Rainsmith entdeckte. Kaum hatte er mich erblickt, bog er jäh ab und verzog sich nach achtern.
Was unser Verhältnis für den Rest der Reise ziemlich treffend ausdrückte.
Als wir ein paar Tage darauf in den Hafen von Halifax einliefen, wies Dorsey mich an, mir die Nase zu putzen. Das war meine erste Begegnung mit der Neuen Welt.
In Quebec City gingen wir an Land. Ein kanadischer Zollbeamter in schwarzer Uniform fragte mich nach dem Zweck meines Aufenthalts.
»Strafkolonie«, erwiderte ich knapp. Er zog die Augenbrauen hoch, sah die Rainsmiths mitfühlend und kopfschüttelnd an und knallte einen Stempel in meinen Pass.
Erst in diesem Augenblick wurde mir so richtig bewusst, wie weit weg von zu Hause ich war. Allein in einem fremden Land.
Unerklärlicherweise brach ich in Tränen aus.
»Na, na«, machte Ryerson Rainsmith, sah dabei aber nicht mich an, sondern den Zollbeamten.
»Das kleine englische Mädchen hat wohl Heimweh«, sagte der Beamte, ging vor mir in die Hocke und trocknete mir mit einem riesigen weißen Taschentuch die Augen.
Für diese Feststellung musste er kein großartiger Detektiv sein, denn er hatte bereits in unsere Pässe geschaut und wusste, dass ich nicht das Kind der beiden war. Was führte er also dann im Schilde? Gehörte diese Inspektion aus nächster Nähe zu seiner routinemäßigen Suche nach Schmuggelware?
Ganz kurz liebäugelte ich mit dem Gedanken, eine Ohnmacht vorzutäuschen und anschließend lautstark nach einem belebenden Schluck aus einer der sechs Flaschen Gordon’s Gin zu verlangen, die – neben anderen zu verzollenden Waren – im doppelten Boden des Rainsmithschen Überseekoffers versteckt waren.
Fragen Sie mich jetzt nicht, woher ich das wusste. Es gibt in meinem Leben ein paar Dinge, auf die ich immer noch nicht stolz bin.
»Kopf hoch!«, sagte der Beamte, hob mit dem gekrümmten Zeigefinger mein Kinn an und schaute mir in die Augen. Schmunzelnd sagte er zu den Rainsmiths: »Ich hab auch so eine zu Hause.«
Aus irgendeinem Grund glaubte ich ihm das nicht ganz, rang mir aber ein mattes Lächeln ab.
Trotzdem … was für eine dämliche Bemerkung! Und wenn er zu Hause hundert Töchter hatte, die in hundert seidene Taschentücher schluchzten, was ging mich das an, bitte schön?
Eine der Sachen, die mir am Erwachsenwerden Angst machen, ist der Umstand, dass einem die Sentimentalität früher oder später die einfachste Logik vernebelt. Unechte Gefühle verkleben einem das Hirn wie Honig, den man in die komplizierte Mechanik eines kostbaren Uhrwerks gießt.
Ich habe dieses Phänomen bei den Erwachsenen meiner Umgebung immer wieder beobachtet. Wenn alles andere nichts mehr half, konnten sie sich immer noch mit einem tüchtigen Tränenausbruch aus der Klemme helfen. Das war nicht nur reiner Instinkt, nein, es war mehr als das. Es hat mit den ölhaltigen chemischen Stoffen zu tun, die ein weinender Mensch absondert. Irgendwelche hochempfindlichen Sensoren in der Nase reagieren auf den veränderten Hormon- und Eiweißspiegel des von seinen Gefühlen überwältigten Menschen – vor allem des weiblichen.
Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, eine kleine Abhandlung über dieses spannende Thema zu verfassen – Tränen im Reagenzglas –, war aber nicht mehr dazu gekommen, weil man mich mir nichts, dir nichts aus dem Stammsitz meiner Ahnen hinausgeworfen hatte. Allein bei der Vorstellung, dass ich mich vom prachtvollen Chemielabor meines verstorbenen Onkels Tarquin mit seinen unzähligen glänzenden Glasbehältern, dem herrlichen alten Leitz-Mikroskop, den Reihen von Fläschchen mit Chemikalien und großartigen Giften hatte trennen müssen, kamen mir erneut die Tränen – sodass alles wieder von vorn losging.
In jenem stillen Raum, in den das Tageslicht durch hohe Fenster hereinfiel, und mit der Hilfe von Onkel Tars Notizbüchern und seiner Fachbibliothek hatte ich mich selbst zur Chemikerin ausgebildet und mich damit ein für alle Mal vom Rest der Menschheit abgesondert.
Dass ich zu Anfang meiner Studien noch ein Kind gewesen war, spielte keine Rolle. Inzwischen war ich zwölf und hatte ein bemerkenswertes Geschick in der Kunst erworben, mit den »Krümeln des Universums« zu jonglieren, wie Onkel Tar es einmal genannt hatte.
»Tut mir leid«, schniefte ich. »Es ist einfach über mich gekommen. Entschuldigung.«
Der Bann war gebrochen. Der Augenblick war vorüber, und wir waren wieder in die schnöde kalte Welt zurückgekehrt.
Der Zollbeamte stand auf und vergewisserte sich mit einem raschen Blick, dass niemand seinen Anflug von Schwäche mitbekommen hatte.
»Der Nächste bitte!«, rief er und kritzelte sein Kreidezeichen auf unser Gepäck.
Während sich Ryerson Rainsmith am Bahnschalter nach Fahrkarten anstellte, nahm ich ein Streckennetz und einen Fahrplan aus einem Ständer. Die Entfernung zwischen Quebec City und Toronto betrug fünfhundert Meilen, stellte ich fest. Über die Hälfte der Strecke von Land’s End nach John o’Groats.
Wir würden neun Stunden unterwegs sein und erst spätabends, gegen elf Uhr, in Toronto eintreffen.
Dorsey Rainsmith hatte sich hinter einem Taschenbuch aus dem Zeitungskiosk verschanzt. Die Rache ist mein, lautete der Titel des Romans, der von einem gewissen Mickey Spillane verfasst war. Sie versuchte, die Schwarte in der gefalteten Montreal Gazette zu verstecken, aber ich hatte schon einen Blick auf das Umschlagbild erhascht. Ein Mann mit Trenchcoat und breitkrempigem Hut hielt eine anscheinend leblose Blonde in den Armen. Ihr weißes Seidenkleid war bis zum Rachenzäpfchen hochgeschoben.
Der Titel war ein Bibelzitat. Es war mir selbst des Öfteren in den Sinn gekommen, wenn ich mal wieder Pläne geschmiedet hatte, meinen Schwestern eine Lektion zu erteilen. Quer über dem Umschlag prangte Werbung für weitere Bücher des Autors mit Titeln wie: Ich, der Richter und Meine Kanone sitzt locker.
Die Titel übten auf mich eine seltsam befriedigende Wirkung aus, warum, wusste ich selbst nicht recht.
»Einsteigen bitte!«, rief der Schaffner.
Ich lernte schnell. Zu Hause in England hatten nur Busse und Straßenbahnen Schaffner, in der Bahn fuhr ein Zugbegleiter mit. Hier in Kanada hieß auch Letzterer »Schaffner«, und in den Waggons, die hier »Wagen« hießen, gab es keine abgetrennten Abteile, die nur nach außen zum Bahnsteig hin zu öffnen waren, sondern die Sitze waren zu beiden Seiten eines Mittelganges aufgereiht.
Ich kam mir vor, als wäre ich eingeschlafen und als Alice im Wunderland wieder aufgewacht. Alles war überlebensgroß, und alle fuhren auf der falschen Straßenseite.
Kein Wunder, dass es »Neue Welt« hieß.
Endlich setzte sich der Zug mit einem Ruck in Bewegung, und die Reise ging weiter. Ich musste den Rainsmiths gegenübersitzen, als hockte ich im Old Bailey auf der Anklagebank vor zwei griesgrämigen alten Richtern.
Nach fünfzig Meilen himmlischer Ruhe beschloss Ryerson Rainsmith, etwas für meine Bildung zu tun. Er entfaltete ebenfalls eine Eisenbahnkarte und las jedes Mal, bevor wir in einen Bahnhof einfuhren, den Namen der betreffenden Stadt vor. »Val-Alain, Villeroy … Parisville … St. Wenceslas …«
Ich gähnte verstohlen.
Er machte unbeirrt weiter, die ganze Strecke von St. Léonard de Nicolet über St. Perpétue, St. Cyrille, St. Germain, St. Eugene, St. Edward, St. Rosalie, St. Hyacinthe, St. Madeleine, St. Hilaire, St. Hubert und St. Lambert, bis ich hätte schreien können. Eine Zeit lang tat ich so, als wäre ich eingeschlafen, aber das half auch nichts. Er beugte sich vor, packte mich am Arm und schüttelte mich wie ein Terrier ein Kaninchen.
»Erdkunde kann richtig Spaß machen, Flavia«, sagte er. »Lass dich doch mal darauf ein!«
Dorsey nahm kaum die Nase aus ihrem Reißer. Sie blickte nur ein einziges Mal auf und fragte: »Was bedeutet eigentlich ›sich entleiben‹, Ryerson?«
Er wurde leichenblass, und sein Gesicht sah aus, als führte sein Hirn einen Ringkampf mit seinen Mandeln auf. Er zog ein Taschentuch aus der Weste und wischte sich übers Gesicht, dann sagte er nur: »Nicht vor dem Kind.«
Dorsey widmete sich wieder ihrer Lektüre, als hätte sie gar nicht hingehört.
Ich hätte ihr erklären können, dass »sich entleiben« dasselbe bedeutete wie »Selbstmord begehen«, aber ich hatte keine Lust.
Ryerson griff eilig wieder nach seinem Streckennetz und las die Namen der Bahnhöfe vor, durch die wir im Lauf des Tages noch durchfahren würden, nur dass er diesmal die zurückzulegenden Meilen sowie die Ankunfts- und Abfahrtszeiten aus dem Fahrplan anfügte.
Als wir endlich im Hauptbahnhof von Montreal ankamen, hatte sich mein Hirn komplett in Wackelpudding verwandelt.
Zum Glück mussten wir nicht nur in einen anderen Zug umsteigen, sondern dieser fuhr auch von einem anderen Bahnhof ab, und mein selbst ernannter Erdkundelehrer hatte die folgenden vier Stunden damit zu tun, Taxifahrern in herablassendem Ton Anweisungen zu erteilen sowie Schalterbeamte und Kofferträger zu beschimpfen, sodass sich meine Ohren ein bisschen erholen konnten.
Doch nur allzu bald fuhren wir weiter.
»Auf nach Westen!«, hätte ich am liebsten gejohlt.
Ich konnte die Ankunft in Toronto kaum erwarten – nicht nur deshalb, weil ich dann am Ziel war, sondern vor allem, weil ich dort endlich diesen Kerl loswurde, den ich inzwischen heimlich »Lord Labertasche« getauft hatte.
Wir glitten gemütlich – von Ryerson mal abgesehen – am Ufer des breiten Sankt-Lorenz-Stromes entlang, der mit so vielen Inseln übersät war wie der Himmel mit Sternen. Auf manchen dieser Eilande standen einsame Häuser in beneidenswerter Abgeschiedenheit.
Ich beschloss, beim nächsten Halt aus dem Zug zu springen. Ich würde zu einer jener Inseln hinüberschwimmen und dort als eine moderne Ausgabe von Robinson Crusoe leben. Kanada war eine riesige Wildnis. Niemand würde mich jemals finden.
»Sieh mal da drüben, Flavia!« Ryerson zeigte auf eine Burg mit grauen Mauern, vielleicht aus Kalkstein. »Das ist die Arrestanstalt von Kingston.«
»Wo du eines Tages enden wirst, wenn du nicht lernst, dich zu benehmen.« Dorsey hatte abermals von ihrem blutrünstigen Kriminalroman aufgeschaut.
Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was eine Arrestanstalt war, aber das Wort klang mir ganz nach einer treffenden Umschreibung meiner derzeitigen Lage, und ein paar kostbare Augenblicke lang stellte ich mir vor, wie ich hinter den hohen Mauern jener unwirtlichen Festung Schutz vor den Rainsmiths fand.
Die Stunden schlurften mit schweren, in Ketten gelegten Füßen dahin.
Vor den Zugfenstern rauschte Kanada vorüber wie auf einem sich drehenden Plattenteller. Das Land schien aus erstaunlich viel Wasser zu bestehen.
Dann wurde es dunkel, und alles, was ich noch sah, war das Spiegelbild der Rainsmiths in der Fensterscheibe. Dorsey war eingeschlafen. Ihr Hals war so verrenkt, als hinge sie an einem Strick, und ihr Mund stand auf eine so abstoßende Weise offen, dass mir der Anblick außerordentlich gut gefiel.
Ich stellte mir vor, sie sei die Mörderin Edith Thompson, deren ungewöhnlich gewaltsame Hinrichtung den amtlichen Henker John Ellis in den Selbstmord getrieben hatte.
Jetzt bildete sich ein Speichelfaden in ihrem Mundwinkel. Der Tropfen am Ende schwang im Takt mit dem Stampfen des Zuges hin und her wie eine akrobatische Spinne. Ich überlegte noch, ob das den Eindruck einer Gehängten eher verstärkte oder verdarb, als Ryerson mich am Arm fasste.
Mir blieb vor Schreck fast das Herz stehen.
»Wir sind gleich da«, verkündete er im Flüsterton, um seine schlummernde Gattin nicht zu stören.
Er war genauso wenig darauf erpicht, sie zu wecken, wie ich.
Ich wandte mich wieder ab und betrachtete die erleuchteten Fenster, die nun draußen vorbeiglitten. Fenster, hinter denen unzählige Mütter in unzähligen Küchen Essen kochten, unzählige Väter in unzähligen bequemen Sesseln Zeitung lasen, unzählige Kinder an unzähligen Tischen schrieben oder malten, dazu hier und dort, wie eine Kerze in der Einöde, das einsame bläuliche Geflacker eines kleinen Fernsehbildschirms.
Es war alles so unerträglich traurig.
Konnte es wirklich noch schlimmer kommen?
2
In Toronto regnete es.
Tief hängende Wolken, vom Widerschein der Neonreklamen rötlich gefärbt wie entzündete Eingeweide, leuchteten über himmelhohen Hotelgebäuden. Die nassen Bürgersteige waren ein durchweichter Flickenteppich aus zerlaufenden Farben und strömenden Wasserbächen. Straßenbahnen rasselten funkensprühend durch die Dunkelheit, und die Nachtluft roch beißend nach ihren Ozonausdünstungen.
Dorsey Rainsmith stand unter dem Schirm, den ihr Mann über sie hielt, und war noch nicht ganz wieder bei sich. Sie sah sich blinzelnd um, als sei sie soeben auf einem fremden, äußerst unerfreulichen Planeten aufgewacht.
»Heute sind viele Taxen unterwegs«, sagte ihr Gatte munter und spähte nach beiden Richtungen die Straße entlang. »Bestimmt hält gleich eins.« Er wedelte hektisch mit den Armen, als ein einsames Taxi auf der falschen Straßenseite vorbeibrummte, doch der Wagen fuhr weiter, ohne ihn zu beachten. Wasser spritzte aus den Pfützen auf.
»Ich verstehe nicht, warum uns Merton nicht abholen kann«, sagte Dorsey.
»Weil seine Mutter gestorben ist, Dödelchen«, antwortete Ryerson, der anscheinend vergessen hatte, dass ich auch noch da war. »Er hat uns doch ein Telegramm geschickt, weißt du nicht mehr?«
»Nein«, erwiderte sie und setzte eins ihrer eindrucksvollen Schmollgesichter auf.
Ryerson nagte nervös an seiner Unterlippe. Wenn nicht innerhalb der nächsten zwei Minuten ein Taxi hielt, war er geliefert.
»Gleich morgen früh bestelle ich Blumen«, sagte er. »Für euch beide.«
Bei allen galoppierenden Galatern! Sollte das eine Beleidigung sein? Oder hatte ich mich verhört?
Dorsey richtete den trägen, kalten Reptilienblick auf ihn, doch im selben Augenblick bremste ein Taxi am Bordstein.
»Na bitte!«, sagte Ryerson fröhlich und rieb sich die Hände – oder rang er sie verzweifelt?
Die Rainsmiths setzten sich nach hinten, wodurch für mich nur der Platz neben dem Fahrer blieb.
Ryerson nannte ihm ihre Adresse.
»Heute Nacht schläfst du bei uns, Flavia«, wandte er sich an mich. »Es ist schon zu spät, um dich noch in die Schule zu bringen. Dort ist bestimmt längst ›Licht aus!‹ befohlen, und die Schülerinnen liegen im Bettchen.«
»Nichts da!«, mischte sich seine Frau ein. »Wir haben kein Gästezimmer hergerichtet, und wenn Merton verhindert ist, wird mir das alles zu viel. Fahrer, bringen Sie uns auf dem kürzesten Weg zu Miss Bodycotes Höherer Mädchenschule! Irgendjemand wird uns schon aufmachen.«
Damit war es entschieden.
Im Rückspiegel konnte ich beobachten – leider ohne Ton –, wie Dorsey Rainsmith mit zorniger Miene auf ihren Gatten einredete. Ryersons Gesicht sah im Licht der Straßenlaternen, das durch die regennassen Wagenfenster fiel, aus, als würde es zerfließen.
Miss Bodycotes Höhere Mädchenschule lag in einer Sackgasse, die von einer breiten Straße namens Danforth Avenue abging.
Ich musste zugeben, dass ich mir das alles ganz anders vorgestellt hatte.
Auf beiden Straßenseiten ragten hohe Reihenhäuser auf. Ihre Fenster waren einladend erleuchtet. Dazwischen stand auf einem eigenen, weitläufigen Grundstück dunkel und wuchtig das Schulgebäude, noch höher und größer als die umliegenden Häuser, ein riesiger schwarzer Steinkasten im Regen.
Später erfuhr ich, dass das Gebäude früher ein Kloster gewesen war, doch das wusste ich noch nicht, als Ryerson die Vortreppe hochstieg und energisch den Klingelzug an einem kleinen gotischen Tor betätigte, das seitlich in den Gewölbebogen der Haustür eingelassen war und vermutlich zur Pförtnerloge führte. Ich stand wartend neben ihm.
Dorsey wartete im Taxi. Ryerson hämmerte jetzt ungeduldig mit der Faust an die schwere Haustür.
»Aufmachen!«, rief er zu den leeren, vorhanglosen Fenstern empor. »Hier ist der Beiratsvorsitzende!«
Halblaut sagte er vor sich hin: »Das dürfte sie ja wohl aus den Betten holen.«
Irgendwo im Haus flackerte ein mattes Licht auf, als hätte jemand eine Kerze angezündet.
Ryerson warf mir einen triumphierenden Blick zu, und ich erwog kurz, Beifall zu klatschen.
Nach einer halben Ewigkeit, die in Wirklichkeit wohl eher eine halbe Minute war, öffnete eine Erscheinung im Nachthemd, mit Lockenwicklern und einer dicken Brille, die Tür einen kleinen Spalt.
»Ja bitte?«, fragte eine knarzige Frauenstimme. Ein zinnerner Kerzenhalter wurde hochgehoben, und unsere Gesichter wurden angeleuchtet. Dann der erschrockene Ausruf: »Ach, Sie sind’s, Sir! Bitte entschuldigen Sie!«
»Schon gut, Fitzgibbon. Ich bringe die neue Schülerin.«
»Aha.« Die Erscheinung beschrieb mit der Kerze einen ausladenden Bogen, der uns hereinbitten sollte.
Wir betraten ein riesiges, hallendes Mausoleum. Die Wände waren über und über mit spitz zulaufenden, farbig ausgemalten Nischen übersät wie mit Pockennarben, einige waren auch in Muschelform ausgehöhlt und machten den Eindruck, als hätten sie früher fromme Figuren beherbergt. Inzwischen hatte man die bleichen Heiligen und Jungfrauen jedoch durch Messingbüsten missmutig blickender alter Männer mit Schnurrbärten und Zylinderhüten ersetzt, die die Hände zwischen die Knöpfe ihrer Gehröcke geschoben hatten.
Abgesehen davon kam ich gerade noch dazu, einen flüchtigen Blick auf blank gescheuerte Dielen und endlose Flächen lackierter Wandvertäfelung zu erhaschen, denn die Kerze erlosch, und wir standen im Finstern. Es roch wie in einem Klavierlager, nach Holz, Politur und nach etwas streng Metallischem, das mich an gespannte Saiten und alte Zitronen denken ließ.
»Verdammt!«, schimpfte jemand an meinem Ohr.
Dann flammte das elektrische Licht auf, und wir kniffen alle drei geblendet die Augen zusammen.
Am oberen Ende einer breiten Treppe stand, die Hand noch am Schalter, eine hochgewachsene Frau. »Wer ist da, Fitzgibbon?«, fragte sie mit einer Stimme, die vermuten ließ, dass sie sich von Erdbeeren mit Stacheldraht zu ernähren pflegte.
»Es ist der Beiratsvorsitzende, Miss. Er hat die neue Schülerin gebracht.«
Ich merkte, dass ich allmählich sauer wurde. Jedenfalls hatte ich nicht vor, tatenlos herumzustehen, während über mich verhandelt wurde, als wäre ich ein neuer Besen im Haushaltswarenladen.
Ich trat vor. »Guten Abend, Miss Fawlthorne. Ich bin Flavia de Luce. Sie haben mich sicherlich schon erwartet.«
Den Namen der Rektorin kannte ich aus dem Prospekt, den die Schule Vater zugeschickt hatte. Ich konnte nur hoffen, dass die Frau auf der Treppe tatsächlich die Rektorin war und nicht nur eine Hausangestellte.
Sie schritt die Treppe gemessenen Schrittes herab, ihr Gesicht wurde von dem leuchtend weißen Haar wie von einem Heiligenschein aus Schnee eingerahmt. Sie trug ein schwarzes Kostüm und eine weiße Bluse, und an ihrem Hals glühte eine große Rubinbrosche wie ein Tropfen frischen Blutes. Ihre Adlernase und der dunkle Teint ließen mich unwillkürlich an eine Piratin denken, die ihre Abenteuer auf See zugunsten einer pädagogischen Laufbahn aufgegeben hat.
Sie musterte mich von oben bis unten, vom Scheitel bis zur Sohle.
Was sie sah, schien sie zufriedenzustellen, denn schließlich sagte sie: »Hol ihre Sachen.«
Fitzgibbon öffnete die Haustür wieder und gab dem Taxifahrer ein Zeichen. Im nächsten Augenblick stapelte sich mein pitschnasses Gepäck in der Eingangshalle.
»Danke, Dr. Rainsmith«, verabschiedete die Hochgewachsene den Beiratsvorsitzenden. »Sehr nett von Ihnen.«
Eine ziemlich knappe Abfertigung für jemanden, der mich quer über den Atlantik und durch halb Kanada mitgeschleppt hatte, aber vielleicht lag es an der späten Stunde.
Ryerson Rainsmith nickte nur. Dann war er verschwunden und ich meinen neuen Gefängniswärtern ausgeliefert.
Miss Fawlthorne – inzwischen war ich so gut wie sicher, dass sie es war, sonst hätte sie mir ja widersprochen – schritt langsam einmal um mich herum. »Hast du Alkohol oder Zigaretten am Körper oder im Gepäck dabei?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ich höre?«
»Nein, Miss Fawlthorne«, sagte ich.
»Schusswaffen?« Sie beobachtete mich scharf.
»Nein, Miss Fawlthorne.«
»Sehr schön. Dann heiße ich dich in Miss Bodycotes Höherer Mädchenschule willkommen. Morgen früh nehme ich dich offiziell auf. Bring sie auf ihr Zimmer, Fitzgibbon.«
Damit knipste sie das elektrische Licht aus und verschmolz mit der Dunkelheit.
Fitzgibbon hatte ihre Kerze wieder angezündet, und wir erklommen, umtanzt von flackernden Schatten, die Treppe.
»Du bist in Edith Cavell untergebracht«, krächzte sie, als wir oben waren, angelte einen Schlüsselbund aus irgendeiner unaussprechlichen Falte ihres Nachtgewands und schloss auf.
Ich kannte den Namen an der Tür. Das Zimmer war dem Andenken Edith Cavells gewidmet, einer heldenhaften Krankenschwester im Ersten Weltkrieg, die von einem Erschießungskommando der Deutschen hingerichtet worden war, weil sie Gefangenen zur Flucht verholfen hatte. Ich dachte an ihre berühmten, praktisch letzten Worte, die ich unter ihrem Standbild in der Nähe des Trafalgar Square in London gelesen hatte: »Ich habe erkannt, dass Vaterlandsliebe nicht genug ist und dass ich weder Hass noch Bitterkeit gegenüber irgendjemandem empfinden darf.«
Spontan beschloss ich, diese Worte zu meinem persönlichen Wahlspruch zu machen. Nichts hätte passender sein können.
Zumindest fürs Erste.
Fitzgibbon stellte den Kerzenhalter auf ein Tischchen. »Puste die Kerze aus, wenn du dich bettfertig gemacht hast. Schalte das Deckenlicht nicht ein, die anderen schlafen schon.«
»Darf ich denn den Kamin anzünden?«, fragte ich. »Ich bin völlig durchgefroren.«
»Kein Kaminfeuer bis zum fünften November«, lautete die Antwort. »Das ist hier Tradition. Außerdem sind Kohle und Holz bares Geld.«
Ohne ein weiteres Wort ließ sie mich stehen.
Allein.
Über diese Nacht will ich kein weiteres Wort verlieren außer der Erinnerung daran, dass die Matratze offenbar mit Schottersteinen gefüllt war und dass ich den Schlaf der Verdammten schlief.
Die Kerze ließ ich brennen. Sie war die einzige Wärmequelle im Raum.
Ich würde gern erzählen, dass ich von Buckshaw träumte und von Vater, Feely und Daffy, aber das wäre gelogen. In meinem erschöpften Hirn überschlugen sich stattdessen Bilder von tosenden Wellen, von sprühender Gischt und von Dorsey Rainsmith, die sich in einen Albatros verwandelt hatte, der auf der Mastspitze eines vom Sturm umhergeschleuderten Schiffes hockte und mich mit wüsten Vogelflüchen überschüttete.
Als ich mich endlich aus meinem unruhigen Schlaf herausgekämpft hatte, musste ich feststellen, dass jemand rittlings auf meiner Brust saß und meinen Kopf und meine Schultern mit wütenden Faustschlägen bearbeitete.
»Verräterin!«, hörte ich eine schluchzende Stimme. »Elende, dreckige Verräterin! Verräterin! Verräterin!«
Es war noch lange nicht Morgen. Der trübe Lichtschein der Straßenlaterne, der ins Zimmer sickerte, reichte nicht aus, um das Gesicht der Angreiferin zu erkennen.
Ich nahm alle Kraft zusammen und stieß sie von mir weg.
Jemand plumpste auf den Boden und blieb dort stöhnend liegen.
»Sag mal, spinnst du?«, fragte ich und schnappte mir die Kerze vom Tisch. Im Notfall war sie auch als Waffe besser als nichts. Die schwache Flamme loderte wieder hell auf.
Ich hörte, wie jemand nach Luft schnappte. Es klang überrascht.
»Du bist ja gar nicht Pinkham!«, ertönte es aus dem Halbdunkel.
»Natürlich nicht! Ich bin Flavia de Luce.«
Ein Schlucken. »De Luce? Die Neue?«
»Ja.«
»Ach du Sch… äh … Schreck! Da hab ich ja was angerichtet.«
Es raschelte, dann wurde das Deckenlicht angeknipst.
Neben dem Lichtschalter stand, mit geblendet blinzelnden Augen – die Daffy als »Glupschaugen« bezeichnet hätte –, die erstaunlichste kleine Person, die mir je begegnet war. Unter dem dunkelblauen Rock einer zerknitterten Schuluniform ragten dürre Eidechsenbeine in ausgeleierten schwarzen Wollstrümpfen hervor. Der übrige Körper, kaum mehr als ein Anhängsel der bemerkenswert langen O-Beine, glich einem plattgeklopften Teigklumpen, einem schlampig geformten Lebkuchenmann.
»Wer zum Teufel bist du?«, fragte ich barsch, um gleich klarzustellen, wer hier den Ton angab.
»Collingwood, P. A. P. A. steht für Patricia Anne. Mensch, hoffentlich bist du jetzt nicht stinksauer auf mich. Ich hab dich für Pinkham gehalten. Ehrlich! Ich hab nicht dran gedacht, dass sie mit Barton nach Laura Secord verlegt wurde, weil sie immer Albträume hat. Sonderregelung.«
»Und warum wolltest du diese Pinkham verdreschen? Was hat sie dir getan?« So glimpflich kam sie mir nicht davon!
Collingwood lief rot an. »Das darf ich dir nicht sagen. Sonst bringt sie mich um.«
Ich musterte sie mit dem berühmten eisig blauen de-Luce-Blick – auch wenn meiner eher ins Violette spielt, vor allem, wenn ich sauer bin.
»Spuck’s aus«, sagte ich, hob drohend die Kerze und trat einen Schritt auf sie zu. Schließlich waren wir hier in Nordamerika, dem Land von George Raft und James Cagney, wo man nicht lange um den heißen Brei herumredete.
Collingwood brach in Tränen aus.
»Komm schon, Kleines«, sagte ich etwas milder.
Komm schon, Kleines?
Meine Ohren wollten kaum glauben, was mein Mund soeben ausgesprochen hatte. Kaum war ich ein paar Stunden in Kanada, schon redete ich daher wie Humphrey Bogart! Lag das an der hiesigen Luft oder woran?
»Sie hat mich verpfiffen«, schniefte Collingwood und wischte sich mit der Schulkrawatte über die Augen.
Die redeten hier tatsächlich so! Dann waren die zahllosen Nachmittage mit Feely und Daffy im Kino von Hinley doch keine Zeitverschwendung gewesen, wie Vater immer behauptet hatte. Damals hatte ich meine erste Fremdsprache erlernt, und ich beherrschte sie gut.
»Verpfiffen«, wiederholte ich.
Collingwood nickte. »Bei der Direx«, setzte sie hinzu.
»Miss Fawlthorne?«
»Wir nennen sie auch ›das Henkersweib‹. Aber erzähl bloß keinem, von wem du das hast. Sie hat ganz unaussprechliche Dinge getan, musst du wissen.«
»Zum Beispiel?«
Collingwood schaute sich nach allen Seiten um, ehe sie im Flüsterton antwortete: »Hier verschwinden Leute.« Sie drückte die Hände erst fest aneinander, um mir im nächsten Augenblick blitzschnell die leeren Handflächen zuzukehren. »Puff! Einfach so. Ohne jede Spur.«
»Du willst mich auf den Arm nehmen«, sagte ich.
»Ach ja?« Ihre Augen waren riesig und feucht. »Und was ist mit Le Marchand? Mit Wentworth? Mit Brazenose?«
»Die können doch nicht alle spurlos verschwunden sein«, wandte ich ein. »Das hätte doch jemandem auffallen müssen.«
»Das ist es ja gerade! Es ist niemandem aufgefallen. Ich hab mir Notizen darüber gemacht, aber Pinkham hat mich erwischt. Sie hat mir das Heft aus der Hand gerissen und ist damit zu Miss Fawlthorne gerannt.«
»Wann war das?«
»Gestern Abend. Glaubst du, ich werde jetzt umgebracht?«
»Unsinn«, sagte ich. »So was gibt es nur im Film. Nicht im wahren Leben.«
Dabei wusste ich nur allzu gut, dass so etwas durchaus vorkam. Nach meiner Erfahrung sogar öfter, als man denken sollte.
»Bist du sicher?«, fragte Collingwood.
»Ganz sicher«, log ich.
»Versprich mir, dass du es niemandem weitersagst«, flüsterte sie.
»Ich schwöre«, erwiderte ich und zeichnete aus unerfindlichen Gründen ein Kreuz in die Luft.
Collingwood runzelte die Stirn. »Bist du etwa katholisch?«
»Wieso?«, fragte ich zurück, um Zeit zu gewinnen. Zufällig hatte sie nämlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Obwohl wir de Luces uns nach außen hin als praktizierende Anglikaner gaben, war unsere Familie schon römisch-katholisch gewesen, als Rom noch aus sieben malerischen Hügeln inmitten der italienischen Wildnis bestanden hatte. Die Seele ist nicht unbedingt dort, wo das Herz ist, wie Daffy immer sagt.
»Zufällig ja«, sagte ich.
Collingwood pfiff durch die Zähne. »Hab ich’s mir doch gleich gedacht! Unsere Nachbarn zu Hause in Niagara-on-the-Lake, die Connollys, die sind auch katholisch. Sie machen mit den Fingern das gleiche Zeichen wie du. Es soll ein Kreuz darstellen, oder? Hat mir jedenfalls Mary Grace Connolly erklärt. Ich musste ihr versprechen, es für mich zu behalten. Aber sag mal … Was machst du dann überhaupt hier? Diese Schule ist doch …«
»Ich weiß, ich weiß«, fiel ich ihr ins Wort. »Dermaßen anglikanisch, dass man nur auf einen Küchenhocker zu steigen braucht und schon mit einem Bein im Paradies steht.«
Wo hatte ich den Spruch denn her? Ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Von Tante Felicity? Von Vater auf keinen Fall.
»An deiner Stelle würde ich keinem verraten, dass du katholisch bist«, sagte Collingwood. »Sonst ziehen sie dir bei lebendigem Leib das Fell über die Ohren.«
»Pah, wir Katholiken sind schon seit der Erfindung des Scheiterhaufens Märtyrer«, gab ich zurück. »Wir sind an so was gewöhnt.«
Eine ziemlich patzige Bemerkung, aber ich musste sie trotzdem loswerden.
»Bei mir ist dein Geheimnis gut aufgehoben«, sagte Collingwood und kniff die Lippen fest zusammen, während sie weitersprach. »Keine zehn Pferde könnten mich dazu bringen, es preiszugeben.«
Der letzte Satz hörte sich an wie: »Keie-ehn-Erde-önne-ich-afu-ringe-eff-peifffugebe.«
»Es ist kein Geheimnis«, entgegnete ich. »Wir sind sogar sehr stolz darauf.«
Im selben Augenblick wurde so donnernd gegen die Tür gehämmert, dass das Holz splitterte und ich beinahe einen Nierenstillstand erlitt.
»Aufmachen!«, rief jemand. Obwohl ich die Stimme erst ein paarmal gehört hatte, erkannte ich sie sofort wieder.
Sie gehörte Miss Fawlthorne.
»Licht aus!«, zischelte Collingwood.
»Zu spät«, zischelte ich zurück. »Die Tür ist sowieso offen.«
»Nein. Ich hab abgeschlossen, als ich mich reingeschlichen hab.«
Sie huschte auf Zehenspitzen zum Schalter und löschte das Licht. Ich pustete die Kerze aus, und wir standen im Dunkeln.
Jedenfalls beinahe. Nach ein paar Sekunden nahm ich wahr, dass von der Straße immer noch ein bisschen Helligkeit hereinfiel.
»Was soll ich denn jetzt machen?«, raunte Collingwood mir zu. »Wir dürfen einander nicht auf den Zimmern besuchen. Jetzt bin ich dran!«
Ich sah mich im kränklichen Schein der Straßenlaterne im Zimmer um. Abgesehen vom Bett und der Wäschemangel für die Kleider konnte ich kein Versteck entdecken. Sie konnte sich höchstens hinter die Tapete quetschen.
Eins musste man Collingwood lassen – sie reagierte schnell. Mit einem einzigen Satz stand sie vor dem Kamin, duckte sich unter dem Sims weg und kroch irgendwie im Abzug nach oben. Das Letzte, was ich von ihr sah, waren die schwarz bestrumpften Eidechsenbeine, die auf Zehenspitzen auf den Feuerböcken standen – dann waren auch sie verschwunden.
Hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen, ich hätte es nicht geglaubt.
Verzweiflung kann wahre Wunder wirken.
»Aufmachen!«, tönte es wieder von draußen. »Ich weiß, dass ihr da drin seid!«
Es klopfte abermals, noch heftiger als beim ersten Mal, sodass das ganze Türblatt erzitterte. Falls nicht schon das erste Hämmern die ganze Schule aufgeweckt hatte, dann garantiert das zweite.
Bestimmt saßen jetzt Dutzende Mädchen kerzengerade im Bett, die Decke bis zum Kinn hochgezogen, die Augen angstvoll aufgerissen.
Die Totenstille, die auf das Klopfen folgte, war beinahe noch erschreckender.
»Macht sofort auf!«, befahl Miss Fawlthorne. »Oder muss ich erst Mr. Tugg rufen, damit er die Tür aufbricht?«
Ich tappte quer durchs Zimmer, drehte den Türknauf um und öffnete. »Was ist denn?«, fragte ich blinzelnd und rieb mir die Augen. »Brennt es? Ich habe geschlafen.«
»Lass gut sein, Mädchen«, sagte Miss Fawlthorne. »Du hast Licht angehabt. Und mit jemandem gesprochen.«
»Ich hab schlecht geträumt«, behauptete ich. »Bestimmt deshalb, weil ich so weit von zu Hause weg bin und so weiter. Ich rede öfter im Schlaf.«
»Soso«, machte Miss Fawlthorne. »Und knipst du im Schlaf auch öfter das Licht an?«
»Nein. Aber beim Aufwachen wusste ich plötzlich nicht mehr, wo ich bin. Ich war desorientiert.«
Ganz schön wagemutig, mitten in einem Verhör ein neues Wort auszuprobieren, aber mich trieb der Mut der Verzweiflung. »Desorientiert« hatte Daffys Ausrede gelautet, als Vater sie einst dabei ertappt hatte, wie sie Weihnachtsplätzchen aus der Speisekammer stibitzt hatte.
»Ich war desorientiert«, hatte sie verkündet, und Vater hatte ihr geglaubt. Allen Ernstes – er hatte ihr geglaubt!
Ich warf unauffällig einen Blick über die Schulter und schaltete die Deckenbeleuchtung wieder ein. Das Zimmer wurde in kaltes, grelles Licht getaucht.
»Nein!« Miss Fawlthornes Hand schoss an meiner Nase vorbei und knipste die Beleuchtung energisch wieder aus. »›Licht aus‹ bedeutet ›Licht aus‹, du dummes Ding.«
Das war zu viel. Erst hatte mich Ryerson Rainsmith eine ertrunkene Ratte genannt, und jetzt war Miss Fawlthornes Bemerkung der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ich war erst eine Woche von zu Hause fort, und schon standen auf meiner Liste der zu Vergiftenden zwei Personen mehr … drei, wenn man die dämliche Dödel mitzählte.
Miss Fawlthorne zauberte ein Heftchen Pappstreichhölzer hervor. Mit feierlicher Miene riss sie eines an und hielt es, ohne mich aus den Augen zu lassen, an den Docht der Kerze. Eine gelungene Demonstration sicherer Auge-Hand-Koordination.
»Also«, sagte sie dann und durchbohrte mich mit ihrem Blick wie einen Schmetterling, der in einem Schaukasten auf ein Stück Pappe aufgespießt wird. »Mit wem hast du eben gesprochen?«
Ich ahnte, dass wir noch bis Sonnenaufgang hier rumstehen würden, wenn ich die Antwort verweigerte. Miss Fawlthorne gehörte eindeutig zu diesem Schlag Erwachsener.
»Mit mir selber«, erwiderte ich und wandte verschämt den Blick ab. »Ich … ich führe manchmal Selbstgespräche, wenn es mir nicht gut geht. Ich weiß, dass man das nicht tut, und ich bin dabei, es mir abzugewöhnen.«
Es war zwecklos, das war mir eigentlich schon klar, als ich den Mund aufmachte.
Miss Fawlthorne ließ den Blick suchend durchs Zimmer wandern, wobei sie den Kopf verdrehte wie eine Eule. Ich überlegte kurz, ob er wohl abbrechen und herunterfallen würde, wenn sie ihn noch ein kleines Stückchen weiterdrehte.
Ich muss gestehen, dass ich insgeheim darauf hoffte.
Ich wagte nicht, zum Kamin hinüberzuschielen, denn damit hätte ich Collingwood sofort verraten. Daher schaute ich zerknirscht auf meine Füße.
»Sieh mich an!«, befahl Miss Fawlthorne, und ich hob zaghaft den Blick.
Ich war kurz davor loszuheulen, das spürte ich.
Was sie als Nächstes sagte, erschütterte mich bis ins Mark.
»Arme, einsame, unglückliche Flavia de Luce«, sagte sie, hob mit dem Zeigefinger mein Kinn an und blickte mir voller Zuneigung und sogar mit einem schiefen Lächeln in die Augen.