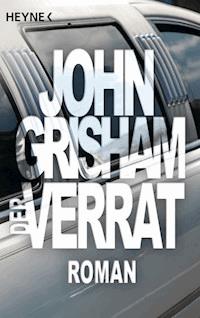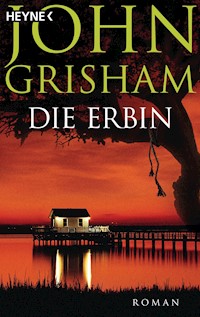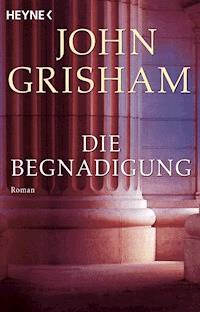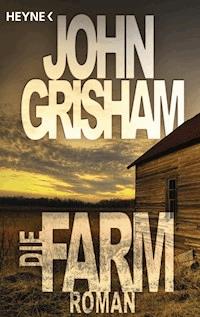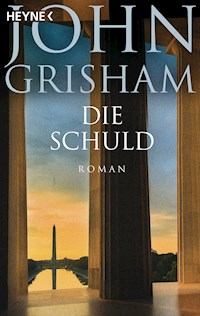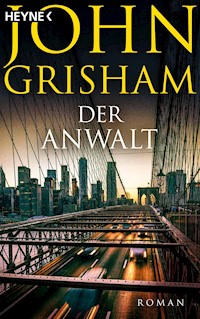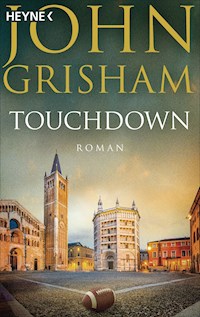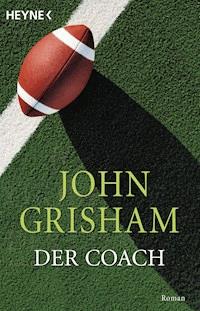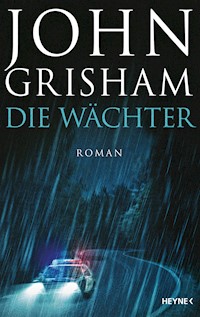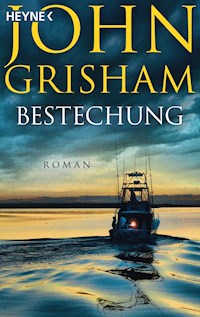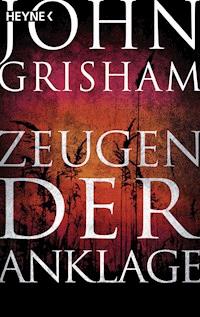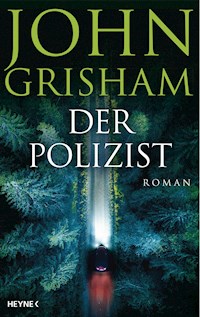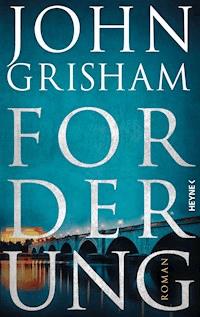
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein hochaktueller Roman um Profitgier, Betrug und Rache – John Grisham ist ein meisterhafter Erzähler
Sie wollten die Welt verändern, als sie ihr Jurastudium aufnahmen. Doch jetzt stehen Zola, Todd und Mark kurz vor dem Examen und müssen sich eingestehen, dass sie einem Betrug aufgesessen sind. Die private Hochschule, an der sie studieren, bietet eine derart mittelmäßige Ausbildung, dass die drei das Examen nicht schaffen werden. Doch ohne Abschluss wird es schwierig sein, einen gut bezahlten Job zu finden. Und ohne Job werden sie die Schulden, die sich für die Zahlung der horrenden Studiengebühren angehäuft haben, nicht begleichen können. Aber vielleicht gibt es einen Ausweg. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, nicht nur dem Schuldenberg zu entkommen, sondern auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ein geniales Katz- und Mausspiel nimmt seinen Lauf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Sie wollten die Welt verändern, als sie ihr Jurastudium aufnahmen. Doch jetzt stehen Zola, Todd und Mark kurz vor dem Examen und müssen sich eingestehen, dass sie einem Betrug aufgesessen sind. Die private Hochschule, an der sie studieren, bietet eine derart mittelmäßige Ausbildung, dass die drei das Examen nicht schaffen werden. Doch ohne Abschluss wird es schwierig sein, einen gut bezahlten Job zu finden. Und ohne Job werden sie die Schulden, die sich für die Zahlung der horrenden Studiengebühren angehäuft haben, nicht begleichen können. Aber vielleicht gibt es einen Ausweg. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, nicht nur dem Schuldenberg zu entkommen, sondern auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ein geniales Katz- und Mausspiel nimmt seinen Lauf.
Der Autor
John Grisham hat 31 Romane, ein Sachbuch, einen Erzählband und sechs Jugendbücher veröffentlicht. Seine Bücher wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt. Er lebt in Virginia.
JOHN GRISHAM
FORDERUNG
ROMAN
Aus dem Amerikanischen vonKristiana Dorn-Ruhl, Bea Reiterund Imke Walsh-Araya
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
The Rooster Bar
bei Doubleday, New York
Copyright © 2017 by Belfry Holdings, Inc.
Copyright © 2018 der deutschen Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Oliver Neumann
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,unter Verwendung eines Motivs von shutterstock / Sean Pavone
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-17419-4V002
www.heyne.de
1
Wie immer am Ende eines Jahres bereiteten sich die Fraziers auch diesmal auf die Festtage vor, obwohl im Haus niemandem nach Feiern zumute war. Aus reiner Gewohnheit schmückte Mrs. Frazier ein Bäumchen, wickelte ein paar einfache Geschenke in Papier und backte Kekse, die niemand essen würde. Aus den Lautsprechern der Stereoanlage erklang wie üblich ununterbrochen der Nussknacker, und sie summte in der Küche dazu, als herrschte eitel Sonnenschein.
Dabei waren die Zeiten alles andere als rosig. Vor drei Jahren hatte ihr Mann sie sitzen gelassen. Nicht dass sie ihn vermisste, ganz im Gegenteil. Er hatte es damals gar nicht abwarten können, mit seiner blutjungen und – wie sich herausstellen sollte – von ihm schwangeren Sekretärin zusammenzuziehen. Im Stich gelassen, mittellos und gedemütigt, war Mrs. Frazier in Depressionen verfallen, mit deren Folgen sie noch heute kämpfte.
Louie, ihr jüngerer Sohn, blickte schweren Zeiten entgegen, weil ihm ein Drogenprozess drohte. Er war auf Kaution frei, stand allerdings unter Hausarrest. Ein Geschenk erwartete sie nicht von ihm. Angeblich konnte er das Haus wegen der elektronischen Fußfessel nicht verlassen, doch das war eine billige Ausrede. In den beiden vergangenen Jahren hatte er sich frei bewegen können und trotzdem nie etwas für sie besorgt.
Mark, der ältere Sohn, machte Ferien vom Horror des Jurastudiums in Washington, D. C. Obwohl es ihm finanziell noch schlechter ging als seinem Bruder, hatte er ihr ein Parfüm gekauft. Er würde im Mai seinen Abschluss machen, im Juli die Prüfung zur Zulassung bei der Anwaltskammer und im September bei einer Kanzlei in Washington anfangen. Wie es der Zufall wollte, war Louies Prozess für den gleichen Zeitraum anberaumt. Dabei war fraglich, ob das Verfahren jemals vor Gericht gehen würde, und zwar aus zwei Gründen: Erstens war Louie von zivilen Drogenfahndern in flagranti erwischt worden, wie er zehn Tüten Crack verkaufte – es gab sogar eine Videoaufnahme davon. Zweitens konnten sich weder Louie noch seine Mutter einen anständigen Anwalt leisten. Während der Feiertage deuteten sowohl Mrs. Frazier als auch Louie wiederholt an, dass Mark doch einspringen und die Verteidigung seines Bruders übernehmen könne. Die Angelegenheit lasse sich bestimmt so lange verschleppen, bis Mark zugelassen sei, er stehe ja kurz davor. Anschließend werde er sicher einen dieser Formfehler finden, von denen man immer lese, sodass das Verfahren eingestellt werde.
Ihr bescheidener Wunschtraum wies ein paar grundlegende Denkfehler auf, doch Mark dachte ohnehin nicht im Traum daran, auf die Idee einzugehen. Als sich abzeichnete, dass Louie den Silvesterabend vor dem Fernseher zu verbringen gedachte, um mindestens sieben Football-Play-off-Spiele in Folge zu schauen, verzog er sich klammheimlich, um einen Freund zu besuchen. Auf der Heimfahrt beschloss er unter dem Einfluss des Alkohols, das Weite zu suchen, nach Washington zurückzukehren und sich bei seinem zukünftigen Arbeitgeber die Zeit zu vertreiben. Die Uni würde zwar erst in knapp zwei Wochen wieder anfangen, doch nachdem er sich zehn Tage lang Louies Jammern und Klagen angehört hatte, ganz zu schweigen vom ewigen Nussknacker-Gedudel, hatte Mark die Nase voll von zu Hause und freute sich geradezu auf das letzte Semester.
Er stellte seinen Wecker auf acht Uhr. Beim Frühstück erklärte er seiner Mutter, dass er in Washington gebraucht werde und leider vorzeitig abreisen müsse. Sorry, Mom, dass ich dich mit meinem nichtsnutzigen Bruder allein lasse. Aber es war nicht seine Aufgabe, Louie zu erziehen. Er hatte seine eigenen Probleme.
Zum Beispiel sein Wagen, ein Ford Bronco, den er seit der Highschool fuhr. Irgendwann mitten im Studium war der Tacho bei knapp dreihunderttausend Kilometer stehen geblieben. Das Auto brauchte unbedingt eine neue Benzinpumpe, und das war nicht der einzige Punkt auf der Liste der dringenden Reparaturen. Motor, Getriebe und Bremsen hatte Mark in den letzten zwei Jahren mit Klebeband und Büroklammern notdürftig zusammengeflickt, doch bei der Benzinpumpe hatten seine Künste versagt. Sie lief zwar noch, allerdings nur mit halber Kraft, sodass der Bronco selbst bei durchgedrücktem Gaspedal nicht mehr als achtzig Stundenkilometer schaffte. Um auf den Schnellstraßen nicht von Sattelzügen überrollt zu werden, kreuzte Mark auf Nebenstraßen durch das ländliche Delaware und an der Atlantikküste entlang, sodass er von Dover bis in die Innenstadt von Washington nicht zwei Stunden brauchte, sondern vier.
Immerhin hatte er auf diese Weise Zeit, um über seine anderen Probleme nachzudenken, zum Beispiel die horrenden Schulden aus dem Studienkredit. Das College hatte er mit sechzigtausend Dollar im Minus und ohne Aussicht auf einen Job abgeschlossen. Sein Vater – damals zwar noch glücklich verheiratet, aber hoch verschuldet – hatte ihn davor gewarnt, weiter zu studieren. »Verdammt, Junge«, hatte er gesagt, »nach vier Jahren College bist du mit sechzigtausend in den Miesen. Hör auf, bevor es noch schlimmer wird.« Doch Mark gab nichts auf die Finanzkompetenzen seines Vaters. Er jobbte als Barmann oder fuhr Pizza aus und versuchte unterdessen, seine Kreditgeber zu vertrösten. Im Rückblick konnte er nicht mehr sagen, wie er auf die Idee mit dem Jurastudium gekommen war, doch er erinnerte sich, ein Gespräch zwischen zweien seiner Verbindungsbrüder mitgehört zu haben, die beim Zechen ins Philosophieren geraten waren. Mark hatte hinter der Theke an jenem Abend nicht viel zu tun gehabt, und nach der vierten Runde Wodka und Cranberrysaft hatten sich die beiden so hineingesteigert, dass die ganze Bar mithören konnte. Von den vielen spannenden Dingen, die sie sagten, waren Mark zwei im Gedächtnis geblieben: »Die großen Hauptstadtkanzleien stellen ein wie verrückt.« Und: »Die Anfangsgehälter liegen bei hundertfünfzigtausend im Jahr.«
Kurz darauf hatte er zufällig einen ehemaligen Kommilitonen aus dem College getroffen, der inzwischen im ersten Semester an der Foggy Bottom Law School studierte. Der Freund schwärmte, dass er sein Studium innerhalb von zweieinhalb Jahren durchziehen und anschließend bei einer großen Kanzlei mit üppigem Gehalt unterkommen werde. Die Zentralbank werfe den Studenten die Darlehen förmlich hinterher. Jeder könne sich bewerben. Okay, er werde mit einem Berg Schulden ins Arbeitsleben starten, aber den baue er binnen fünf Jahren wieder ab. Es sei jedenfalls mehr als sinnvoll, »in sich selbst zu investieren«, so der Freund, denn die Schulden von heute seien die Grundlage für die Ertragskraft von morgen.
Das leuchtete Mark ein, und er begann, für die Aufnahmeprüfung zu lernen. Das Resultat war bescheiden, doch darüber sah die Foggy Bottom Law School großzügig hinweg. Ebenso wie über sein College-Diplom mit einem Notendurchschnitt von 2,8 von vier möglichen Punkten. Die FBLS empfing ihn mit offenen Armen. Der Kredit wurde umgehend bewilligt, und fortan überwies das Bildungsministerium jährlich 65000 Dollar für ihn. Ein Semester trennte Mark noch vom Abschluss, und er musste der bitteren Realität ins Auge sehen, dass er die Uni mit einer Belastung von 266000 Dollar inklusive Zinsen verlassen würde, für College und Jurastudium.
Nicht minder problematisch waren seine Jobaussichten. In Wahrheit war der Arbeitsmarkt bei Weitem nicht so reizvoll wie erhofft und auch nicht so dynamisch, wie in den Hochglanzbroschüren und auf der schamlos beschönigenden Website der Foggy Bottom dargestellt. Abgänger von Eliteuniversitäten fanden immer noch beneidenswert gut bezahlte Stellen, doch die Foggy Bottom gehörte nicht in diese Kategorie. Mark war es gelungen, sich von einer mittelgroßen Kanzlei anheuern zu lassen, die als Fachgebiet »Regierungskontakte« angab, was nichts anderes hieß als Lobbyismus. Sein Einstiegsgehalt stand noch nicht fest, weil sich die Kanzleileitung erst Anfang Januar zusammensetzen würde, um anhand des Vorjahresergebnisses die Gehälter zu bestimmen. In ein paar Monaten hatte Mark einen wichtigen Termin mit seiner »Kreditbetreuerin«, um zu besprechen, wie er seine Schulden abbezahlen konnte. Sie hatte bereits Besorgnis darüber geäußert, dass er noch nicht wusste, wie viel er verdienen würde. Das bereitete auch Mark Sorgen, zumal er in der Kanzlei niemandem über den Weg traute. Man musste schon gänzlich die Augen vor der Wirklichkeit verschließen, um zu glauben, dass dieser Job sicher war.
Ein weiteres Problem war die Zulassungsprüfung der Anwaltskammer. Wegen der großen Nachfrage war dieser Test in der Hauptstadt besonders schwer, und Absolventen der Foggy Bottom fielen erschreckend oft durch. Auch hier schlugen sich die Eliteunis der Stadt prächtig. Im Vorjahr hatte die Georgetown University einundneunzig Prozent ihrer Absolventen durchgebracht, die George Washington immerhin neunundachtzig Prozent. An der Foggy Bottom lag die Erfolgsquote bei mageren sechsundfünfzig Prozent. Wenn er bestehen wollte, musste Mark sofort anfangen zu lernen und durfte die Bücher für die nächsten sechs Monate nicht mehr aus der Hand legen.
Doch es fehlte ihm an Motivation, vor allem jetzt, in den kalten, tristen Wintertagen. Manchmal fühlte er sich, als lasteten die Schulden wie Backsteine auf seinen Schultern. Das Gehen fiel ihm schwer. Lächeln war mühsam. Er lebte am Rande des Existenzminimums, und trotz des Jobangebots lag seine Zukunft im Ungewissen. Dabei gehörte er noch zu den Privilegierten. Die meisten seiner Kommilitonen hatten nur Schulden und keine Stellung in Aussicht. Rückblickend dämmerte ihm, dass die bösen Vorzeichen schon im ersten Studienjahr erkennbar gewesen waren. Mit jedem Semester hatte sich die Stimmung verdüstert und das Misstrauen verstärkt. Der Arbeitsmarkt hatte an Stabilität verloren. Foggy-Bottom-Absolventen waren bei der Zulassungsprüfung in Scharen durchgefallen. Die Schulden der Studenten hatten sich immer weiter aufgetürmt. In Marks drittem und letztem Studienjahr kam es in den Lehrveranstaltungen nicht selten zum offenen Schlagabtausch zwischen Studenten und Dozenten. Der Dekan ließ sich gar nicht mehr blicken. Im Internet hagelte es harsche Kritik, die Kommentatoren nahmen kein Blatt vor den Mund. »Das ist Betrug!« »Wurden wir reingelegt?« »Was passiert mit unserem Geld?«
Im Grunde waren sich alle, die Mark kannte, einig, dass die Foggy Bottom (1) eine Ausbildung unter dem üblichen Standard lieferte, (2) zu viel versprach und (3) zu hohe Gebühren verlangte, außerdem (4) zu hohe Darlehen zuließ und (5) Studenten aufnahm, die in einem Jurastudium nichts verloren hatten, weil sie (6) entweder zu faul waren, um sich ausreichend auf die Anwaltsprüfung vorzubereiten, oder (7) zu dumm, um sie zu bestehen.
Gerüchten zufolge waren die Bewerbungen an der Foggy Bottom um die Hälfte zurückgegangen. Ohne staatliche Subventionen oder Stiftungsgelder musste ein solcher Einbruch zwangsläufig zu Kosteneinsparungen führen, sodass die ohnehin miserable Ausbildung noch schlechter werden würde. Mark Frazier und seinen Freunden war das eigentlich egal. Sie würden die Zähne vier weitere Monate lang zusammenbeißen, um der Uni danach für immer den Rücken zu kehren.
Mark wohnte in einem fünfstöckigen Mietshaus, das achtzig Jahre alt und in einem desolaten Zustand war, doch die Mieten waren günstig, und das zog Studenten der George Washington University und der Foggy Bottom Law School an. In seinen frühen Tagen war das Gebäude als Cooper House bekannt gewesen; nach drei Jahrzehnten studentischem WG-Betrieb hatte sich der Name zu »Coop« abgeschliffen. Da die Aufzüge nur selten funktionierten, nahm Mark die Treppe zum dritten Stock und betrat seine bescheidene, spärlich möblierte Fünfzig-Quadratmeter-Bude, für die er stolze achthundert Dollar im Monat bezahlte. Aus irgendeinem Grund hatte er nach der letzten Prüfung vor den Feiertagen aufgeräumt. Als er das Licht einschaltete, stellte er zufrieden fest, dass alles so aussah, wie er es zurückgelassen hatte. Aber was sollte auch passiert sein? Außer ihm selbst hatte nur der Vermieter einen Schlüssel. Erst als er seine Taschen abstellte, fiel ihm die Stille auf. Normalerweise war hier rund um die Uhr Remmidemmi – kein Wunder, bei so vielen Studenten auf engem Raum und den dünnen Wänden. Stereoanlagen, Fernseher, Streit, Gelächter, lautstarke Pokerrunden, Handgreiflichkeiten, Gitarrengeschrammel … Im dritten Stock gab es sogar einen Irren, der mit seiner Posaune die Mauern zum Beben brachte. Aber nicht heute. Alle waren nach Hause gefahren und genossen die Ferien, sodass auf den Fluren eine geradezu schaurige Leere herrschte.
Nach einer halben Stunde wurde Mark langweilig, und er verließ das Gebäude. Auf seinem Weg über die New Hampshire Avenue schnitt der Wind durch seine dünne Fleecejacke und die abgetragene Baumwollhose. Spontan beschloss er, in die Twenty-First Street einzubiegen und bei der Uni vorbeizuschauen. Obwohl die Stadt keinen Mangel an Bausünden verzeichnete, stach die Foggy Bottom Law School in ihrer Hässlichkeit heraus. Das Nachkriegsgebäude mit der blassgelben Backsteinfassade maß acht Stockwerke, die in asymmetrischen Flügeln ineinander verschlungen waren – der misslungene Versuch des Architekten, etwas Extravagantes zu erschaffen. Angeblich waren früher Büros darin untergebracht gewesen. In den unteren vier Etagen hatte man großzügig Wände herausgerissen, dennoch waren die Seminarräume zu klein. In der vierten Etage befand sich die Bibliothek, ein Labyrinth aus Räumen, vollgestopft mit kaum beachteten Büchern und dekoriert mit Repliken gemalter Porträts von namenlosen Richtern und Juristen. In der fünften und sechsten Etage hatten die Lehrkräfte ihre Büros, und in der siebten – so weit von den Studenten entfernt wie möglich – befanden sich der Verwaltungstrakt und das Eckbüro des Dekans, das dieser nur in seltenen Ausnahmefällen verließ.
Die Eingangstür war unverschlossen, und Mark betrat das menschenleere Foyer. Es war angenehm warm, doch ansonsten empfand er die Umgebung wie immer als furchtbar deprimierend. An einem großen Schwarzen Brett prangten handgeschriebene Notizen, Ankündigungen und Werbungen. Es gab ein paar professionell aussehende Poster, die zum Studium im Ausland einluden, außerdem die übliche Mischung aus Mietangeboten und Kleinanzeigen – biete/suche Bücher, Fahrräder, Eintrittskarten, Vorlesungsmitschriften, Nachhilfe. Da die Zulassungsprüfung der Anwaltskammer ständig wie eine Gewitterwolke über der Uni schwebte, wurden auch Repetitorien offeriert. Wenn er lange genug suchte, würde er wahrscheinlich sogar Jobangebote finden, wobei die an der Foggy Bottom von Jahr zu Jahr weniger wurden. In einer Ecke entdeckte er die altbekannten Bankbroschüren zum Thema Studienkredite. Am entfernten Ende des Foyers befanden sich Verkaufsautomaten und eine kleine Cafeteria, deren Kaffeemaschinen in den Ferien allerdings stillstanden.
Mark ließ sich in einen durchgesessenen Ledersessel sinken. Die Atmosphäre war erdrückend. War das eine Hochschule? Oder doch nur eine Titelmühle? Allmählich dämmerte ihm die Wahrheit. Wie schon so oft wünschte er, er wäre nie durch diese Tür getreten, damals als ahnungsloser Studienanfänger. Jetzt, fast drei Jahre später, ächzte er unter Schulden, die er nie würde abbezahlen können. Falls es ein Licht am Ende des Tunnels gab, konnte er es nicht erkennen.
Woher kam eigentlich der Name Foggy Bottom? Als wäre das Studium hier nicht schon schlimm genug, hatte sich ein schlauer Kopf vor rund zwanzig Jahren einen Namen überlegt, der jeden positiven Gedanken sofort erstickte – »nebliger Grund«. Der Typ, der inzwischen tot war, hatte den Laden an Wall-Street-Investoren verkauft, denen eine ganze Reihe solcher »Universitäten« gehörten. Sie erzielten zwar hübsche Gewinne, brachten aber kaum juristischen Nachwuchs hervor.
Wie konnte man überhaupt mit Universitäten handeln? Für Mark war das immer noch ein Rätsel.
Als er Stimmen hörte, floh er rasch nach draußen. Er wanderte die New Hampshire entlang bis zum Dupont Circle, wo er sich bei Kramer Books mit einer Tasse Kaffee aufwärmte. Er ging immer zu Fuß. Sein Bronco ruckelte und spuckte im Stadtverkehr, und so ließ er ihn lieber auf einem Parkplatz hinter dem Coop stehen, stets mit dem Schlüssel in der Zündung. Leider war bislang niemand in Versuchung geraten, ihn zu stehlen.
Wieder aufgewärmt, eilte Mark auf der Connecticut Avenue sechs Blocks Richtung Norden zu seiner zukünftigen Kanzlei, die in einem modernen Gebäude unweit des Hinckley Hilton mehrere Stockwerke belegte. Im letzten Sommer hatte er sich dort Zugang verschafft, indem er ein miserabel bezahltes Praktikum annahm. Die großen Kanzleien boten Sommerpraktika an, um Topstudenten das Glamourleben der Großverdiener zu zeigen. Leistung wurde von ihnen kaum erwartet. Stattdessen bekamen sie Tickets zu Sportgroßveranstaltungen und Einladungen zu rauschenden Partys in den luxuriösen Gärten ihrer reichen Arbeitgeber. Einmal verführt, unterschrieben sie die Arbeitsverträge; sobald sie ihr Examen in der Tasche hatten, wurden sie in Hundert-Stunden-Wochen verheizt.
Anders bei Ness Skelton. Mit gerade einmal fünfzig Anwälten gehörte die Kanzlei nicht zu den Top Ten. Ihre Mandanten waren Berufsverbände – der Verband der Sojabauern, die Vereinigung ehemaliger Postangestellter, die Rind- und Lammfleisch-Innung, der Bundesverband der Straßenbauer, die Vertretung der Lokführer mit Behinderungen und ein paar Waffenhändler, die auch nicht zu kurz kommen wollten. Das Fachgebiet der Kanzlei – wenn man es so nennen durfte – waren ihre Beziehungen zum Kongress. Die Sommerpraktika dort dienten nicht dazu, Elitestudenten anzulocken, sondern möglichst billig an Arbeitskräfte zu kommen. Mark hatte sich angestrengt, sosehr er auch unter der stupiden Tätigkeit gelitten hatte. Als er am Ende der Ferien ein vages Stellenangebot bekam – unter der Voraussetzung, dass er die Zulassungsprüfung bestand –, wusste er nicht, ob er jubeln oder weinen sollte. Mangels Alternative nahm er an und konnte sich fortan damit brüsten, einer der wenigen Foggy-Bottom-Studenten zu sein, die eine Zukunft hatten. In den Folgemonaten hatte er bei seinem Vorgesetzten immer wieder freundlich wegen der Details zu seiner künftigen Position nachgehakt, aber nur zu hören bekommen, dass es unter Umständen zu einer Fusion, vielleicht aber auch zu einer Aufspaltung kommen werde. Vieles schien denkbar, nur von einem Arbeitsvertrag für ihn war nie die Rede.
Und so zeigte er Präsenz. An Nachmittagen, Samstagen, Feiertagen, immer wenn ihm langweilig war, schaute er in der Kanzlei vorbei, stets ein künstliches Lächeln im Gesicht und demonstrativ bereit, die Ärmel hochzukrempeln und bei der Drecksarbeit zu helfen. Ob diese Taktik von Vorteil für ihn war, wusste er nicht, aber er ging davon aus, dass sie ihm wenigstens nicht schaden würde.
Sein Vorgesetzter hieß Randall und arbeitete seit zehn Jahren für die Kanzlei. Er war kurz davor, zum Partner aufzusteigen, und stand entsprechend unter Druck. Wer es bei Ness Skelton nach zehn Jahren nicht schaffte, Partner zu werden, wurde vor die Tür gesetzt. Randall hatte an der George Washington University studiert, was in der akademischen Hackordnung der Hauptstadt zwar weniger wert war als ein Abschluss von der Georgetown, aber immer noch weit mehr als einer von der Foggy Bottom. Diese Hierarchie war ebenso unveränderlich wie unumstößlich und wurde besonders leidenschaftlich von den Abgängern der George Washington gepflegt. Sie fanden es unerträglich, von der Georgetown als unzulänglich betrachtet zu werden, und blickten umso verächtlicher herab auf die Foggy Bottom. Ness Skelton war geprägt von Klüngelei und Standesdünkel, und Mark fragte sich regelmäßig, was er hier sollte. Zwei der Angestellten stammten von der Foggy Bottom, doch sie taten alles, um das zu verschleiern. Unterstützung brauchte sich Mark von ihnen nicht zu erhoffen, dafür taten sie zu beschäftigt. In Wahrheit ignorierten sie ihn konsequent. »Wie kann man eine Kanzlei nur auf diese Weise führen?«, hatte Mark oft vor sich hin gemurmelt, war jedoch irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass wohl jede Berufssparte ihre Rangordnung hatte. Außerdem fürchtete er viel zu sehr um seine eigene Haut, als dass er sich über die Studienabschlüsse der anderen Gedanken machen wollte. Probleme hatte er auch so genug.
Er hatte in einer E-Mail angekündigt, dass er vorbeikommen würde, um auszuhelfen. Randall empfing ihn kurz angebunden: »Schon zurück?«
Besten Dank für den freundlichen Empfang, Randall, und wie waren Ihre Ferien? »Ja, ich hatte keine Lust mehr auf das Feiertagsgedöns. Was gibt’s Neues?«
»Zwei Sekretärinnen haben Grippe.« Randall deutete auf einen dreißig Zentimeter hohen Stapel Akten. »Ich brauche vierzehn Kopien davon, sauber sortiert und gebunden.«
Kopieren, dachte Mark, na klar, was sonst. »Gern«, sagte er, als könnte er es nicht erwarten, sich an die Arbeit zu machen. Er schleppte den Papierberg in einen dunklen Kellerraum, wo er drei Stunden lang zwischen Kopiergeräten stand und einen stumpfsinnigen Job verrichtete, für den er nie einen Penny sehen würde.
Drei Stunden, in denen er Louie und dessen Fußfessel beinahe vermisste.
2
Genau wie Mark hatte sich auch Todd Lucero von bierseligen Kneipengesprächen zum Jurastudium anregen lassen. In den vergangenen drei Jahren hatte er Cocktails gemixt, im Old Red Cat, einer Kneipe im Stil eines Pubs, die vor allem von Studenten der George Washington und der Foggy Bottom besucht wurde. Nach seinem College-Abschluss an der Frostburg State University in Baltimore war Todd nach Washington gezogen, um sich einen Job zu suchen. Als er nichts fand, was seinem Abschluss entsprochen hätte, heuerte er im Old Red Cat als Teilzeitkraft an. Bald schon stellte er fest, dass es ihm Spaß machte, Bier zu zapfen und Drinks zu mixen. Ihm gefiel das Kneipenleben, und er konnte mit den Schnapsdrosseln genauso gut umgehen wie mit den Rowdies. Todd war jedermanns Lieblingsbarkeeper und mit Hunderten seiner Stammgäste per Du.
Schon oft in den letzten zweieinhalb Jahren hatte Todd daran gedacht, das Studium abzubrechen, um seinen Traum zu verwirklichen und eine eigene Kneipe zu eröffnen. Doch dafür hätte sein Vater, Polizeibeamter aus Baltimore, keinerlei Verständnis gehabt. Mr. Lucero hatte seinem Sohn von klein auf eingeschärft, wie wichtig es sei, einen ordentlichen Beruf zu erlernen. Bedauerlicherweise war es bei den strengen Worten geblieben. Und so war Todd in die gleiche Falle getappt wie Mark, indem er das großzügig von der Bank bereitgestellte Geld annahm und den gierigen Typen der Foggy Bottom Law School in den Rachen warf.
Er hatte Mark Frazier am ersten Tag kennengelernt, bei der Einführungsveranstaltung. Damals hatten beide noch erschreckend blauäugig von einer Anwaltskarriere mit üppigem Gehalt geträumt, genau wie dreihundertfünfzig andere Erstsemester. Als Todd nach einem Jahr aufhören wollte, bekam sein Vater einen Tobsuchtsanfall und warf ihm vor, dass er wegen des Kneipenjobs nie Zeit gehabt habe, Klinken putzen zu gehen und sich um ein Sommerpraktikum zu bemühen. Nach dem zweiten Jahr wollte er wieder aufhören, um die Schuldenlast zu begrenzen, doch diesmal riet ihm seine Kreditbetreuerin dringend davon ab. Solange er studiere, so ihr Argument, müsse er keine Raten zahlen. Es sei doch viel sinnvoller, so lange Geld zu leihen, bis das Studium abgeschlossen sei. Danach werde er einen lukrativen Job finden, und die Schulden wären bald kein Thema mehr. So weit die Theorie. Todd war längst klar, dass solche Jobs nicht existierten.
Wenn er sich damals nur 195000 Dollar von einer Bank geliehen und eine Kneipe eröffnet hätte. Er würde jetzt Geld wie Heu verdienen und das Leben genießen.
Kurz nach Einbruch der Dunkelheit betrat Mark das Old Red Cat, nahm seinen Lieblingsplatz am Ende der Theke ein und tauschte einen Faust-zu-Faust-Gruß mit Todd. »Schön, dich zu sehen.«
»Ebenso«, erwiderte Todd und schob ihm einen eisgekühlten Krug helles Bier entgegen. Da er schon lange hier arbeitete, konnte er Getränke ausgeben, so viel und wem er wollte. Mark hatte seit Jahren nichts mehr bezahlt.
Da die meisten Studenten noch in den Ferien waren, ging es in der Kneipe geruhsam zu. Todd stützte sich auf die Ellbogen. »Und, was treibst du so?«
»Heute Nachmittag war ich bei meinen Freunden von Ness Skelton und habe im Kopierraum Ausdrucke sortiert, die kein Mensch je lesen wird. Ich habe den Hiwi gespielt, wie immer. Selbst die Assistenten nehmen mich nicht für voll. Ich hasse den Laden. Dabei haben sie mich noch nicht mal eingestellt.«
»Immer noch kein Vertrag in Sicht?«
»Nein, und die Aussichten werden immer trüber.«
Todd nahm einen raschen Schluck aus seinem Glas, das unter der Theke stand. Obwohl er schon so lange hier arbeitete, galt auch für ihn das Alkoholverbot am Arbeitsplatz. Doch der Chef war nicht da. »Wie war Weihnachten bei den Fraziers?«
»Ho, ho, ho. Ich hab’s zehn Tage ausgehalten und dann die Biege gemacht. Und bei dir?«
»Drei Tage, dann rief die Pflicht, und ich musste wieder zur Arbeit. Wie geht’s Louie?«
»Wartet immer noch auf seinen Prozess. Sieht so aus, als müsste er tatsächlich in den Knast. Er sollte mir leidtun, aber mein Mitgefühl hält sich ehrlich gesagt in Grenzen. Die eine Hälfte des Tages verpennt er, und die andere verbringt er auf dem Sofa, glotzt Gerichtsserien und jammert über seine Fußfessel. Arme Mom.«
»Du bist ganz schön streng mit ihm.«
»Nicht streng genug. Genau das ist sein Problem. Niemand war jemals streng mit ihm. Mit dreizehn ist er zum ersten Mal mit Pot erwischt worden. Er hat es einem Freund in die Schuhe geschoben, und natürlich sind ihm unsere Eltern sofort beigesprungen. Er musste nie Konsequenzen tragen. Bis jetzt.«
»Echt übel, Mann. Ich möchte keinen Bruder im Gefängnis haben.«
»Ja, das ist beschissen. Ich wünschte, ich könnte ihm helfen. Keine Chance.«
»Nach deinem Vater frage ich lieber nicht.«
»Ich habe ihn nicht gesehen und auch kein Wort von ihm gehört. Nicht mal eine Postkarte hat er geschrieben. Er ist jetzt fünfzig und stolzer Papa eines Dreijährigen. Ich vermute, dass er im Weihnachtsmannkostüm einen Haufen Spielzeug unter den Baum gelegt und blöde grinsend zugesehen hat, wie das Kind quietschend die Treppe runterkommt. Diese miese Ratte.«
Zwei Studentinnen traten an die Theke, und Todd ging zu ihnen, um sie zu bedienen. Mark holte sein Handy heraus und rief seine Nachrichten ab.
Als Todd zurückkam, fragte er: »Hast du die Noten schon gesehen?«
»Nein. Wozu? Wir sind doch sowieso alle Einserstudenten.« Die Notengebung an der Foggy Bottom war ein Witz. Die Studenten mussten natürlich erstklassig abschneiden, deshalb verteilten die Dozenten grundsätzlich nur Bestnoten. Man konnte an der FBLS praktisch nicht durchfallen. Die Folge war, dass sich niemand mehr anstrengte und es keine Konkurrenz unter den Studenten gab. Mittelmäßige Schulabgänger wurden zu miserablen Uniabsolventen. Kein Wunder, dass die Zulassungsprüfungen für sie so schwer waren. »Außerdem«, setzte Mark hinzu, »kann man von überbezahlten Dozenten nicht erwarten, in den Weihnachtsferien Prüfungsbögen zu korrigieren, oder?«
Todd nahm noch einen Schluck und beugte sich näher zu Mark. »Wir haben ein viel größeres Problem.«
»Gordy?«
»Gordy.«
»Das hatte ich befürchtet. Ich habe versucht, ihn per SMS oder Anruf zu erreichen, aber sein Handy ist abgestellt. Was ist passiert?«
»Es sieht schlimm aus«, sagte Todd. »Offenbar hat er sich an Weihnachten zu Hause die ganze Zeit mit Brenda gestritten. Sie will eine große kirchliche Hochzeit mit tausend Gästen. Gordy will überhaupt nicht heiraten. Ihre Mutter mischt sich dauernd ein. Seine Mutter redet nicht mit ihrer Mutter, und jetzt sieht es aus, als würde die ganze Sache platzen.«
»Sie heiraten am 15. Mai, Todd. Wenn ich mich recht entsinne, sind wir sogar Trauzeugen.«
»Sei dir da mal nicht so sicher. Er ist schon wieder zurück. Und er hat seine Medikamente abgesetzt. Zola war heute Nachmittag hier, um mich einzuweihen.«
»Was für Medikamente?«
»Eine lange Geschichte.«
»Komm schon, was für Medikamente?«
»Er ist bipolar, Mark. Wurde vor ein paar Jahren festgestellt.«
»Das ist nicht dein Ernst.«
»Warum sollte ich darüber Witze machen? Er ist bipolar, und Zola sagt, er hat die Medikamente abgesetzt.«
»Warum hat er uns das nicht erzählt?«
»Keine Ahnung.«
Mark nahm einen ausgiebigen Schluck Bier und schüttelte den Kopf. »Ist Zola auch wieder hier?«
»Ja, offenbar ist sie spontan zurückgekommen, um die letzten Ferientage mit Gordy zu verbringen, wobei ich bezweifle, dass sie die gemeinsame Zeit genießen konnten. Sie meint, er nimmt seit einem Monat keine Medikamente mehr, also seit der Zeit, als wir für die Semesterabschlussprüfungen gelernt haben. Mal ist er manisch und springt herum wie ein Flummi, dann wieder liegt er apathisch da, weil er total stoned und mit Tequila abgefüllt ist. Er redet wirres Zeug, dass er das Studium schmeißen und mit ihr nach Jamaika will. Sie fürchtet, er könnte eine Dummheit begehen oder sich was antun.«
»Gordy ist ein Idiot. Er ist mit seiner Freundin aus der Highschool verlobt, die nicht nur echt hübsch ist, sondern noch dazu aus betuchtem Haus kommt. Stattdessen zieht er mit einer Afroamerikanerin herum, deren Eltern und Brüder nicht mal im Besitz der berühmten Einwanderungsdokumente sind, von denen zurzeit alle reden. Völlig schwachsinnig.«
»Gordy hat Probleme, Mark. In den letzten Wochen wurde es immer schlimmer mit ihm. Er braucht unsere Hilfe.«
Mark schob sein Glas ein paar Zentimeter von sich weg und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. »Als hätten wir nicht genug Sorgen. Wie sollen wir ihm helfen?«
»Sag du’s mir. Zola versucht, ihn ständig im Auge zu behalten. Sie möchte, dass wir heute Abend vorbeikommen.«
Mark lachte und nahm noch einen Schluck.
»Was ist so witzig?«, wollte Todd wissen.
»Nichts. Aber kannst du dir den Skandal in Martinsburg, West Virginia, vorstellen, wenn sich herumspricht, dass Gordon Tanner, dessen Vater Pfarrer ist und der mit der Tochter eines prominenten Arztes verlobt ist, komplett durchgedreht ist, sein Jurastudium geschmissen hat und mit einer afroamerikanischen Muslima nach Jamaika durchgebrannt ist?«
»Die Vorstellung entbehrt nicht einer gewissen Komik.«
»Komm schon, das ist zum Totlachen.« Doch Mark lachte nicht mehr. »Wir können ihn nicht zwingen, seine Pillen zu nehmen, Todd. Er würde uns was husten.«
»Er braucht unsere Hilfe. Um neun Uhr bin ich hier fertig, dann gehen wir hin.«
Ein Mann in einem eleganten Anzug setzte sich an die Bar, und Todd ging zu ihm, um seine Bestellung aufzunehmen. Mark schlürfte sein Bier und versank in düstere Grübeleien.
3
Drei Jahre vor Zola Maals Geburt waren ihre Eltern aus dem Senegal geflohen. Sie hatten für sich und ihre zwei kleinen Söhne Unterschlupf in einem Slum in Johannesburg gefunden, wo sie sich als Hilfsarbeiter über Wasser hielten. Nach zwei Jahren Bödenwischen und Gräbenschaufeln hatten sie genug Geld gespart, um ein Ticket über den Atlantik bezahlen zu können. Ein Menschenschmuggler verhalf ihnen zu einer mehr als unkomfortablen Überfahrt auf einem liberianischen Frachter, zusammen mit einem Dutzend weiterer Senegalesen. Nachdem sie erfolgreich an Land geschmuggelt worden waren, wurden sie von einem Onkel abgeholt, der sie mit zu sich nahm, nach Newark, New Jersey, wo sie in einer Zweizimmerwohnung unterkamen, in einem Haus voller Senegalesen, die alle keine Greencard besaßen.
Ein Jahr nach ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten wurde Zola in der Universitätsklinik von Newark geboren und war damit automatisch amerikanische Staatsbürgerin. Während ihre Eltern in zwei bis drei unterbezahlten Jobs gleichzeitig schufteten, gingen Zola und ihre Brüder zur Schule und wuchsen im Schoß ihrer kleinen Gemeinde auf. Als gläubige Muslime praktizierten sie ihre Religion, wobei Zola sich von klein auf zur westlichen Lebensart hingezogen fühlte. Ihr Vater war sehr streng und bestand darauf, dass statt der beiden Muttersprachen Wolof und Französisch nur noch Englisch gesprochen wurde. Die Jungen nahmen die neue Sprache rasch an und unterstützten die Eltern, wo es nur ging.
Die Familie zog häufig innerhalb von Newark um. Die Wohnungen waren immer klein, wenn auch von Mal zu Mal ein wenig größer, und stets wohnten andere Senegalesen in der Nähe. Alle lebten ständig in der Angst vor Abschiebung, und nur gemeinsam waren sie stark – zumindest wollten sie das glauben. Dennoch zuckten sie jedes Mal zusammen, wenn es an der Tür klopfte. Sie durften sich nicht den geringsten Fehltritt erlauben. Zola und ihre Brüder wurden dazu erzogen, auf keinen Fall Aufmerksamkeit zu erregen. Obwohl Zola gültige Papiere besaß, wusste sie, dass ihre Familie in ständiger Gefahr lebte. Sie wuchs mit dem Albtraum auf, dass ihre Eltern und Brüder verhaftet und in den Senegal zurückgeschickt werden könnten.
Mit fünfzehn fand sie ihren ersten Job in einem Diner, wo sie für einen Hungerlohn Teller wusch. Und obwohl auch ihre Brüder etwas dazuverdienten, kam die Familie nur knapp über die Runden.
Wenn Zola nicht arbeitete, büffelte sie für die Schule. Die Highschool fiel ihr leicht, sie schloss mit guten Noten ab und schrieb sich bei einem Community College zunächst als Abendschülerin ein. Ein bescheidenes Stipendium ermöglichte es ihr, ein Vollstudium zu beginnen, und brachte ihr außerdem einen Job in der College-Bibliothek ein. Nebenbei fuhr sie fort, Teller zu waschen, mit ihrer Mutter putzen zu gehen und Kinder für Freunde der Familie zu hüten, die besser verdienten. Ihr ältester Bruder heiratete eine Amerikanerin, die keine Muslima war. Das ebnete ihm zwar den Weg in die Staatsbürgerschaft, führte aber zugleich zu erheblichen Spannungen mit den Eltern. Der Bruder und seine neue Frau gingen schließlich nach Kalifornien, um dort ein neues Leben zu beginnen.
Mit zwanzig Jahren zog Zola von zu Hause aus und begann ein Studium an der Montclair State University. Im Wohnheim teilte sie sich ein Zimmer mit zwei Amerikanerinnen, die ebenfalls finanziell keine großen Sprünge machen konnten. Sie wählte Buchführung im Hauptfach, weil sie Spaß an Zahlen hatte und gut mit Geld umgehen konnte. Wenn es die Zeit erlaubte, lernte sie fleißig, doch mit zwei und zuweilen sogar drei Jobs kamen die Bücher oft zu kurz. Ihre Zimmergenossinnen führten sie in die Partyszene der Stadt ein, und sie stellte fest, dass sie auch am Feiern Spaß hatte. Zwar hielt sie sich an das strenge Alkoholverbot der Muslime – zumal sie den Geschmack ohnehin nicht mochte –, doch für andere Versuchungen war sie durchaus zu haben, insbesondere Mode und Sex. Sie war knapp eins dreiundachtzig groß und bekam oft Komplimente, wenn sie enge Jeans trug. Ihr erster Freund brachte ihr alles über Sex bei, ihr zweiter machte sie mit Partydrogen bekannt. Am Ende ihres vorletzten Studienjahres betrachtete sie sich selbst insgeheim und mit einem gewissen Trotz nicht mehr als praktizierende Muslima. Ihre Familie hatte keine Ahnung.
Doch Zolas Eltern würden alsbald wesentlich ernstere Probleme bekommen. Im Wintersemester ihres Abschlussjahres wurde ihr Vater festgenommen und saß zwei Wochen im Gefängnis, ehe er auf Kaution freikam. Zu der Zeit arbeitete er für einen Maler, einen Senegalesen mit legalem Aufenthaltsstatus. Offenbar hatte der Mann einen Konkurrenzbetrieb unterboten, um sich einen Großauftrag zu sichern – die Renovierung eines großen Bürogebäudes in Newark. Daraufhin hatte sich der leer ausgegangene Konkurrent an die ICE, die Einwanderungs- und Zollbehörde, gewandt und gemeldet, dass sein Landsmann Mitarbeiter ohne Papiere beschäftige. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, war auch noch von entwendeten Büromaterialien die Rede, und die Verdächtigen waren rasch ausgemacht. Zolas Vater und vier Kollegen ohne Papiere wurden des schweren Diebstahls beschuldigt. Sie erhielten eine Vorladung vom Einwanderungsgericht, außerdem wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.
Zola schaltete einen Anwalt ein, der sich nach eigener Aussage auf solche Fälle spezialisiert hatte, und die Familie leistete eine Anzahlung von neuntausend Dollar, die praktisch ihre gesamten Ersparnisse auffraß. Der Anwalt war extrem beschäftigt und rief selten zurück. Während sich ihre Eltern und Brüder in und nahe bei Newark versteckten, musste Zola sich mit dem Anwalt herumärgern. Irgendwann hasste sie den Kerl, der wie ein Wasserfall redete und es mit der Wahrheit nicht sonderlich genau nahm. Wenn die Anzahlung nicht gewesen wäre, hätten sie ihn gefeuert. Aber sie hatten kein Geld, um einen anderen zu engagieren. Als er zum Termin nicht erschien, entband ihn der Richter von dem Fall. Zola konnte schließlich den Anwalt eines Rechtshilfevereins überreden, den Vater kostenlos zu vertreten. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt. Die Abschiebung war damit aber nicht abgewendet. Der Fall zog sich immer weiter in die Länge und nahm sie so in Anspruch, dass ihre schulischen Leistungen darunter litten. Nach mehreren Gerichtsterminen und Anhörungen kam sie zu der Überzeugung, dass alle Anwälte entweder faul oder dumm waren und dass sie selbst den Job besser erledigen könnte.
Zola fiel dem Trugschluss anheim, dass mit dem Sofortkredit der Zentralbank jeder Jura studieren konnte, und machte die ersten kühnen Schritte auf dem Weg, der sie an die Foggy Bottom führen würde. Heute, kurz vor dem Abschluss, hatte sie mehr Schulden, als sie sich je hätte vorstellen können. Ihre Eltern und ihr unverheirateter Bruder Bo blickten unterdessen immer noch der Abschiebung entgegen. Allerdings waren die Einwanderungsgerichte so überlastet, dass mit einem baldigen Abschluss des Verfahrens nicht zu rechnen war.
Zola wohnte in der Twenty-Third Street in einem Gebäude, das nicht ganz so heruntergekommen war wie das Coop, dem es jedoch sonst in vielerlei Hinsicht ähnelte. Eine große Anzahl von Studenten teilte sich kleine, billig ausgestattete Wohnungen. Anfang des dritten Studienjahres hatte sie dort einen blonden jungen Mann kennengelernt, gut aussehend und sportlich, der auf dem Flur gegenüber wohnte: Gordon Tanner. Rasch hatte eines zum anderen geführt, und sie hatten sich in eine verhängnisvolle Affäre gestürzt, in der alsbald von Zusammenziehen die Rede war, natürlich nur um Geld zu sparen. Gordon hatte sich schließlich dagegen entschieden, weil Brenda, seine hübsche Verlobte aus der Heimat, die Großstadt liebte und ziemlich häufig zu Besuch kam.
Zwei Frauen auf einmal aber waren zu viel für Gordy. Mit Brenda war er im Grunde schon zeit seines Lebens verlobt, doch jetzt, kurz vor der Hochzeit, hatte er das Bedürfnis, die Notbremse zu ziehen. Zola warf ganz andere Fragen auf. Besaß er den Mumm, mit einer Afroamerikanerin durchzubrennen und seine Familie und Freunde nie wiederzusehen? Hinzu kamen der angespannte beziehungsweise nicht existierende Stellenmarkt, die erdrückenden Schulden und die Aussicht, womöglich die Zulassungsprüfung zu vermasseln. Also brannten bei Gordy alle Sicherungen durch. Fünf Jahre zuvor war eine bipolare Störung bei ihm diagnostiziert worden, doch dank Medikamenten und Psychotherapie war sein Leben – abgesehen von einer ziemlich schaurigen Phase im College – bislang relativ normal verlaufen. Das hatte sich im dritten Studienjahr Ende November geändert, als er seine Medikamente absetzte. Schockiert über seine Stimmungsschwankungen, hatte Zola ihn darauf angesprochen. Er hatte ihr seine Krankheit gebeichtet und die Pillen wieder genommen. Zwei Wochen lang hielten sich die Hochs und Tiefs in Grenzen.
Nach den Semesterabschlussprüfungen waren sie über die Feiertage heimgefahren, wobei sie beide eigentlich keine rechte Lust dazu verspürt hatten. Gordy hatte sich vorgenommen, mit Brenda einen ultimativen Streit vom Zaun zu brechen, der zur Absage der Hochzeit führen würde. Zola war nicht scharf darauf, ihre Familie zu besuchen, weil ihr Vater, allen Widrigkeiten zum Trotz, keine Gelegenheit auslassen würde, um ihr Strafpredigten zu halten, in denen er sie für ihren sündigen westlichen Lebensstil schalt.
Eine Woche später waren beide wieder in Washington. An den Hochzeitsplänen hatte sich nichts geändert, doch Gordy nahm seine Medikamente nicht mehr und verhielt sich völlig unberechenbar. Zwei Tage lang verließ er sein Schlafzimmer gar nicht. Entweder er schlief stundenlang, oder er starrte, das Kinn auf die Knie gestützt, im Dunkeln die Wände an. Zola schaute hin und wieder vorbei, wusste aber nicht, was sie tun sollte. Dann verschwand Gordy für drei Tage. In einer SMS teilte er ihr mit, dass er im Zug auf dem Weg nach New York sei, um »ein paar Leute zu interviewen«. Er sei einem großen Komplott auf der Spur und habe immens viel zu tun. Wieder zurück, stürmte er in ihre Wohnung, rüttelte sie wach, riss ihr die Kleider vom Leib und wollte Sex. Im Laufe des Tages verschwand er abermals, um böse Buben zu jagen und »im Dreck zu wühlen«. Als er zurückkam, war er immer noch manisch und saß stundenlang am Laptop. Er sagte, sie brauche nicht vorbeizukommen, weil er anderweitig beschäftigt sei.
Verängstigt und verzweifelt ging Zola schließlich ins Old Red Cat, um mit Todd zu reden.
4
Zola empfing die beiden Freunde auf den Stufen vor dem Gebäude, und sie folgten ihr durch das Treppenhaus in den ersten Stock zu ihrer Wohnung. Als sie drinnen waren, schloss sie die Tür und bedankte sich für ihr Kommen. Ganz offensichtlich machte sie sich große Sorgen.
»Wo ist er?«, wollte Mark wissen.
»Drüben.« Zola nickte Richtung Flur. »Er lässt mich nicht rein und kommt auch nicht raus. In den letzten zwei Tagen hat er bestimmt nicht geschlafen. Er ist mal oben, mal unten, und im Moment rennt er wieder gegen Wände.«
»Und die Medikamente?«, erkundigte sich Todd.
»Nimmt er nicht, jedenfalls nicht die aus der Apotheke. Ich vermute, dass er irgendwas anderes einwirft.«
Sie tauschten Blicke, und jeder wartete darauf, dass die anderen zuerst reagierten. Irgendwann brach Mark das Schweigen. »Gehen wir.« Sie traten über den Flur, und Mark klopfte an. »Gordy, ich bin’s, Mark. Ich stehe hier mit Todd und Zola. Wir möchten mit dir reden.«
Keine Antwort. Gedämpft war Bruce Springsteen zu hören.
Mark klopfte erneut und wiederholte, was er gesagt hatte. Die Musik erstarb. Ein Stuhl oder Hocker wurde umgetreten. Wieder Stille, dann klickte der Türknauf. Nach ein paar Sekunden öffnete Mark die Tür.
Gordy stand mitten in dem kleinen Raum und trug nichts am Leib als die alten gelben Trainingsshorts mit dem Indianerkopf-Logo der Redskins, die sie alle schon so oft an ihm gesehen hatten. Er starrte an die Wand, ohne sie zu beachten. Die Kochnische zu ihrer Linken war übersät mit leeren Bierdosen und Schnapsflaschen, die in der Spüle und überall auf der Arbeitsfläche lagen. Der Boden war bedeckt mit Pappbechern, gebrauchten Servietten und Sandwichverpackungen. Auf dem kleinen Esstisch rechts von ihnen stapelten sich um einen Laptop und einen Drucker herum Berge von Papier. Der Boden verschwand unter Blättern, Akten und Zeitschriftenausschnitten. Sofa, Fernseher, Sessel und Wohnzimmertisch waren in eine Ecke geschoben.
Die freigeräumte Wand war tapeziert mit weißen Posterkartons und unzähligen Blättern, die – zu einem geheimnisvollen Muster angeordnet – mit Scotchtape festgeklebt oder bunten Reißzwecken angeheftet waren. Es war ein gigantisches Gebilde aus Firmen und Namen, das Gordy da mit schwarzem, blauem und rotem Marker konstruiert hatte. An der Spitze der monströsen Verschwörung prangten die Konterfeis mehrerer Männer.
Gordy schien diese Gesichter zu fixieren. Er war bleich und ausgezehrt und hatte stark an Gewicht verloren. Noch vor zwei Wochen während der Prüfungen war Mark und Todd nichts an ihm aufgefallen. Gordy war sportlich und ging gern ins Fitnessstudio, doch von Muskeln war jetzt nichts mehr zu sehen. Das dichte blonde Haar, sein ganzer Stolz, war strähnig und seit Tagen nicht gewaschen. Der Zustand, in dem er und seine Wohnung sich befanden, verriet unmissverständlich, was los war. Ihr Freund hatte eine Grenze überschritten. Hier war ein manischer Künstler am Werk, einsam und verwirrt, vor sich seine Leinwand.
»Was gibt’s?« Gordy drehte sich um und sah sie an. Seine Augen lagen tief in den Höhlen, die Wangen waren eingefallen und voller Bartstoppeln.
»Wir müssen reden«, sagte Mark.
»Stimmt. Allerdings werde nur ich reden. Ich habe alles genau analysiert. Ich habe die Schweine. Wir müssen jetzt schnell handeln.«
»Okay, Gordy«, sagte Todd zögernd. »Wir sind ganz Ohr. Worum geht es?«
Gordy deutete auf das Sofa. »Bitte setzt euch«, forderte er sie ruhig auf.
»Ich bleibe lieber stehen, wenn es dir recht ist«, sagte Mark.
»Nein, es ist mir nicht recht!«, bellte Gordy. »Tut einfach, was ich sage, dann ist alles gut. Und jetzt hinsetzen.« Er sah plötzlich aus, als wollte er vor Wut auf sie losgehen. Weder Mark noch Todd würden gegen Gordy in einem Kampf länger als zehn Sekunden durchhalten. Zweimal während des Studiums waren sie Zeuge gewesen, wie sich Gordy in einer Bar prügelte. Beide Gegner waren k. o. gegangen, ohne dass Gordy nennenswerte Spuren davongetragen hatte.
Todd und Zola setzten sich auf das Sofa, und Mark zog sich von der Küchentheke einen Hocker heran. Ungläubig blickten sie auf das Netz aus Flussdiagrammen, das die Wand überzog, mit Linien und Pfeilen, die in alle Richtungen zeigten und Dutzende von Firmen, Kanzleien, Namen und Zahlen miteinander verbanden. Wie gescholtene Schulkinder saßen sie da und warteten.
Gordy trat zum Esstisch und nahm eine bereits halb geleerte Flasche Tequila. Er füllte seinen Lieblingsbecher und trank, als wäre es Tee.
»Du hast ganz schön abgenommen, Gordy«, äußerte Mark.
»Ist mir nicht aufgefallen. Ich nehme auch wieder zu. Aber wir sind nicht hier, um über mein Gewicht zu reden.« Den Kaffeebecher in der Hand – und ohne daran zu denken, seinen Freunden auch etwas anzubieten –, trat er auf die Wand zu und deutete auf das oberste Foto. »Das ist der Große Satan. Er heißt Hinds Rackley, seines Zeichens Anwalt und Investment-Hai an der Wall Street. Der arme Kerl ist lausige vier Milliarden wert, damit schafft man es heutzutage nicht mal mehr auf die Forbes-Liste. Trotzdem hat er alles, was man so braucht: eine Villa in der Fifth Avenue mit Blick auf den Central Park, ein Riesengrundstück in den Hamptons, eine Jacht, zwei Jets, eine Trophy-Frau, das Übliche. Jurastudium in Harvard, dann ein paar Jahre bei einer Großkanzlei. Konnte sich nicht einfügen, also hat er mit ein paar Kumpels seine eigene Klitsche aufgemacht, und nach ein paar Fusionen hier und da leitet er heute vier Kanzleien. Wie andere Milliardäre auch scheut er die Öffentlichkeit und verschleiert seine Operationen mit einem Netz aus Scheinfirmen. Ich konnte nur einen Teil davon aufspüren, aber das war schon aufschlussreich genug.«
Gordy wandte seinem Publikum beim Sprechen den Rücken zu. Als er den Tequila-Becher zum Trinken hob, offenbarten sich Kerben zwischen seinen Rippen. Es war erschütternd zu sehen, wie abgemagert er war. Er sprach ruhig und ernst, als enthüllte er bedeutende Fakten, die ohne ihn nie ans Licht gekommen wären.
»Sein Hauptinstrument ist eine Gesellschaft für Privatinvestitionen namens Shiloh Square Financial, die auch im Zusammenhang mit fremdfinanzierten Übernahmen und faulen Krediten auftaucht – das volle Wall-Street-Programm. Shiloh gehört ein Teil von Varanda Capital. Wie viel genau, wissen wir nicht, weil darüber praktisch keine Informationen zu finden sind und Varanda außerdem einen Teil der Baytrium Group besitzt. Wie ihr vielleicht wisst, ist Baytrium neben ein paar anderen Gesellschaften Eigentümer unserer geliebten Foggy Bottom Law School – und dreier weiterer Privatunis. Was ihr sicher nicht wisst, ist, dass Varanda außerdem ein Laden namens Lacker Street Trust gehört und Lacker Street wiederum vier weitere private juristische Unis besitzt. Das macht zusammen acht.«
Auf der rechten Seite der Wand standen in großen Quadraten die Namen Shiloh Square Financial, Varanda Capital und Baytrium Group. Darunter waren in einer ordentlichen Reihe die Namen der acht Privatunis aufgelistet: Foggy Bottom, Midwest, Poseidon, Gulf Coast, Galveston, Bunker Hill, Central Arizona und Staten Island. Unter jedem Namen standen Zahlen und Wörter, die aber so klein geschrieben waren, dass man sie aus der Entfernung nicht entziffern konnte.
Gordy ging zum Tisch und schenkte sich großzügig Tequila nach. Er nahm einen Schluck, trat zurück zu seiner Wand und blickte seine Besucher an. »Vor etwa zehn Jahren hat Rackley begonnen, diese Hochschulen zusammenzukaufen, natürlich stets im Schutz seines Scheinfirmenlabyrinths. Es ist nicht verboten, kommerzielle Hochschulen zu besitzen, trotzdem hält er es lieber geheim. Wahrscheinlich hat er Angst, dass jemand seine schmutzigen Tricks aufdeckt. Aber ich bin ihm auf die Schliche gekommen.« Er trank wieder und funkelte sie aus weit aufgerissenen Augen an. »2006 beschlossen die Schlauberger im Kongress, dass alle Amerikaner in der Lage sein sollten, sich eine gute Ausbildung zu leisten, um vernünftig Geld verdienen zu können. Und so wurde ein Programm verabschiedet, nach dem jeder, einschließlich wir vier, Geld für eine Berufsausbildung oder ein Studium aufnehmen kann. Darlehen für alle, leichtes Geld. Studiengebühren, Unterhaltskosten, ganz egal wie hoch, und natürlich alles abgesichert durch die Bundesregierung.«
»Das ist bekannt, Gordy«, warf Mark ein.
»Oh, vielen Dank, Mark. Wenn du jetzt bitte so freundlich wärst, den Mund zu halten und mich reden zu lassen.«
»Ja, Sir.«
»Weniger bekannt ist, dass die acht Hochschulen stark expandiert haben, seit sie Rackley gehören. 2005 hatte die Foggy Bottom vierhundert Studenten. Als wir 2011 anfingen, gab es elfhundert Neuanmeldungen. So viele sind es bis heute. Das Gleiche gilt für die anderen Hochschulen. Alle haben um die tausend Studenten. Es wurden Immobilien gekauft, ein Haufen Dilettanten und Möchtegerns als Lehrkräfte eingestellt, dazu Verwaltungspersonal mit Minimalqualifikation, das fürstliche Gehälter bekommt, und vor allem wurde wie verrückt Werbung gemacht. Und warum? Nun, ich werde euch jetzt mal erklären, wie kommerzielle Hochschulen kalkulieren.«
Er nahm wieder einen Schluck und ging zur rechten Seite der Wand, wo ein Poster voller Zahlen und Berechnungen hing. »Hier ein paar harte Fakten. Nehmen wir die Foggy Bottom als Beispiel. Sie knöpfen uns 45000 pro Jahr an Gebühren ab. Es gibt weder Stipendien noch Beihilfen, wie man sie bei echten Universitäten bekommen kann. Das macht 45000 brutto pro Student und Jahr. Davon zahlen sie den Lehrkräften rund hunderttausend jährlich, das ist weit entfernt von den 220000, die man im Schnitt an einer ordentlichen Uni bekommt, und trotzdem ein dickes Gehalt für die Witzfiguren, die bei uns lehren. Der Nachschub an Arbeit suchenden studierten Juristen ist unerschöpflich, die stehen Schlange um die Jobs. Selbstverständlich sind das nur Leute, die für die Lehre geboren sind. Die Hochschule gibt gern damit an, dass auf zehn Studenten ein Dozent kommt. Als würden wir in netten kleinen Gruppen von lauter hoch qualifizierten Professoren unterrichtet werden. Wisst ihr noch, Schadenersatzrecht im ersten Semester? Wir saßen mit zweihundert anderen in Stotter-Steves Büro.«
»Wie hast du herausgefunden, was die Dozenten verdienen?«, unterbrach Todd.
»Ich habe mit einem von ihnen gesprochen. Er hat Verwaltungsrecht fürs dritte Studienjahr gegeben. Wir hatten ihn nie. Er wurde vor zwei Jahren gefeuert, weil er im Dienst getrunken hat. Wir haben uns zusammen die Kante gegeben, da hat er mir alles erzählt. Ich habe meine Quellen, Todd. Ich weiß genau, wovon ich rede.«
»Schon gut, schon gut. Hat mich nur interessiert.«
»Jedenfalls, die Foggy Bottom hat etwa hundertfünfzig Dozenten, das wäre mit sagen wir fünfzehn Millionen Dollar im Jahr der größte Ausgabeposten.« Gordy deutete auf eine Ansammlung schwer lesbarer Zahlen. »Dazu kommt die Verwaltung im obersten Stock. Wusstet ihr, dass unser unfähiger Dekan achthunderttausend Dollar im Jahr verdient? Natürlich nicht. Der Dekan von Harvard macht eine halbe Million jährlich, aber der muss auch keine Titelmühle leiten, wo es darauf ankommt, was unter dem Strich steht. Unser Dekan hat einen hübschen Lebenslauf, das macht sich gut in den Broschüren, er ist ein talentierter Redner – wenn er mal eine Rede hält –, kurzum, er hat vor allem die Aufgabe, den Schwindel geschickt zu verkaufen. Rackley zahlt alle seine Dekane gut, weil er von ihnen erwartet, dass sie seiner Masche ein glaubwürdiges Gesicht geben. Packen wir noch eine oder besser drei Millionen für die überhöhten Gehälter der Sachbearbeiter drauf, dann können wir sagen, die Verwaltung kostet vier Millionen Dollar im Jahr. Sagen wir fünf. Damit sind wir bei zwanzig Millionen insgesamt. Letztes Jahr sind vier Millionen in den Standort geflossen – für Gebäudeunterhalt, Personal und natürlich Werbung. Knapp zwei Millionen gingen in die Werbung, die immer mehr arme Seelen verführen soll, sich einzuschreiben, Geld aufzunehmen und eine strahlende Karriere als Jurist zu verfolgen. Ich weiß das, weil ich einen Freund habe, der ein ziemlich guter Hacker ist. Er hat ein paar Sachen gefunden – bei Weitem nicht alles – und war beeindruckt von den Sicherheitsmaßnahmen. Er meinte, die geben sich große Mühe, ihre Daten zu schützen.«
»Das macht vierundzwanzig Millionen«, sagte Mark.
»Du bist schnell. Runden wir auf fünfundzwanzig auf, dann zieht der Große Satan netto zwanzig Millionen aus der guten alten Foggy Bottom. Das multiplizieren wir mit acht, und dann kotzen wir alle bei dem Ergebnis.« Gordy räusperte sich und spuckte an die Wand. Er setzte den Becher wieder an den Mund, schluckte bedächtig und ging ein paar Schritte auf und ab.
»Wie funktioniert Rackleys Masche?«, fuhr er fort. »Er wirft seinen Köder aus, die Studienbewerber beißen an. Seine Unis konnten förmlich über Nacht expandieren, weil sie ihre Türen für jedermann öffneten, ungeachtet von Abschlussnoten oder LSAT-Aufnahmetests. Wenn man sich an der Georgetown immatrikulieren will – und die gehört zweifelsfrei zu den besten Unis des Landes –, muss man beim allgemeinen Aufnahmetest für das Jurastudium mindestens einen Wert von 165 Punkten erreichen. Bei den Eliteunis liegen die Anforderungen sogar noch höher. Was die Foggy Bottom fordert, wissen wir nicht, denn das ist Staatsgeheimnis. Mein Hackerfreund ist nicht an die Daten herangekommen. Doch wir können mit Gewissheit behaupten, dass ein LSAT-Wert von unter 150 ausreicht, wahrscheinlich genügen sogar 140 Punkte oder weniger. Ein Riesenmakel dieses kranken Systems ist, dass man beim LSAT noch so schlecht abschneiden kann und trotzdem angenommen wird. Diese Klitschen nehmen jeden, der ein Darlehen von der Zentralbank bekommt, und das bekommt wie gesagt jeder. Die Anwaltskammer würde einen Kindergarten als juristische Hochschule zulassen. Es interessiert niemanden, wie ungeeignet ein Kandidat ist, weder die Kammer noch die Zentralbank. Ich möchte niemanden in diesem Raum zu nahe treten, aber wir wissen alle Bescheid über die LSAT-Ergebnisse der anderen. Kam im Suff ja alles raus – Zola, du warst natürlich nüchtern, dafür hast du von uns vieren am besten abgeschnitten. Ich will mal diplomatisch sein und behaupte, der Durchschnitt unserer kleinen Gruppe liegt bei 145 Punkten. Statistisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit, die Zulassungsprüfung mit einem LSAT-Ergebnis von 145 zu bestehen, fünfzig Prozent. Das hat uns niemand gesagt, als wir uns beworben haben, weil es niemanden interessiert. Die wollten nur unser Geld. Wir waren vom ersten Tag an die Gelackmeierten.«
»Erzähl uns was, das wir nicht wissen«, sagte Mark.
»Ich bin noch nicht fertig«, erwiderte Gordy und ignorierte sie für eine Weile, während er sein Wandbild musterte. Abermals tauschten sie bange Blicke. Dieser Vortrag war interessant, doch sie machten sich vor allem Sorgen um ihren Freund.
»Wir stecken in diesem Schlamassel«, fuhr Gordy fort, »weil wir eine Chance gesehen haben, unseren Traum zu verwirklichen, ohne die finanziellen Mittel zu haben. Keiner von uns hätte Jura studieren sollen, doch jetzt stecken wir bis zum Hals in der Scheiße. Wir gehören nicht hierher. Man hat uns vorgegaukelt, es würden hoch bezahlte Stellen auf uns warten. Reines Marketing, diese Verheißung auf Jobs. Tolle Jobs mit satten Gehältern. In Wahrheit gibt es die gar nicht. Letztes Jahr haben die Großkanzleien an der Wall Street den Topabsolventen 175000 Dollar Einstiegsgehalt angeboten. Hier in Washington sind es 160000. Wir haben uns jahrelang Märchen über diese Jobs angehört, bis wir irgendwann selbst daran geglaubt haben. Heute wissen wir, wie es wirklich aussieht. In Wahrheit gibt es ein paar Jobs im Bereich von fünfzigtausend Dollar, so was wie du, Mark, dir ergattert hast, wobei du immer noch nicht weißt, wie viel genau du verdienen wirst. Das sind kleinere Kanzleien, wo man sich zu Tode schuftet und trotzdem nie Karriere macht. Die großen Kanzleien zahlen 160000 und mehr. Und dazwischen gibt es nichts. Gar nichts. Wir haben das Internet durchforstet, Klinken geputzt und Bewerbungsgespräche durchlitten. Wir wissen, wie übel der Markt aussieht.«
Sie nickten, allerdings nur, um ihn zu beschwichtigen. Gordy trank einen Schluck, ging zur linken Seite der Wand und zeigte mit dem Finger darauf. »Hier sind die richtig bösen Sachen, von denen ihr keine Ahnung habt. Rackley besitzt eine New Yorker Kanzlei namens Quinn & Vyrdoliac, vielleicht habt ihr schon davon gehört. In Fachkreisen ist sie als Quinn bekannt. Sie hat Vertretungen in sechs Städten, beschäftigt rund vierhundert Anwälte, gehört aber nicht zu den hundert größten. In Washington gibt es ein kleineres Büro mit dreißig Anwälten.« Er deutete auf ein Blatt Papier, auf dem der Name der Kanzlei in dicken Buchstaben stand. »Quinn ist überwiegend im Bereich Finanzdienstleistungen tätig, und zwar am unteren Ende: Zwangsversteigerungen, Pfändungen, Inkassoforderungen, Zahlungsverzug, Insolvenzen, praktisch alles, was irgendwie mit aus dem Ruder gelaufenen Schulden zu tun hat, einschließlich Studienkredite. Quinn zahlt gut, zumindest zu Beginn.« Er deutete auf eine bunte Faltbroschüre, die er aufgeklappt an die Wand gepinnt hatte. »Das hier habe ich entdeckt, als ich vor vier Jahren überlegte, mich an der Foggy Bottom einzuschreiben. Ihr habt es bestimmt auch gesehen. Auf dem Cover strahlt uns ein gewisser Jared Molson entgegen, der als Foggy-Bottom-Absolvent mit einem Einstiegsgehalt von 125000 Dollar bei Quinn angefangen haben soll. Ich weiß noch, dass ich dachte, hey, wenn man mit einem Abschluss von der FBLS so einen Job bekommt, dann bin ich dabei. Tja, ich habe Mr. Molson ausfindig gemacht und mich bei mehreren Drinks ausführlich mit ihm unterhalten. Er hat einen Job bei Quinn angeboten bekommen und nach bestandener Zulassungsprüfung den Vertrag unterzeichnet. Sechs Jahre hat er dort gearbeitet, ehe er kündigte, weil sein Gehalt immer weiter sank. Er meinte, die Kanzleileitung beschließe jedes Jahr nach Prüfung des Betriebsergebnisses, dass Einschnitte gemacht werden müssten. Als er bei hunderttausend angelangt war, hat er gekündigt. Er sagt, er lebe wie ein Penner und stottere mühsam seine Schulden ab. Inzwischen verkaufe er Immobilien und fahre nebenher für Uber. Die Kanzlei sei ein reiner Ausbeutebetrieb, und er habe sich von der Propaganda der FBLS einlullen lassen.«
»Da ist er nicht der Einzige, oder?«, fragte Todd.
»Nein. Molson war einer von vielen. Quinn hat eine schicke Website, ich habe die Lebensläufe von allen vierhundert Anwälten gelesen. Dreißig Prozent davon stammen von Rackleys Privatunis. Knapp ein Drittel! Rackley stellt sie ein und zahlt ihnen ein stattliches Anfangsgehalt, damit er ihre strahlenden Gesichter und Erfolgsgeschichten für seine Werbekampagnen benutzen kann.«
Gordy unterbrach sich, trank und sah sie selbstgefällig an, als erwartete er Applaus. Dann trat er näher an die Wand heran und zeigte auf ein Gesicht, ein Schwarz-Weiß-Foto auf Kopierpapier, eines von dreien direkt unterhalb des Großen Satans. »Dieser Gangster heißt Alan Grind, Anwalt aus Seattle und beschränkt haftender Teilhaber von Varanda. Grind gehört eine Kanzlei namens King & Roswell, auch eine Klitsche mit zweihundert Anwälten in fünf Städten, überwiegend drüben an der Westküste.« Er deutete auf die linke Seite, wo King & Roswell einen Platz gleich neben Quinn & Vyrdoliac innehatte. »Von den zweihundert Anwälten, die bei Grind angestellt sind, stammen fünfundvierzig von den acht Privatunis.«
Er nahm wieder einen Schluck und ging zum Tisch, um sich nachzuschenken.
»Hast du eigentlich vor, die ganze Flasche zu trinken?«, fragte Mark.
»Mal sehen.«
»Vielleicht solltest du ein bisschen langsamer machen.«
»Kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Ich bin nicht betrunken, nur ausreichend angeheitert. Was bildest du dir überhaupt ein, meine Trinkgewohnheiten zu kommentieren?«
Mark atmete tief durch und schwieg. Gordy sprach einigermaßen deutlich und schien bei klarem Verstand zu sein. Trotz seines derangierten Äußeren hatte er sich recht gut unter Kontrolle, zumindest im Moment.
Er ging zurück zur Wand und zeigte auf die Fotos. »Der Typ hier in der Mitte ist Walter Baldwin. Er führt eine Kanzlei in Chicago namens Spann & Tatta, dreihundert Anwälte in sieben Städten, übers ganze Land verstreut.« Er deutete auf das dritte Gesicht unter Rackleys Bild. »Und dann haben wir noch Mr. Marvin Jockety, Seniorpartner einer Kanzlei in Brooklyn, Ratliff & Cosgrove. Gleicher Aufbau, gleiches Geschäftsmodell.«
Gordy trank wieder und bewunderte sein Werk. Dann drehte er sich um und blickte die drei an. »Noch mal zum Mitschreiben: Rackley hat vier Kanzleien mit elfhundert Anwälten in siebenundzwanzig Büros, die so viele von seinen Absolventen einstellen, dass sich die Uni damit brüsten kann und Idioten wie wir auf sie hereinfallen und Säcke voller Geld bringen, das der Kongress bewilligt hat. Ein Traum!« Seine Stimme schwoll an und begann zu zittern, als er weitersprach. »Einfach grandios! Eine fette Abzockmaschinerie ohne jedes Risiko. Wenn man davon absieht, dass die Steuerzahler dafür blechen. Rackley streicht die Gewinne ein, und die Verluste sozialisiert er.«
Unvermittelt schleuderte Gordy den Kaffeebecher von sich, der an der dünnen Gipskartonwand abprallte und unversehrt über den Boden rollte. Dann ließ er sich zu Boden sinken, lehnte sich schwer mit dem Rücken gegen die Wand, das Gesicht ihnen zugewandt, und streckte die Beine aus. Seine Fußsohlen waren schwarz vor Dreck.
Der Knall hallte ein paar Sekunden nach. Alle blickten auf Gordy. Eine ganze Weile lang sprach niemand. Mark studierte das Schaubild und versuchte, Gordys Schilderungen nachzuvollziehen. Es gab keinen Grund, seine Recherchen anzuzweifeln. Todd starrte die Wand an, als hätte ihn die Geschichte völlig in Bann geschlagen. Zola betrachtete Gordy und überlegte, was sie mit ihm anstellen sollten.
Irgendwann sprach Gordy wieder, jetzt beinahe im Flüsterton. »Ich bin 276000 Dollar im Minus, dieses Semester inbegriffen. Wie viel ist es bei dir, Mark?«
Es gab keine Geheimnisse. Die vier kannten einander gut genug.
»Einschließlich dieses Semesters 266«, sagte Mark.
»Todd?«
»195.«
»Zola?«
»191.«
Gordy schüttelte den Kopf und lachte, allerdings nicht vor Belustigung, sondern aus Fassungslosigkeit. »Das macht zusammen knapp eine Million. Wer würde uns vieren wohl eine Million Dollar leihen, wenn er halbwegs bei Verstand ist?« So formuliert, kam ihnen diese Vorstellung absurd vor, geradezu lächerlich.
Nach einer langen Pause sagte Gordy: »Wir wurden betrogen und in die Falle gelockt. Es gibt keinen Ausweg.«
Todd stand langsam auf und trat an die Wand. Er