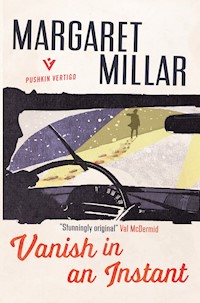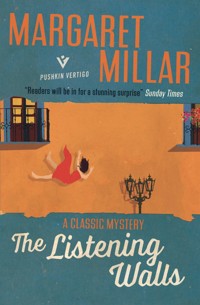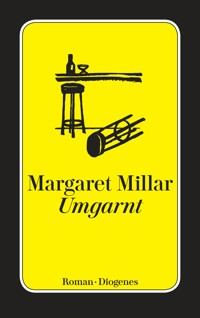7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die reiche Mrs. Gilly Decker aus Los Angeles beauftragt den jungen Anwalt Aragon, ihren Exgatten Lockwood aufzuspüren, der sich vor Jahren mit dem fünfzehnjährigen Hausmädchen nach Mexiko abgesetzt hat. Merkwürdig ist nur, daß alle Zeugen, die Aragon mühsam auftreibt, sehr schnell eines unerfreulichen Todes sterben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Margaret Millar
Fragt morgen nach mir
Roman
Aus dem Amerikanischen von Anne Uhde
Diogenes
{5}Für Charles Barton Clapp
{7}Fragt morgen nach mir, und Ihr werdet
einen stillen Mann an mir finden.
ROMEO UND JULIA III/I
{9}1
Spätnachmittag. Marco döste im Rollstuhl; die langen trägen Sonnenstrahlen berührten die Schädeldecke, strichen über die spärlichen grauen Härchen des gesunden Arms und verloren sich in den Falten des Hausmantels. Gilly stand im Türrahmen und sah zu ihrem Mann hinüber. Sie wartete auf ein Zeichen, daß er ihre Anwesenheit wahrnahm.
»Marco? Hörst du mich?«
Er konnte nur wenige Teile seines Körpers bewegen, und davon rührte sich keiner. Kein Fingerzucken der rechten Hand, die den Rollstuhl in Gang setzte, kein Vibrieren der einen Mundseite, kein Flattern des rechten Augenlids, das sich normal zu öffnen und zu schließen vermochte. Das andere Auge blieb wie immer: das Lid halb geschlossen, die Pupille reglos in der Mitte. Auch wenn er wach war, konnte niemand sicher sagen, was er gerade ansah oder wieviel er überhaupt sah. Manchmal kam es Gilly vor, als starre das Auge sie anklagend und direkt an, und manchmal schien es geradezu belustigt, als amüsiere es sich über ein Witzwort aus vergangener Zeit oder über einen zukünftigen Scherz. »Das Auge sieht nichts«, hatte der Arzt ihr gesagt. »Ich glaube, Sie irren sich, Doktor. Er betrachtet manche Dinge.« – »Nein, das Auge ist tot.«
{10}Das tote Auge, das nichts sah, blickte Gilly an, die jetzt ins Zimmer trat. Man hörte nichts; wie Gras schluckte der Teppich das Geräusch der Schritte.
»Du tust nur so, als ob du schläfst, nicht wahr, Marco? Weil du mich los sein willst. Ich gehe aber nicht. Ich will nicht gehen, siehst du?«
Nein – das tote Auge sah nichts, und das lebende blieb unter dem Lid verborgen.
Gilly berührte die Stirn ihres Mannes. Sie war von Falten durchzogen, als habe ein Kannibale angefangen, das Fleisch zu verzehren, und dabei seine Nägel eingegraben, die Spuren wie von einer Gabel hinterließen.
»Ich vertrag’s nicht, wenn Leute nur so tun. Ich werde gleich schreien.«
Aber sie schrie nicht. Jedesmal wenn sie schrie, kam Marcos Pfleger Reed angelaufen, der Airedale des Gärtners fing an zu jaulen, und die Haushälterin Violet Smith brach zusammen. Einer ihrer Zusammenbrüche war noch unvergessen.
»Violet Smith sagt, wir essen zuviel Fleisch. Heute abend gibt es Fisch.« Das mußte ihn aufrütteln – er haßte Fisch. »Marco –?«
Weder der angedrohte Schrei noch der Fisch unterbrachen das rhythmische Atmen.
Gilly blieb wartend stehen. Es war heiß; sie hätte gern eine Weile draußen im Patio gesessen, wo fast jeden Nachmittag um diese Zeit vom Ozean her eine Brise aufkam. Aber der Patio war allein Marcos Reich. Sie hatte ihn zwar entwerfen und bauen lassen, aber sie fühlte sich dort nicht recht wohl. Vielleicht lag es an den Pflanzen, die überall wucherten: sie standen in steinernen Urnen und Holzkästen auf dem Boden und hingen {11}in Terrakottaschalen und mit Draht zusammengehaltenen Seegras- und Palmfiberkörben von den Deckenbalken herab.
Marco bewegte sich mühelos mit dem Rollstuhl durch das Pflanzengewirr, aber Gilly stieß immer wieder mit dem Schienbein an die Fuchsientöpfe und verfing sich mit dem Haar in den Ranken der Spinnenpflanze. Bequem war der Patio nur für Leute im Rollstuhl oder für Kinder und Zwerge. Normale Erwachsene mochten ihn nicht. Der Pfleger fluchte, wenn er sich an den versteckten Dornen des Spargelfarnkrauts oder den tückischen Spikes der Windmühlenpalme verletzte; und selbst Violet Smith, die niemals fluchte, ließ einen sinngemäßen Ausruf fahren, wenn sie in den Wasserlilienteich trat, weil sie den schwingenden Armen des Polypodiums ausweichen wollte.
Für Kinder und Zwerge, und für Krüppel wie Marco, war der Patio ideal: hier konnte man Erwachsenen eine Falle stellen und normale Leute zum Narren halten. Aber natürlich bekam ihn kein Kind und auch kein Zwerg jemals zu sehen. Nur Gilly und Reed und Violet Smith und manchmal der Arzt, der nicht viel sagte oder tat, denn es blieb ihm nicht mehr viel zu sagen, nachdem er Gilly beigebracht hatte, wie man Injektionen verabreicht. (Sie hatte es mit Orangen geübt, bis es ihr ganz natürlich vorkam, die Nadel in eine weiche und doch resistente Materie einzustechen. »Also, so wahr mir Gott helfe«, hatte Violet Smith gesagt, »das ist doch wirklich sündhaft, gute Orangen für so etwas zu verschwenden, wo Sie genausogut an sich selber üben könnten.« – »Halten Sie den Mund, sonst übe ich’s an Ihnen«, sagte Gilly darauf.)
{12}Die Schiebetür zum Patio stand offen; von den Pflanzen kam ein leises Schwirren und Wispern, als flüsterten sie untereinander. Vielleicht mochten sie den Fischgeruch nicht, der über den Rasen aus der Küche kam. Es waren Marcos Pflanzen, vielleicht liebten sie den Fisch genauso wenig wie er, und ihr Protest war genauso schwach und schwer verständlich wie seiner. Aber er hätte auch nicht viel genützt: Violet Smith war kürzlich den Heiligen Sabbatäern beigetreten und legte sich jede Woche ein neues Credo zu. Diese Woche war es Fisch.
»Gleich kommt sie mit deinem Dinner, Marco.«
Sein Atem ging etwas schneller; sie war jetzt ganz sicher, daß er wach war und einfach von ihr und vom Essen nichts wissen wollte.
»Wenn du’s nicht magst, bringe ich dir was anderes, wenn Violet Smith weg ist; sie geht zu ihrem Gebetsabend. Hast du Hunger?«
Die eine Seite des Mundes bewegte sich, ein Geräusch entstand, das weder nach einem Tier noch nach einer der Pflanzen draußen auf dem Patio klang. Es war ein Laut von einem vegetierenden Lebewesen. »Er ist wirklich eine klägliche Gestalt«, sagte Violet Smith oft in Marcos Gegenwart, als habe der Schlaganfall, der seine Stimmbänder und den größten Teil seines Körpers gelähmt hatte, ihn auch taub gemacht. Das war nicht der Fall: er hatte, wie Gilly sehr wohl wußte, Ohren wie ein Luchs. Sie und Reed mußten sehr vorsichtig sein und ihre Zusammenkünfte stets nach Marcos Tabletten und Injektionen abstimmen.
»Möchtest du heute vielleicht im Ferrari essen?« Gilly belegte den Rollstuhl stets mit irgendwelchen Namen von Sportwagen – teils um Marco zu amüsieren und {13}teils, um für sich selber die unvermeidliche und dominierende Gegenwart des Krankenstuhls ein wenig zu mildern. Die Namen bekam sie von Reed, die meisten kannte sie gar nicht: Maserati, Lotus Europa, Aston Martin, Lamborghini.
Er öffnete das rechte Auge langsam und mit Mühe, als sei das Lid während des Nachmittagsschlafs festgeklebt. Aus dem Ausdruck des Auges ließ sich nicht schließen, ob er belustigt war oder nicht. Wahrscheinlich nicht; es war ein schwacher Scherz gewesen und er war ein sehr kranker Mann. Aber Gilly versuchte es immer wieder. Sie mußte – es entsprach ihrer Natur, so wie das Aufgeben Marcos Natur entsprach. Er hatte schon lange vor dem Schlaganfall aufgegeben. Der Schlaganfall war nichts als ein Interpunktionszeichen, der Schlußstrich am Ende eines Satzes.
»Na schön, also der Ferrari. Der Lamborghini ist sowieso in der Werkstatt, wird überholt … Gleich kriegst du etwas Fisch, damit du bei Kräften bleibst … Mußt du aufs Klo?«
Die Finger der rechten Hand lehnten ab.
»Der Arzt meint, du müßtest mehr Wasser trinken, wenn du kannst.«
Nein, er konnte nicht. Er wollte auch nicht. Er hatte aufgegeben. Hunger hatte er nur nach den Tabletten, Durst nur nach der Flüssigkeit in der Injektionsnadel.
Violet Smith kam mit einem Tablett ins Zimmer und schob die Tür mit dem knochigen Hinterteil zu. Sie war eine hochgewachsene hellhäutige Indianerin aus Süd-Dakota oder Oklahoma oder Michigan oder Arizona, das hing ab von ihrer Stimmung und von dem Staat, der gerade Schlagzeilen machte. Nach einem Wirbelsturm in {14}Oklahoma hörte man von ihr Geschichten aus ihrer Kindheit, die sie in steter Gefahr und auf der Flucht von einem Schutzkeller zum andern verbracht hatte. Dann fingen die stumpfen braunen Augen an zu glänzen wie polierte Bronze, und das ruhig-feierliche Gesicht leuchtete vor Erregung. Sie vergaß dann sämtliche Formulare und alles, was sie in der Agentur angegeben hatte, die sie zu Gilly geschickt hatte, vor knapp einem Jahr. Dort hieß es einfach: Violet Smith, zweiundvierzig Jahre alt, geboren, aufgewachsen und bisher angestellt in Los Angeles. Gilly vermutete, daß sie nie weiter nach Osten als Disneyland gekommen war und auch nicht weiter nach Norden als Santa Felicia, wo sie jetzt noch war.
»Hier – diesen Rotbarsch habe ich heute morgen am Hafen gekauft, ganz frisch.« Violet Smith trug das Tablett mit dem silbernen Deckel wie einen Schild vor sich her, halb stolz, halb defensiv. »Wir sollen das essen, was der Herr uns in seinen Meeren und Flüssen bereithält, und nicht Kühe und Schweine erst aufziehen und dann schlachten.«
»Bloß keine Konversionsversuche«, sagte Gilly.
»Versteh ich nicht.«
»Verstehen Sie sehr wohl.«
»Hab ich das verstanden, Mr. Decker? Was sie da sagt? … Nein? Nein. Mr. Decker sagt nein, und er weiß, was er sagt. Ein Jammer, daß er nicht lesen kann. Wenn ein Mensch nicht die Bibel lesen kann, wird er sehr klein.«
»Er hat gar keine.«
»Es ist noch nicht zu spät. Er könnte noch im allerletzten Moment gerettet werden, so wie ich, gelobt sei Jesus Christus.«
{15}»Stellen Sie das Tablett hin, und halten Sie den Mund.«
»Er könnte noch gerettet werden, ganz sicher.«
»Na schön, versuchen Sie’s mal in Ihrer Betstunde heute abend, aber geben Sie bitte nicht unseren Namen an. Ich will nicht, daß ein paar Verrückte in aller Öffentlichkeit über uns herziehen und laut singen, wir müßten errettet werden, weil wir Gottweißwas für Sünden begangen hätten. Sonst denken die Leute, wir hätten hier nichts als Diebe und Mörder im Haus.«
»Wir haben alle unsere Fehler«, gab Violet Smith kühl zurück. »Und jetzt machen Sie selber solche – solche Konsionsver-«
»Konversion. Und das bedeutet ganz was anderes.«
»Was es bedeutet, bestimmt der Betrachter. Ich meine, Sie tun genau das, was Sie mir vorgehalten haben. Stimmt das nicht, Mr. Decker? Ja? Er sagt ja.«
»Beeilen Sie sich bloß, sonst kommen Sie zu spät zur Betstunde.«
Gilly warf einen Blick auf ihre Armbanduhr und sah erstaunt, wie dünn und faltig ihre Arme aussahen, gerade als ob ihr Leib aus Mitleid mit Marcos Körper zu schrumpfen und zu altern beabsichtigte, auch wenn sie noch so viel aß und Reed ihr noch so oft beteuerte, sie sei noch jung. »Sie sehen überhaupt nicht aus wie vierzig«, sagte Reed oft. »Ja – das liegt daran, daß ich gar nicht vierzig bin, ich bin fünfzig.« – »Ach hören Sie doch auf mit dem Quatsch. Wer zählt schon die Jahre.« Sie zählte sie. Und er zählte. Jeder zählte, auch wenn er es nicht zugab. Alter – das war die zweite Antwort, die man als kleines Kind lernte. »Wie heißt du denn, Kleine? Wie alt bist du? …« Gilda Grace Decker. Ich bin fünfzig.
{16}Violet Smith stellte das Tablett auf den Metallklapptisch neben Marcos Rollstuhl und brachte den Tisch auf die richtige Höhe. »Ach ja – Mr. Smedler hat angerufen. Er läßt sagen, morgen um elf in seinem Büro, das ist in Ordnung.«
»Danke.«
»Sekretärinnen, die sind manchmal ziemlich pampig.«
»Ja, stimmt. Guten Abend, Violet Smith.«
»Guten Abend, Mrs. Decker. Und Mr. Decker auch, guten Abend. Ich werde für Sie beide beten.«
Gilly wartete, bis sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte. Dann sagte sie leichthin zu Marco: »Du brauchst dir keine Gedanken zu machen, Lieber. Ich muß mit Smedler über Anlagen und Aktien und solche Sachen sprechen. Alles langweiliger Rechtskram.«
Es war nicht langweilig, und es war auch kein Rechtskram, aber dies war nicht die Zeit, ihrem Mann das zu sagen. Man mußte es ihm langsam und vorsichtig beibringen, damit er begriff, daß es sich hier nicht um eine Laune handelte. Sie hatte es seit Monaten überlegt, geplant. Jeden Tag erschien es ihr richtiger, und heute war es mehr als richtig. Es war unvermeidlich.
{17}2
In der Nacht war Wind aufgekommen, ein Wirbelwind aus Santa Ana, der Sand und Staub von der andern Seite des Gebirges mit sich brachte. Am Vormittag war die City leergefegt wie von einem Blizzard; die Menschen drückten sich in die Torwege und hielten Schals und Taschentücher vors Gesicht. Autos blieben verlassen auf den Parkplätzen stehen; hier und da waren Zeitungskioske umgefallen und lagen zerschlagen auf der Straße, während die Zeitungsblätter durch die Luft segelten, auf und nieder wie ermattete weiße Vögel.
Smedlers Anwaltskanzlei lag in einem schmalen dreistöckigen Gebäude mitten in der City, einen Häuserblock vom Gericht entfernt. Die weniger wichtigen Angehörigen der Firma teilten sich in die beiden unteren Stockwerke; den dritten Stock hatte Smedler, dem das Haus gehörte, für sich reserviert und nach einem Erdbeben vor ein paar Jahren völlig umgebaut. In sein Büro kam man nur über einen vergitterten Fahrstuhl. Das verschaffte ihm das Gefühl der Ungestörtheit und auch der Macht, denn der Schalter, mit dem der elektrische Strom kontrolliert wurde, befand sich neben seinem Schreibtisch. Wenn ein gereizter oder sonstwie unerwünschter Klient nach oben fuhr, so konnte Smedler mit einem Handgriff den Strom abschalten und so dem {18}Klienten Gelegenheit geben, sein Anliegen noch einmal zu überdenken, während er im Fahrstuhl gefangensaß.
Gilly wußte nichts von dem Schalter, nur hatte sie eine Todesangst vor Fahrstühlen, die ihr wie kleine schwebende Gefängniszellen vorkamen. Sie benutzte deshalb den äußeren Eingang, eine schmale steile Eisentreppe, die als Notausgang bei Feuer installiert worden war, um die Baupolizei zu beruhigen. Oben war die Tür verschlossen, und Gilly mußte warten, bis Charity Nelson, Smedlers Sekretärin, erschien. Für Charity war der Türriegel das, was für Smedler der Schalter war. Sie rief: »Wer ist da?«
»Mrs. Decker.«
»Wer?«
»Decker. Decker!«
»Was wünschen Sie?«
»Ich habe eine Verabredung mit Mr. Smedler für elf Uhr.«
»Warum kommen Sie nicht im Aufzug?«
»Weil ich Aufzüge nicht mag.«
»Ich mag auch keine Steuern, aber deshalb bezahle ich sie doch.« Charity schloß die Tür auf. Sie war eine kleine schlanke Frau, über sechzig, mit starken grauen Augenbrauen, die ein eigenes Leben zu haben schienen, als ob sie von einem Motor außerhalb des Gesichts in Bewegung gesetzt würden. Sie trug eine kürbisfarbene Perücke, nicht nur um damit eigenes Haar vorzutäuschen – häufig nahm sie sie ab, wenn die Kopfhaut juckte, wenn es warm wurde oder wenn sie viel Arbeit hatte –, sondern weil Orange ihre Lieblingsfarbe war. Sie war seit dreißig Jahren bei Smedler und hatte fünf Ehen überlebt: zwei eigene und drei von Smedler.
{19}»Es wäre mir lieb, Mrs. Decker, wenn Sie wie alle Klienten den Fahrstuhl benutzen würden. Dann brauchte ich nicht extra vom Schreibtisch aufzustehen, den ganzen Weg durchs Zimmer zu gehen, um die Tür aufzuschließen, und dann wieder zurück zum Schreibtisch.«
»Tut mir leid, daß ich Ihnen Mühe gemacht habe.«
»Der Fahrstuhl ist wirklich sehr bequem, und Sie kämen dann nicht so außer Atem. Sie rauchen sicher sehr viel, was?«
»Ich rauche überhaupt nicht.«
»Einfach nicht in Form, was? Sie müßten mal Gymnastik versuchen.«
»Im Augenblick ist mir eher nach Karate zumute«, gab Gilly zurück. Warum benahmen sich bloß so viele Angestellte heutzutage so, als wären sie beim Staat angestellt und hätten es nicht nötig, irgend jemanden höflich zu behandeln? Nach Charitys Verhalten könnte man annehmen, ihre Arbeitgeber seien das Steueramt, CIA, FBI und vielleicht noch der liebe Gott, außer der Anwaltssozietät von Smedler, Downs, Castleberg, McFee & Powell.
»Mr. Smedler erwartet Sie in seinem Büro.« Charity drückte auf einen Summer. »Und Aragon wird auch gleich hier sein.«
»Wer ist Aragon?«
»Der junge Mann, den Sie gewünscht haben. Sie wollten doch einen zweisprachigen, n’est-ce pas?«
»N’est-ce pas. Das habe ich in einem privaten und persönlichen Telefongespräch mit Mr. Smedler erbeten.«
»Alle Anrufe gehen über mich. Ich bin seine Privatsekretärin.«
{20}»Aha. Sie sind außerdem ein Klugscheißer. N’est-ce pas?«
Charitys buschige Augenbrauen schoben sich eilig unter die Perücke und versteckten sich einen Augenblick unter den gelben Locken wie erschreckte Mäuse. Als sie wieder hervorkamen, sahen sie kleiner aus, als habe das Erlebnis sie eingeschrumpft. »Ziemlich grob.«
»Aber wirksam.«
»Das werden wir sehen.«
Gilly trat in Smedlers Büro. Er erhob sich hinter seinem Schreibtisch und kam auf sie zu, ein großer gutaussehender Mann Ende Fünfzig. Er kannte Gilly seit dreizehn Jahren, seit dem Tage, als sie B.J. Lockwood geheiratet hatte, der ein alter Schulfreund von Smedler war und ihn zu seinen beiden Hochzeiten eingeladen hatte. An die erste – mit einem jungen Mädchen der Gesellschaft, sie hieß Ethel – erinnerte sich Smedler nur undeutlich, aber an die zweite hatte er häufig und mit Staunen gedacht. Gilly war weder jung noch besonders hübsch, doch an jenem Tage sah sie in ihrem langen weißen Spitzenkleid und Schleier wirklich strahlend aus. Sie war unsinnig verliebt in B.J., und er war klein und dick und sommersprossig; kein Mensch hatte ihn bisher ernstgenommen. Gilly war über dreißig, also alt genug, um zu wissen, was sie tat, und sie leuchtete wie ein Kolibri, wenn sie ihn ansah. Smedler kam später zu dem Schluß, daß es am Make-up liegen mußte: ein Tupfer Pink, ein Hauch Silber, Augentropfen, die das Blau ihrer Augen noch intensiver machten. (Im nächsten Jahrzehnt hörte man ihn manchmal sagen, nicht in der Politik, vielmehr in der Ehe gäbe es seltsame Bettgenossen.)
{21}Abgesehen von gelegentlichen geschäftlichen Besprechungen oder einem Fußballspiel traf Smedler nach ihrer Heirat mit Gilly und B.J. nur selten zusammen. Die Scheidung vor acht Jahren hatten andere Anwälte durchgeführt, und das einzige nähere Detail hatte Smedler von Charity erfahren: B.J. war mit einem jungen Mädchen durchgebrannt. Gilly sollte die Scheidung sehr schwer genommen haben, obgleich für sie am Ende nicht nur Trübsal herauskam, denn B.J., wie immer ein miserabler Geschäftsmann, hatte hier offensichtlich auch noch ein schlechtes Gewissen und war bei der Teilung des gemeinsamen Besitzes sehr großzügig vorgegangen.
»Setzen Sie sich, Gilly, setzen Sie sich. Hier – dieser Stuhl ist bequemer.«
Er sagte, sie sehe reizend aus (unwahr), ihr beiges Seidenleinenkostüm sei sehr schick (wahr), und er sei sehr froh, sie wiederzusehen (etwas von beidem). Er war eigentlich weder froh noch unfroh, sondern noch immer etwas verwirrt, seit sie ihn am Vortage angerufen und nur wenige Angaben gemacht hatte. Sie wünschte einen jungen Mann, der Spanisch sprach und zuverlässig war, er sollte einen Auftrag für sie ausführen, wahrscheinlich in Mexiko. Wieso wahrscheinlich? dachte Smedler. Was war das für ein Auftrag? Sie hatte keine geschäftlichen Interessen im Süden oder überhaupt im Ausland, abgesehen von einer kleinen Goldmine in Nordkanada, die viel Geld fraß. Aber er war zu lange Anwalt, um direkt zur Sache zu kommen.
»Nun, und wie geht es Ihrem Mann, Gilly?«
»Wie immer.«
»Immer noch keinerlei Hoffnung?«
{22}»Meine Haushälterin hat gestern abend in der Kirche für ihn gebetet. Vielleicht kann man das als Hoffnung ansehen, wenn man sonst keine mehr hat.«
Smedler hatte sie etwa drei Monate nicht gesehen, und in der kurzen Zeit war sie sichtlich gealtert. Aber das Ergebnis war nicht unbedingt schlecht: ihr Gesicht schien neue Kraft gewonnen zu haben, und sie machte einen sicheren Eindruck. Sie hatte auch ziemlich abgenommen. Smedler hatte ihren Sinn für Stil stets bewundert – was immer sie trug, konnte, so kam es ihm vor, von keiner anderen Frau getragen werden –, und der Gewichtsverlust betonte ihre Eigenart.
»Ihr Anruf gestern war etwas geheimnisvoll«, sagte er jetzt.
»Das war Absicht – für den Fall, daß jemand mithörte, bei mir oder bei Ihnen.«
»Bei mir macht das nichts. Vor Charity habe ich keine Geheimnisse.«
»Ich aber.«
»Sie ist wirklich sehr diskret.«
»Was diskret ist, bestimmt der Betrachter, würde meine Haushälterin sagen.«
»Aha. Schön.«
»Erzählen Sie mir was über den jungen Mann.«
»Er heißt Aragon. Tom Aragon. Er ist fünfundzwanzig, intelligent, sieht gut aus, spricht Spanisch wie ein Spanier, hat im Frühjahr sein juristisches Staatsexamen abgelegt. Mir kommt er etwas pedantisch vor, aber das kann auch an unserem Verhältnis liegen – ich bin sein Boss. Theoretisch jedenfalls.«
»Was soll ich ihm zahlen?«
»Das kommt darauf an, was er für Sie tun soll. Wir {23}haben da einen Stundensatz für junge Leute mit seiner Ausbildung.«
»Bezahlung nach Stunden wäre in diesem Fall zu kompliziert. Ich brauche seine ganze Zeit für etwa zwei bis drei Wochen, vielleicht auch länger. Was ist sein Monatsgehalt?«
»Das weiß ich nicht genau. Wir können ja Charity fragen und –«
»Nein. Absolut nein.«
»Ich glaube, Sie sehen Charity nicht ganz richtig.«
»Ich glaube, ich sehe sie ganz richtig«, sagte Gilly. »Wie wäre es, wenn ich Ihrer Firma sein Monatsgehalt zahle, plus Provision für die Überlassung seiner Dienste. Dann würde ich mit Aragon ein getrenntes finanzielles Abkommen treffen, das wäre aber nur zwischen ihm und mir.«
»Warum so geheimnisvoll, Gilly?«
»Wenn ich Ihnen mehr sagte, dann würden Sie versuchen, mir die Sache auszureden.«
»Vielleicht auch nicht. Geben Sie mir eine Chance.«
»Nein.«
Eine Minute starrten sie einander an, nicht feindlich, aber auch nicht freundlich. Dann erhob sich Smedler mit einem Seufzer und trat an das große Fenster. Wolken zogen wie eine Prozession von Raumschiffen über den Himmel. Unten auf der Straße war der Verkehr immer noch gering und zähflüssig. Smedler blickte weder nach oben noch nach unten. Sie ist verdammt starrsinnig, diese Frau. Na schön, ich werde ebenso starrsinnig sein.
»Sie waren B.J.s Freund«, sagte Gilly. »Aber Sie haben nie viel von ihm gehalten. Sie haben ihn {24}behandelt wie einen lustigen netten Kerl, der nicht bis drei zählen kann.«
»Also, was zum Teufel – ich meine, wie kommen Sie darauf? Was hat das mit Ihrer Sache zu tun? Selbst wenn es stimmte, was es nicht tut –«
»O doch, es stimmt. Sie haben das ganz offen getan, und es war verletzend. Wahrscheinlich hat es mich mehr verletzt als ihn, weil er sich selber auch nicht mehr zutraute als Sie. Aber ich schon. Ich glaubte an ihn.«
»Verdammt noch mal, Gilly, nun kommen Sie doch zur Sache.«
»Das ist ganz einfach. Wenn ich Ihnen sagte, was ich von Aragon will, würden Sie mich für blödsinnig halten.«
»Versuchen Sie’s doch.«
»Nein.«
»Absolut nein?«
Sie antwortete nicht.
»Menschenskind«, sagte Smedler. »Ich brauche einen Drink.«
Tom Aragon schloß die vergitterte Fahrstuhltür und ging auf Charitys Schreibtisch zu. Er war ein hochgewachsener schmaler junger Mann mit Hornbrille, die ihm einen Ausdruck anhaltenden Erstaunens verlieh. Da er gleich nach dem Examen zu Smedler gekommen war, staunte er tatsächlich fast ununterbrochen. Seine bisherigen Arbeiten hatten ihn selten in den dritten Stock und zu der Frau geführt, die dort das Zepter schwang. Einem Gerücht zufolge sollte sie jedoch Sinn für Humor besitzen, wenn man ihn zu finden und auszugraben verstand.
{25}Sie mußte gehört haben, wie sich die Aufzugstür öffnete und schloß, aber sie blickte nicht auf von ihren Papieren und gab keinerlei Zeichen, daß sie seine Anwesenheit bemerkt hatte.
»Hey«, sagte Aragon. »Kennen Sie mich noch?«
Sie hob den Kopf. »Ah ja. Der Neue von ganz unten. Keß. Verfängt bei mir nicht. Was wollen Sie?«
»Der Boss sagt, Sie würden mich aufklären.«
»Im Allgemeinen, oder denken Sie an was Besonderes?«
»Wie ist diese Mrs. Decker?«
»Da müssen Sie mich nicht fragen. Sie hat mich eben Klugscheißer genannt. Wie finden Sie das?«
»Ich halte das für eine Suggestivfrage, die ich vor Gericht nicht zu beantworten brauchte.«
»Wir sind hier nicht vor Gericht, wir sind hier in einem gemütlichen Büro mit nur zwei Leuten; einer hat gerade eine Frage gestellt, und der andere wird sie beantworten.«
»Schön. Mrs. Decker könnte recht haben. Wir beide, Sie und ich, wir kennen uns noch nicht genug, ich kann mir da kein Urteil erlauben.«
Charity schob die Perücke beiseite und kratzte sich nachdenklich am linken Ohrläppchen. »Die Junioren in dieser Firma, vor allem die jüngeren, bemühen sich im allgemeinen um einen höflichen Ton mir gegenüber, und zu Weihnachten sogar noch um etwas mehr.«
»Weihnachten ist noch lange hin. Vielleicht bringe ich’s bis dahin auch noch soweit.«
»Das will ich hoffen.«
»Nun also zurück zu Mrs. Decker.«
»Gilda heißt sie. Gilda Grace Lockwood Decker. {26}Lockwood war ihr erster Mann, ein komischer kleiner Kerl, sah aus wie ein betrunkener Cherub, auch wenn er stocknüchtern war. Sie hat ihn natürlich wegen seines Geldes geheiratet, auch wenn Smedler das nicht glaubt. Aber Smedler ist und bleibt ein Romantiker, und das bei seinem Beruf und seinen vielen Ehen … Ja, Lockwood ist also lange tot. Gilly ist nach der Scheidung viel gereist und soll in verschiedenen Teilen der Welt verschiedene Liebschaften gehabt haben, aber nichts Ernsthaftes, bis sie diesen Marco Decker in Paris kennenlernte. Dann läuteten die Hochzeitsglocken noch einmal, und sie telegraphierte Smedler, er sollte ihr Geld schicken, an die American Express Co., für ihre Aussteuer. Aussteuer, ha – sie muß alle Parfüms und Nachthemden in Frankreich aufgekauft haben. Vermutlich hat sie dem alten Decker damit zuviel zugemutet, jedenfalls bekam er einen Schlaganfall, als sie noch auf der Hochzeitsreise in Saint-Tropez waren. Und damit saß Gilly dann da, mit einem gelähmten Ehemann inmitten von all den reizenden nackten jungen Franzosen.«
»Wieso waren die Franzosen nackt?«
»Mein Bester, es war in Saint-Tropez. Deshalb fahren die Leute ja hin, um andere Menschen nackt zu sehen.«
»Ziemlich lange Reise, nur um jemanden nackt zu sehen.«
»Na ja, natürlich nur Leute, die ›in‹ sind, fahren nach Saint-Tropez. Die anderen, solche wie Sie und ich, ziehen sich einfach aus und stellen sich vor den Spiegel. Ja, das ist also Gillys Geschichte. Sie ist dann mit Decker heimgekommen, hat allerhand teure Anschaffungen gemacht, um ihn zu Hause zu behalten, und einen Pfleger angestellt. Undsoweiter.«
{27}»Was gehört noch zu dem Undsoweiter?«
»Na, Sie können sicher sein, daß sie die teuren Pariser Nachthemden nicht im Schrank liegen läßt. Noch weitere Fragen?«
»Ja, eine«, sagte Aragon.
»Okay, raus damit.«
»Welchem Witzbold haben Sie den Namen Charity zu verdanken?«
{28}3
Der Swimming-pool mitten im Patio war größer als der im Christlichen Verein Junger Männer, wo Aragon als Junge schwimmen gelernt hatte. Auf dem Boden lag eine Meerjungfrau aus Keramik, die man im YMCA niemals geduldet hätte; sie trug nichts als ein albernes Lächeln.
Ein dunkelhaariger gutaussehender Mann in sehr kurzer Badehose war dabei, den Pool mit einem Vakuumsauger zu säubern. Mit kurzen heftigen Stößen fuhr er der Meerjungfrau über das Gesicht, als wolle er ihr Lächeln wegwischen. Dabei führte er einen halblauten Monolog, von dem Aragon annahm, er sei auf ihn gemünzt.
»Kein Mensch kümmert sich hier um den ganzen Kram. Nicht einer. Soll sich bloß mal einer ansehen. Ekelhaft.«
Aragon sah es sich an. Der Morgenwind aus der Wüste hatte einen feinen Staubschleier über das Wasser gelegt und die Oberfläche übersät mit Tannennadeln und Blütenblättern von Rosen und Jacaranda, mit Zypressenzweigen und Eukalyptusschoten – mit sämtlichen Blättern und Samen und Abfällen der Pflanzen.
»Wir haben zwei Gärtner, eine Putzfrau, ein Tagmädchen, einen Jungen fürs Schwimmbad, der zweimal {29}wöchentlich kommt, und einen Arbeiter, der über der Garage wohnt. Aber der Arbeiter hat auf einmal Arthritis, die Gärtner behaupten, das sei nicht ihre Arbeit, der Putzfrau und dem Tagmädchen kann man allerhöchstens einen Besen anvertrauen, und der Junge muß ausgerechnet diese Woche eine Biologiearbeit schreiben. Wer bleibt also übrig? Na klar: Reed. Der dumme Reed.«
»Tag, dummer Reed.«
»Wer sind Sie denn?«
»Tom Aragon. Ich bin mit Mrs. Decker verabredet.«
»Aragon. Es gab doch mal einen Boxer, der Aragon hieß. Kennen Sie den noch?«
»Nein.«
»Sind wohl zu jung, was? Ich eigentlich auch. Aber meine Mutter hat mir von ihm erzählt. Sie liebte Boxkämpfe. Ich seh sie noch vor mir, wie sie sich und mir Boxhandschuhe anzog, als ich sechs oder sieben war. Man stelle sich das vor. Ein verrücktes altes Huhn.«
Noch einmal stieß er der Meerjungfrau den Vakuumsauger ins Gesicht, dann ließ er ihn in den Pool fallen und fuhr mit seinem Monolog fort. »Wir haben erst Mitte Oktober – wie kann der Junge jetzt in der zweiten Schulwoche eine Semesterarbeit schreiben? Und der Mann mit seiner Arthritis – ich bin doch gelernter Pfleger, ich weiß, wie Arthritis aussieht. Es gibt mehr als achtzig verschiedene Arten, und davon hat er nicht eine. Was er hat, ist ’n Kater, genau wie gestern und vorgestern und vorigen Monat und letztes Jahr. Wenn das Haus hier richtig geführt würde, wäre er längst gefeuert. Im Grunde läuft es bloß darauf hinaus, daß ich den Pool am meisten benutze, und wenn ich ihn sauber {30}haben will, muß ich’s eben selber tun, verdammt noch mal.«
Er hörte sich allmählich an wie ein zänkischer Alter, dabei war er, wie Aragon annahm, nicht mehr als fünfunddreißig. Vermutlich hatte seine schlechte Laune auch mit dem Pool und der Sauberhaltung gar nichts zu tun, was er gleich darauf indirekt bestätigte. »Gilly wollte, daß ich hier bleibe, bis Sie kommen. Dafür mußte ich meine Kochstunde aufgeben. Beef Wellington mit Spinatsoufflé orientale wollte ich heute machen. Das Essen hier ist scheußlich. Lassen Sie sich bloß nicht zum Dinner einladen. Gilly hat eine verrückte Köchin angestellt, die immer neue Diäten ausprobiert. Seit einer Woche haben wir kein anständiges Stück Fleisch vorgesetzt bekommen … Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich mit Ihnen machen sollte – abschätzen, vielleicht. Gilly ist manchmal so unklar.«
»Na, dann schätzen Sie doch.«
Reed starrte ihn aus kleinen graugrünen Augen an, die wie trübe Teiche aussahen. »Sie sehen okay aus, würde ich sagen.«
»Danke.«
»Ist natürlich heutzutage schwer zu sagen. Mir wurde Donnerstag meine Brieftasche gestohlen, das waren zwei völlig harmlos aussehende Girls … Gehen Sie quer über den Patio, und ziehen Sie tüchtig am Glockenstrang. Sie ist bei Marco im Zimmer. Wenn ich mich beeile, komme ich vielleicht noch zurecht zum letzten Soufflé in meiner Kochstunde.«
»Viel Glück.«
»Soufflé ist keine Glückssache, da kommt es auf die richtige Temperatur und Zeit an. Können Sie kochen?«
{31}»Ja, Sandwiches mit Erdnußbutter.«
»Na, dann schmeckt Ihnen vielleicht sogar das Essen hier«, sagte Reed und verschwand eilig um die Hausecke.
Aragon brauchte den Glockenstrang nicht zu ziehen; Gilly wartete an der Tür eines Zimmers auf ihn, das offenbar als Familienaufenthaltsraum gedacht war. Der Blick fiel zunächst auf eine runde Grillgrube in gleicher Höhe wie der Fußboden, die aus gebrauchten Backsteinen hergestellt war; das Grillgitter war tadellos sauber, es gab auch keinerlei Aschenreste vom letzten Feuer und keine Holzkohle für das nächste. Man sah nur an ein paar kleinen Flecken, daß der Grill benutzt worden war. Eine riesige kupferne Haube über dem Gitter reflektierte die Gegenstände im Raum verschieden stark, etwa wie die Konvexspiegel, die in Warenhäusern zur Feststellung von Ladendieben benutzt werden.
Aragon erblickte sich in der Kupferhaube: größer, dünner und viel geheimnisvoller als im Spiegel der Herrentoilette im Büro. Die Gläser der Hornbrille wirkten fast wie Milchglas, als ob sie sein Gesicht verschleiern und nicht die Sehfähigkeit verbessern sollten. Er sah aus wie ein Oberlehrer, der einer Nebentätigkeit als Spion nachging, oder wie ein Spion mit dem Deckmantel einer Lehrtätigkeit.
Auch Gilly sah jetzt anders aus. Sie trug nicht mehr das beige Kostüm, sondern ein rosa Cottonkleidchen, das mehrere Nummern zu groß war, und Sandalen mit abgenutzten Kreppsohlen. Das Gesicht wies nur noch ein schwaches Make-up auf, alles andere war verschwunden, die Maskara weggeblinzelt, das Wangenrot {32}abgerieben, der Lippenstift fortgelächelt oder fortgeredet. Oder es war alles in einer Tränenflut untergegangen. Sie hatte einen großen Umschlag aus Leinenpapier in der Hand, quer darüber waren mehrere Buchstaben in Blockschrift mit schwarzer Tinte geschrieben.
»Sie heißen Tom, nicht wahr?«
»Ja.«
»Sie sind sicher gespannt, warum ich Sie hier herausgebeten habe.«
»So sehr weit ist es ja nicht.«
»Das war eine nette ausweichende Bemerkung. Aus Ihnen wird mal ein prima Anwalt werden.«
»Na schön, zugegeben, ich bin neugierig.«
»Ich konnte heute morgen nicht offen mit Ihnen reden, weil ich nicht wollte, daß Smedler oder die Xanthippe in seinem Büro mithört.« Über ihr Gesicht fuhr ein schnelles Lächeln wie ein Wetterleuchten; es sah jetzt viel frischer und weicher aus. »Der alte Fuchs hat da überall Wanzen gelegt, wissen Sie. Was hat er Ihnen von mir erzählt?«
»Sehr wenig.« Sie müssen mitmachen, hatte Smedler gesagt. Sie wird schon nichts Unzumutbares von Ihnen verlangen. Jedenfalls bringt es Ihnen Geld und Erfahrung, außerdem liegt uns daran, sie als Mandantin zu erhalten. Sie gehört zu unseren Goldvögeln, wissen Sie. »Ich glaube übrigens nicht, daß er Wanzen gelegt hat.«
»Warum nicht?«
»Das würde sich mit der Standesehre nicht vertragen.«
»Das müssen Sie Smedler mal erzählen, wenn ich dabei bin! Ich möchte sehen, was er für ein Gesicht macht.« Sie legte den Umschlag auf einen {33}lederbezogenen kleinen Tisch, setzte sich auf einen der vier dazu passenden Stühle und forderte ihn mit einer Handbewegung auf, ebenfalls Platz zu nehmen. »An diesem Tisch habe ich schon viele Spiele gemacht: Bridge, Scrabble, Monopoly, Backgammon. Jetzt kommt ein neues.«
»Und das heißt?«
»Sehen Sie selber.« Sie schob ihm den Umschlag zu, so daß er die Buchstaben auf der Vorderseite lesen konnte: B.J. – FOTOS, UNTERLAGEN USW. »Wir wollen es erst mal B.J. nennen, das ist einfacher.«
»Und die Spielregeln?«
»Die machen wir während des Spiels … Hat Ihnen Smedler etwas von B.J. erzählt?«
»Nein.«
»Oder sonst jemand?«
»Charity hat ihn erwähnt.«
»Ich sehe, ich muß aufpassen, Sie weichen tatsächlich aus. Was hat sie gesagt?«
»Daß er Ihr erster Mann war, B.J. Lockwood, und daß er schon lange tot ist.«
»Schon lange tot. Ja, er ist lange tot«, wiederholte sie, und es war, als lasse sie die Worte auf der Zunge zergehen, um den Geschmack festzustellen. Spinatsoufflé? Erdnußbutter-Sandwiches? Saure Trauben? Aus ihrem Ausdruck konnte man nichts schließen. »Genauer gesagt, seit acht Jahren. Wir waren fünf Jahre verheiratet und alles war in schönster Ordnung. Vielleicht nicht wie im Bilderbuch, wir waren schließlich erwachsen, er war schon mal verheiratet gewesen, und ich hatte auch meine Erfahrungen. Aber es war sehr viel besser als der Durchschnitt der Ehen. Jedenfalls bildete ich mir das ein.«
»Und was hat Ihre Ansicht geändert?«
{34}»Er. Er ließ sich mit einem unserer Dienstmädchen ein, einer Mexikanerin, höchstens fünfzehn. Sie war schwanger. B.J. hat sich immer ein Kind gewünscht, und ich wollte nicht – aus verschiedenen Gründen. In seiner Familie gab es mehrere Fälle von Diabetes, und in meiner lag, offen gesagt, auch allerhand vor. Außerdem fängt man mit Kindern nicht an, wenn man Ende Dreißig ist. Da muß der Mutterinstinkt schon erheblich stärker sein als bei mir.«
»Wie hieß das Mädchen?«