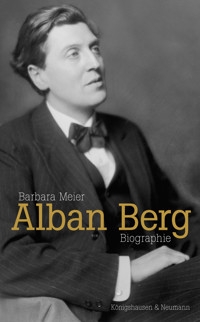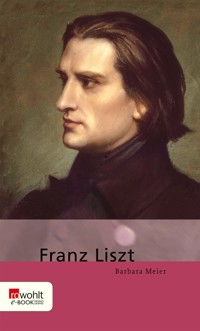
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Rowohlt E-Book Monographie Franz Liszt war ein höchst widersprüchlicher Mensch. Dieses Buch schildert ihn als Virtuosen, der für seine Berühmtheit mit lebenslanger Heimatlosigkeit bezahlt hat, als Lehrer vieler bekannter Pianisten, als Dirigenten, der Richard Wagner den Weg bereitet hat – und als Komponisten, dessen Werk Entwürfe einer zukünftigen Musik enthält. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Barbara Meier
Franz Liszt
Über dieses Buch
Rowohlt E-Book Monographie
Franz Liszt war ein höchst widersprüchlicher Mensch. Dieses Buch schildert ihn als Virtuosen, der für seine Berühmtheit mit lebenslanger Heimatlosigkeit bezahlt hat, als Lehrer vieler bekannter Pianisten, als Dirigenten, der Richard Wagner den Weg bereitet hat – und als Komponisten, dessen Werk Entwürfe einer zukünftigen Musik enthält.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Vita
Barbara Meier, geb. 1938 in Magdeburg, Studium der Schulmusik in Köln, später der Musikwissenschaft, Germanistik und Philosophie in Münster, 1991 Promotion zum Dr. phil. Veröffentlichungen: «Geschichtliche Signaturen der Musik bei Mahler, Strauss und Schönberg» (1992), «Giuseppe Verdi» (rm 50593, 2000), «Franz Liszt» (rm 50633, 2008) und «Robert Schumann» (rm 50714, 2010).
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2015
Copyright © 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Hamburg
Coverabbildung Umschlagfoto Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth/Richard-Wagner-Gedenkstätte, Bayreuth
ISBN 978-3-644-54191-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Zu Höherem bestimmt
Im Frühjahr 1819 erschien bei dem bekannten Wiener Klavierpädagogen Carl Czerny ein siebenjähriger Junge zum Vorspiel. Sein Vater, der ihn begleitete, stellte sich als der fürstlich-esterházysche Beamte Adam Liszt vor. Das auffällig blasse Kind wirkte schwächlich, es wankte «wie betrunken» am Klavier hin und her, beständig in Gefahr, im nächsten Augenblick vom Stuhl zu fallen. Sein Spiel erschien dem Lehrer «ganz unregelmäßig, unrein, verworren». Umso erstaunter verfolgte er, wie der Kleine die ihm vorgelegten Stücke mühelos vom Blatt spielte, wie er über ein vorgegebenes Thema improvisierte und, ohne harmonische Regeln zu kennen, einen «gewissen genialen Sinn» in seinen Vortrag legte.
In Czernys «Erinnerungen»[1] erscheint Franz Liszt als ein kränkliches, introvertiertes Kind mit deutlichen nervösen Störungen. Noch am Tag seiner Geburt hatte Adam Liszt ins Tagebuch geschrieben: «Mein Sohn, du bist vom Schicksal bestimmt! Du wirst jenes Künstlerideal verwirklichen, das vergeblich meine Jugend bezaubert hat.»[2] Und der Sohn, unerbittlich zur Virtuosität bestimmt und sehnsüchtig nach Anerkennung, hatte sich im Entsagen üben müssen. Aus scheuem Respekt vor dem Vater war er kaum jemals ungehorsam, Schläge bekam er für Fehler, die er machte.
Schon Adam Liszt sollte nach dem Willen seines Vaters, eines Dorfschullehrers[3], etwas «Höheres» werden. Er durfte das Gymnasium in Preßburg[4] besuchen und spielte mehrere Instrumente: Klavier, Violine, Cello, Gitarre. Mit achtzehn trat er in den Franziskanerorden ein, wurde aber nach zwei Jahren wegen seiner «unbeständigen und veränderlichen Natur»[5] wieder entlassen. Danach begann er an der Preßburger Akademie ein Philosophiestudium, das er, weil das Geld fehlte, nach anderthalb Jahren abbrach. Er wurde Wirtschaftspraktikant auf einem der Güter des Fürsten Esterházy[6], dann Amts- und Rentschreiber in der Güterverwaltung, wechselte aber oft die Stellen, unzufrieden mit dem Leben auf dem Land. Nach Eisenstadt zog es ihn, wo es Theater- und Opernaufführungen gab und Konzerte der fürstlichen Kapelle, die einmal von Joseph Haydn geleitet worden war. Um sich dem Fürsten zu empfehlen, hatte Adam Liszt 1801 ein Tedeum für ihn komponiert. Als er endlich nach mehreren Bittgesuchen Amtsschreiber am Eisenstädter Hof geworden war, durfte er gelegentlich als Cellist in der Kapelle mitspielen, unter der Leitung des berühmten Konzertmeisters Johann Nepomuk Hummel. Doch schon drei Jahre später, wegen einer ehrenvollen Beförderung zum Schäferei-Rentmeister, musste er Eisenstadt wieder verlassen. Seine Arbeit erledigte er weiterhin gewissenhaft, aber er wurde unglücklich, ja verbittert.
Im Januar 1811 heiratete er die elf Jahre jüngere Maria Anna Lager aus Krems. Früh zur Selbständigkeit gezwungen, hatte sie als Stubenmädchen in Wien gearbeitet und etwas Geld gespart. Adam Liszt, damals 34, war als Rechnungsführer der fürstlichen Schäferei in Raiding[7] ein angesehener Mann. Unwürdig muss ihm das unstete Leben seines Vaters Georg Adam vorgekommen sein, der 25 Kinder aus drei Ehen hatte, zweimal wegen Unzuverlässigkeit und Streitsucht aus dem Dienst entlassen worden war und immer wieder in Not geriet, sodass sein Sohn Adam ihn zeitweilig bei sich aufnahm.
Dann bekam Adam Liszts Leben mit der Geburt des einzigen Kindes am 22. Oktober 1811, im Jahr des «Großen Cometen», wieder ein Ziel. Das astronomische Wunder[8] deutete er als Zeichen, dass sein Sohn zu Großem bestimmt sei, und auf diese Bestimmung hin entwarf er einen Lebensplan.
Im Taufbuch findet sich der Eintrag «Franciscus List», die ungarische Schreibweise bestimmte der Vater dann der Aussprache wegen, ohne das z hätte man «Lischt» gelesen. Denn Raiding, damals Doborján, 35 Kilometer südlich von Eisenstadt gelegen, gehörte bis 1821 noch zu Ungarn. Wenngleich die Bevölkerung zu 90 Prozent aus Deutschen bestand, Deutsch die Amtssprache war und man selbst im fürstlichen Theater kein Wort Ungarisch zu hören bekam, verstand sich Adam Liszt, der wie sein Sohn nie die ungarische Sprache lernte, immer als Ungar.
Wenn der Vater auf dem Spinett spielte, war das Kind sein einziger Zuhörer. Bald sang es die gehörten Melodien nach und bat unaufhörlich, selber spielen zu dürfen. So wurde der Vater sein erster Lehrer. Dessen Ansprüche waren, was das Lernpensum betraf, unverhältnismäßig hoch: Etüden, klassische Stücke und Bach’sche Fugen, Übungen im Transponieren, zur Belohnung Fantasieren und Vierhändigspiel. Vernachlässigt blieben dabei Spieltechnik, Präzision und theoretische Grundlagen. Fast den ganzen Tag saß der Junge am Instrument, begierig zu lernen und versunken in seine eigene Welt. Der schlechte Gesundheitszustand des Kindes, das in den ersten drei Lebensjahren über Monate schwer krank gewesen war, machte den Eltern Sorgen. Erst als der Junge in die Schule kam, schienen die gefährlichsten Krisen überwunden.
Der Lehrer Johann Rohrer unterrichtete die Raidinger Schüler in einem einzigen Raum. Im Sommer, wenn die Kinder bei der Landarbeit gebraucht wurden, kam nur die Hälfte zum Unterricht. Franz Liszt blieb viereinhalb Jahre dort, bis zum Mai 1822, da war er zehn, danach besuchte er nie mehr eine Schule. Noch 1850, als er von der guten, nach keiner Richtung vernachlässigten Erziehung des Gymnasiasten Frédéric Chopin berichtet, wird das Gefühl der eigenen Benachteiligung spürbar.[9] Unter dem Mangel an Bildung, der oft peinlichen Unsicherheit des Autodidakten, der sich alles Wissen selbst anlesen musste, hat er sein Leben lang gelitten. Intellektuell sei er, schrieb er einmal, in der Lage eines verschämten Armen geblieben.[10]
Bald suchte Adam Liszt nach einem professionellen Lehrer. Am liebsten hätte er seinen Sohn zu Hummel geschickt, den er ja von Eisenstadt her kannte. Aber Hummel leitete jetzt die Hofkapelle in Weimar und war viel zu teuer. Am besten geeignet für die Ausbildung zum Virtuosen und Komponisten schien Wien, die Stadt Beethovens und Schuberts, für Adam Liszt der «Wohnsitz der Music»[11], im Übrigen, wie der Kritiker Eduard Hanslick fand, geradezu ein «Stapelplatz von Wunderkindern»[12]. Adam Liszt hatte alle Kosten für das Leben im «geldfressenden» Wien[13] genau zusammengerechnet: für den theoretischen und praktischen Musikunterricht seines Sohnes, für Reisen, Sprachunterricht, Konzertbesuche, Noten und Bücher, für Kost und Logis. Mit den Plänen ihres Mannes war Anna Liszt nicht einverstanden. Sie dachte an die Strapazen einer Künstlerlaufbahn und hätte es am liebsten gesehen, wenn ihr Sohn Geistlicher geworden wäre. Dem Jungen blieben die Zukunftssorgen der Eltern nicht verborgen, die wachsende Nervosität des Vaters, die kränkende Abhängigkeit vom fürstlichen Wohlwollen. Auslöser dieser Schwierigkeiten war er ja selbst, und wie oft verzögerten Krankheiten den Fortschritt. Adam Liszt reichte mehrere Gesuche an den Fürsten Esterházy ein, die jedes Mal den schwer durchschaubaren Beamtenapparat zu passieren hatten, untertänigste Bitten um eine Versetzung nach Wien, um Förderung des Jungen, Empfehlungen, Beihilfen. Unter «Thränen» bat er im Frühjahr 1820 um ein Jahr unbezahlten Urlaub und eine finanzielle Unterstützung für den Aufenthalt in Wien, denn betteln gehen könne ein fürstlicher Beamter doch nicht.[14] Erst zwei Jahre später wurde der Urlaub gewährt. Dass Nikolaus II. sein Mäzen gewesen sei, wies Franz Liszt später nachdrücklich zurück: Der Fürst habe nie irgendetwas für ihn getan.[15]
Im Oktober 1820 war Franz Liszt zum ersten Mal in der Bezirkshauptstadt Ödenburg, heute Sopron, öffentlich aufgetreten. Vor vielen Zuhörern zu spielen begeisterte ihn geradezu. Dem Publikum gefiel er sofort: durch seine Anmut, sein Temperament, den frappierenden Gegensatz zwischen der grazilen Gestalt und der Kraft seines Spiels, durch die Unbefangenheit, mit der er aus dem Stegreif über vorgeschlagene Melodien fantasierte. Als er einen Monat später im Preßburger Palais vor adliger Gesellschaft spielte, erklärte sich spontan eine Gruppe ungarischer Aristokraten bereit, dem Jungen für die Dauer von sechs Jahren ein Stipendium von jährlich 600 Gulden zu gewähren. Adam Liszt verkaufte seinen gesamten Besitz, das Vieh, die Möbel, das Spinett, und zog am 8. Mai 1822 mit seiner Familie in die Residenzstadt, sozusagen als freier Unternehmer, ein Jahr später beantragte er seine Entlassung aus den fürstlichen Diensten.
Carl Czerny, damals Anfang dreißig, war trotz seiner Jugend ein gesuchter Lehrer in Wien. Da seine Tage mit Klavierstunden ausgefüllt waren, unterrichtete er Franz Liszt abends, bald schon unentgeltlich. Er konnte mich ob meines Fleißes gut leiden, trotz meines Herunterhudelns, berichtete Liszt später. Fleißig waren sie beide, Czerny, der mit Muzio Clementi, Johann Nepomuk Hummel, Ferdinand Ries und Ignaz Moscheles die «brillante Wiener Schule» vertrat, hat über tausend Werke hinterlassen. Anfangs stand die technische Schulung im Mittelpunkt, die Czerny strikt vom Studium der Klavierliteratur trennte, ein rein mechanisches Training des «richtigen» Fingersatzes, der Geläufigkeit, des Anschlags, der Taktfestigkeit. Und bevor der Junge Bach, Beethoven, Hummel und Moscheles studieren durfte, stopfte ihn sein Lehrer tüchtig mit Clementi.[16] Übungen im Fantasieren und Vom-Blatt-Spielen ergänzten den Unterricht.
Der damals schon über siebzigjährige Hofkapellmeister Antonio Salieri unterrichtete Liszt in Harmonielehre, Kontrapunkt, Partiturlesen und Komposition. Er hatte noch mit Mozart verkehrt, Beethoven widmete ihm seine Violinsonaten op. 12, Schubert, Hummel, Moscheles und Meyerbeer waren seine Schüler gewesen, auch viele berühmte Sänger. Dennoch glaubte er zu träumen, als er Franz Liszt zum ersten Mal spielen hörte.
Da die Quartiere in der Wiener Innenstadt teuer waren, wohnte die Familie Liszt zunächst in Mariahilf, am Stadtrand. Der Weg zum Unterricht war weit. Als Salieri bemerkte, wie erhitzt und erschöpft der Junge an warmen Tagen bei ihm erschien, war er so besorgt, dass er sich an Esterházy wandte. So konnte die Familie bald in die Innenstadt ziehen. Auf Salieris Initiative hin durfte Franz Liszt sich an einer Gemeinschaftskomposition beteiligen, zu welcher der Verleger Anton Diabelli die fünfzig berühmtesten Musiker Wiens eingeladen hatte. Die Aufgabe, eine Variation über einen vorgegebenen Walzer zu schreiben, löste der Elfjährige mit vielen Modulationen und eigenwillig im 2/4-Takt. Die Variation erschien als seine erste gedruckte Komposition 1824 in Diabellis Sammelband.[17]
Am 1. Dezember 1822 trat er in Wien zum ersten Mal öffentlich auf, gemeinsam mit einer Sängerin und einem Geiger. «Der kleine Zauberer», wie der Kritiker der «Wiener Allgemeinen Musikalischen Zeitung» Franz Liszt nannte, erregte mit Hummels a-Moll-Konzert op. 85 «allgemeine Bewunderung»[18], die Leipziger «Allgemeine Musikalische Zeitung» berichtete über die erstaunliche Kraft, mit welcher «der kleine Herkules» die Musik «herabdonnern» ließ.[19] Weitere Konzerte folgten, zuletzt, am 13. April 1823, spielte Liszt im Kleinen Redoutensaal die Glanznummer aller Pianisten, Hummels h-Moll-Konzert op. 90, dazu Variationen von Moscheles und, wie es Mode war, eine freie Fantasie über ein von den Zuhörern gewünschtes Thema.[20]
Die überwältigenden Erfolge ermutigten Adam Liszt, seinen Sohn auch in Paris und London auftreten zu lassen – gegen den Rat Czernys, der ihm vorhielt, der Kleine sei doch gerade «im besten Studieren»[21]. Am 20. September 1823 verließ die Familie Liszt die Heimat für immer. Drei Monate waren sie mit der Postkutsche unterwegs, denn bevor sie am 11. Dezember Paris erreichten, musste der Junge in zahlreichen Konzerten das notwendige Startkapital erspielen. So feierte man bereits in München, Augsburg, Stuttgart und Straßburg den «neuen Mozart».
Herumtastendes Studieren und Produzieren
Nach dem Plan seines Vaters sollte Franz Liszt eine möglichst umfassende musikalische Bildung erhalten, vor allem sollte er Komposition studieren, natürlich am Pariser Konservatorium, dem berühmtesten Musikinstitut Europas. Hier herrschte der mächtige Luigi Cherubini. Unerbittlich verwies er auf das Reglement, das die Aufnahme eines Ausländers nicht gestattete. Dagegen konnte selbst ein Empfehlungsschreiben Metternichs nichts ausrichten. Die Ablehnung traf die Familie völlig unvorbereitet. Waren die vielen Kosten, die Opfer umsonst gewesen? Alles schien mir verloren, selbst die Ehre, schrieb Liszt später. Nach der Abweisung durch ein Tribunal, das für immer verdammt oder für immer begnadigt, blieb die Scham über die eigene Ohnmacht.[22]
Da war die Verbindung mit dem liebenswürdigen Sébastien Erard, die durch einen Empfehlungsbrief Diabellis zustande kam, ein Glück für die Familie Liszt. Die Erard-Fabriken in Frankreich und England hatten Weltruf, sie produzierten Flügel mit einer neuartigen Mechanik, die einen verbesserten Anschlag und schnelle Repetitionen ermöglichte. Franz Liszt widmete Pierre Erard, dem Neffen Sébastiens, eines seiner ersten Werke, die Acht Variationen.
Als Lehrer für Komposition konnte Ferdinando Paër gewonnen werden, der bekannte Opernkomponist und Direktor der Italienischen Oper. Liszt hat ihn später kaum einmal erwähnt. Bei seinen Klavierübungen war er von nun an auf sich selbst angewiesen. Schon bald bot sich, wiederum durch Empfehlungsschreiben, die Möglichkeit, in privaten Salons der Aristokratie und des Großbürgertums vorzuspielen, dann auch in Konzertsälen. Die Klavierstücke, die er 1824 für diese Gelegenheiten schrieb, forderten durch ihre Virtuosität, die effektvollen Schlussgesten, brillant und con bravura, den Beifall geradezu heraus.
Mit abergläubischem Staunen verfolgte das Pariser Publikum die Konzerte des Zwölfjährigen. «Le petit Litz» bezauberte alle, nicht nur durch sein Spiel, auch mit seinen guten Manieren, seinem bald schon eleganten Französisch, mit der sprechenden Mimik, seinem Charme, wenn er Bekannten im Publikum zulächelte. Die Art, wie er jedes Mal den Flügel geradezu in Besitz nahm, die Leichtigkeit, mit der er improvisierte, die Kraft, die schwindelerregende Virtuosität seines Spiels lösten Beifall ohne Ende aus, und noch nach den Konzerten nahm er Huldigungen in den Logen entgegen. So wurde er zum «enfant gâté», dem verwöhnten Kind, dem man kostbares Spielzeug, Schmuck, Kunstgegenstände schenkte, die Zeitungen lobten ihn überschwänglich, sein Porträt war im Louvre ausgestellt. Adam Liszt konnte nun plötzlich Geld bei Rothschild anlegen. Czerny indes, dem er von all diesen Erfolgen schrieb, mahnte aus der Ferne, dass der Zisy ja «fleissig mit Metronom exerziren» und «sich durch übertriebenes Lob» «nicht irremachen lassen» solle.[23] Der Junge arbeitete hart, lernte Sprachen – Italienisch, Latein, Englisch –, schrieb Stücke für Klavier und finanzierte das Leben seiner Familie mit Konzerten und Privatstunden.
«Stelle Dir vor, 14 Journalisten schreiben über das Talent und noch ist kein Ende. Freund, weißt, was ich zu all diesem sage? – ich weine – und aufrichtig Dir gesagt, seine Phantasie am Klavier ist wirklich außerordentlich, und dieses ist’s eben, was die Herren und Damen in Paris zum höchsten Grad des Erstaunens und der Bewunderung bringt. Und stelle Dir vor, wir gehen fast täglich in Gesellschaften, überall wird nur phantasiert, improvisiert und über aufgegebene Themen gespielt.»
Aus einem Brief Adam Liszts vom 9. März 1824 (Die Musik V, 13, S. 17)
Weil das Pariser Publikum immer neue Wunder erwartete, sollte Franz Liszt unter Paërs Anleitung nun auch noch eine Oper komponieren, natürlich für die Grand Opéra, die berühmteste Opernbühne der Welt. Das einfältige Libretto zu Don Sanche oder das Liebesschloss, eine Mixtur aus Märchen und galantem Abenteuer, war für einen Dreizehnjährigen nicht gerade inspirierend; die Musik geriet denn auch nur «hübsch und gefällig», wie ein Kritiker bemerkte.[24] Nach der Uraufführung am 17. Oktober 1825 wurde der Einakter noch dreimal wiederholt, das heißt, die Oper war durchgefallen – eine Demütigung für den empfindlichen und verwöhnten Jungen.
Ein Virtuose musste europaweit bekannt sein, das hatte Mozarts Beispiel gezeigt. So unternahm Adam Liszt anstrengende Reisen mit seinem Sohn. Weil man Anna Liszt die damit verbundenen Strapazen nicht hätte zumuten können, zog sie zu ihrer Schwester nach Graz. 1824, 1825 und 1827 reisten Vater und Sohn nach England, wo man Master Liszt enthusiastisch applaudierte, sogar König George IV. hörte ihm zu und lud ihn nach Windsor ein. Dazwischen lagen wieder Konzerte in Paris und dann Tourneen durch Südfrankreich und die Schweiz. Vier Jahre lang beschwerliche, endlose Fahrten in der Reisekutsche oder auf dem Schiff, immer der Kampf gegen die Müdigkeit, dann die Ungewissheit, ob die Investitionen sich auch lohnten – das führte zu Erschöpfungszuständen, schließlich zu einem regelrechten Widerwillen des Jungen gegen den Konzertbetrieb. Natürlich feierte man das Wunderkind überall, doch allmählich fühlte sich der Heranwachsende durch die Komplimente und Schmeicheleien fast gebrandmarkt, je weniger er sich täuschen ließ über die schlecht verhehlte Erniedrigung des Künstlers zum Bedientenstande. Es war demütigend, den Dienstboteneingang benutzen zu müssen und in Gesellschaften zu spielen, zu denen sein Vater nicht zugelassen war. 1837 schrieb er an George Sand: Ich hätte alles in der Welt lieber sein mögen als Musiker im Solde großer Herren, patronisirt und bezahlt von ihnen wie ein Jongleur oder wie der weise Hund Munito.[25]
Das Tagebuch, das der Fünfzehnjährige während der dritten Englandreise führte – wie selbstverständlich in Französisch –, ist ein Studien- und Andachtsbuch. Darin aufgeschrieben sind nicht Stimmungen und Eindrücke, sondern Gedanken, Lehrsätze, Imperative, meist als Zitate. Zugleich enthält es Rechenschaftsberichte über Kirchgänge, Andachtsübungen und Gebete: Die Zahl 7 deutet auf die ersten sieben Litaneien mit der immer wiederkehrenden Bitte um Erbarmen. Nächtelang las er religiöse Bücher. Richtlinien für sein Handeln fand er in den strengen Maximen französischer Moralisten des 17. Jahrhunderts, im Neuen Testament und in der Biographie seines Namenspatrons Franz von Paula. Sein Bildungshunger war zugleich ein regelrechter Hunger nach Erziehung. «Über die Nachfolge Christi» des mittelalterlichen Mystikers Thomas von Kempen ging ihm nicht aus dem Kopf; immer wieder fällt im Tagebuch das Zeichen des Kreuzes auf, unter das er nun sein Leben stellen wollte. Seine Frömmigkeit war ebenso aufrichtig wie die strengen Anforderungen an sich selbst. Doch weil das Wunderkind ja von früh auf gelernt hatte, all seine Äußerungen im Blick auf ein Publikum zu reflektieren, registrierte er zugleich, wie interessant der religiöse Ernst und die neugewählte Einsamkeit ihn für die anderen machten.
Der Wunsch, Priester zu werden, und die Loyalität seinem Vater gegenüber, der entschieden an seinem Lebensplan, der Karriere seines Sohnes, festhielt, führten zu einem zermürbenden Konflikt. Nach einem Nervenzusammenbruch des Jungen sollte eine Kur im Seebad Boulogne-sur-Mer Erholung bringen. Dort erkrankte Adam Liszt. Sein Gallenleiden hatte sich verschlimmert, und am 28. August, im Alter von fünfzig Jahren, starb er. Plötzlich sah sich der fünfzehnjährige Franz Liszt in die Rolle des Erwachsenen gedrängt, der alle Entscheidungen allein zu treffen hatte und die Probleme des praktischen Lebens, in dem er ganz unerfahren war, selbst regeln musste. In Paris fand er mit Hilfe der Familie Erard eine neue Wohnung für sich und seine Mutter, die nun zu ihm zog, und verdiente den Lebensunterhalt mit Klavier- und Theorieunterricht.
Anders als in den Paradestücken, die er mit zwölf und dreizehn Jahren geschrieben hatte, verbindet sich in den 1826 entstandenen Zwölf Etüden ein neuer Ausdruckswille mit der Virtuosität. 48 sollten es ursprünglich werden, ein Zyklus durch alle Dur- und Molltonarten, offenbar nach dem Vorbild der beiden Bände des «Wohltemperierten Klaviers» von Bach. Das allgemeine Interesse an den mechanischen Möglichkeiten der modernen Klaviere führte dazu, dass Etüden hochaktuell waren, neuerdings auch als eigene lyrische Gattung. Liszt behandelte in jeder Etüde ein technisches Problem, zugleich aber skizzierte er Impressionen und Stimmungen. Dass er den Zyklus 1837 und noch einmal 1851 umarbeitete, zeigt, wie wichtig diese Zwölf Etüden ihm waren.[26]
Natürlich wurde Franz Liszt auch als Lehrer umworben. Meist waren es die Töchter reicher Bürger und Aristokraten, denen er Privatstunden gab. Mit siebzehn verliebte er sich in eine seiner Schülerinnen, Caroline de Saint-Cricq, Tochter des französischen Handelsministers. Die Beziehung fand ein jähes Ende, als Saint-Cricq weitere Begegnungen verbot, da seine Tochter standesgemäß, mit dem Grafen Bertrand d’Artigaux, verheiratet werden sollte. Franz Liszt begriff, welcher Abgrund ihn von der Gesellschaftsschicht trennte, zu der er so gern gehört hätte. Trauer über den Verlust, Scham und Empörung stürzten ihn in eine Krise, die fast zwei Jahre anhielt. Er las wieder viel. In Goethes «Werther» und im «René» von François-René de Chateaubriand sah er sein eigenes Unglück, seine Einsamkeit, seinen Weltschmerz wie in einem Spiegel. Er trug nun lange Haare, rauchte, wählte schwarze Kleidung und mied Gesellschaften. Es hielt sich das Gerücht, er sei gestorben; im «Corsaire» erschien ein Nachruf.
Angeregt durch einen seiner Schüler, den gleichaltrigen Pierre Wolff, und geradezu gierig nach Bildung, vertiefte er sich in die französischen Klassiker, in Shakespeare und Byron. Zu seinen Freunden gehörten außer Wolff Chrétien Urhan, Sologeiger an der Grand Opéra, und der Cellist Alexander Batta. Mit ihnen spielte er Kammermusik von Beethoven, oft auch hörte er Urhans Orgelmusik zu. Zeichen eines neuen künstlerischen Ernstes, des Verzichts auf schnellen Beifall, war die Aufführung von Beethovens Es-Dur-Klavierkonzert im November 1828.
Dass er dann doch nicht Priester wurde, lag an der entschiedenen Ablehnung seiner Mutter. Seit sie bei ihm wohnte, hatte er wieder ein Zuhause, sie sorgte für ein wenig Behaglichkeit und kümmerte sich um die Dinge des Alltags. Französisch hatte sie bald nach dem Gehör gelernt. Wenngleich sie an Heimweh litt, beklagte sie sich nie über ihr Leben in der Fremde. Ihre Sorgen um seine Gesundheit, die Kosenamen und die humorvollen «merks», das waren kleine Ermahnungen und Belehrungen in ihren Briefen, sind Zeichen ihrer Zärtlichkeit, die Anrede «Mein liebes Kind» behielt sie immer bei.
Der Kanonendonner der Julirevolution befreite Franz Liszt aus seiner Melancholie und Isolation. Seine Empörung über die Lage der Unterdrückten war aufrichtig, seine Vorstellungen von Volkssouveränität und Menschenrechten eher schwärmerisch. Schnell war ja auch, wie Hector Berlioz bemerkte, «der Traum zu Ende geträumt und die gesellschaftliche Maschinerie wieder im Lot»[27]. Während der Barrikadenkämpfe skizzierte Liszt den Beginn einer Revolutionssymphonie, in der er drei volkstümliche Melodien als Zeichen für die brüderliche Verbundenheit der Völker verarbeiten wollte: ein Hussitenlied aus dem 15. Jahrhundert, den Choral «Ein feste Burg» und die Marseillaise. Zahlreiche Stichwörter auf dem Manuskript deuten an, dass er schon 1830, bevor er die Musik von Berlioz kennengelernt hatte, eine Art Programmsinfonie plante. Noch ganz unerfahren mit dem Komponieren für Orchester, gab er das Werk bald auf.[28]
1830 fanden in Paris drei Tage lang Straßenkämpfe statt. Im Widerstand gegen das absolutistische Regime waren sich Arbeiter, Kleinbürger und Intellektuelle einig; am 29. Juli hatten sie den Sturz Karls X. erreicht. Ihre Forderungen nach demokratischen und sozialen Reformen blieben indes unerfüllt, das soziale Elend nahm noch zu. Der neue König Louis-Philippe steuerte einen reaktionären Kurs und begünstigte das «juste-milieu», das finanzstarke Bürgertum, sodass es bald zu neuen Unruhen, Streiks und Aufständen kam.
Er besuchte nun oft die Versammlungen der Saint-Simonisten. Nach dem Tod des Grafen Henri de Saint-Simon, der einen utopischen Sozialismus vertrat, hatten seine Anhänger eine Art Sekte gegründet, die seine Gedanken über eine umfassende Reform der Gesellschaft nach christlichen Grundsätzen zu verwirklichen suchte, und zwar in einer neuen Kirche mit einem eigenen Papst. Zu den Vorträgen und Predigten der Saint-Simonisten kamen viele, die von der Revolution enttäuscht waren, auch bekannte Künstler und Intellektuelle wie Heinrich Heine, Eugène Delacroix, der Kritiker Charles Augustin Sainte-Beuve, George Sand und Berlioz. Was Liszt geradezu begeisterte, war die Forderung nach einer herausgehobenen, geadelten Stellung des Künstlers: Lehrer der Menschheit sollte er sein. Von der Kunst und der Religion erwarteten die Saint-Simonisten eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft. Ernüchternd war das schnelle Scheitern der Bewegung, es kam zu finanziellen Unregelmäßigkeiten und grotesken Auswüchsen. Später, wenn gelegentlich die Rede auf die Saint-Simonisten kam, distanzierte sich Liszt verlegen.