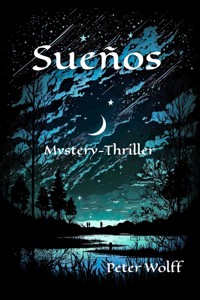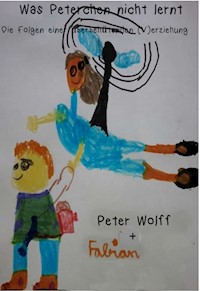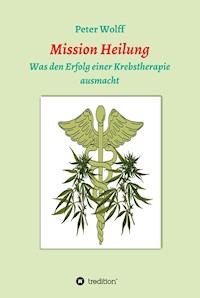18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Clara Wolff tut seltsame Dinge: Unverhofft steht sie im Garten ihres Sohnes und weiß nicht, wie sie hergekommen ist. Ehemals treusorgende Ehefrau, fängt sie an, Haushalt und Gatten zu vernachlässigen. Was ist nur los mit Frau Wolff? Alzheimer? Ein Wechselbad der Gefühle erleben Clara Wolff und ihre Familie, bis die Diagnose steht: Lewy-Body-Demenz. Über Phasen der Bagatellisierung, des Unverständnisses, der Wut und Trauer gelingt es allen schließlich, die Krankheit zu akzeptieren. Denn Clara Wolff bleibt in ihrer neuen Welt die alte: unternehmungslustig und liebenswert. Peter Wolff macht mit der lebendigen Geschichte seiner Mutter Angehörigen von Menschen mit Demenz Mut, das Unabänderliche anzunehmen und schöne, ja auch komische Momente gemeinsam fröhlich zu genießen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Peter Wolff, Köln, war als Betriebswirt tätig. Seine Leidenschaft fürs Schreiben entdeckte er als freier Mitarbeiter bei der „Kölnischen Rundschau“ und beim „Kicker Sportmagazin“.
Hinweis: Soweit in diesem Werk eine Dosierung, Applikation oder Behandlungsweise erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass die Autoren große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen oder sonstige Behandlungsempfehlungen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. – Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnungen nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-497-02897-9 (Print)
ISBN 978-3-497-61254-3 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-497-61255-0 (EPUB)
© 2019 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München,unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EU
Covermotiv: © by-studio / ArtushFoto / Fotolia; © iStock.com / tomap49 / mingman
Satz: JÖRG KALIES – Satz, Layout, Grafik & Druck, Unterumbach
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
Unerwarteter Besuch
Ein Grab schweigt nicht länger
Stürze ins Vergessen
Krankenhaus-Hopping
Gefangen unter Freunden
Basteln und Malen auf Rezept
Lewy – was?
Der Phantomhund
Einbrecher und Einkaufsengpässe
Schmalhans im Reich der Spitzenköchin
Der Finder
Die Demenz-Zweckgemeinschaft – ein Interaktionsmodell in sechs Phasen
Kaschieren, verbergen, verheimlichen und verschweigen
Demenz für jedermann
Irrgarten im Kopf
Den Faden verwickelt
Schmetterlinge und Eifersuchtsdramen
Clara ruft an
Helfende Hände
Zittern und Bangen
Vom Sündenbock zum Politiktalent
Emotionen auf der Flucht
Für immer verloren
Die Titelheldin
Danksagung
Literatur
Sachregister
Vorwort
Demenz – kaum eine andere Diagnose erschüttert den Menschen so sehr wie diese Erkrankung.
In Deutschland registriert man jährlich circa 300.000 Neuerkrankungen, die Gesamtzahl der Personen mit Demenz in unserem Lande liegt zurzeit bei 1,7 Millionen.
Für das Jahr 2050 werden knapp 3 Millionen demenzkranke Bundesbürger erwartet.
Weltweit leiden nach Schätzungen von Alzheimer‘s Disease International etwa 47 Millionen Menschen an der tückischen Krankheit, jedes Jahr kommen rund 7,7 Millionen Neuerkrankungen hinzu (DAlzG o.J.).
Der Sammelbegriff Demenz beschreibt chronische Erkrankungen des Gehirns, die mit einem schleichenden Verfall kognitiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten zusammenfallen. Demenz-Patienten leiden insbesondere unter Störungen des Kurzzeitgedächtnisses und einer damit einhergehenden erhöhten Vergesslichkeit, die im weiteren Krankheitsverlauf sogar zum Verlust der Sprach- und Rechenfähigkeiten führen kann.
Zudem lassen die körperlichen Fähigkeiten rasch nach: von motorischen Komplikationen über mangelnde Bewegungskompetenz bis hin zum völligen Verlust der Mobilität.
Auch zeitliche wie räumliche Desorientierung ist häufig mit der Krankheit verbunden – die Folge ist Pflegebedürftigkeit.
Demenz tritt in meisten Fällen erst ab dem sechzigsten Lebensjahr auf, Frauen sind genetisch bedingt signifikant höher betroffen als Männer (Statista 2019).
Die häufigste Form der Demenz ist die Alzheimer-Krankheit, die weltweit gut sechzig Prozent der Demenzfälle ausmacht, gefolgt von Mischformen (ca. 15%), der vaskulären Demenz (ca. 10–20%) und der Lewy-Körper-Demenz (10–20%) (www.therapie.de/psyche/info/index/diagnose/demenz/formen-der-demenz, 4.6.2019).
Sollte Sie gerade das Gefühl beschleichen, dass Sie mit diesen Ausführungen und Zahlen nur wenig anfangen können, dass sie Sie nur am Rande interessieren und kaum emotional berühren – mir ging es genauso.
Sitzt man beim Arzt im Wartezimmer und vertreibt sich die Zeit mangels Alternativen damit, die bunt auf dem Tisch verstreut liegenden Illustrierten zu überfliegen, kommt man am Thema Demenz nicht vorbei. Kaum eine Zeitschrift, in der man nicht davon unterrichtet würde, dass einem prominenten Mitbürger aus Unterhaltung, Sport oder Politik die tragische Diagnose „Demenz“ gestellt wurde.
Aber selbst diese Artikel liest man meist nur oberflächlich, vielleicht die Überschrift. Wer ist der oder die Bemitleidenswerte? Mehr interessiert in der Regel jedoch nicht, zu fern ist das Thema, wenn nicht im Familien- oder engeren Freundeskreis Fälle von Demenzerkrankungen auftreten.
Demenz war auch kein Thema, das in meinem Leben in irgendeiner Form präsent war, und ich hätte kaum erklären können, worum es sich bei dieser Krankheit überhaupt genau handelt.
Unsere Familie hatte äußerst selten mit Krankheiten zu tun, kaum einmal mit „kleineren“ und schon gar nicht mit den „großen Krankheiten“ unserer Zeit – bis zum Herbst 2014.
Erkrankt ein Elternteil an Demenz, ist das Leben fortan nicht mehr das, was es früher einmal war – weder für den Betroffenen Menschen selbst, noch für die Angehörigen.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer der „Einstieg“ ins Leben als Angehöriger eines an Demenz erkrankten Menschen fällt, wenn man das erste Mal mit den Symptomen der Krankheit konfrontiert wird.
Wie schwierig es ist, den geistigen wie körperlichen Verfall eines geliebten Menschen nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu begleiten.
Als ich im Frühling 2018 beim Abendessen einmal mehr von einer abstrusen Geschichte erzählte, die ich im Laufe des Tages mit meiner Mutter erlebt hatte, entgegnete mir meine Lebensgefährtin Ewa, „Schreib‘ ein Buch“ – und irgendwie sagte mir mein Bauchgefühl in dem Moment, in dem diese drei Worte ausgesprochen wurden, dass ich genau dies tun sollte.
Ein Buch, in dem der Verlauf der Krankheit auch aus der Sicht des Betroffenen geschildert wird und die Erkrankte selbst über ihren Zustand berichtet.
Wie und was denkt man?
Wie fühlt es sich an, wenn das eigene Leben einem zunehmend aus den Händen gleitet?
Was lässt einen verzweifeln?
Was lässt einen hoffen?
Wie jede chronische Erkrankung verläuft auch die Demenz individuell verschieden, und doch sind gewisse Entwicklungen und Tendenzen der erkrankten Personen zumindest ähnlich, wenn nicht gar gleich.
Somit schreibe ich dieses Buch nicht nur, um meiner Seele Erleichterung zu verschaffen, sondern auch, um betroffenen Angehörigen ein besseres Verständnis von dementiellen Erkrankungen zu vermitteln.
Meine Intention ist es, meine Leserinnen und Leser auf etwas vorzubereiten, mit dem sich viele von ihnen in der zweiten Lebenshälfte konfrontiert sehen werden: die Frage nach dem Umgang mit einem an Demenz erkrankten Angehörigen.
Und ich möchte Hoffnung machen: Fraglos leben Demenzerkrankte mit zunehmenden geistigen wie körperlichen Einschränkungen, aber diese können durchaus erträglich sein.
Begleiten Sie mich nun auf einer faszinierenden Reise durch die Welt der Lewy-Körper-Demenz, im Rahmen derer die Erlebniswelt eines an Demenz erkrankten Menschen nicht nur von einer außenstehenden Person dargestellt, sondern auch von der Erkrankten selbst beschrieben wird.
Mit Ausnahme der Familienangehörigen wurden dabei Namen von Personen aus ihrem Umfeld aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geändert.
Und noch eine weitere kleine Anmerkung in eigener Sache: Die detaillierte Schilderung einiger Details aus dem „neuen Leben“ meiner Mutter mag durchaus ein wenig befremdlich bei den Leserinnen und Lesern ankommen.
Vielleicht mag der eine oder die andere den Eindruck bekommen, ich würde meine Mutter bloßstellen, ihr Andenken an die Person, die sie vor dem Ausbruch der Krankheit einmal war, verunglimpfen oder aber ihrer Krankheit nicht den nötigen Respekt entgegenbringen. Nichts von alledem trifft zu.
Es ist nun einmal so, dass der Verlauf der Krankheit dazu führt, dass unweigerlich absurde, kaum nachvollziehbare Situationen entstehen, die einem manchmal ein melancholisches Lächeln entlocken, ab und an jedoch auch zu schallendem Gelächter führen können.
Und ich habe gelernt, dass Humor durchaus dazu beiträgt, das Leben von Betroffenen wie Angehörigen in der für beide Seiten fatalen Situation des Umgangs mit der Krankheit und im alltäglichen Miteinander ein wenig erträglicher zu gestalten.
Ich war sorgsam darauf bedacht, die Ausfälle meiner Mutter nicht ins Lächerliche zu ziehen, wohl wissend, dass es durchaus im Sinne meiner Mutter ist und, viel wichtiger noch, auch vor dem Ausbruch der Krankheit gewesen wäre, der Krankheit, wo immer es eben möglich ist, mit Humor zu begegnen.
Ich betrachte den bisweilen humorvollen Umgang mit der Krankheit als eine, ja, als die für beide Seiten beste Art und Weise, das Leben des oder der Betroffenen wie der Angehörigen ein wenig angenehmer zu gestalten – zutiefst traurige Momente erlebt man infolge der Demenzerkrankung ohnehin mehr als genug.
Köln, im Mai 2019 Peter Wolff
Unerwarteter Besuch
Ein Freitag im Frühjahr 2018, endlich hat der lange und für unsere Breitengrade harte Winter seinen Rückzug angetreten. Der Duft des Frühlings liegt in der Luft, die Pflanzen erwachen zum Leben, das Wetter lädt dazu ein, die ersten wärmenden Sonnenstrahlen zu genießen.
Seit Stunden bin ich bereits mit anhaltender Begeisterung im Garten aktiv, viel zu lange hat die dunkle Jahreszeit ihr Recht gefordert.
Es ist schon früher Abend, die Zeit vergeht, wie immer dann, wenn man mit Enthusiasmus am Werk ist, wenn man völlig in seiner Arbeit versunken ist, wie im Fluge.
Ich muss mich zügeln, würde mich gern noch eine Zeit lang weiter Rasen, Pflanzen und Unkraut widmen, doch habe ich geplant, meine Lebensgefährtin des Abends zum Essen auszuführen. Und so bin ich gerade dabei, die Gartenutensilien in den Geräteschuppen zu räumen, als ich vor dem Gartentor jemanden erblicke: Meine Mutter steht wortlos, mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht, vor unserem Garten.
„Was machst du denn hier? Und vor allem: Wie kommst du hier hin?“
„Wir hatten eine Veranstaltung auf der zweiten Etage. Als die vorbei war, bin ich die Treppe runter und dann bin ich losgelaufen“
„Du bist den ganzen Weg gelaufen?“
„Nein, zwischendurch auch mal ein bisschen mit der Bahn, aber mehr gelaufen“
„An welcher Station bist du denn ausgestiegen?“
„Ich bin gelaufen“
„Ja, aber du sagtest doch,du bist auch mit der Bahn gefahren“
„Das stimmt ja auch“
„Von der Berliner Straße? Und bis wohin?
„Ein kleines Stückchen nur. Bis wo weiß ich nicht mehr“
„Und warum hast du nicht vorher angerufen?“
„Ich wollte doch gar nicht zu euch laufen, aber auf einmal stand ich vor eurem Haus und dachte, dann kann ich auch reingehen“.
„Es ist schon fast sechs, ihr bekommt doch gleich Abendessen im Heim.“
„So spät ist es? Mein Gott, was war ich lange unterwegs!“
„Wo warst du denn die ganze Zeit?“
„Wieso die ganze Zeit? So lange war das doch nicht.“
„Na, dann komm‘ mal rein.“
Ich öffne das Gartentor und mein Hund kommt freudig wedelnd angerannt, um meine Mutter zu begrüßen, während ich versuche, den unerwarteten Besuch gedanklich zu verarbeiten.
Meine Eltern sind seit einem Dreivierteljahr in einem Pflegeheim untergebracht. Während mein Vater diese letzte Lebensphase wohl nie akzeptieren wird, ist meine Mutter durchaus „angekommen“ im Heim, sie fühlt sich wohl dort, es ist ihr neues Zuhause. Umso mehr verwundert es mich, dass sie den Nachmittag nicht wie sonst im Kreise ihrer neuen „Freunde“, wie sie die Mitbewohner liebevoll nennt, verbringt, sondern sich völlig unerwartet zu uns auf den Weg gemacht hat.
Was hat sie wohl veranlasst, fortzulaufen?
Wo ist sie die ganze Zeit gewesen?
Wie hat sie es geschafft, vor unserem Haus anzukommen?
In Gedanken versunken bekomme ich kaum mit, dass meine Lebensgefährtin auf der Terrasse im ersten Stock erschienen ist und mir aufgeregt zuruft: „Das Heim hat angerufen. Deine Mutter ist weg!“
Es ist 18:00 Uhr, Abendessen-Zeit. Natürlich fällt es unmittelbar auf, wenn ein Platz am Gemeinschaftstisch leer bleibt.
Insbesondere, wenn es meine Mutter ist, die fehlt. Sie hat sich in den letzten Monaten ein wenig als Mittelpunkt der Gemeinschaft etabliert.
Frau Wolff redet am meisten, sie lacht am meisten, sie fällt am meisten auf. Und sie ist körperlich bei weitem die fitteste unter den Bewohnern – durchaus in der Lage, noch eigenständig größere Exkursionen, auch außerhalb des Pflegeheims, in Angriff zu nehmen.
„Sie ist hier. Gerade angekommen“, rufe ich nach oben auf die Terrasse. „Ruf‘ bitte direkt das Heim an und sag‘ Bescheid.“ Nachdem sie dies getan hat, gesellt sich Ewa zu uns in den Garten.
„Was machst du denn hier? Im Heim haben sie sich große Sorgen gemacht“
„Warum?“
„Na, weil keiner wusste, wo du warst.“
„Ich muss doch nicht jedem sagen, wo ich bin.“
„Nein, natürlich nicht, aber wenn du raus aus dem Heim gehst, sollst du doch Bescheid sagen.“
„Ich wusste doch zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass ich rausgehe.“
„Und sie hatten Angst, es könnte dir was passieren.“
„Was soll mir denn passieren? Ich bin doch kein kleines Kind. Ich werde doch wohl mal vor die Tür gehen und meinen Sohn besuchen können!“
„Ja, sicher.“ Ewa gibt es auf.
Meine Mutter hatte uns noch im letzten Frühling regelmäßig bei der Gartenarbeit unterstützt. Als ihre Demenzerkrankung fortschritt, hatten wir ihr entsprechend körperlich leichtere wie einfachere Aufgaben gegeben, die sie mit großer Begeisterung erledigte.
Und so schreitet sie voller Elan zum Geräteschuppen, um sich ihrer bevorzugten Gartenwerkzeuge zu bedienen.
„Es ist doch schon sechs Uhr, wir können doch auch morgen im Garten arbeiten“, sagt Ewa.
„So spät ist es schon? Dann muss ich zurück, die vermissen mich bestimmt schon.“
Das Pflegeheim, in dem meine beiden Elternteile – gleicher Flur, verschiedene Zimmer – untergebracht sind, ist nur fünf Autominuten entfernt, sodass Clara, leicht verspätet, doch noch zu ihrem wohlverdienten Abendbrot kommt.
Wir betreten das Pflegeheim gegen Viertel nach sechs.
Nach rechts geht es zum Essensbereich, nach links zum Zimmer von Frau Wolff.
Sie möchte sich noch die Hände waschen, also wählen wir den Weg zur Linken.
Wie eine Königin schreitet sie über den Flur. Mimik und Körpersprache verraten Genugtuung, verdeutlichen ihren Stolz auf das, was sie am Nachmittag geleistet hat.
Ein Pflegerin kreuzt unseren Weg: „Frau Wolff, wo waren Sie denn? Wir haben uns große Sorgen gemacht!“
„Ich wollte meinen Sohn besuchen.“
Die Tür ihrer Zimmernachbarin steht offen.
„Wie haben Sie das denn geschafft?“, fragt sie.
„Ich bin gelaufen!“
Clara platzt fast vor Stolz, als sie sich, die Hände frisch gewaschen, zum gemeinschaftlichen Essenstisch begibt.
„Frau Wolff, Sie machen Sachen“, begrüßt sie die Köchin des Heimes.
„Ja, ja ... einer muss sie ja machen“, entgegnet meine Mutter strahlend.
Ein Grab schweigt nicht länger
„Ich kann schweigen wie ein Grab. Mir könnte man einen Mord beichten – ich würde niemals etwas verraten“.
Einer der Leitsätze meiner Mutter Clara, der immer dann postuliert und auch gelebt wurde, wenn ihr wieder einmal jemand aus Familie oder Nachbarschaft seine kleinen, bisweilen auch größeren Probleme offenbart hatte, sie jedoch einen Teufel tun würde, dieselben mit ihren Mitmenschen zu teilen.
Meine Mutter hat dieses „pastorale Etwas“, wie ich es gern nenne. Sie vermittelt ihren Mitmenschen wohl regelmäßig das Gefühl, dass man ihr alles erzählen, sich bei ihr ausweinen kann, bei ihr Verständnis findet.
Zudem war sie immer und für jeden da, der Inbegriff der Hilfsbereitschaft, insbesondere, aber nicht nur, was Familie und Nachbarschaft betraf.
Dies galt beileibe nicht nur für Alltagsprobleme und kleinere Gefälligkeiten, sondern auch dann, wenn existenzielle Aspekte des menschlichen Daseins betroffen waren.
So begleitete sie in dem Haus, in dem sie fünfzig Jahre ihres Lebens mit meinem Vater verbrachte, mehrere Nachbarn in den Tod, wenn die Angehörigen sich dazu nicht, oder zumindest nicht allein, in der Lage sahen.
Sie kümmerte sich um ehemalige Kollegen meines Vaters, wenn diese gesundheitliche Probleme hatten, hat so manche Zweierbeziehung im Umfeld gerettet oder zu retten versucht, half meinen Freunden und Freundinnen, wo immer sie konnte, und versorgte die Berber im nahe gelegenen Stadtwald des Öfteren mit Speis‘ und Trank.
Auf Frau Wolff kann man zählen. Jeder. Immer. Auch, weil sie mit 71 Jahren nur so vor Kraft, Vitalität und Tatendrang strotzt.
So ist es sowohl für sie als auch für mich beinahe selbstverständlich, dass sie mich tatkräftig unterstützt, als sich mein Leben im Frühjahr 2014 radikal verändert.
Ich wohne im äußersten Kölner Westen, muss meine Wohnung in einem alten Zweifamilienhaus aufgrund eines Vermieterwechsels jedoch aufgeben. Noch habe ich keine neue Bleibe gefunden, so dass ich beschließe, einen Großteil meiner Möbel zu verkaufen und die Teile, an denen ich besonders Gefallen gefunden habe, in einem Lager zu deponieren.
Ich habe Clara gebeten, frühmorgens vorbeizukommen, da ich die komplette Küche verkauft habe und diese für den Abbau durch den Käufer vorbereiten will. Wie immer ist Clara eine tatkräftige Unterstützung. Pünktlich sehe ich den Kleintransporter des Käufers vorfahren, zwei Männer und eine Frau steigen aus, ich öffne die Tür und gewähre den Herrschaften Einlass. Als wir gemeinsam die Küche betreten, begrüßt meine Mutter jeden der drei mit Handschlag und legt los: „Und sie sind jetzt die neuen Mieter?! Das ist ja nicht alles hier oben. Hier lebt man ja wie in einem Haus, es geht ja noch die Treppe runter und im Keller sind ja auch noch zwei Räume. Und dann der schöne Garten – herrlich“.
Blicke wandern zwischen den neuen Besitzern meiner Küche und mir hin und her, ich bin irritiert. Was war das denn?
Als nach einer guten Stunde die Küche leer, der Kleintransporter der Käufer dafür voll beladen ist, spreche ich Clara auf ihren Monolog an.
„Was hast du denn da erzählt? Du wusstest doch, dass die Leute kommen, um die Küche abzuholen.“ – „Dann habe ich mich halt vertan. Ich dachte eben, das wären die neuen Mieter“. Punkt.
Damit ist das Thema Küche erledigt, wir begeben uns in den großen Garten, um dort unser Tageswerk fortzusetzen.
Als wir die Pflanzen, welche ich im Garten meiner Eltern „zwischenlagern“ und dann möglichst bald im Garten des neuen Heims wieder einpflanzen möchte, ausgraben, scheint meine Mutter ein wenig verwirrt zu sein. Sie kennt sich recht gut mit Pflanzen aus und hat zudem eine sehr gute Auffassungsgabe. Diesmal jedoch tut sie sich schwer damit, zu behalten, welche Pflanzen sie ausgraben soll. Sie spaziert hin und her zwischen Pflanzkübeln und Randbeet, wirkt äußerst unsicher und fragt immer wieder nach, was denn nun konkret zu tun sei. Darüber hinaus wirken ihre Bewegungen anders als sonst, sie „schleicht“ förmlich durch den Garten, bisweilen eher unkoordiniert, und scheint „wacklige Beine“ zu haben.
So habe ich Clara noch nie erlebt.
Als sie zwischen zwei Pflanzen hin und her geht, gerät sie ins Stolpern, fällt auf einen der Pflanzenkübel und zerbricht diesen. Sie ist untröstlich. Und ich zunehmend verwirrt. Was ist nur los mit meiner Mutter?
Im Nachbargarten wird gleichfalls gearbeitet.
Als wir uns eine kleine Pause gönnen und ich mich auf die Parkbank im Garten setze, geht Mutter unvermittelt zum Gartenzaun und begrüßt das Familienoberhaupt der Nachbarfamilie.
Schnell entwickelt sich ein Gespräch. Ich höre Clara sagen: „Mein Sohn hat sich von seiner Lebensgefährtin getrennt. Er hat auch schon eine Neue. Die wollte mit ihm hier einziehen, aber der neue Vermieter will das nicht. Darum sucht mein Sohn jetzt etwas anderes. Aber das ist gar nicht so einfach. Auch wegen der Krankheit. Und es muss ja auch etwas mit Garten sein wegen dem Hund.“
Ich bin völlig perplex. Einen Mord würde sie für sich behalten, aber intimste Einzelheiten meines Privatlebens gibt sie ungefragt preis. So kenne ich Clara gar nicht. Wie kann das sein?
Trotzdem: Nach ein paar Tagen mache ich mir keine Gedanken mehr über das auffallende Verhalten meiner Mutter. Ich habe zu dieser Zeit viel im Kopf, bin wie aus dem Nichts ernsthaft erkrankt, habe noch kein neues Zuhause gefunden und muss den Wechsel der Lebenspartnerin verarbeiten, hinter dem ich zwar vollends stehe, der mich aber trotzdem sehr beschäftigt.
So schenke ich den seltsamen Eingebungen meiner Mutter im Rahmen meines Auszugs keine sonderliche Beachtung mehr und tue sie damit ab, dass sie womöglich einen schlechten Tag, vielleicht schlecht geschlafen oder am Abend vorher ein Gläschen Wein zu viel getrunken hat.
Einige Wochen später jedoch holen mich die Begebenheiten in Küche und Garten wieder ein: Nachdem ich meinen heiß und innig geliebten Labrador-Rüden Carlos hatte einschläfern lassen müssen, habe ich einen neuen Hund aufgenommen. Es ist an der Zeit, die Begleithundprüfung mit dem neuen Familienmitglied zu absolvieren. Meine Mutter überrascht mich, als sie mir mitteilt, dass sie gern dazukommen würde. Ich kann sie jedoch davon überzeugen, dass es für den Hund besser ist, nur eine Bezugsperson dabei zu haben und darüber hinaus die Prüferin ja nun einmal sehen will, wie ICH mit dem Tier umgehe und ob er MIR gehorcht. Sie sieht das ein – denke ich.
Am nächsten Morgen betrete ich das Gelände, auf dem die Prüfung stattfinden soll. Ich sehe mehrere Hundehalter mit ihren Lieblingen umher spazieren und – meine Mutter. Sie läuft kreuz und quer über den vorbereiteten Parcours, guckt mal hier und mal da und nimmt mich anfangs gar nicht wahr.
Erst als die Prüferin bereits zu mir gekommen ist und wir uns ein wenig unterhalten haben, gesellt sich meine Mutter zu uns.
Die Prüfung kann beginnen. Allerdings mit Hindernissen, weil Clara unaufhörlich redet, diese und jene lustige Anekdote über Hunde als solche – und meinen neuen Hund Cielo im speziellen – zum Besten gibt und uns auf Schritt und Tritt folgt.
Höchst ungewöhnlich, sagt mir mein Bauchgefühl. Normalerweise hält sich meine Mutter in solchen Situationen diskret zurück, vor allem dann, wenn sie bestenfalls als Randfigur eine Rolle spielt.
So verläuft die Begleithundprüfung etwas holprig, letztendlich aber dennoch erfolgreich. Ich schüttele der Prüferin die Hand, bedanke und verabschiede mich.
Gleiches tut meine Mutter, begleitet von einem kräftigen „Und wann sehen wir uns wieder?“
Die Prüferin schaut mich entgeistert an, ich versuche, die Situation zu retten: „Na, so nett die Dame auch ist, zum Glück muss die Prüfung nicht wiederholt werden.“
Wir lachen alle drei, obwohl mir eigentlich gar nicht zum Lachen zumute ist.
Irgendetwas stimmt nicht. Irgendeine Erklärung für das Verhalten meiner Mutter muss es geben. Sie wäre früher kaum auf die Idee gekommen, entgegen unserer Absprache einfach irgendwo aufzutauchen. Sie hätte sicher nicht während der Hundeprüfung solch ein wirres Zeug erzählt.
Vielleicht sollte man mit ihr zum Arzt gehen? Aber warum? Sie erzählte ein bisschen viel und war nicht mehr ganz so fit, wie ich sie kannte.
Daran, dass das Verhalten meiner Mutter ein erstes Anzeichen für eine schwere Erkrankung sein könnte, verschwende ich keinen Gedanken.
Warum soll ich auch – ist sie doch zeitlebens ein Inbegriff von Vitalität, Energie, Optimismus und Lebensfreude gewesen.
Erst viel später fällt mir ein, dass mein Vater in dieser Zeit ab und an, Tendenz zunehmend, von ihm befremdlich vorkommenden Begebnissen im Haushalt meiner Eltern berichtet.
Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen: Mein Vater ist Jahrgang 1921, wuchs also in einer Zeit auf, in der die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau noch eindeutig definiert war. „Der Mann geht tagsüber mit seiner Keule auf die Jagd und die Familie sitzt in der Höhle und wartet“ (Zitat aus dem herrlichen Loriot-Film „Pappa ante portas“ von 1991). Mutter fügte sich nicht nur in diese Rolle, sie lebte sie.
Mein Vater liebte seine Arbeit. Er war ein bekannter Sportjournalist, mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, der Ehrenurkunde der Stadt Köln und der Ehrenmitgliedschaft des Bundes Deutscher Sportpresse.
Seine Arbeit war sein Hobby, seine Berufung, in die er sich mit vollem Einsatz und oft auch darüber hinaus einbrachte.
Er schwang seine Keule somit durchaus erfolgreich und erfüllte seine Pflicht als Familienoberhaupt. Allerdings sah er sein Aufgabenfeld im familiären Zusammenleben auf eben diese tägliche Jagd begrenzt. Sich am Feierabend oder den Wochenenden anderweitig produktiv im Haushalt oder in außerberuflichen Alltagstätigkeiten einzubringen, kam ihm nicht in den Sinn, die über den Beruf hinausgehenden „klassischen Aufgaben“ des Mannes nahm er kaum wahr.
Mein Vater hat noch nie eine Bank von innen gesehen, er weiß wahrscheinlich nicht einmal, dass man mittels EC-Karte Geld abheben kann.
Ebenso wenig hat er sich um Geldanlagen, das Abschließen oder Kündigen von Versicherungen oder sämtliche Tätigkeiten rund um das Familienauto gekümmert. Er hat nie einen Urlaub selbst geplant oder gebucht, hat bestenfalls Vermutungen darüber, wie man eine warme Mahlzeit zubereitet und kann keinen Dübel von einer Heftzwecke unterscheiden. Hätte man ihm aufgetragen, doch bitte den Hausmüll in die im Garten befindliche Mülltonne zu befördern – er hätte wahrscheinlich nicht einmal gewusst, wo selbige sich befindet.
Mag der eine oder andere – vor allem männliche – Leser all‘ das ähnlich wie mein Vater noch als selbstverständlich erachten: Die Fürsorge meiner Mutter ging aber noch weit darüber hinaus.
Weil mein Vater sich partout weigerte, einen Herrenausstatter oder aber ein Schuhgeschäft aufzusuchen, marschierte meine Mutter los, kaufte vier bis fünf Hosen oder drei Paar Schuhe und brachte Tage später die, die meinem Vater nicht passten oder gefielen, in die jeweiligen Geschäfte zurück. Zu Hause wurde dann jeden Abend das Outfit für den nächsten Tag frisch gebügelt parat gelegt: „Hast du mir was zum Anziehen rausgesucht?“ Meine Mutter reparierte, tapezierte, schleppte schwerste Einkäufe auf die vierte Etage und den Hausmüll aus derselben in die Mülltonnen, befindlich im nur durch einen großen Keller erreichbaren Garten.
Meine Mutter kümmerte sich um ALLES. Meine Mutter funktionierte – und sie funktionierte nahezu perfekt. So war es wenig verwunderlich, dass meinem Vater die ersten Nachlässigkeiten in ihrem täglichen Schaffen schnell auffielen.
Wenn ich meine Eltern besuchte, begann dieser Besuch regelmäßig mit den Standardfragen – „Wie geht’s? Was gibt’s Neues?“ – denen ich in Erwartung der Standardantworten – „Soweit ganz gut,nichts Besonderes“ – oft schon in dem Moment, in dem ich sie formuliert hatte, keine Beachtung mehr schenkte.
Im Frühjahr 2014 jedoch änderte sich dies, zunächst jedoch nur sehr zögerlich.
Mein Vater berichtete mir ab und an von Kleinigkeiten des häuslichen Zusammenlebens, die ihn ein wenig störten: „Ich habe heute kein warmes Essen bekommen.“ – „Wir haben keine Butter mehr“ – „Es ist kein Geld im Haus“.
Ich bin keinesfalls beunruhigt, im Gegenteil, eher bin ich erleichtert, weil ich hoffe, dass meine Mutter endlich zu der Einsicht gelangt ist, dass sie nicht alles und jedes im Haushalt machen muss und sich durchaus auch einmal Auszeiten, ab und an Zeit für sich selbst, nehmen kann.
Wie oft habe ich ihr bereits gesagt, dass sie genau dies tun solle.
Was mich überrascht, ist einzig und allein die Tatsache, dass ich ihr im mittlerweile reifen Alter von siebzig Jahren diese entscheidende Wandlung nie und nimmer mehr zugetraut hätte.
Ich freue mich für sie – wie wenig ich doch wusste.
Die ersten Anzeichen für eine beginnende demenzielle Erkrankung – sie waren da, aber weder ich noch das familiäre Umfeld waren sensibilisiert genug, sie zu erkennen.
Mit der Zeit werden die Ausfälle meiner Mutter im Haushalt meiner Eltern immer deutlicher, die Klagen meines Vaters häufen sich: „Sie hat schon wieder den Schlüssel verlegt“ – „Die läuft zwei bis dreimal am Tag zum Discounter, weil sie was vergessen hat“ – „Der Fernseher läuft nicht, sie hat da irgendwas umgesteckt“.
Habe ich die ersten Bemerkungen meines Vaters noch als Bagatellen abgetan – nun ist es an der Zeit, meine Mutter auf die Vorfälle anzusprechen. Zu meiner Überraschung reagiert sie ganz gelassen, es scheint ihr keinesfalls in irgendeiner Form unangenehm zu sein, auf gewisse Versäumnisse im ehelichen Haushalt angesprochen zu werden.
„Ich kann das schon alles noch. Ich habe nur manchmal einfach keine Lust dazu, diese Sachen zu machen“ und: „Wenn der dauernd an mir rummeckert, mach‘ ich gar nichts mehr“, höre ich sie sagen.
Durchaus nachvollziehbar, denke ich bei mir, und fühle mich zunächst ein wenig erleichtert darüber, dass meine Mutter plausible Gründe für ihr verändertes Verhalten artikuliert. Und nochmal: Es wäre sicherlich gut für sie, wenn sie sich von ihren häuslichen Pflichten ab und an ein wenig distanziert und auch einmal ihren eigenen Bedürfnissen Beachtung schenkt. Trotzdem passt es so ganz und gar nicht zu ihrem Wesen, ihren Haushalt und noch viel mehr ihren Ehemann zu vernachlässigen.
Erste unangenehme, noch völlig vage und schwammige Ahnungen ergreifen Besitz von mir. Leider sollten sich diese in den nächsten Wochen und Monaten konkretisieren und mit Vehemenz bestätigen.
Stürze ins Vergessen
Meine Mutter ist ein regelrechtes „Energiebündel“, voller Elan und Temperament. Ein Mensch des Handelns. Einfach einmal einen Tag nur herumsitzen und der Erholung widmen – für sie undenkbar. Frau Wolff ist stets in Bewegung, von morgens bis abends aktiv.
Ihr Körper dankt es ihr. Kaum einmal ist sie auch nur leicht erkrankt, von schwereren gesundheitlichen Problemen bleibt sie vollends verschont.
Sicher, sie hat zeitlebens einen niedrigen Blutdruck. Beim ruckartigen Aufstehen wird es ihr deshalb oft schwindlig, bei mir ist das in abgeschwächter Form ähnlich.
Aber das ist es auch schon, was ich über das Thema „meine Mutter und Krankheiten“ zu berichten weiß.
Ich habe mich für den Abend bei meinen Eltern zum Besuch angemeldet. Als meine Mutter die Wohnungstür öffnet, erschrecke ich. Sie trägt einen dicken Verband um den Kopf, durch den leicht geronnenes Blut schimmert.
„Was ist denn passiert?“, frage ich besorgt.
„Ich bin umgekippt ...“
„Wie – umgekippt? Wo denn?“
„Hier in der Wohnung.“
„Und wann?“
„Mitten in der Nacht.“
„Bist du ausgerutscht?“
„Nein. Einfach umgekippt.“
„Ja, und dann?“
„Dann lag ich da.“
„Und wer hat dich aufgehoben?“
„Keiner. Nach einer Zeit bin ich wieder aufgestanden.“
„Und wer hat dich verbunden?“
„Ich bin dann ins Krankenhaus marschiert.“ (Es liegt ca. 300 Meter entfernt.)
„Alleine?“
„Ja.“
In den Folgetagen ist Clara ein wenig durcheinander, vergisst hier und da eine Kleinigkeit, redet ab und an absonderlich und macht kleinere Fehler in der Hausarbeit.
Das kann schon vorkommen, wenn man so heftig wie sie auf den Kopf fällt, denke ich mir.
Der Vorfall in der elterlichen Wohnung kann nicht aufgeklärt werden, ich habe ihn bald schon fast vergessen. Vielleicht ist meine Mutter einfach ausgerutscht, dann auf die Bettkante gefallen und war kurz bewusstlos. Ja, so muss es gewesen sein.
Einige Wochen später jedoch holt mich das Geschehene unvermittelt wieder ein.
„Das war komisch heute Nacht ...“
„Was?“
„Ich bin um sechs Uhr in der Küche wach geworden. Ich lag da auf dem Boden.“
„Du hast dich in die Küche gelegt? Warum das denn?“