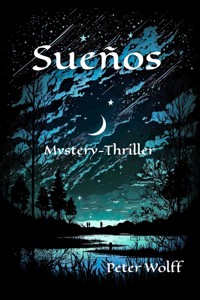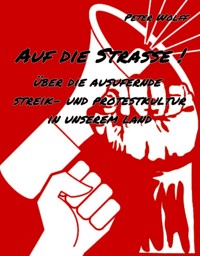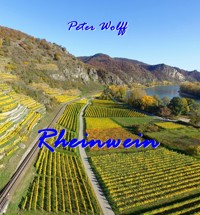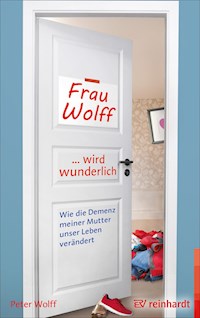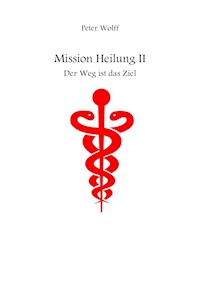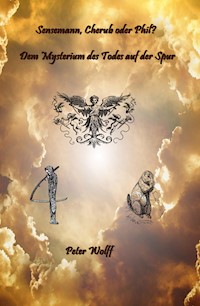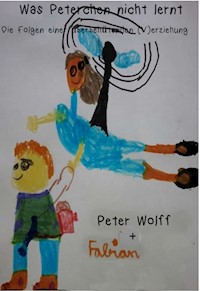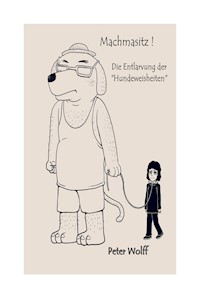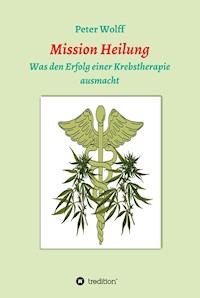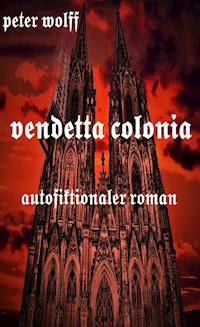
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Köln in der Nachkriegszeit. Werner Schmitz macht Karriere als Journalist und findet auch privat sein Glück. Als sein Bruder vom jugoslawischen Gastarbeiter Borna Krupcic ermordet wird, macht Werner seinen Einfluss geltend, um den Täter lebenslänglich hinter Gitter zu bringen. Nach dem Urteilsspruch bringt sich Krupcic in seiner Zelle um. Seine Familie schwört Rache. Die einflussreiche italienische Familie von Werner's Frau Clarissa macht Werner Glauben, dass sein erstgeborener Sohn Tomaso kurz nach der Geburt gestorben ist und schiebt Tomaso in ein Pflegeheim ab, da er behindert zur Welt kommt. Als Werners Schwiegervater Horst Kramer durch Zufall einen Hinweis auf Tomasos Schicksal findet, kommt er unter mysteriösen Umständen ums Leben. Allmählich ahnt Werner die Zusammenhänge und steht fortan auch im Fadenkreuz der norditalienischen Verwandtschaft. Wieder und wieder sind die Hauptfigur, Clarissa und der zweitgeborene Sohn Patrizio in den folgenden Jahren Ziel von Übergriffen der Widersacher aus Jugoslawien und Italien, denen sie oft nur mit Glück entkommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Wolff
Vendetta Colonia
autofiktionaler Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Impressum neobooks
*
Der Kölner Sportjournalist Werner Schmitz sieht sich nach dem Suizid des Mörders seines Bruders den Rachegelüsten der jugoslawischen Familie des Täters ausgesetzt.
Zudem droht Gefahr von der italienischen Verwandtschaft seiner Frau, die Werners totgeglaubten, behinderten Sohn in ein Pflegeheim abschiebt und seinen Schwiegervater, der eben dies herausfindet, kaltblütig ermordet.
Wieder und wieder sind Werner Schmitz und seine Familie über viele Jahre hinweg Übergriffen aus Jugoslawien und Italien ausgesetzt, denen sie oft nur mit Glück entkommen.
Ein spannender, autofiktionaler Roman mit historischen Bezügen.
PETER WOLFF, studierter Betriebswirt, war früher als Gruppenleiter im Controlling, Geschäftsführer einer Entsorgergemeinschaft und als Leiter der Seminarplanung in der Erwachsenenbildung tätig. Heute widmet er sich dem Schreiben von erzählenden Sachbüchern und Belletristik.
Vendetta Colonia
autofiktionaler Roman
von Peter Wolff
© / Copyright 2021 Peter Wolff
Umschlaggestaltung, Illustration: Peter Wolff
ASIN: B09NYSKPTT
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung oder Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar
Für meinen Vater
Prolog
Ein Sonntagabend im Herbst. Ich sitze mit meiner Frau vor dem Fernseher, der „Tatort“ ist, auch mangels halbwegs anspruchsvoller Alternativangebote anderer TV-Sender, beinahe schon Tradition am siebten Wochentag.
Der heutige „Fall“ steht kurz vor seiner Auflösung: Die tot geglaubte Zwillingsschwester der Hauptprotagonistin ist es offenbar, die, weil sie ein Kind von ihrem Schwager erwartet, von diesem in Jenseits geschickt werden soll, jedoch überlebt, und sich nunmehr für den Verlust ihres ungeborenen Kindes am Schwager rächen will, indem sie das Neugeborene von diesem und ihrer Zwillingsschwester entführen und selbst aufziehen will.
Meine Gattin schüttelt den Kopf. „Viel zu sehr konstruiert, so etwas gibt es doch gar nicht.“
In einer früheren Lebensphase hätte ich ihr wohl noch beigepflichtet, mittlerweile weiß ich: Das Leben ist wie ein Irrgarten. Seine verzweigten Wege, seine bizarren Verästelungen verwirren uns oft so sehr, dass es ebenso schwierig ist, das Ziel, wie auch den Rückweg zum Ausgang zu finden.
So werden Menschen, die Böses tun, nicht etwa als Übeltäter geboren, sondern durch verhängnisvolle Lebensumstände und fatale Fügungen des Schicksals erst zu ihren Missetaten getrieben.
I
Der Begriff Faschismus steht für die politische Strömung, die der italienische 'Duce', zu Deutsch Führer, Benito Mussolini im Königreich Italien zwischen 1922 und 1943 etabliert. Die Herrschaftsform entwickelt sich ab 1925 zur Diktatur und gilt im Folgenden als Modell für vielerlei ähnliche antiliberale Bewegungen in verschiedenen Staaten und Regionen Europas, unter anderem auch für den in Deutschland im Jahr 1933 zur Macht gelangten und bis 1945 herrschenden Nationalsozialismus (01).
Als im Frühjahr 1945 der Krieg für Italien zu Ende geht, geht das Morden im Staate weiter. Vor allem im Norden des Landes bricht ein grausamer Rachefeldzug los. Tausende von kommunistischen Partisanen machen sich daran, es den Faschisten in einer Art 'Volkstribunal' heimzuzahlen. Die Drahtzieher dieser 'Vendetta', die Verantwortlichen dieses Nachkriegsmassakers, werden zwar verurteilt, sie entziehen sich ihrer Strafe jedoch, indem sie mit Hilfe ihrer Partei rechtzeitig fliehen können, größtenteils nach Jugoslawien und in die Tschechoslowakei (02).
Antonio Tardea, überzeugter Faschist und in Kriegszeiten in hohem Rang der Partito Nazionale Fascista, der Nationalen Faschistischen Partei, flüchtet vor den Partisanen nach Deutschland. Nachdem er in den ersten Jahren häufiger seinen Lebensmittelpunkt wechselt, um der Vendetta, der Rache der Partisanen, zu entgehen, wird er schließlich in Köln heimisch.
Antonio Tardea ist in der Vorkriegszeit in Italien ein mächtiger Mann. Seine Familie besitzt ein einflussreiches Industrieimperium und bringt es zu Macht, Ansehen und finanziellem Wohlstand. All' das muss er nach Kriegsende aufgeben. Nach dem politischen Wechsel macht es seine unbedingte Treue zum Mussolini-Regime für ihn unmöglich, weiterhin im Heimatland zu leben.
In Deutschland muss Antonio Tardea völlig neu anfangen. Er arbeitet fortan als Maler und Lackierer und baut sich so eine neue, kleine Existenz auf. Eine Arbeit, die ihn nicht befriedigt, aber angesichts der Arbeitslosigkeit in großen Teilen Nachkriegseuropas und der Sprachbarriere, er spricht anfangs kaum Deutsch, schon ein gewisses Privileg darstellt. Sein Arbeitgeber Horst Kramer ist deutlich jünger als Tardea, trotzdem verstehen sich die beiden sehr gut.
Als die jüngere Schwester Antonio Tardeas, Amanda, ihren Bruder in der neuen Heimat besucht, lernt sie Horst Kramer kennen und nur kurze Zeit später auch lieben. Die beiden heiraten und schon bald stellt sich Nachwuchs ein. Tochter Antonella wird geboren, zwei Jahre später folgt das zweite Mädchen, das glückliche Paar nennt es Clarissa.
Einige Jahre später verstirbt Antonio Tardea, Amanda und Horst Kramer leben mit ihren Töchtern weiterhin in Köln. Sie bauen den Kontakt zu der italienischen Verwandtschaft, den Antonio Tardea notgedrungen abbrechen musste, wieder auf und reisen anfangs noch regelmäßig mit ihren Kindern in den Süden zu Amandas Familie. Die Tardeas sind nach wie vor ein mächtiger Familienclan, ein Cousin von Antonio hat zudem Alberta Scirelli, die Tochter des Bankdirektors Gianni Scirelli, geheiratet.
Beide Familienclans zusammen haben eine immense wirtschaftliche Macht, vor allem im Norden Italiens. Hier herrschen zwar durchaus kapitalistische Produktions- und Arbeitsorganisationen vor, feudalistische Eigentums-strukturen sind jedoch keine Seltenheit. Die Familien verfügen über einen Großteil des Grundbesitzes in der Region zwischen der Ostküste der Adria und dem Alpenhauptkamm. Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg sind sie maßgeblich beteiligt am modernen Wiederaufbau von Kleinstädten und Handelszentren. Mit der 'ndrangheta', der norditalienischen Mafia, die mit Geldwäsche, Rauschgift- und Waffenhandel sowie Erpressung und Prostitution Reichtümer verdient, haben sie direkt nichts zu tun, Teile des Ehrenkodex mafiöser Strukturen indes beherzigen sie durchaus.
Der Stolz des Clans lässt Schwäche und Versagen nicht zu, Familienmitglieder die nicht 'funktionieren', werden verstoßen.
Von alledem bekommen Horst und Amanda Kramer, geborene Tardea, während ihrer regelmäßigen Urlaube an der Adria kaum etwas mit. Horst Kramer ist im Familienkreis eher ein Außenseiter, als Maler und Lackierer genießt er nicht das Ansehen, dass dem Ruf der Familien Tardea und Scirelli gerecht wird. So bleiben die Kontakte der Familie Kramer zur italienischen Verwandtschaft eher oberflächlich, über die Jahre reißen sie beinahe ganz ab. Die Besuche werden weniger, abgesehen von obligatorischen Geburtstags- oder Weihnachtsgrüßen hört man kaum mehr voneinander.
Erst als die Töchter der Kramers beinahe erwachsen sind, intensivieren die Tardeas den Kontakt zu Hans und Amanda wieder, auch, weil die Töchter der beiden mittlerweile im heiratsfähigen Alter sind und dementsprechend Familienzuwachs zu erwarten ist. Trotz der räumlichen Trennung und des über lange Jahre kaum gepflegten Kontaktes ist der Clan der Familien Tardea und Scirelli an den potenziellen bambini interessiert – schließlich fließt Tardea-Blut in den Adern von Antonella und Clarissa Kramer.
*
Als es am 1. März 1941 zum ersten großen Luftangriff auf Köln kommt, ist dies der Beginn für schwerste Zerstörungen, die die Stadt vollkommen verwüsten. Die amerikanischen Truppen, die Köln knapp vier Jahre später betreten, finden eine Ruinenstadt vor, die völlig entvölkert scheint. Der Krieg hat 20.000 Kölner Bürgern den Tod gebracht, die Altstadt ist zu 90 % zerstört, der Neustadt ist es mit rund 80 % an Kriegsschäden nicht weniger schlecht ergangen. Nach dem Ende des Krieges kehren die Menschen langsam in die Stadt zurück, Ende 1945 ist die Bevölkerung trotz der schwierigen Umstände bereits wieder auf 400.000 Menschen angewachsen. Beim anstehenden Wiederaufbau soll sich das Gesicht der Stadt massiv ändern (03).
Die Zeit des Wiederaufbaus ist geprägt von Hunger und der Knappheit von Gütern aller Art. Man ist bemüht, Ordnung wiederherzustellen, Wirtschaft und Infrastruktur aufzubauen. Eine Zeit der Entbehrungen, aber auch der Chancen. Nach dem Krieg krempeln die Kölner die Ärmel hoch und ordnen die traurigen Überreste ihrer Stadt. Rund um den Dom, der wie durch ein Wunder relativ unversehrt geblieben ist, sind praktisch alle Häuser zerstört. Die Straßen sind verschüttet und teilweise unpassierbar, alle Rheinbrücken sind eingestürzt. Die städtische Infrastruktur, von der Straßenbahn über das Telefon- und Stromnetz bis hin zur Kanalisation, ist größtenteils unbenutzbar geworden.
Am 1. August 1947 wird der Wiederaufbauplan der Öffentlichkeit vorgelegt. Für diese Phase hat sich die Stadt im Wesentlichen drei Ziele gesteckt: Erstens sollen die alten Strukturen wieder aufgenommen und durch einige Verkehrserweiterungsmaßnahmen ergänzt werden. Zweitens soll, wo dies möglich und sinnvoll ist, die historische Bausubstanz gerettet oder aber zumindest rekonstruiert werden. Und zu guter Letzt soll die Stadt auf lange Sicht „autogerecht“ angelegt werden. Stadtbaumeister Rudolf Schwarz hat die Idee, rund um die Kirchen erneut Wohnviertel hochzuziehen, sodass die Gotteshäuser als Kerne kleiner Stadtteile mit eigenem Charakter erhalten bleiben. Im Übrigen werden die historischen Gebäude der Altstadt möglichst originalgetreu wiederaufgebaut (04).
So sieht das Köln aus, in das Paul Schmitz, reisender Kaufmann aus dem Stadtteil Ehrenfeld, nach Kriegsende zurückkehrt. Im Kampf hat er ein Bein verloren. Nach seiner Genesung bietet die Stadt Köln ihm einen Arbeitsplatz bei der Ausländerbehörde an. Nicht unbedingt das, was er sich für sein Leben vorgestellt hat, aber infolge seiner Behinderung bleibt ihm kaum eine andere Wahl, er nimmt das Angebot an. Paul Schmitz ist verheiratet, Familienzuwachs ist geplant. Ein sicherer Beamtenjob kann da nicht schaden.
Pauls zwei Jahre älterer Bruder Werner kämpft nicht für sein Vaterland. Er teilt am Truppensammelplatz dem Truppenführer kurz vor dem geplanten Abmarsch zum Kriegsschauplatz mit, dass er „nach Hause“ gehe. Das Risiko, infolge seiner Weigerung erschossen zu werden, nimmt er in Kauf. Derart aussichtslos erscheint Werner Schmitz der Einsatz an der Front, zu dem er auserkoren ist. Werner Schmitz hat Glück: sein Truppenführer lässt Gnade walten und den Abtrünnigen von dannen ziehen.
Im Sommer 1944 erkrankt Werner Schmitz an der Schwindsucht, besser bekannt als Tuberkulose. Als er im November des Jahres aus dem Sanatorium, damals Lungenheilstätte genannt, zurückkehrt, wundert er sich über den großen Menschenauflauf am Ehrenfelder Bahnhof.
Spätestens ab 1942 kann man Köln als das Zentrum der Edelweiß-Gruppen, wie sich die Widerstandskämpfer formell nannten, bezeichnen. In den Gestapo-Akten tauchen mehr als 3000 Namen Kölner Edelweißpiraten auf. Es handelt sich um informelle Gruppen deutscher Jugendlicher mit unangepasstem, teilweise oppositionellem Verhalten im Deutschen Reich von 1939 bis 1945.
Am Bahndamm in Ehrenfeld, direkt an der Unterführung Venloer Straße, werden bereits am 25.10.1944 elf vom NS-Regime zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppte Bürger Polens und der UdSSR ohne Gerichtsurteil öffentlich durch Gestapo und SS gehenkt. Am 10.11.1944 ereilt dreizehn Deutsche, unter ihnen jugendliche Edelweißpiraten aus Ehrenfeld sowie andere Kämpfer gegen Krieg und Terror, das gleiche Schicksal (05). Heute erinnern eine Bronzetafel und ein Wandgemälde an die Hinrichtungen. Die parallel zum Bahndamm verlaufende Hüttenstraße heißt in diesem Abschnitt zum Gedenken an einen der Edelweißpiraten heute Bartholomäus-Schink-Straße (06).
Das grausame Prozedere in seinem „Veedel“, dem Stadtteil Kölns, in dem er geboren und aufgewachsen ist, trifft Werner Schmitz, überzeugter und bekennender Pazifist, bis ins Mark. Eine solche Gräueltat hätte er in seiner Heimatstadt, in der doch das Motto „Levve un levve losse“ (Leben und leben lassen) allgegenwärtig ist, nicht für möglich gehalten. Wochenlang ist er befangen, apathisch, unfähig, wieder am Leben teilzunehmen und sich um seine Zukunft zu kümmern.
Nachdem Adolf Hitler am 30.April 1945 im Berliner Führerbunker Selbstmord begangen hat, ist der Krieg im Mai 1945 endlich beendet.
In Werner Schmitz erwachen langsam, aber sicher die Lebensgeister. Nach Kriegsende tingelt er zunächst als Waschmittel- und Seifenverkäufer durch Köln und schreibt bisweilen Berichte über regionale Fußballspiele, die eine ansässige Tageszeitung in Auftrag gibt. Diese beeindrucken die Zeitungsmacher so sehr, dass Werner Schmitz einige Zeit später als Lokal- und Sportredakteur fest eingestellt wird.
*
Jugoslawien wird nach Kriegsende als sozialistischer und föderaler Staat neu gegründet. Die jugoslawischen Kommunisten errichten 1945 sechs eigenständige Teilrepubliken: Slowenien, Kroatien, Serbien, Mazedonien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Wie in allen kommunistischen Ländern, wird das Wirtschaftssystem nach 1945 völlig umgestaltet. Industrie und Banken werden verstaatlicht, der Großgrundbesitz aufgeteilt. Am 7.April 1963 wird Josip Broz, besser bekannt als Tito, zum Präsidenten auf Lebenszeit ernannt (07). Dem neuen Staatschef gelingt es, seinen Staat vom Einfluss der stalinistischen Sowjetunion zu lösen. Weil sich Jugoslawien von der Sowjetunion losgesagt hat, erhält das Land auch massive Wirtschaftshilfe des Westens, wobei es gleichzeitig enge Handelsbeziehungen zum RGW, einer internationalen Organisation der sozialistischen Staaten unter Führung der Sowjetunion, unterhält. So scheint das sozialistische Wirtschaftssystem Jugoslawiens zunächst erfolgreich zu sein, die Lebensverhältnisse im Land bessern sich.
Tito glaubt an den "dritten Weg", einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Er revolutioniert die Gesellschaft nach sozialistischem Vorbild, die Landwirtschaft wird kollektiviert, die Industrie verstaatlicht. Marktwirt-schaftliche Ansätze sowie der Tourismus kurbeln die Wirtschaft des Landes an, dank der Reisefreiheit fließen viele Devisen von Gastarbeitern nach Jugoslawien zurück. Jugoslawien ist das Freieste der sozialistischen Länder (08). Jedoch gelingt es nicht, die südlichen Republiken wirtschaftlich zu entwickeln, hier herrschen weiterhin Arbeitslosigkeit beziehungsweise Unterbeschäftigung vor. Es fehlt an der Infrastruktur und an Investoren, um den wirtschaftlichen Aufschwung in Gang zu setzen. So kommt es, dass Zehntausende Jugoslawen als Gastarbeiter nach Westeuropa gehen (09).
Enver Krupcic lebt mit seiner Frau Vesna in der Nähe von Novi Sad. Die Kinder Dragica und Davor wohnen noch im Elternhaus, der älteste Sohn Borna nur wenige Kilometer entfernt. Enver betreibt eine kleine Schmiederei, die nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht wird.
Enver Krupcic hat einen Freund in Deutschland, Filip Krastic, der in Köln in einer großen Automobilfirma arbeitet und sich schon ein gutes Stück bis zum Vorarbeiter emporgearbeitet hat. Er verfügt über entsprechende Kontakte und kann Envers Sohn Borna einen Arbeitsplatz in der Fertigung von Automobilen beschaffen.
Familie Krupcic sitzt beim Abendessen.
„Borna, das ist eine große Chance für Dich.“
„Ich weiß, Papa. Aber ich möchte lieber hierbleiben, in meiner Heimat etwas aufbauen und die Familie unterstützen.“
„Und eben das kannst Du am besten, in dem Du nach Deutschland gehst und dort gutes Geld verdienst.“
„Und meine Familie lasse ich hier zurück? Ich habe zwei kleine Kinder und eine Ehefrau, die Unterstützung braucht.“
„Du weißt genau, dass es Deiner Familie an nichts fehlen wird. Wir kümmern uns jeden Tag um sie.“
Bornas Frau Ana ergreift das Wort.
„Borna, Dein Vater hat recht. So schwer es uns allen auch fällt, Du solltest gehen.“
„Das sagst Du so einfach?“
„Borna!“, mischt sich sein Vater ein. „Mach' Deiner Frau das Herz nicht unnötig schwer.“
„Sobald Du Dich eingelebt hast, kannst Du Deine Familie nachholen.“
„Ich würde lieber wieder zurückkehren, sobald ich in der Heimat eine Perspektive habe.“
„Wir werden sehen. Also. Darf ich Filip sagen, dass Du kommst?“
„Habe ich eine Wahl?“, fragt Borna mit gesenktem Haupt.
„Du tust das Richtige, glaub' es mir, mein Junge.“
*
Im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs wächst im Nachkriegsitalien die Nachfrage nach einer qualifizierten Schul- und Hochschulbildung. Die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Situation breiter Bevölkerungsschichten führt zu einem stärkeren Zustrom zu den höheren Schulen und den Universitäten. Der unter dem Faschismus elitär und ideologisch reduzierte Hochschulzugang wird weitestgehend liberalisiert. Die Ausdehnung der Bildungsnachfrage führte zur Gründung zahlreicher neuer Universitäten. Die Städte profitieren von den neuen Hochschulen kulturell wie wirtschaftlich und sehen in ihnen einen Zugewinn an sozialem und nationalem Prestige (10).
Guiseppe Scirelli, Sohn von Gianni Scirellis Bruder Andrea, studiert economia politica, Volkswirtschaftslehre, an der Universität in Florenz, einer der ältesten Universitäten Italiens, gegründet 1321 (11). Nach Beendigung seines Studiums gewinnt er Anfang der 60er Jahre innerhalb des Clans immer mehr Einfluss. Auch, weil er offen Gedanken ausspricht, die viele seiner Verwandten sich nicht auszusprechen trauen, obschon auch sie ähnlich denken.
Der Nationalsozialismus ist in Italien auch 20 Jahre nach Kriegsende durchaus noch gegenwärtig. Guiseppe Scirelli ist ein Verfechter der Theorie von Charles Darwin. Dieser ging davon aus, dass in der Natur ein ständiger Austauschprozess herrsche. In diesem würden für das Überleben ungünstige Merkmale automatisch eliminiert (12).
Ansichten, die auch Benito Mussolini, Staatsoberhaupt Italiens während des Zweiten Weltkrieges, und sein Bruder im Geiste, der deutsche Diktator Adolf Hitler, ausgiebig propagierten. Das Gedankengut des „Duce“ und jenes vom „Führer“ - ganz im Sinne des Emporkömmlings im Familienclan.
Guiseppe Scirelli bewundert Adolf Hitler insbesondere für seine Aktion, die den Decknamen „T4“ trägt. Die Nazis bezeichneten es auch als Euthanasie – eine zynische Entfremdung des Wortes, das eigentlich einen leichten und schönen Tod meint. T4 steht für die Tiergartenstraße 4 in Berlin. Hier befand sich der Hauptsitz der Aktion. Ihr Leiter war der Chef der "Kanzlei des Führers", Philipp Bouhler. Gemeinsam mit Ärzten, Pflegern und anderen setzte er die Tötung von mehreren Tausend Kranken und Menschen mit Behinderung um. In speziellen Kammern erwartete sie der Tod durch Vergasung oder Giftspritze (13). Rund 200.000 Behinderte fielen im Dritten Reich dem "Euthanasie"-Programm der Nazis zum Opfer. (14)
Hitler sah sich als Beschleuniger des in der Natur ohnehin vorhandenen Ausleseprozesses, in dem sich nur die stärkere Rasse durchsetzen wird. Ähnlich denkt Guiseppe Scirelli. Behinderte Menschen sind ihm ein Gräuel, mehrmals stellt er deren Eingliederung in die Gesellschaft öffentlich infrage. Als er zum Kommunalpolitiker aufsteigt, plädiert er für große Behindertenheime, isoliert in ländlichen Gebieten, in denen man geistig oder körperlich behinderte Menschen unterbringen soll.
Gehandicapte Menschen in der eigenen Familie verachtet Guiseppe. Ein entfernter Cousin leidet unter dem Tourette-Syndrom. Darunter versteht man eine neuropsychiatrische Erkrankung, die sich in sogenannten Tics äußert. Tics sind spontane Bewegungen, Laute oder Wortäußerungen, die ohne den Willen des Betroffenen zustande kommen. Vergleichbar ist das mit dem Niesen oder einem Schluckauf. Tics beim Tourette-Syndrom lassen sich nur bedingt kontrollieren (15).
Guiseppe Scirelli setzt alle Hebel in Bewegung, den jungen Mann so schnell wie möglich aus dem Umfeld des Clans zu entfernen. Ein neu errichtetes Pflegeheim in der Nähe von Bergamo hat er als neues Zuhause für seinen Cousin auserkoren und arbeitet daran, ihn schnellstmöglich dort unterzubringen.
*
Anfang der 60er Jahre erkrankt Amanda Kramer an Tuberkulose. Einer Krankheit, die am häufigsten die Lunge befällt und in den 60er Jahren weltweit die tödlichste Infektionskrankheit ist. Die Beschreibung des Erregers Mycobacterium tuberculosis durch Robert Koch war 1882 ein Meilenstein der Medizingeschichte. Die Tuberkulose wird deshalb auch Morbus Koch genannt (16). Tuberkulose ist bereits in den 60er Jahren durchaus heilbar. Allerdings bildet sich infolge der Behandlung bei Amanda Kramer Wasser im Gehirn, ihr Zustand ist kritisch.
Clarissas Mutter liegt im St. Elisabeth-Krankenhaus in Köln-Lindenthal, ihr Ehemann Horst besucht sie jeden Tag, auch Clarissa selbst ist beinahe täglich vor Ort.
Eines Nachts wird Clarissa um 01:30 Uhr plötzlich wach. Ohne erkennbaren Anlass sitzt sie plötzlich aufrecht im Bett und weiß nicht, warum. Sie kann sich nicht erinnern, etwas Schlimmes geträumt zu haben, auch sind keine lauten Geräusche vernehmbar, die ein Aufwachen hätten verursachen können. Clarissa schläft schnell wieder ein und wird gegen 07:00 vom Läuten des Telefons geweckt.
„Hallo?“, spricht sie verschlafen in den Hörer.
„Mit wem spreche ich denn da?“
„Hier spricht Clarissa Kramer.“
„Doktor Wolter am Apparat, St.Elisabeth-Krankenhaus.“
„Ja?“, Clarissa beschleicht eine schlimme Vorahnung.
„Frau Kramer, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Mutter diese Nacht gegen 01:30 verstorben ist.“
Clarissa laufen Tränen über das Gesicht, sie ist kaum fähig, das Gespräch fortzuführen.
„Es tut uns sehr leid, Frau Kramer, aber wir konnten am Ende nichts mehr für sie tun.“
„Um 01:30...“, stammelt Clarissa, mehr zu sich selbst. Ich komme gleich ins Krankenhaus.“
„Ist gut, Frau Kramer. Wollen Sie Ihre Mutter noch einmal sehen?“
„Das weiß ich noch nicht.“
Als sie den Hörer auflegt, spürt Clarissa, wie ihr Vater ihr von hinten die Arme um den Körper legt. Horst Kramer hat das Gespräch mitangehört.
„Amanda ist tot, nicht wahr?“Clarissa dreht sich zu ihrem Vater um und beide weinen bitterlich.
*
Im ersten Jahrzehnt nach dem letzten Weltkrieg überwindet die Bundesrepublik rasch die anfänglich hohe Arbeitslosigkeit und erreicht Ende der 1950er Jahre bereits Vollbeschäftigung. Neben der rasant wachsenden Wirtschaft tragen der Eintritt geburtenschwacher Jahrgänge in den Arbeitsmarkt, die Verlängerung der Ausbildungszeiten, die Verkürzung der Wochenarbeitszeiten, der Anstieg des durchschnittlichen Renteneintrittsalters und der Aufbau der Bundeswehr zu den Engpässen am Arbeitsmarkt bei. Schließlich stoppt der Bau der Berliner Mauer im Jahre 1961 den Zustrom von Arbeitskräften. Die Arbeitskräfteknappheit stellt angesichts weiter steigender Nachfrage das größte Hemmnis für eine Ausweitung der Produktion bei stabilen Preisen dar. Aus der Sicht der Arbeitgeber und der Bundesregierung liegt es daher nahe, diesen Bedarf durch ausländische Arbeitnehmer zu füllen, um die Unternehmensgewinne zu erhalten.
Ergo verfolgt die deutsche Bundesregierung Anfang der 60er Jahre die Politik, südeuropäische Arbeiter temporär in die Bundesrepublik zu holen, um die heiß laufende Arbeitsnachfrage in der Bundesrepublik zu kühlen.
Der Nachfrage aus der Bundesrepublik steht ein entsprechendes Angebot südeuropäischer Staaten gegenüber. So geht die Initiative für die Anwerbeabkommen stets von den Anwerbestaaten selbst aus, welche sich dadurch Vorteile versprechen. Von der Arbeitnehmerentsendung erhofft man sich vielerorts eine Entlastung des eigenen Arbeitsmarktes, eine Kanalisation ohnehin vorhandener Arbeitsmigration, einen Import von Know-how und dringend benötigte Devisen. Auf deutscher Seite wird die Gastarbeiterpolitik als eine Art Entwicklungshilfe und Beitrag zur europäischen Integration begriffen. Ein erstes Anwerbeabkommen, welches den Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft lindern soll, wird am 22. Dezember 1955 mit Italien geschlossen. Anfang der 60er Jahre folgen schnell weitere Vereinbarungen mit Spanien und Griechenland (1960), der Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968). Als Konsequenz dieser Abkommen kommt es zur ersten großen Einwanderungswelle in die noch junge Bundesrepublik.
Die Zuwanderung südeuropäischer Gastarbeiter kommt Anfang der 60er Jahre zunehmend ins Rollen. Die Zahl der Ausländer in der Bundesrepublik erhöht sich zwischen 1961 und 1967 von 686.000 auf 1,8 Millionen. Letztendlich stellen die Jugoslawen und schließlich die Türken die größten Kontingente. Viele der Gastarbeiter, die in den 1960er Jahren in Deutschland kommen, stehen schon am nächsten Tag auf der Baustelle oder am Fließband (17).
Köln spielt bei der Anwerbung von "Gastarbeitern" eine entscheidende Rolle. Neben München ist die Stadt am Rhein der Ort, von wo aus die ankommenden ausländischen Arbeitskräfte mittels sogenannter Sammel-transporte in die ganze Bundesrepublik verteilt werden. Während die italienischen, griechischen, türkischen und jugoslawischen Arbeiter am Münchener Hauptbahnhof ankommen und durch die dortige Weiterleitungsstelle betreut werden, nimmt man die spanischen und portugiesischen "Gastarbeiter" am Bahnhof Köln-Deutz in Empfang (18).
In der Domstadt selbst herrscht bedingt durch die hohen Verluste im zweiten Weltkrieg und durch die boomende Wirtschaft in den 50er und frühen 60er Jahren zu dieser Zeit ein großer Bedarf, gleichzeitig aber auch ein Mangel an Arbeitskräften. So rekrutiert man die dringend benötigten Mitarbeiter nicht nur aus der Umgebung Kölns, aus entlegenen Regionen wie der Eifel und dem hohen Westerwald, sondern auch aus dem vornehmlich südeuropäischen Ausland (19).
Hauptbahnhof Köln. Borna Krupcic ist nach der langen und anstrengenden Fahrt endlich in der Metropole am Rhein angekommen. Er steigt aus dem völlig überfüllten aus München kommenden Zug aus und schaut sich auf dem Bahnsteig um. Er hat den Freund des Vaters lange nicht gesehen, dieser erkennt ihn jedoch, der umher eilenden Menschenmenge zum Trotz, direkt.
„Borna!“
„Herr Krastic....erst einmal: Danke!“
„Ab heute Filip. Und danken brauchst Du mir nicht, es ist doch selbstverständlich, dass ich Dir helfe.“
„Sehr gern, Filip. Ich möchte Dir trotzdem danken.“
„Du wohnst erst einmal bei mir, bis ein Zimmer für Dich im Betriebswohnheim eingerichtet ist. Schon morgen kannst Du in der Firma anfangen.“
Filip Krastic hat seine Frau und seinen achtjährigen Sohn nachgeholt, die Familie bewohnt eine kleine Zweizimmerwohnung. Auch wenn die beiden Männer am nächsten Morgen zeitig aufstehen müssen, wird es ein langer Abend in Köln-Merkenich. Schließlich gibt es einiges aus der Heimat zu erzählen, zudem will Borna vieles rund um seine neue Arbeit und das Leben in Deutschland erfahren. Um 05:00 schellt unbarmherzig der Wecker. Ein kurzes Frühstück und die beiden Männer machen sich auf zur Arbeit.
Mit einem Kapital von nur 28.000 US-Dollar gründet Henry Ford am 16. Juni 1903 in Detroit die Ford Motor Company. Erster Unternehmenssitz in Deutschland ist Berlin. Am 28. Oktober 1929 unterzeichnet der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer den Vertrag über den Bau des Ford-Werkes auf einem 170.000 Quadratmeter großen Gelände in Köln-Niehl, das ursprünglich für eine Jahresproduktion von bis zu 250.000 Fahrzeugen ausgelegt sein soll und dessen Errichtung 12 Millionen Reichsmark kostet. Der Unternehmenssitz wird 1930 von Berlin nach Köln verlegt, wo Henry Ford am 2.Oktober 1930 eigens für die Grundsteinlegung anreist. Im Jahre 1955 wird Ford eine Aktiengesellschaft. Ein akuter Arbeitskräftemangel veranlasst die Firma zu Beginn der 1960er Jahre zur Anwerbung von Gastarbeitern.
So ist Köln die erste Stadt Deutschlands, in der ausländische Arbeiter den wirtschaftlichen Aufschwung unterstützen.Denn als erstes Unternehmen in Deutschland stellt Ford im Rahmen von Anwerbeabkommen bereits im Herbst 1961 Gastarbeiter ein. Während die ersten türkischen Mitarbeiter noch in Übergangswohnheimen wohnten, stellen die Ford-Werke ab 1962 ihren ausländischen Arbeitern neu errichtete und gut eingerichtete Wohnheime zur Verfügung. Ford beschäftigt in den 60er Jahren neben 14 000 deutschen Lohnempfängern 7000 Ausländer. Ein Bettplatz in den Wohnheimen kostet zehn Mark Wochenmiete, das Mittagessen in der Kantine 60 Pfennig (20).
Borna Krupcic bezieht bereits zehn Tage nach seiner Ankunft ein Zimmer im Ford-Wohnheim. Er lebt sich schnell in Köln ein, verbringt viel Zeit bei den Krastics und findet auch schnell Kontakt zu anderen Gastarbeitern.
Zweimal in der Woche telefoniert Borna mit seiner Familie, was in den 60er Jahren bisweilen noch ein schwieriges Unterfangen ist.
„Zdravo tata. Hallo Papa.“
„Borna, mein Junge! Wie geht es Dir?“
„Ihr fehlt mir natürlich sehr, aber ansonsten geht es mir gut. Ich habe bereits ein eigenes Zimmer und die Arbeit klappt auch immer besser.“.
„Ich wusste, dass Du das schaffst, moj sin.“
„Wie steht es denn um Euch?“
„Die Kleinen vermissen Dich natürlich. Deine Frau auch. Sie bringt die beiden gerade ins Bett. Soll ich Ana an den Hörer holen?“
„Nein, lass' Sie sich in Ruhe um die Kinder kümmern.“
„Willst Du majka noch kurz sprechen.“
„Ja, gern.“
„Mein Sohn, wie schön, von Dir zu hören!“
„Mutter! Ich umarme Dich!“
„Wir sind unheimlich stolz auf Dich, dass Dir der Start so gut gelungen ist.“
„Es wurde mir hier auch sehr leicht gemacht. Hier arbeiten einige Landsleute, wir unterstützen uns alle gegenseitig.“
„So soll es sein, mein Junge. Lass' uns jetzt aufhören, das wird zu teuer für Dich.“
„Ich melde mich in zwei oder drei Tagen wieder bei Euch, Kuss für Ana und die Decki.“
*
Alfredo Bugno fällt erschöpft ins Bett. Endlich Urlaub. Eigentlich wollte er sich einer Wandergruppe anschließen, die in der Umgebung des Monte Amiata, mit 1739 Metern die höchste Erhebung in der Toskana (21), eine fünftägige Tour geplant hat. Aber seine Nervenerkrankung ist fortgeschritten, und die unkontrollierten Zuckungen und Bewegungen, die er in infolge seines Tourette-Syndroms zunehmend macht, lassen eine längere Wanderreise kaum zu. Statt dieser hat sich Alfredo vorgenommen, an seinen freien Tagen zwei weitere Ärzte zu konsultieren, die im Ruf stehen, auf dem Gebiet der nervlichen Erkrankungen Spezialisten zu sein. Irgendwie muss es ihm gelingen, der Krankheit Einhalt zu gebieten.
Alfredo hat einen sicheren Arbeitsplatz in der Fertigung des Automobilherstellers Fiat am Lingotto, dem legendären Hauptsitz von Fiat im Süden Turins.
Gegründet wird die Firma Fiat am 11. Juli 1899 von neun Personen. Einer von ihnen ist Giovanni Agnelli senior, der Großvater von Gianni Agnelli, unter dem Fiat in den 60er Jahren zu einer großen europäischen Marke wird (22).
Alfredo ist an der Produktion des Fiat Nuova 500 beteiligt und fest in die zunehmend beschleunigte Fertigung des Automobils eingebunden.
Nehmen die Tics weiter zu, wird er seinen Job kaum weiter zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten ausführen können.
Mario Stroppa, der zu jener Zeit als Fertigungsleiter in Turin arbeitet, ist ein guter Freund der Familie Scirelli. Er ist entschlossen, solange es eben geht an Alfredo Bugno, dem Cousin von Guiseppe Scirelli, festzuhalten.
Er denkt daran, ihn demnächst in einen anderen Teil des Produktionsprozesses einzubinden, der eher mit seinen krankheitsbedingten unkontrollierten Bewegungen vereinbar scheint.
Just in den Tagen, an denen sich Alfredo Bugno auf den neuesten Wissensstand bezüglich seiner Erkrankung bringt, erreicht Mario Stroppa ein Anruf von Guiseppe Scirelli:
„Ciao Guiseppe, das ist ja eine schöne Überraschung. Wir haben lange nicht mehr gesprochen“
„Ti saluto! Wie geht es Dir, Mario?“
„Bestens, ich kann nicht klagen. Und Dir und der Familie?“
„Soweit auch tutto bene, alles gut.“
„Wir müssen uns einmal wiedersehen, Guiseppe.“
„Ja, das müssen wir. Warum ich anrufe, Mario...“
„Ja?“
„Es geht um Alfredo. Denkst Du, dass er den Anforderungen in Deinem Betrieb noch gewachsen ist? Ich habe da meine Bedenken.“
„Der Junge legt sich wirklich mächtig ins Zeug. Er scheint mir wild entschlossen, sich hier trotz der Sache zu beweisen.“
„Certo, aber es steht wirklich nicht gut um ihn. Diese Krankheit...Ich weiß nicht, ob man Alfredo einen Gefallen tut, wenn er sich in diesem Zustand noch der Öffentlichkeit zeigt.“
„Was soll das heißen?“
„Es gibt da ein noch recht neues Wohnheim in der Nähe von Bergamo.“
„Und?“
„Ich denke, das ist das Beste für Alfredo. Es gibt dort eine Behindertenwerkstatt und es wird selbst gekocht.“
„Behindertenwerkstatt? Alfredo ist doch nicht behindert!“
„Wie würdest Du das denn nennen, Mario?“
„Ich weiß es nicht, aber...“
„Du siehst doch selbst, wie es immer schlimmer wird mit seinen Anfällen. Wofür ihn weiter auf der Arbeit quälen?“
„Er liebt seine Arbeit. Ich glaube nicht, dass er sich bereits im jetzigen Stadium der Krankheit quält. Man sollte...“
„Mario, wir brauchen das an der Stelle nicht weiter zu diskutieren. Ich habe einen Arzt, der Alfredo die Berufsunfähigkeit attestiert. Es ist bereits ein Platz im Pflegeheim reserviert.“
„Du willst Deinen eigenen Cousin ins Pflegeheim abschieben?“
„Wir haben keine andere Wahl.“
„Das sehe ich anders. Ich habe schon überlegt, ihm eine etwas weniger anspruchsvolle Tätigkeit zu übertragen.“
„Die Famiglia hat entschieden. Nach seinem Urlaub sprichst Du Alfredo die Kündigung aus. Seine Wohnung in Turin habe ich bereits gekündigt.“
Guiseppe Scirelli legt den Hörer auf. Mario Stroppa sitzt mit offenem Mund in seinem Bürostuhl und ist völlig perplex. Wie kann man einen jungen Mann derart aus dem Leben reißen? Wie kann es den Scirellis dermaßen wichtig sein, Alfredo so schnell wie möglich aus der Öffentlichkeit zu ziehen und ihn in ein abgelegenes Pflegeheim einzuweisen? Mario Stroppa kann sich keinen Reim auf das gerade Gehörte machen. Das Telefonat mit Guiseppe Scirelli lässt ihn völlig verwirrt zurück und beunruhigt ihn zutiefst.
*
Während Paul Schmitz Ende Anfang der 60er Jahre in der Ausländerbehörde sehr viel mit dem Zuzug von südeuropäischen Gastarbeitern beschäftigt ist, widmet sich sein Bruder Werner bei der Kölnischen Umschau mit Begeisterung dem Aufbau einer Sportredaktion.
Sowohl das Interesse am Breiten- wie am Spitzensport als auch die Auflage der zweitgrößten Kölner Zeitung sind immens gestiegen, so dass Werner Schmitz den Auftrag erhalten hat, zwei Mitarbeiter einzustellen. In der Mittagspause hat er ein Gespräch mit einem Kandidaten, den er in einer nahegelegenen Gaststätte treffen will.
Die Kölnische Umschau ist zentral gelegen, unweit des Hauptbahnhofes und auch in Nähe des größten Wahrzeichens der Stadt am Rhein, des ab 1248 erbauten Kölner Doms. Werner will sich noch kurz die Beine vertreten und so verlässt er seine Redaktion frühzeitig, um noch ein wenig in der schönen Maisonne herum zu schlendern.
Werner Schmitz ist gebürtiger Kölner. Er liebt diese Stadt, er lebt sie. Nach seinem Aufstieg zum bekannten Lokal- und Sportjournalisten ist er in Köln ein bekannter Mann, fest im gesellschaftlichen Leben Kölns wirklicher und selbst ernannter Größen verankert und über vielfältige Kontakte verfügend. Was ihm noch fehlt, ist die Frau fürs Leben. Werner Schmitz hat die 40 bereits überschritten, es wird Zeit, eine Familie zu gründen.
Eine halbe Stunde bleibt ihm noch bis zum Termin im „Alt Köln am Dom“, einem stadtbekannten großen Restaurant am Bahnhofsvorplatz. Gedankenverloren flaniert Werner über den Domvorplatz, als er einer jungen Dame gewahr wird, die, genüsslich an einem Eis schleckend, zwischen den Geschäften am Rande des Platzes hin- und hergeht. Nur selten um einen guten Spruch verlegen, nähert er sich der auffallend hübschen, offenbar noch blutjungen Frau, behutsam und wartet, bis sie sich von den Geschäften abwendet und seine Richtung einschlägt. Als sie an ihm vorbeikommt, nimmt er allen Mut zusammen.
„Darf ich vorstellen, zur Linken der Kölner Dom!“
Nicht sonderlich originell, denkt er sich, und hofft, dass sein legerer Spruch dennoch ausreichend ist, um die junge Dame in ein Gespräch zu verwickeln.
„Das ist ja interessant. Arbeiten Sie als Fremdenführer?“
„Nein, ich bin Lokal- und Sportredakteur bei der Kölnischen Umschau, gleich hier um die Ecke, in der Stolkgasse.“
„Ich arbeite auch hier in der Nähe, in der Industrie- und Handelskammer.“
„Dann sind sie auch in der Mittagspause?“
„Ja.“
„Ich würde Sie ja gern auf einen Kaffee einladen, aber ich habe gleich im Alt Köln einen Termin mit einem Bewerber für unsere Redaktion. Vielleicht können wir uns morgen in der Pause treffen?“
„Ich glaube nicht, dass ich im Moment eine gute Gesprächspartnerin bin. Meine Mutter ist kürzlich verstorben.“
„Das tut mir leid, dann werde ich Sie selbstverständlich nicht weiter belästigen. Hier: Meine Visitenkarte. Wenn Sie es sich anders überlegen, wenn Sie Hilfe brauchen oder Ihnen einfach nur nach Reden ist, melden Sie sich einfach.“
Zögernd nimmt Clarissa Kramer die Karte des Unbekannten an und wendet sich von ihm ab.
„Mein Name ist Werner Schmitz.“, ruft der Journalist Clarissa noch nach.
Kurz dreht sie sich noch einmal zu ihm um. „Ich heiße Clarissa.“
Nach der Arbeit Zuhause angekommen, hat Clarissa Kramer die Begegnung am Mittag beinahe schon vergessen. Die Beerdigung Ihrer Mutter muss geplant werden, zudem gilt es, eine neue Wohnung zu suchen. Jetzt, nach dem Tode Amandas und dem Auszug der Schwester Antonella, die geheiratet hat, ist die Wohnung in der Meister-Ekkehart-Straße in Köln-Lindenthal für sie und ihren Vater zu groß und vor allem deutlich zu teuer.
Die Wohnungssuche gestaltet sich als schwierig. Die Mietpreise in Köln steigen, „Schnäppchen“ gibt es selten und um an günstige Wohnungen zu kommen, bedarf es oft persönlicher Kontakte zu einflussreichen Menschen in der Stadt. Clarissa und Hans haben bereits mehrere Wochen erfolglos gesucht, als Clarissa durch Zufall eine Visitenkarte in der Tasche ihrer Sommerjacke entdeckt. Warum ist ihr der Gedanke nicht schon vorher gekommen? Werner Schmitz arbeitet bei der Zeitung, er verfügt bestimmt über entsprechende Kontakte und kann ihr womöglich bei der Wohnungssuche helfen. Ob er sich wohl noch an sie erinnert? Einen Versuch ist es in jedem Fall wert und so greift sie zum Telefonhörer.
„Guten Tag Herr Schmitz, hier ist Clarissa.“
Werner Schmitz freut sich sehr über den unverhofften Anruf. Hatte er doch schon gar nicht mehr damit gerechnet, von seiner flüchtigen Bekanntschaft vom Domvorplatz jemals wieder zu hören.
„Guten Tag! Das ist ja eine freudige Überraschung.“
„Haben Sie vielleicht heute in der Mittagspause Zeit? Ich habe eine Bitte, vielleicht können Sie mir helfen.“
„Ja, kein Problem. Wo sollen wir uns treffen? 12:30 Uhr beim „Gröters“? Kennen Sie die Gaststätte?“
„Ja.“
„Dann bis gleich.“
„Vielen Dank, Herr Schmitz.“
Werner Schmitz springt auf von seinem Stuhl und klatscht in die Hände. Hatte er doch gar nicht mehr erwartet, von der jungen Dame, die Wochen zuvor seine Aufmerksamkeit erregt hatte, jemals wieder zu hören.
Es ist erst 10:00, dem Sportjournalisten fällt es schwer, sich weiterhin auf die Arbeit zu konzentrieren. Seine Gedanken kreisen bereits um das bevorstehende Treffen mit der schönen Unbekannten. Bereits um 12:15 betritt Werner das Lokal.
„Hallo Bätes, tu' mir mal ein Kölsch.“
„Werner! Was treibt Dich den schon mittags hier hin, Du kommst doch sonst erst nach Feierabend?“
„Das wirst Du gleich sehen, Junge. Trinkst Du eins mit?“
„Da sage ich selten nein.“
„Dann mach' Dir auch eins.“
„Prost, Werner.“
„Prost, Bätes.“
Pünktlich um 12:30 betritt Clarissa Kramer die Gaststätte Gröters.
„Guten Tag, Herr Schmitz.“
„Guten Tag, Clarissa. Schön, Sie wiederzusehen. Leider kann ich Sie nur beim Vornamen anreden, also tun Sie das doch auch: ich heiße Werner. Lassen Sie uns zum Du übergehen.“
„In Ordnung, Werner.“
„Was möchtest Du trinken?“
„Nur ein Wasser bitte, ich muss ja gleich noch arbeiten.“
„Ein Wasser für die Dame und noch ein Kölsch für mich, Bätes.“
Werner Schmitz ist genauso beeindruckt wie bei der ersten Begegnung auf der Domplatte, irgendetwas an der jungen Frau fasziniert ihn.
„Du siehst sehr südländisch aus. Hast Du Familie in Südeuropa?“
„Meine Mutter ist...meine Mutter war...“, Clarissa stockt die Stimme.
„Brauchest Du ein Taschentuch?“ fragt Werner.
„Nein, es geht schon. Meine Mutter war Italienerin.“
„Das lässt sich nicht verleugnen, die italienische Herkunft steht Dir aber ganz hervorragend.“, umschmeichelt Werner die junge Frau.
„Danke.“
„Nun gut, wie kann ich Dir helfen?“
„Ich suche für meinen Vater und mich eine neue Wohnung. Wir wohnten zu viert, meine Schwester Antonella hat geheiratet und ist bereits ausgezogen, in einer Wohnung in der Meister-Ekkehart-Straße in Lindenthal. Nach dem Tod meiner Mutter suchen mein Vater und ich eine etwas kleinere und vor allen Dingen eine etwas günstigere Wohnung. Und ich dachte, da Sie, Entschuldigung, da Du bei der Zeitung bist...“.
„Ich werde sehen, was ich tun kann. Schon möglich, dass ich Dir da behilflich sein kann.“
„Das ist wirklich sehr nett von Dir.“
„Mache ich gerne. Noch ein Wasser?“
„Nein, ich muss zurück ins Büro.“
„In Ordnung, sehen wir uns wieder?“
„Mir ist noch nicht nach Ausgehen, Werner. Versteh' das bitte nicht falsch, aber...“
„Schon gut, ich verstehe“
„Danke“
„Ich melde mich bei Dir, sobald ich etwas passendes gefunden habe“
„Danke, Werner. Und einen schönen Tag noch.“
Anmutigen Ganges verlässt Clarissa Kramer das Lokal.
„Mein lieber Mann! Die ist aber noch taufrisch, was?!“ kommentiert der Mann hinter dem Tresen das eben Gesehene.
„Bätes, mach' mir noch ein Kölsch.“, entgegnet Werner Schmitz.
*
Bis Anfang der 1970er Jahre wächst die Zahl der nach Deutschland kommenden Gastarbeiter weiter an. Das Konzept besteht ursprünglich darin, überwiegend junge Männer aus rückständigen Regionen zu rekrutieren und sie befristet zu den vergleichsweise hohen deutschen Löhnen arbeiten zu lassen. Anschließend würden sie als die sprichwörtlichen gemachten Männer in ihre Heimat zurückkehren. Wenngleich viele nach Ablauf ihres Vertrages heimkehren, nimmt die Zahl derjenigen zu, die bleiben. Sie holen ihre Familien nach Deutschland.
Für einen wachsenden Anteil der Arbeitseinwanderer steht eine kurzfristige Rückkehr in die Heimat nicht mehr auf der Tagesordnung.
Auch und nicht zuletzt, weil die Gastarbeiter in Deutschland überproportional gut verdienen. Ihre Erwerbsquote liegt daher deutlich über und ihre Arbeitslosenquote unter dem deutschen Durchschnitt.
Mit Bezug auf die Entlohnung ist es für die Gastarbeiter in den 1960ern von Vorteil, dass sie überproportional häufig in Großbetrieben beschäftigt sind, welche üblicherweise höhere Stundenlöhne zahlen als Kleinbetriebe. Das liegt daran, dass die Gastarbeiter vor allem in Branchen wie zum Beispiel der Eisen- und Metallerzeugung, dem Bergbau und der chemischen Industrie beschäftigt sind, welche von Großbetrieben dominiert sind (23).Auch Borna Krupcic profitiert von den guten Löhnen bei Ford, Monat für Monat kann er einen beträchtlichen Betrag zurücklegen. Was die Zukunft für sich und seine Familie betrifft, kann er es sich mittlerweile durchaus vorstellen, in Deutschland sesshaft zu werden. Wenngleich die Illusion, eines Tages zurückzukehren, bei ihm, wie bei vielen anderen Gastarbeitern auch, wach bleibt, sucht er bereits nach kurzer Zeit ein Zuhause und zieht schließlich aus der Gastarbeiterbaracke in eine Wohnung nach Köln-Chorweiler. Nach und nach richtet er sein neues Heim ein und hat dabei immer im Hinterkopf, dass seine Familie bald zu ihm zieht. Noch bleiben ihm nur die Telefonate nach Jugoslawien.
„Hallo Papa, was gibt es Neues in der Heimat?“
„Hier wird im Moment viel gebaut, Du würdest unser Viertel kaum wiedererkennen.“
„Na, so schlimm wird es wohl nicht sein.“
„Gut, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber es tut sich was in der Heimat.“
„Das muss es auch.“
„Tante Dunja kommt die Tage zu Besuch. Wir haben ihr Dein Zimmer hergerichtet.“
„Ihr habt mich wohl schon vergessen, was?! Das ging aber schnell.“, lacht Borna.
„Aus den Augen, aus dem Sinn...“
„Ja, ja. Ich habe meine Wohnung schon ein wenig eingerichtet und mir einige kleine Möbel gekauft. Zum Teil auch gebrauchte Stücke von einem Kollegen, der nach Jugoslawien zurückgegangen ist.“
„Schön.“
„Trotzdem – Ihr fehlt mir alle so, Papa.“
„Du fehlst uns auch, Junge. Deine Frau schläft schon, soll ich sie wecken?“
„Nein, lass mal. Ich habe gestern kurz mit ihr telefoniert, als Du unterwegs warst.“
„Ja, ich weiß.“
„Ich werde jetzt auch ins Bett gehen, morgen um 04:30 klingelt der Wecker.“
„Ich wünsche Dir eine gute Nacht, mein Sohn.“
„Danke Papa. Laku noc.“
*
Alfredo Bugno sitzt im Speisesaal der Casa di Cura. Zwölf Uhr, Mittagessen. Eine kleine Minestrone, dann Spaghetti all' arrabiata, als Dessert ein Erdbeereis. Mit dem Essen im Pflegeheim ist er durchaus zufrieden. Auch die Arbeit in der Behindertenwerkstatt macht ihm Spaß.
Mit seiner Tätigkeit bei Fiat zwar nicht zu vergleichen, aber immerhin ist er weiter handwerklich tätig. Er repariert Fahrräder aus dem Fundus des Heims, wird auch bei Reparaturen im Heimgebäude ab und an miteingebunden und entwickelt sich im Laufe der Monate quasi zum „Hausmeister“ des Heims. Alfredos vielfältige handwerkliche Fähigkeiten werden durchaus geschätzt. Die Tics, die ihn immer häufiger heimsuchen, fallen hier nicht weiter ins Gewicht, dass er infolge der Zuckungen länger für seine Arbeit braucht, ist in der Werkstatt des Heims egal.
Die Umstände seines Umzugs ins Pflegeheim hat Alfredo Bugno noch keinesfalls überwunden. Er hat die letzten Monate so erlebt, als wäre ihm der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Seinen Arbeitsplatz
bei Fiat hat er verloren. Hatte sein Chef, Mario Stroppa, nach Ausbruch der Erkrankung nicht mehrmals betont, dass er Möglichkeiten sieht, ihn anderweitig in der Firma einzusetzen? Was hat Stroppa wohl zum Umdenken bewegt? Alfredos Vermieter hat wie aus heiterem Himmel Eigenbedarf angemeldet und ihm die Wohnung gekündigt. Obwohl der Mann mehrere Mehrparteien-Miethäuser besitzt. Sehr ungewöhnlich, denkt sich Alfredo.
Dass Guiseppe Scirellis hinter all' dem steckt, ahnt Alfredo Bugno nicht einmal. Dieser hat ganze Arbeit geleistet. Als bei seinem Cousin das Tourette-Syndrom diagnostiziert wird, setzt er alle Hebel in Bewegung, den jungen Mann aus dem öffentlichen Leben zu entfernen.
Nachdem er Fiat-Fertigungsleiter Mario Stroppa unmissverständlich klar gemacht hat, dass er seinem Cousin die Kündigung auszusprechen hat, setzt er Alfredos Vermieter unter Druck, indem er ihm damit droht, sämtliche Objekte, die er besitzt, im Hinblick auf Beschädigungen und Sicherheitsrisiken zu kontrollieren. Beide beugen sich der Macht des Scirelli-Clans und funktionieren so, wie es in Guiseppes perfiden Plan passt.
Alfredo Bugno wird das Ansehen, wird den Ruf der Famiglia nicht beschmutzen.
*
Werner Schmitz nimmt der Aufbau der neuen Sportredaktion sehr in Anspruch. Er führt viele Gespräche, ist sehr akribisch in der Auswahl seiner potenziellen Mitarbeiter. Trotzdem bleibt die Zeit, sich intensiv um eine Wohnung für seine neue, junge Bekanntschaft und deren Vater zu kümmern. Er beschränkt sich dabei auf Objekte in den westlichen Stadtteilen Köln – schließlich wohnt er in Ehrenfeld und wer weiß: Vielleicht wird es sich ja irgendwann als praktisch erweisen, dass Clarissa Kramer in einem angrenzenden Stadtteil lebt...
Dank der Kontakte des aufstrebenden Journalisten ist schon bald etwas Passendes für die Kramers gefunden: eine schöne Zweizimmerwohnung in der Piusstraße in Köln-Lindenthal. Eine Genossenschaftswohnung zwar, die eigentlich nur die Mitglieder der Genossenschaft mit preisgünstigem Wohnraum versorgen soll, aber der kölsche Klüngel ist in den 60er Jahren in der Domstadt allgegenwärtig.
Für alle Nicht-Kölner: Als Kölner Klüngel, Kölscher Klüngel oder einfach Klüngel wird in Köln ein System auf Gegenseitigkeit beruhender Hilfeleistungen und Gefälligkeiten bezeichnet. "Man kennt sich und man hilft sich." So definierte der ehemalige Bundeskanzler und Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer den kölschen Klüngel (24).
Der Begriff Klüngel ist im Kölner Raum durchaus positiv besetzt, im Sinne von "eine Hand wäscht die andere", über Beziehungen verfügen oder "vernetzt" sein.
Werner Schmitz jedenfalls ist in den 60er Jahren in Köln bestens vernetzt: Ein Anruf bei der richtigen Stelle und er kann Horst und Clarissa Kramer die freudige Nachricht überbringen. Zwei Monate Wartezeit nehmen die Kramers für die günstige wie gemütliche Wohnung gern in Kauf. Nachdem das Wohnungsproblem gelöst ist, intensivieren Werner und Clarissa ihren Kontakt. Sie treffen sich regelmäßig, er nimmt sie mit auf diverse Sportveranstaltungen, zunehmend wird Clarissa auch Werners Begleitung bei gesellschaftlichen Anlässen.
Werner lebt noch in einem kleinen Appartement in der Lichtstraße, einem alten Arbeiterviertel in Ehrenfeld, im Nebenhaus seines Elternhauses. Er hat sich nach dem Krieg vornehmlich um seine Karriere als Journalist gekümmert und genießt darüber hinaus nach wie vor die Kochkünste seiner Mutter im Nebenhaus, die ihm auch die Wäsche macht. Als er diese einmal mehr in einem großen Kopfkissenbezug abholt, stellt ihn Mutter Elsa zur Rede.
„Und, hast Du das Mädchen von der Domplatte wiedergesehen?“
„Clarissa? Aber ja doch!“
„Das freut mich. Du wirst auch nicht jünger und so langsam wird es Zeit, dass Du mal mit einer jungen Dame sesshaft wirst. Oder willst Du ewig in dem kleinen Appartement neben Deinen Eltern wohnen bleiben?“
„Wollt ihr mich loswerden?“
„Aber nein, das weißt Du doch. Nur, jetzt, wo Du einen sicheren Arbeitsplatz hast und gutes Geld verdienst, denk' doch auch einmal an Dein Privatleben.“
„Das tue ich, Mama. Und gerade in den letzten Wochen umso mehr.“
„Wegen Clarissa?“
„Sei nicht so neugierig, Mama.“
*
Als Borna Krupcic in Novi Sad aus dem Zug steigt, staunt er nicht schlecht: Beinahe die gesamte Familie erwartet ihn. Sicher, mit seinen Eltern, seinen Geschwistern und natürlich mit seiner Ana und den zwei Kindern war zu rechnen. Aber dass auch seine Tanten, Onkel Cousins und Cousinen samt ihren Familien nahezu komplett erschienen sind, um ihn zu begrüßen, lässt Borna Krupcic beinahe die Fassung verlieren. Er weint hemmungslos, nimmt einen nach dem anderen in den Arm und hat Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. „Zahvaliti“, „Danke.“ schluchzt er mehrmals.
Bornas Eltern haben den Hinterhof ihres kleinen Häuschens bunt geschmückt, das Radio spielt heimische Musik, aus der Küche riecht es herrlich nach regionalen Köstlichkeiten. Nach und nach gesellen sich auch Nachbarn zu der feiernden Familie, es wird ein langer Abend.
„Borna, erzähl' doch mal, wie es Dir so ergangen ist“, ergreift Zlatko, ein guter Freund Bornas, das Wort.
„Wo soll ich anfangen, Zlatko? Es sind so viele neue Erfahrungen, so viele neue Menschen, die ich kennengelernt habe.“
„Und die Arbeit?“, fragt ein Freund der Familie.
„Ich arbeite bei Ford, einem großen Werk in Köln. Jeden Tag bis zu zehn Stunden. Schichtdienst, mal fange ich früh an, mal spät. Ich bin da in der Fertigung beschäftigt, ich montiere Autoteile. Man muss dort sehr schnell arbeiten, das kannte ich bisher nicht. Ich habe mich aber ganz gut daran gewöhnt mittlerweile.“
„Und wie gefällt Dir die Stadt?“, möchte ein anderer Gast der Krupcics wissen.
„Die Stadt...wie soll ich sagen, irgendwie besonders ist sie. Die Leute sind sehr offen und es wird viel gelacht. Man feiert auch viel. Und an Karneval...“
„An was ?!“ fragt Zlatko.
„Karneval. Das ist ein Fest in Köln, einmal im Jahr, meistens im Februar. Da verkleiden sich die Leute und ziehen durch die Straßen, sechs Tage lang!“
„Warum machen die das?“
„Das weiß ich auch nicht, aber die ganze Stadt feiert diesen Karneval sehr ausgiebig, Jahr für Jahr.“
„Und wie hältst Du es ohne Dein geliebtes pivo aus? Ozujsko wirst Du ja in Deutschland kaum bekommen...“
„Wisst Ihr, es ist mir beinahe unangenehm, es so deutlich zu sagen, aber in Köln gibt es ein Bier … dafür lasse ich selbst mein Ozujsko stehen.“
„Nicht Dein Ernst?!“ echauffiert sich Onkel Nenad.
„Es nennt sich Kölsch und man trinkt es aus kleinen Gläsern.“
„Kleine Gläser?“
„Ja, nicht mal die Hälfte von unseren Gläsern.“
„Hahaha, Borna, bestellst Du dann immer drei auf einmal?“, Onkel Nenad gibt keine Ruhe.
„Lacht Ihr nur, Ihr wisst nicht, was Ihr verpasst. Ich bringe nächstes Mal, wenn ich heimkomme, ein paar Flaschen mit, wenn ich mit Filip Krastic im Auto statt mit dem Zug fahre, vielleicht sogar ein „Pittermännchen.“
„Ein was?!“ rufen gleich mehrere Zuhörer aus.
„Ein Pittermännchen. Ein Zehnliterfass Kölsch.“
„Und warum heißt das so?“
„Keine Ahnung. Aber auch das werde ich bestimmt noch erfahren.“
Es ist spät geworden auf dem Hinterhof der Krupcics.
Borna geht in die Küche und hilft seiner Frau beim Aufräumen.
So gut Borna die überraschende Feier anlässlich seiner Rückkehr auch gefallen hat – endlich ist er mit Ana allein.
Er umarmt seine Frau mit Inbrunst, welche dieser ein leises „Aua“ entlockt.
„Wie habe ich das vermisst.“
„Und ich erst.“
„Sobald es den Kleinen zuzumuten ist, kommt ihr nach.“
„Ja, aber lass' sie erst einmal in ihrem gewohnten Umfeld ein bisschen größer werden.“
„Natürlich, das haben wir ja so abgesprochen.“
Borna küsst seine Frau leidenschaftlich und freut sich auf die bevorstehende Nacht im Ehebett.
*
Francesca Tardea, ältere Schwester von Amanda, reist alleine zur Beerdigung Amandas an. Der Rest der Familie bleibt in Italien – auch aus Trotz. Die Famiglia war wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass Amanda in der Heimat ihre letzte Ruhe finden soll, doch Horst Kramer hat sich anders entschieden.
Der Kontakt Francescas zu ihrer Schwester hatte sich über die Jahre zunehmend reduziert. Seit Amanda in Deutschland lebte, telefonierten die beiden höchstens einmal im Monat miteinander, ab und an schrieben sie sich einen längeren Brief. Dass Francescas Schwester Italien für immer verlassen hat, konnten viele Mitglieder der Familie nicht verstehen. Der Clan der Scirellis und Tardeas ist wohlhabend, in Norditalien hoch angesehen, man verfügt über Grundbesitz und viele Familienmitglieder arbeiten in bedeutenden Positionen in Politik und Wirtschaft. Trotzdem hat sich Francescas Schwester Amanda dafür entschieden, ihr Leben an der Seite Ihres Mannes in Köln zu verbringen.
Horst Kramer ist Inhaber eines Malereibetriebes, eines kleinen Familienbetriebes, gegründet von seinem Vater Friedrich. Er ist der einzige männliche Nachkomme Friedrich Kramers und bringt es nicht über das Herz, den Betrieb aufzugeben und seine Heimatstadt zu verlassen.
Der Melaten-Friedhof ist der Zentralfriedhof von Köln. Er liegt im Stadtbezirk Köln-Lindenthal. Der „hoff to Malatan“, der 1243 erstmals urkundlich erwähnt wird, ist ursprünglich ein Heim für Kranke und Aussätzige, Am 29. Juni 1810 weiht der Dompfarrer Michael Joseph DuMont den Melaten-Friedhof ein. Das erste Begräbnis findet hier am 1. Juli 1810 statt (25).
Francesca Tardea steht nach der Beisetzung noch eine Weile am Grab ihrer Schwester. Sie möchte allein von ihr Abschied nehmen und hat die Einladung Horst Kramers zum obligatorischen Trauerkaffee nach der Beerdigung abgelehnt. Gesenkten Hauptes betet Francesca für die verstorbene Schwester. Sie muss an gemeinsame Kindheitserinnerungen denken, an die Urlaube am Lago di Garda oder auf dem Bauernhof, an manche Streiterei um Nichtigkeiten, an die ersten Männerbekanntschaften, die beide machten. Amanda war erst 57 Jahre alt – kein Alter zum Sterben eigentlich. Behutsam legt Francesca Tardea eine Gerbera, Amandas Lieblingsblume, auf das frische Grab.
„Dio ti benedica. Gott segne Dich“, verabschiedet sich Francesca ein letztes Mal von ihrer Schwester.
*
Werner Schmitz hat die Sportredaktion der Kölnischen Umschau neu strukturiert. Zunehmend etablieren sich in der Nachkriegszeit Fußball- und andere Sportvereine in Köln und Umgebung, das Ausmaß der Sportberichterstattung wächst stetig. Jetzt, wo die Zeitung neue Mitarbeiter eingestellt hat, hat Werner endlich die Zeit, sich auch um sein Privatleben zu kümmern, und hier vor allen Dingen um seine „Domplattenbekanntschaft“ Clarissa.
Die beiden unternehmen viel zusammen, kommen sich schließlich näher und genießen ihr noch junges Glück. Clarissa interessiert sich durchaus für Sport, Werner freut es sehr, auf seinen Besuchen von Fußballspielen, Boxkämpfen und anderen Sportereignissen eine attraktive, interessierte und durchaus kompetente Begleiterin präsentieren zu können. Der beträchtliche Altersunterschied von gut zwanzig Jahren macht beiden nichts aus. Clarissa hat reife Männer schon immer interessant gefunden und Werner fühlt sich lange noch nicht so alt, wie es ihm sein Personalausweis glauben machen will.
Horst Kramer sieht die Beziehung seiner jüngeren Tochter zum Zeitungsmann mit gemischten Gefühlen. Einerseits freut er sich für seine Tochter, andererseits befürchtet er, dass Clarissa mit Werner zusammenziehen könnte. Alleine zu leben kann er sich nach dem Tod seiner Frau Amanda kaum vorstellen. An den Wochenenden sieht Horst Kramer seine Tochter ohnehin kaum noch, weil sie ständig mit ihrem neuen Freund auf Sportveranstaltungen unterwegs ist. Schon dieser Verzicht fällt ihm schwer.
Zumal Horst Kramer auch seine ältere Tochter Antonella kaum noch einmal zu Gesicht bekommt. Auch diese hat ihr Glück in Köln gefunden.
Antonella Kramer hat stets konkrete Vorstellungen, ihren künftigen Ehemann betreffend, gehabt: Gut betucht sollte er sein, eine repräsentative Stellung in der Gesellschaft innehaben, zu den 'oberen zehntausend' gehören. In einem Cafe in der Innenstadt trifft sie schließlich eines Tages auf den windigen Vertreter Bernhard. Eigentlich ist der so ganz anders als es Antonella vorschwebt, Ruf und Ansehen sind ihm nicht wichtig. Bernhard ist eher der Typ Lebemann, gibt nichts auf Etiketten, ein bisschen Abenteurer, ein klein wenig Rebell. Nicht unbedingt der Typ Mann, der einem eine sichere Zukunft verspricht. Trotzdem heiratet Antonella Bernhard, den Bedenken ihres Vaters, der nicht allzu viel vom neuen Schwiegersohn hält, zum Trotz. Bernhard und Antonella ziehen gemeinsam in eine Wohnung am Rathenauplatz, nur gute zwei Kilometer entfernt von der Wohnung ihrer Schwester in Braunsfeld. Trotz der räumlichen Nähe hält sich der Kontakt der Schwestern in Grenzen. Von Kindesbeinen an stehen sich die beiden nicht sonderlich nah, zu verschieden sind ihre Wesenszüge. Während Antonella sich als gern als „Grand Dame“ präsentiert, viel Wert auf Kleidung, Kosmetika und gesellschaftliche Reputation legt, und gerne hofiert wird, ist Clarissa eher der natürliche Typ Frau, sie liebt die Natur, packt gern im Haushalt mit an, interessiert sich für Sport, liebt Hunde und Pferde und bewegt sich auch selbst viel.
Antonella versucht hin und wieder, den Kontakt der beiden ein wenig zu intensivieren. Ab und an lädt Sie ihre Schwester und deren Mann zu sich nach Hause ein. Nur selten jedoch sagt Clarissa zu. Sie wird nicht müde, zu betonen, dass ihre Schwester und sie einfach kaum etwas gemeinsam hätten. Und entgegen Ihrer Empfindungen und Überzeugungen zu handeln, regelmäßigen Kontakt zur Schwester nur zu halten, weil es halt ihre Schwester ist, widerstrebt Clarissa.
So leben beide ihr Leben, ohne viel vom Befinden der jeweils anderen mitzubekommen. Schon in der elterlichen Wohnung, in der sie knappe zwanzig Jahre gemeinsam lebten, hatten sie sich wenig zu sagen. Jetzt, wo sie beide einen eigenen Haushalt führen, ist es noch weniger.
*
In Jugoslawien wird derweil der nächste Umzug ins „gelobte Land“ vorbereitet. Davor Krupcic, Bruder des sechs Jahre älteren Borna, wird gleichfalls seine Zelte in der Heimat abbrechen und dem Ruf Deutschlands nach Arbeitskräften folgen. Die Produktion im Ford-Werk Köln läuft blendend, Borna Krupcic hat sich durchaus bewährt, sodass Kurt Fröhlich, Produktionsleiter und Chef Bornas, dessen Wunsch, seinen Bruder nach Köln zu holen, nachkommt und Davor Krupcic eine Stelle anbietet.
Davor kann es kaum erwarten, mit seinem Bruder in der großen deutschen Firma zu arbeiten. Er vergöttert Borna, ist dieser doch genau so, wie er gern wäre, aber nicht ist. Groß und stark, ein guter Sportler, selbstbewusst, bei allen beliebt, beruflich erfolgreich. Davor selbst ist eher schüchtern und zurückhaltend und hat bislang im Leben nicht viel erreicht. Er lebt mit sechsundzwanzig Jahren noch bei den Eltern, hat keine Freundin und vor kurzem den Job verloren.
Lange hat sich Davor geziert, seine Heimat zu verlassen und als Gastarbeiter in Deutschland sein Geld zu verdienen. Jetzt, wo er in der gleichen Firma wie sein Bruder arbeiten und sogar erst einmal bei diesem in der Wohnung leben darf, ist er endlich dazu bereit.
Enver Krupcic hilft seinem Sohn, die Sachen für den Umzug zu packen.
„Davor, willst Du diese Kiste mit den Büchern wirklich mitnehmen?“
„Borna hat einen Keller!“
„Denkst Du wirklich, Du findest die Zeit, zu lesen?“
„Papa...“ „Fühlt sich das für Dich nicht an, als würden wir Dich verlassen, einer nach dem anderen“.
„Ihr tut das Richtige, glaub' es mir. Das ist das Beste für Eure Zukunft.“
„Vielleicht zwei, drei Jahre, Papa, dann kommen Borna und ich zurück.“
„Ich bin mir gar nicht sicher, dass Borna zurückkehren wird.“
„Wie kommst Du darauf?“
„Er will ja Ana und die Kinder nach der Grundschule zu sich holen. Deutschland hat viel zu bieten, gerade auch für junge Menschen. Gut möglich, dass die Kinder und auch Ana am Ende gar nicht zurückwollen.“
„Aber Borna will zurück – bestimmt!
„Er hat einen guten Job bei Ford. Den gibt man nicht so einfach auf.“
„Mag sein. Aber ich – ich komme zurück, Papa. Auf jeden Fall.“
„Warte es mal ab. Vielleicht gefällt Dir die Arbeit so gut, Du lernst in Deutschland auch ein Mädchen kennen und willst gar nicht mehr weg.“
„Nein, Papa. Ich komme zurück nach Hause.“
„Die Tür steht Dir jederzeit offen, mein Sohn.“
*
Francesca Tardea fällt nach der Beerdigung ihrer Schwester in ein tiefes Loch. Erst jetzt bemerkt sie, wie sehr sie sich in den letzten Jahren mehr Kontakt zu der Verstorbenen gewünscht hätte, wie viel zwischen beiden letztendlich unausgesprochen blieb. Erst als sie erfährt, dass Clarissa schwanger ist, hellt sich ihre Stimmung ein wenig auf.
Der Lago di Bolsena ist in den 60er Jahren ein Insiderziel für Italiener. Hier findet man urige italienische Dörfer, unberührte Natur, und malerische Landschaften am Rande der Toskana. Francesca Tardea sitzt im Ferienhaus der Familie und strickt. Es ist eine alte Sitte in der Familie, Neugeborene mit selbst gestrickten Kleidungsstücken auf der Erde willkommen zu heißen. Das Telefon klingelt.
„Ciao, zia preferita.“
„Lieblingstante? Du hast doch nur eine...“, Francesca lacht. „...ciao, Clarissa.“
„Wie geht es Dir und was wachst Du gerade schönes?“
„So langsam geht es wieder, danke. Ich stricke. Die ersten Söckchen sind fertig. Jetzt mache ich mich an einen Strampler.“
„Ach, Francesca, da bist Du aber früh dran.“
„Es gibt ja noch genug andere Sachen, die man erledigen muss, bevor der principe oder die principessa kommt.“
„Du bist lieb, Francesca. Manchmal fehlt Ihr mir doch alle sehr.“
„Du wolltest es ja nicht anders, Clarissa.“
„So einfach war es nicht. Ich konnte ja nicht nur an mich denken.“
„Werner hätte auch hier arbeiten können. Wir haben gute Kontakte, das weißt Du.“
„Ja, sicher. Aber er hat sich hier gerade in der Zeitung etwas aufgebaut. Ich verstehe, dass Werner das nicht aufgeben möchte.“
„Und wenn wir ihm eine Arbeit besorgen, wo er weniger arbeiten müsste, um genau so viel zu verdienen?“
„Auch dann würde er sich für die Zeitung entscheiden.“
„Euch ist nicht zu helfen“, lacht Francesca.
„Ja, so sind „wir Kölner“, auch Clarissa lacht.
„Wir Kölner? Fühlst Du Dich etwa schon als Kölnerin?“
„Ein bisschen schon...“.
„Clarissa, Clarissa...“.
„Komm' uns doch mal für eine längere Zeit besuchen, vielleicht willst Du dann auch gar nicht mehr weg.“
„Das mache ich. Wenn das Kind da ist. Versprochen.“
„Ich nehme Dich beim Wort, zia.“
„Nun aber zum Thema: Wie geht es Dir? Wie geht es dem Kind?“
„Zweimal die gleiche Antwort: Benissimo! Bestens!“
„Das freut mich zu hören.“
„Ich passe auch sehr auf mich auf. Viel frische Luft, keine Zigaretten, beim Stammtisch trinke ich nur Wasser.“
„Ich weiß, dass Du das tust, liebes.“
„Du, ich rufe Dich eigentlich an, um Dir zu sagen, dass wir planen, nach der Geburt des Kindes für ein oder zwei Wochen nach Italien zu fahren.“
„Nach Italien? Du meinst, zu uns?“
„Nicht direkt. Natürlich kommen wir Euch auch besuchen. Aber Werner will erst einmal die Toskana kennenlernen: Pisa, Siena, Viareggio. Auch für zwei der drei Tage nach Elba rüber wollen wir.“
„Das kann ich verstehen. Aber danach bleibt Ihr mindestens drei Tage bei uns, darauf bestehe ich! Schließlich muss der Kleine seine Großtante - nennt man das so? -, kennenlernen.“
„Ich werde sehen, ob sich das einrichten lässt...“
„Halt' mich auf dem Laufenden, was die Schwangerschaft betrifft. Ich will jede Kleinigkeit wissen, hörst Du?!“
„Ist in Ordnung, Tante Francesca, das mache ich.“
„Grüß' Antonella von mir. Sie hält ja überhaupt keinen Kontakt mehr zur Famiglia.“
„Ich habe auch kaum Kontakt zu ihr, obwohl sie nur vier Kilometer entfernt wohnt. Wir waren immer schon grundverschieden, das weißt Du.“
„Ja. Da die eitle Antonella...“
„...genau, immer hübsch angezogen, viel Zeug im Gesicht und die Haare toupiert...“, Clarissa lacht.
„Und da die rastlose Clarissa...“
„...die ihre Zeit am liebsten damit verbrachte, Hunde der Nachbarn auszuführen, Fahrrad zu fahren oder auf dem Bauernhof zu arbeiten.“