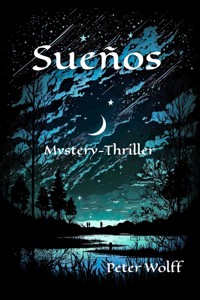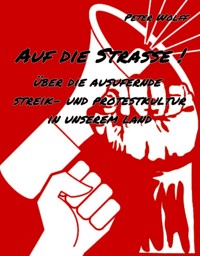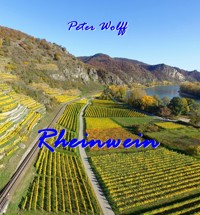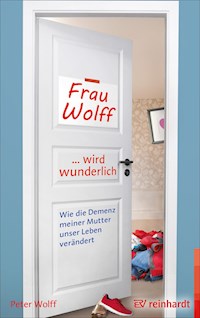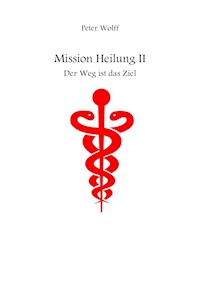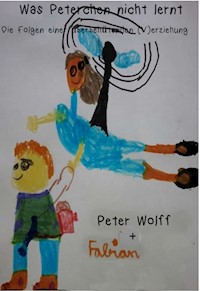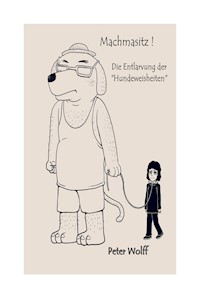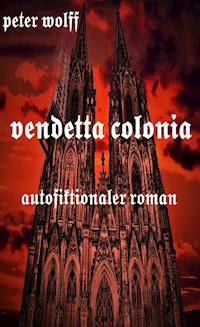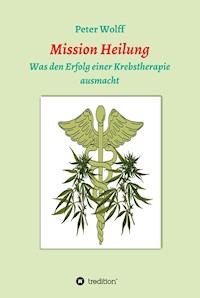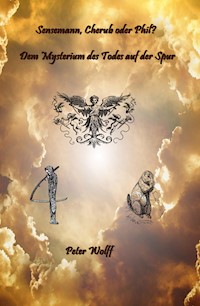
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Tod ist allgegenwärtig – und doch vergessen wir ihn von Geburt an. Haben wir Glück, meldet er sich erst Jahrzehnte später wieder in unserem Leben zurück. Zunächst meist, indem er uns liebgewonnener Menschen beraubt. Später dann in Form einer Krankheit, die medizinisch als unheilbar gilt: Krebs, Schlaganfall, Herz-/Kreislauferkrankungen oder ein Organversagen. Er zwingt uns damit, uns eine Frage zu stellen, die neben jenen, woher wir kommen und wer wir sind, zu den ältesten ungelösten Geheimnissen der Menschheit gehört: Wohin gehen wir? Wie geht es nach unserem irdischen Ableben weiter? Gibt es überhaupt ein Dasein nach dem Tod? Und sollte dem so sein – in welcher Form? Wiedergeburt? Weiterexistenz? Oder doch komplette Vernichtung von Leib und Geist? Das sind existenzielle Fragen, die in der Menschheitsgeschichte immer wieder diskutiert und ganz unterschiedlich beantwortet wurden. Die Antwort, die wir für uns finden, hat bisweilen entscheidende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir leben und handeln. 'Sensenmann, Cherub oder Phil – dem Mysterium des Todes auf der Spur" vermittelt Sachwissen, nennt Fakten und Indizien und gibt vielfältige Denkanstöße, die den Leser, inspirieren, sich eine eigene Meinung über das, was uns alle irgendwann erwartet, zu bilden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Peter Wolff
Sensenmann, Cherub oder Phil ? Dem Mysterium des Todes auf der Spur
Dem Mysterium des Todes auf der Spur
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
06 Der Glaube an ein Leben nach dem Tod in den Weltreligionen
12 Schluckspecht aus der Zwischenwelt
20 Rückführung in ein früheres Leben
23 Nahtoderfahrungen von Kindern
32 Ideelle Unsterblichkeit
33 Jesus reloaded 1
Impressum neobooks
06 Der Glaube an ein Leben nach dem Tod in den Weltreligionen
Der Tod ist allgegenwärtig – wir verdrängen ihn von Geburt an, doch er meldet sich allmählich wieder in unserem Leben zurück.
Der uns alle erwartende Hinschied zwingt uns, uns die Frage zu stellen: Wie geht es nach unserem irdischen Ableben weiter?
Wer wird es sein, der uns nach unserem letzten Atemzug in Empfang nimmt? Der Sensenmann, die Allegorie des Todes, Cherub, der Wächter über das ewige Leben im Garten Eden oder grüßt uns Phil, das Murmeltier. heißt: erleben wir den Kreislauf von Geburt, Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter und Tod wieder und wieder?
Die Antwort, die wir für uns finden, hat bisweilen entscheidende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir leben und handeln.
„Sensenmann, Cherub oder Phil? Dem Mysterium des Todes auf der Spur“' ist ein erzählendes Sachbuch, dessen zentrales Thema die viel-fältigen Ansätze sind, das Mysterium des Todes zu entschlüsseln. Um sich als völlig neutraler, vorbehaltloser Mensch der Frage „was kommt danach?“ bestmöglich anzunähern.
Immer wieder lässt der Autor den Leser an seinen Erlebnissen und Emotionen auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage aller Fragen teilhaben. Dies stets mit einem Augenzwinkern, was dem Werk auch eine humoristische Note vermittelt.
So entsteht ein Buch, das nicht nur Wissen tradiert, sondern auch großes Lesevergnügen bereitet.
PETER WOLFF, studierter Betriebswirt, war früher als Gruppenleiter im Controlling, Geschäftsführer einer Entsorgergemeinschaft und als Leiter der Seminarplanung in der Erwachsenenbildung tätig. Heute widmet er sich dem Schreiben von erzählenden Sachbüchern und Belletristik.
Sensenmann, Cherub oder Phil ?
Dem Mysterium des Todes auf der Spur
© / Copyright 2022 Peter Wolff
Umschlaggestaltung, Illustration: Peter Wolff
Ebook: B0BG51RBRP
Paperback: B0BGN68KLP
Zitate am Beginn aller Themenbereiche: Woody Allen
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung oder Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Mensch besitzt im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen in der Natur das Privileg, von seinem eigenen Tod zu wissen und sich mit diesem auseinandersetzen zu können.
Inhalt
I Gestatten, der Tod
01 Mechanik und Biochemie des Todes 12
02 Der Tod und das Leben danach im Spiegel der
Menschheitsepochen 19
II Das Leben danach im Fokus der
Naturwissenschaften
03 Das Leben nach dem Tod aus 23
materialistsicher Sicht
04 Gibt es wirklich nur eine Wahrheit? 27
05 Warum hoffen wir auf ein Leben nach 29
dem Tod?
III Das Leben nach dem Tod im Spiegel der
Weltreligionen
06 Der Glaube an ein Leben nach dem Tod in den 34
Weltreligionen
07 Religionen, die nicht an ein Leben nach dem 52
Tod glauben
08 Drei mögliche Antworten 57
IV Bestimmen wir unser Nachtodschicksal selbst?
09 Erlebt jeder das, was er erwartet? 62
10 Können wir uns frei entscheiden, wie es mit 66
uns weitergeht?
V Leben in der Zwischenwelt
11 Rückführungen in das Zwischenleben 69
12 Schluckspecht aus der Zwischenwelt 78
13 Lernen als Zweck unseres Daseins? 80
VI Ewiges „Leben“ im Jenseits
14 Vom Tode zurückgekehrt – Nahtoderfahrungen 84
15 Außerkörperliche Erfahrungen 106
16Träume als Beleg für ein Leben nach dem Tod? 110
17 Wahrnehmung des Sterbeprozesses 115
18 Menschen mit medialen Fähigkeiten – Zeichen 120
aus dem Jenseits
VII Kommen wir alle wieder zurück?
19 Reinkarnation 142
20 Rückführung in ein früheres Leben 149
21 Anzeichen dafür, dass man schon einmal 154
gelebt hat
VIII Kinder als Zeugen für ein Leben nach dem
Tod
22 Machen Kinder mehr spirituelle Erfahrungen 165
23 Nahtoderfahrungen von Kindern 167
24 Kinder als Zeugen für die Hypothese der 170
Reinkarnation?
IX „Wuff und miau“ – gibt es ein Leben nach
dem Tod für Tiere?
25 Haben auch Tiere eine Seele? 178
26 Gibt es Reinkarnation von Tieren? 184
X Quantenphysik – Nicht-lokales Bewusstsein als
Beweis für ewiges Leben?
27 Die Grundlagen der Quantenphysik 189
28 Bestätigt die Quantentheorie die Existenz eines
Lebens nach dem Tod? 194
29 Das Dr.Fritz-Phänomen 202
XI Überwindung von Alter, Krankheit und Tod –
Vision oder Fiktion?
30 Das Altern 208
31 Eine Gesellschaft der Methusaleme? 214
32 Ideelle Unsterblichkeit 220
33 Jesus reloaded 1 228
34 Physische Unsterblichkeit 230
35 Jesus reloaded 2 240
36 Ewiges Leben a la carte – eine erstrebenswerte 242
Option?
Schlussgedanken – quid erit? 253
Prolog
Als es absehbar war, dass die Lebenszeit meines Vaters sich dem Ende zu neigte, nahm ich mir fest vor, noch das ein‘ oder andere mit ihm zu be-sprechen. Schließlich hatten wir an die fünf Jahrzehnte nur eine äußerst oberflächliche Kommunikation geführt – zu 85%, der Wert ist noch niedrig gegriffen, ging es um Fußball.
Leider blieb es beim Vorsatz – mit einer Ausnahme. Eines Nachmittags saßen wir beim Kölsch zusammen in dem kleinen Zimmer, welches er in einem Pflegeheim im Kölner Süden bewohnte, und schauten - na was wohl? – Fußball. Es war der erste Tag der christlichen Woche und so ließen die sonntäglichen Standardfragen, derer sich sonst regelmäßig meine Frau erfreuen durfte, nicht lange auf sich warten: „War die Ewa in der Kirche?“ „Und was hat er gepredigt?“ Ich beantwortete beide Fragen nach bestem Gewissen und setzte, wo wir doch gerade beim Thema waren, noch einen obendrauf.
„Meinst Du eigentlich, dass nach dem Tod noch irgendwas kommt?“, frug ich ihn, mir eines positiven Feedbacks mehr als sicher.
„Da is‘ nix“ erhielt ich prompt und unmissverständlich zur Antwort.
Mein Vater war regelmäßiger Kirchgänger. Vor Ort betete er inbrünstig und bekundete der Gemeinde schmetternd, dass „Ein Ros‘ entsprungen“ sei. Er schaute sich sogar den ein‘ oder anderen Gottesdienst im Fernsehen an. So habe ich es eigentlich nie hinterfragt, dass er den christlichen Glau-ben bezeugt. Und dann das! Es ist schon so eine Sache mit dem Glauben an ein Leben nach dem Tod…
Der Tod ist allgegenwärtig – und doch vergessen wir ihn von Geburt an. Haben wir Glück, meldet er sich erst Jahrzehnte später wieder in unse-rem Leben zurück. Zunächst meist, indem er uns liebgewonnener Men-schen beraubt. Später dann in Form einer Krankheit, die medizinisch als unheilbar gilt: Krebs, Schlaganfall, Herz-/Kreislauferkrankungen oder ein Organversagen.
Er zwingt uns damit, uns eine Frage zu stellen, die neben jenen, woher wir kommen und wer wir sind, zu den ältesten ungelösten Geheimnissen der Menschheit gehört: Wohin gehen wir? Wie geht es nach unserem irdi-schen Ableben weiter? Gibt es überhaupt ein Dasein nach dem Tod? Und sollte dem wirklich so sein – in welcher Form? Wiedergeburt? Weiter-existenz? Oder doch komplette Vernichtung von Leib und Geist?
Das sind existenzielle Fragen, die in der Menschheitsgeschichte immer wieder diskutiert und ganz unterschiedlich beantwortet wurden. Die Ant-wort, die wir für uns finden, hat bisweilen entscheidende Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir leben und handeln.
Verantwortungsvollen und hilfsbereiten Menschen verspricht der Ko-ran für die Zeit nach dem Tod das Paradies, den Männern zudem auch eine große Anzahl Jungfrauen. Die Faszination, die diese Aussicht ausübt, ist offenbar so stark, dass junge Muslime, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, bereit sind, in den Tod zu gehen. In dem sie sich als Selbst-mordattentäter in die Luft sprengen oder in aussichtslose Kriege ziehen.
Der Tod ist nicht das Ende, sagen praktisch alle Glaubensgemeinschaf-ten. Alle versprechen uns ein Leben im Paradies oder, wenn schon nicht das, dann zumindest die Wiedergeburt. Zum imposanten Zeugnis für sol-chen Glauben ragen die 4500 Jahre alten Pyramiden von Giseh ebenso in den Himmel wie die Minarette der Al-Haram-Moschee von Mekka, die goldene Kuppel der Isaakskathedrale in St. Petersburg oder die Türme von Notre Dame in Paris und des Kölner Doms.
„Beweise für ein Leben nach dem Tod“, „7 Gründe für ein Leben nach dem Tod“, „Wege zur Unsterblichkeit“, „Den Himmel gibt’s echt“, „Das Leben im großen Jenseits“, „Jenseitige Welten“, „Das neue Leben nach dem Tod“, „Wir sterben nie“. Die Sache scheint klar zu sein. Ja, es gibt ein Leben nach dem Tod! Wie sonst ist es zu erklären, dass sich bei Amazon, Thalia und Konsorten unzählige Bücher finden, deren Autoren eben dies behaupten, jedoch nicht ein einziges, welches bereits im Titel zum Aus-druck bringt, dass der Vertreter der schreibenden Zunft vom Gegenteil überzeugt ist. Darüber hinaus muss man schon sehr intensiv suchen, um wenigstens das ein oder andere Werk ausfindig zu machen, dass zumin-dest als Teilaspekt die Vorstellung vom nicht-existenten Leben nach dem Tod zum Thema hat.
Ist ja auch ein durchaus anreizendes Dogma, dass es für uns alle weiter-geht. Offeriert es doch Herzenstrost, Zuversicht und Halt. Da können wir allesamt ja beruhigt und gelassen dem entgegensehen, was da nach unse-rem Ableben mit uns passiert. Und so glauben Milliarden Menschen auf dieser Welt an ihr Fortbestehen nach dem Tod. Ihre Zuversicht schöpfen sie dabei unter anderem aus religiösen, philosophischen und spirituellen Quellen.
Mir gelingt dies bislang nicht. So treiben mich meine inneren Zweifel dazu, der Sache auf den Grund zu gehen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich bin ein äußerst lebensfroher, fröhlicher Mensch, der nichts lieber glauben würde, als dass da etwas wä-re, wenn wir für immer (?) die Augen schließen. Folglich ist dann auch die Intention, in der ich dieses Buch schreibe, keinesfalls die, den festen Glau-ben an ein Leben nach dem Tod zu widerlegen.
Im Gegenteil: Ich hoffe sehnlichst, dass ich irgendwo Anhaltspunkte dafür finde, dass „da“ wirklich „etwas ist“ und wäre entzückt, wenn ich mich im Rahmen des Schreibens eben davon überzeugen könnte.
Die Erfolgsaussichten meiner Suche indes sind wohl eher gering, wenn man der Bevölkerung Glauben schenken kann. Denn der Glaube an ein Leben nach dem Tod sinkt stetig.
Doch ich lasse mich nicht entmutigen. So fange ich an, dieses Buch zu schreiben und habe keinen blassen Schimmer, zu welcher Erkenntnis ich gelange. Es verhält sich fast wie mit einer langen Reise: Ich fahre los und weiß nicht, was mich an den unterschiedlichen Stationen meines Trips er-wartet. Ich mache mich auf die Suche und bin mindestens so gespannt wie Sie, wo meine Reise hinführt und wie sie letztlich endet.
Wer wird es sein, der uns nach unserem letzten Atemzug in Empfang nimmt? Der Sensenmann, die Allegorie des Todes, Cherub, der Wächter über das ewige Leben im Garten Eden oder grüßt uns Phil, das Murmeltier aus dem famosen Hollywood-Streifen, heißt: erleben wir den Kreislauf von Geburt, Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter und Tod wieder und wie-der?
Lassen Sie uns starten!
Köln, im Frühjahr 2022
Peter Wolff
I Gestatten, der Tod!
„Ich habe keine Angst vor dem Sterben.
Ich möchte nur nicht dabei sein, wenn’s passiert“
01 Mechanik und Biochemie des Todes
Ja, ja, der Tod. Wir sollen uns mit ihm befassen, legen uns Psychologen und Philosophen eindringlich ans Herz. Denn der Sensenmann kommt ir-gendwann um die Ecke. Um meine. Und auch um Ihre.
Trotzdem versuchen fast alle Erdenbürger, ihn zu verdrängen, ihn, soweit es eben geht, nicht an sich heranzulassen, ja, nicht einmal an ihn zu denken. Kurzum: Wir leben unser Leben so, als wäre der Tod nicht exi-stent. So, als wären wir nicht etwa vergänglich, sondern von dauerhafter Natur.
Der Mensch will sich nicht damit abfinden, dass sein irdisches leben endlich ist. Den meisten von uns fällt es bereist schwer, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Weil es Unbehagen bereitet, mit der eigenen Ver-gänglichkeit konfrontiert zu werden. Und heißt es nicht gar, dass man das, woran man am meisten denkt, geradezu anzieht? Vielleicht ist das der Grund, wa-rum unser Unterbewusstsein partout nichts von Freund Hein wissen will. Der Selbsterhaltungstrieb weist die Ratio in die Schranken.
Trotzdem müssen wir bereits in jungen Jahrem beobachten, dass Menschen keinesfalls ewig leben. So hat der Homo Sapiens diverse Theo-rien entwickelt, die die Begrenztheit des menschlichen Lebens schlicht und ergreifend negieren, und uns glauben machen, dass wir letzten Endes doch ewig leben: in Form einer Weiterexistenz im Himmel oder einer Wieder-geburt.
Auch bemühen wir beschönigende Analogien, um uns das, was uns irgendwann unweigerlich erwartet, halbwegs erträglich zu denken. Es wird schlichtweg bestritten, dass der Sterbeprozess als solches und der Tod tragische Ereignisse sind. Im Gegenteil: Der Hinschied wird mit ange-nehmen Erfahrungswerten unseres Erdenlebens assoziiert. Denken wir an das Korrelat zwischen Tod und Schlaf. Sterben, so möchten wir uns glau-ben machen, ist wie einschlafen.
Bereits in der griechischen Mythologie sind nach Hesiod und Homer Schlaf und Tod die Zwillingssöhne der Nacht. So berichtet Hesiod in sei-ner umfassenden Theogonie von den Kindern der Nyx (Nacht), zu denen er auch Thanatos (Tod) Hypnos (Schlaf), sowie die Oneiren (Träume) zählt. Und Homer weist in der Ilias darauf hin, dass Thanatos und Hypnos nicht lediglich als Brüder, sondern vielmehr als Zwillinge zu gelten haben: „Und entsend ihn mit raschen Geleitern, dass sie ihn tragen, / Schlaf und Tod, den Zwillingsbrüdern, die ihn dann eilends / Niedersetzen in Lyki-ens weitem und blühendem Lande“ (01).
Dieselbe Analogie findet sich auch heute noch in der Umgangssprache, derer wir uns bedienen, so sprechen wir vom „Hinüberschlafen“ in den letzten Lebenstagen unserer Lieben und vom „Einschläfern“ unserer Haus-tiere. Wohl ignorierend, dass der Tod nach herrschender wissenschaftli-cher Meinung die unwiederbringliche Vernichtung der bewussten Exi-stenz irdischer Geschöpfe ist und damit aber auch rein gar nichts mit po-sitiv assoziierten Dingen wie Schlafen zu tun hat. In Morpheus`Armen zu liegen ist einzig und allein aus dem Grunde ein Wohlgefühl, weil wir uns sicher sind, dass uns darauf ein Erwachen ereilt.
Wie dem auch sei: Der Mensch klammert sich an derartige Verheißun-gen und Beschönigungen, weil sie es ihm erlauben, im Angesicht des un-weigerlich herannahenden Armageddons seinen irdischen Weg fortzuset-zen.
Insbesondere, wenn man noch recht jung an Jahren ist, erscheint einem der Tod nicht nur ganz weit weg, sondern beinahe illusorisch. Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit, bereits früh dahingerafft zu werden, überschau-bar. Aber durchaus vorhanden:
Sterbeziffern: Sterbefälle je 1.000 Einwohner in den jeweiligen Altersgruppen nach Geschlecht in Deutschland im Jahr 2020
Q
uellehttps://de.statista.com/statistik/daten/studie/3057/umfrage/sterbeziffern-nach-alter-und-geschlecht/
Die Sterbeziffer oder Mortalitätsziffer bezeichnet das Verhältnis der Anzahl der Sterbefälle zum Durchschnittsbestand einer Population. Bis zum 30ten Lebensjahr beträgt sie in Deutschland 0,83%.
Was nichts anderes bedeutet, dass knappe 700.000 Menschen in diesem unserem Lande das 30te Wiegenfest nicht erleben.
Es gibt tödlich verlaufende Krankheiten, Suizide, Morde, Unfälle, Flug-zeugabstürze – der Tod lauert überall.
Doch gerade als junger Mensch denkt man – wenn man sich überhaupt mit dem Thema Tod beschäftigt - „das trifft die anderen und nicht mich.“
Auch, weil die Natur es so eingerichtet hat, dass man im ersten Lebens-viertel meist kaum mit dem Dahinscheiden konfrontiert wird. Vielleicht bekommt man am Rande einmal mit, dass irgendeine Oma oder ein Opa aus der Nachbarschaft das Zeitliche gesegnet hat. Irgendwann jedoch sind es die eigenen Großeltern, dann Eltern aus der Nachbarschaft, die eigenen Eltern und schließlich die ersten Schulkameraden und Freunde.
Peu a peu schleicht sich der Schnitter in unser Leben. Die Einschläge kommen immer näher: man stolpert über Todesanzeigen von Menschen, die man kannte und steht an Allerheiligen unvermittelt an gleich mehreren Gräbern von Menschen, die den eigenen Lebensweg kreuzten. Der Vater einer ehemaligen Freundin, die Frau eines Bekannten, die in jungen Jahren eine Krankheit dahingerafft hat, eine frühere Nachbarin.
Und das bleibt nicht ohne Folgen: zunächst durchaus noch verschwom-men, dann zunehmend konkreter manifestiert sich in uns der Gedanke: Was denen passiert ist, dass passiert mir – „irgendwann“, so ist’s erträgli-cher - auch.
Als mein Vater im reifen Alter mit zunehmender Akribie die Todes-anzeigen in Zeitungen studierte, schüttelte ich mehr als nur einmal ver-ständnislos den Kopf. Heute lese ich sie selber.
Keiner kommt an diesem Thema vorbei. Und weil dem so ist: Fangen wir doch direkt mit dem wohl unangenehmsten Kapitel an. Denn ich den-ke, wenn man sich im Umfang mehrerer hundert Seiten über den Tod aus-lässt, sollte man ihm auch die Ehre erweisen, zunächst einmal auf sein We-sen einzugehen.
Einmal abgesehen von der Geburt betrifft kein medizinisches Ereignis so unausweichlich alle Menschen wie das Sterben. Der biologische Tod des Menschen ist unausweichlich. Und er begleitet uns bereits lange, bevor wir geboren werden. Noch im Mutterleib beginnt das Sterben in dem durch-sichtigen Zellhaufen, aus dem jede und jeder von uns entsteht. Hier müs-sen überflüssige Körperzellen Platz machen. Nur so können sich die Orga-ne des wachsenden Zellklümpchens Mensch entwickeln. Nur so kommt es mit nur zwei Nieren und nur zehn Fingern zur Welt. Ins Erbgut jeder Kör-perzelle sind Programme eingeschrieben, die wie ein Schleudersitz wirken. Der wird aktiv, sobald eine Zelle nicht mehr gebraucht wird oder sie dem Körper gefährlich werden könnte. Die Zelle katapultiert sich in den frei-willigen Tod (02).
Wir Menschen bestehen aus Billionen von Zellen, Und die altern. Lange werden sie umgehend durch identische, runderneuerte Tochterzellen ersetzt. Bedingt durch das allmähliche Verschwinden der Telomere, die als eine Art biochemische Schutzkappe an den Enden der Chromosomen lie-gen, stoppt der Prozess der Erneuerung beim alternden Menschen. Altern-de Zellen werden nicht mehr durch neue ersetzt, was letztendlich dazu führt, dass Organe oder biologische Prozesse im Körper nicht mehr funk-tionieren und unser Körper schlussendlich stirbt. Betroffen sind meist die "Eintrittspforten des Todes": das Herz-Kreislauf-System, die Lunge und das Gehirn. In Summe sorgt ihr Stillstand verlässlich dafür, dass bei uns al-lerspätestens nach rund 120 Jahren Schluss ist. An dieser maximalen Le-benserwartung hat sich seit Jahrtausenden nichts geändert.
Den biologischen Sinn einer begrenzten Lebenszeit sehen die Evolu-tionsforscher in der Optimierung der Weitergabe unseres genetischen Ma-terials. Gemäß der sogenannten «Selfish-DNA-Hypothesis» (Hypothese der egoistischen Erbsubstanz) sind alle Lebewesen lediglich biologische Maschinen mit dem Ziel der maximalen Weitergabe, Vermehrung und Vermischung ihres genetischen Materials. Denkt man diese Hypothese fort, so ist die evolutionär-biologische Funktion eines jeden Lebewesens spätestens dann erschöpft, wenn es möglichst viele Nachkommen produ-ziert und für deren Überleben bis ins fortpflanzungsfähige Alter Vorsorge getroffen hat.
Aber wann ist letztendlich wirklich Schluss?
Sterben ist kein abruptes Ende, sondern ein Prozess, in dem der Körper verschiedene Phasen durchläuft, so wissen Neurobiologen und Hirnfor-scher zu berichten.
Der eigentliche Tod stellt einen Zusammenbruch der koordinierten Tä-tigkeit der lebenswichtigen Körperorgane dar, deren Hauptfunktion es ist, das Gehirn mit Zucker und Sauerstoff zu versorgen. Äußerer Ausdruck dieses Zusammenbruchs ist das Erlöschen der Herz- und Atemtätigkeit. Grundsätzlich kann der Verlust der Funktionsfähigkeit jedes einzelnen le-benswichtigen Organs zum Tod führen, sei es das Herz, die Lunge, die Le-ber, die Niere oder das Gehirn. Bei allen Prozessen, die zum Tod führen, geschieht dies durch das Versagen eines oder mehrerer dieser Organe. So-mit können wir von fünf physiologischen Haupttodesarten sprechen: dem Herz-Kreislauf-, dem Lungen-, dem Leber-, dem Nieren- und dem Gehirn-tod (03).
Von "dem" einen Tod zu sprechen, ist Medizinern zu ungenau, weswe-gen mehrere Definitionen existieren.
Der "klinische Tod" tritt ein, wenn das Herz-Kreislauf-System stockt und Organe nicht mehr mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. Das Herz hört auf zu schlagen, der Atem erlischt und das Bewusstsein schwindet. Von diesem Tod gibt es unter Umständen durch Reanimation noch eine Rückkehr – dem medizinischen Fortschritt in Form von Beat-mungsmaschinen oder gekonnter Herzdruckmassage sei Dank.
Beim "irreversiblen Hirnfunktionsausfall", besser bekannt als Hirntod, ist dies nicht der Fall. Er ist in Deutschland als Ausfall des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms definiert und damit als unumkehrbarer Verlust dessen, was wir Bewusstsein nennen. „Hirntod“ bedeutet dem-nach nicht zwangsläufig, dass im Gehirn keinerlei Zellen mehr leben: Aus-serhalb der genannten Hirnregionen können durchaus in tieferen Schich-ten, die kein EEG aufzeichnet, noch Gehirnzellen aktiv sein. Wichtige Funktionen des "hirntoten" Körpers können mittels Maschinen aufrecht-erhalten werden: Er kann weiter Infektionen bekämpfen, seine Körper-temperatur regulieren oder – in einigen Fällen schwangerer, hirntoter Frauen – sogar Babys bis zu ihrer Geburt austragen. Der Hirntod stellt je-nen Zeitpunkt dar, ab welchem die Integrität des Organismus irreversibel verloren ist.
Was in unserem Körper wie und in welcher Reihenfolge im Tod pas-siert, weiß die Rechtsmedizin.
"Was wir sicher wissen, ist, dass der Mensch nicht auf einmal stirbt, sondern dass die einzelnen Organe mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihre Funktion einschränken und später einstellen", formuliert es Palliativmediziner Gian-Domenico Borasio.
Unsere Organe kommen auch nach der Diagnose "tot" noch eine ge-wisse Zeit ohne Sauerstoff und Nährstoffe aus. Nach dem Ablauf der Wie-derbelebungszeit sind bereits so viele Zellen abgestorben, dass sich kein Organ je wieder davon erholt. Unser Gehirn zeigt dabei die niedrigste To-leranzgrenze: Schon nach drei bis fünf Minuten beginnen seine Zellen zu sterben. Das Herz hält mit ungefähr 15 bis 30 Minuten etwas länger durch, ihm folgen Leber und Lunge. Nach acht Stunden ist die Totenstarre voll ausgeprägt und auch der letzte Muskel gestorben. Diese Starre löst sich erst wieder nach Tagen. Das letzte Organ, das nach ein bis zwei Tagen ka-pituliert, ist der Magen-Darm-Trakt. Nur die Spermien des Mannes schaf-fen es, noch länger durchzuhalten: bis zu drei Tage. Erst am Ende der or-ganspezifischen Überlebenszeit geht dann keine einzige Zelle mehr ihrer Funktion nach (04).
Wie ein Sterbender den Prozess des Dahinscheidens erlebt, ist alles an-dere als einheitlich.
"Der Prozess des Sterbens ist sehr individuell", sagt Lukas Radbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft Palliativmedizin und Professor an der Uniklinik Bonn. "Manch ein Patient bleibt bis zum Ende genauso wie vorher. Ein anderer kann unruhig werden oder halluzinieren. Wieder an-dere dämmern einfach weg."
Peu a peu verflüchtigen sich die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft aus dem Körper des Sterbenden. Das Hungergefühl schwindet, die Körpersubstanz nimmt ab. Der Körper verliert an Wasser, der Durst ver-siegt. Das Feuer-Element – die Körpertemperatur – vermindert sich. Der Blutdruck sinkt, der Puls wird schwächer, die Haut blass. Zum Ende hin fällt das Atmen schwer und hört irgendwann auf (05).
Durch den unsteten Fluss von Blut und Sauerstoff wird auch der Stoff-wechsel des Gehirns heruntergefahren, so dass sich das Bewusstsein ver-ändert. Was und wie viel Sterbende noch wahrnehmen, wissen wir nicht. Und doch gibt es im Sterbeprozess auch Gemeinsamkeiten: Gewisse kör-perliche Veränderungen erleben die meisten Sterbenden. Oft sind sie er-schöpft, haben Schmerzen und bekommen schlechter Luft. Letztlich wird das Gehirn vom Dopamin des Mittelhirns geflutet. Jenem Belohnungsbo-tenstoff, der die Stimmung hebt und ein Gefühl der Wärme auslöst. Und damit vielleicht einen letzten Moment des Glücks (06).
Soviel zum physischen Sterbeprozess.
Darüber hinaus jedoch ist das Sterben ein zutiefst bewegendes seeli-sches Erleben. Die Aufmerksamkeit richtet sich komplett nach innen. In unseren letzten Stunden wechseln sich verschiedene Bewusstseinszustän-de ab, der Sterbende erlebt sowohl helle, klare Stadien als auch dämmern-de, träumerische, in der Art, als würde die Seele schon ins Jenseits blicken.
Der Moment des Sterbens selbst ist oft begleitet von tiefer innerer Klar-heit. Das ist sogar beim Übergang von Menschen zu beobachten, die etli-che Jahre im Koma lagen oder deren Gehirn irreparabel geschädigt war. Der Biologe Michael Nahm, der Zeugnisse aus den letzten 250 Jahren zu diesem Thema archivierte, nennt diesen Zustand „Terminale Geistesklar-heit.
„In solchen Momenten löst sich die unsterbliche Seele des Menschen von den Banden der physischen Materie und erhält ihr ureigenes individu-elles Potenzial zurück, das auch ohne die Anbindung an die Gehirnmaterie weiter existiert.“, folgert Nahm (07).
Mittlerweile bestätigten viele PflegerInnen seine Beobachtungen. Trotz Demenz oder psychischen Krankheiten richtet sich der Mensch in diesem Stadium auf, spricht auf einmal völlig klar und bewusst, bedauert Ver-säumnisse, erkundigt sich letztmalig nach Verwandten oder verabschiedet sich final und liebevoll von den Angehörigen, die ihn beim Übergang begleiten (08).
Es ist nicht die Anzahl der gelebten Jahre, die bedingt, ob sich jemand leichter oder schwerer tut, was das Sterben betrifft. Der individuelle Über-gang, so behaupten Medien wie der US-Amerikaner Tyler Henry, eine amerikanische Reality-Show-Persönlichkeit, die in der Serie „Hollywood Medium mit Tyler Henry“ als „hellsichtiges Medium“ agiert, ist nicht unwesentlich an die Fähigkeit und Bereitschaft gebunden, irdische Anhaftungen und das Ego loszulassen. Streift man seine angstbasierten Vorstellungen an diese Welt ab, hat man einen leichteren Übergang. Wehrt man sich, kann der Übergang ein längerer Prozess sein (09).
Ob man dies tut, hängt auch von den persönlichen Umständen und der vorhandenen Lebensenergie ab. Kann das irdische Dasein zum Lebensen-de hin doch äußerst anstrengend sein. Den ganzen Tag über fühlen sich betagtere Menschen bisweilen erschöpft. Oft fällt es zunehmend schwerer, sich zu bewegen. Kommen dann noch Einsamkeit, Langeweile und immer ereignisärmere Tage hinzu, kann durchaus die Lust am umfassenden Gan-zen verloren gehen. Wenn die Lebensgeister schwinden, verliert auch das Dasein als solches bisweilen zusehends an Attraktivität. Der alte, ausge-laugte und verbrauchte Mensch will einfach nicht mehr. Der nebelhaften Angst vor dem letzten Atemzug und dem darauffolgenden Ungewissen zum Trotz.
Ist schon ein trübes Thema, das mit dem Tod. Verständlich irgendwo, dass der Mensch als solcher bisweilen dazu neigt, sich damit nicht ausei-nandersetzen zu wollen. Auch, weil uns eben jene Ungewissheit, unser letztes Stündlein betreffend, eine durchaus willkommene Illusion der Unvergänglichkeit vermittelt. Klar, bereits jedes Kind bekommt mit, dass es irgendwann sterben wird. Nur impliziert eben dieses „irgendwann“, ge-rade in jungen Jahren, ein unausgesprochenes „niemals“, liegt doch der Tag X in jahrzehntelang entfernter, vager Zukunft.
Trotzdem: Der Tod ist das faszinierendste und bedeutendste Abenteuer des Lebens. Da irritiert es schon, dass wir ihn im Okzident unserer Welt in einem derartigen Ausmaß verleugnen. Denn anders als andere Lebewesen sind wir Menschen uns unserer Endlichkeit bewusst. Wir wissen mit absoluter Sicherheit, dass wir eines Tages nicht mehr existieren werden.
Kein Mensch kommt umhin, sich irgendwann mit der Endlichkeit sei-nes irdischen Lebens auseinanderzusetzen. Mit zunehmendem Alterlüftet die Realität den Mantel des Schleiers der Todesverdrängung. GefährlicheKrankheiten, das leidige Alter, das Dahinscheiden liebgewonnener Freun-de und enger Angehöriger – die Vergänglichkeit des Homo Sapiens lässt sich nicht länger verleugnen. Und so beginnen viele von uns, je näher ihnen das Schauspiel von Tod und Verwesung auf den Leib rückt, an eine immaterielle menschliche Essenz zu glauben, die unsere leibliche Hülle überlebt. Selbst „Ungläubige“ klammern sich an die Existenz der unsterblichen Seele, wenn ihr letztes Stündlein naht.
Früher oder später kann keiner von uns der Konfrontation mit dem Le-bensende ausweichen. Das, wovor wir uns am meisten fürchten wird un-weigerlich eintreffen. Der gefürchtete Gevatter Tod kommt – zu jedem von uns.
02 Der Tod und das Leben danach im Spiegel der Menschheitsepochen
Prähistorische Funde legen den Schluss nah, dass bereits der Vorzeit-mensch an ein Weiterleben nach dem Tod glaubte. Darauf deuten die er-halten gebliebenen Felszeichnungen und Grabbeigaben bei. Die Vorstel-lungen der Steinzeit entsprechen durchaus den unsrigen (10).
So lange wir auf der Erde wandeln, hat der Tatbestand, dass Menschen sterben, die uns innewohnende Einbildungskraft angeregt und in der My-thologie, der Religion und der Philosophie in den verschiedenen Kulturen auf sehr unterschiedliche Weise Ausdruck gefunden. Zu allen Zeiten und in allen Kulturen war man dabei davon überzeugt, dass das Wesen des Menschen, oftmals Seele genannt, nach dem Tod des Körpers fortbesteht, Denn die Idee einer körperunabhängigen Seele existiert schon seit Tausen-den von Jahren.
Die Ur- oder auch Frühgeschichte umfasst einen gewaltigen Zeitraum. Sie beginnt mit dem Auftreten der frühesten Menschenformen vor mehr als 2,5 Millionen Jahren bis zur Einführung der Schrift vor etwa 5000 bis 6000 Jahren. Anthropologische Studien belegen, dass der Tod in vor- und frühgeschichtlicher Zeit gleichsam zunächst vom Menschen entdeckt wer-den musste, bevor er als Problem begriffen wurde. Mutmaßlich haben die Menschen in der Frühzeit ihrer Entwicklung nicht nur die Endgültigkeit des Todes negiert, sondern auch seine Unvermeidlichkeit.
Das Gilgamesch-Epos ist eine Art Wendepunkt. Es stammt etwa aus dem Jahr 2600 vor Christi Geburt und gehört damit zu den ältesten Doku-menten der Kulturgeschichte über den Tod. Das Epos entschlüsselt die Un-vermeidlichkeit des Todes: Noch während Gilgamensch um seinen Freund Engidu trauert, erwacht in ihm die Einsicht, dass auch er sich auf das glei-che schreckliche Schicksal vorbereiten muss. Die Unvermeidbarkeit des Todes ist vor dem Hintergrund der langen Zeit, in der bereits Menschen auf der Welt leben, also eine relativ junge Erfahrung.
Dies war natürlich in der Geschichte des Todesgedankens nur ein erster Schritt. Hatte doch der Gilgamesch noch nicht den Tod vor Augen. Zer-stört wurde allein sein Glaube an die irdische Unsterblichkeit und an eine Welt ohne Tod. Die Einsicht, dass der Tod die absolute Vernichtung dar-stellen könnte, wurde höchstens befürchtet. Denn in der assyrischen und babylonischen Kulturgeschichte wurde der Tod keinesfalls als das absolute Ende des Lebens begriffen und demgemäß auch nicht als völlige Auflö-sung des von Bewusstsein getragenen Daseins. Vielmehr verkörperte der Tod die Trennung von Körper und Geist, den Verfall des Körpers und das Übertreten der Seele von einer Existenz in eine andere, die alles andere als verlockend war: Die Seele taucht ab in eine Unterwelt und verharrt dort bis in alle Ewigkeit.
Das Altertum, das auch die klassische griechisch-römische Antike um-fasst, beschreibt den Zeitraum vom Ende der Frühgeschichte bis zum be-ginnenden Mittelalter (ab dem 6. Jahrhundert).
Die Römer hatten konkrete Vorstellungen bezüglich des Weiterlebens des Menschen nach dem Tode. Die Seele (anima) des Toten, so glaubten die Römer, lebt in seinem Grab weiter und hat dieselben Bedürfnisse, die der Verstorbene auch im Leben hatte. So wurde dem Toten mitgegeben, was man für ihn im Jenseits als nützlich erachtete. Von großer Bedeutung waren beispielsweise Speisen - Obst, Gemüse oder Fleisch - und diverse Getränke, die die Seele für das Reich der Toten stärken sollte. Selbstredend wurde auch das passende Geschirr mit in das Grab gegeben. Auch sollten Lampen für Licht in der ewigen Dunkelheit sorgen. Für die Angehörigen war die Bestattung und die Totenfürsorge Pflicht, nicht zuletzt, weil man den Toten durch die Gaben wohlwollend stimmen wollte. Denn nach der römischen Vorstellung waren die Toten befähigt, das Schicksal der Lebenden positiv oder negativ zu beeinflussen. Schlimmer noch - konnten sie doch gar als Wiedergänger ihr Unwesen treiben. Somit wurde stets genauestens darauf geachtet, dem Verstorbenen ein formidables Begräbnis zu bereiten und die Gedenktage im Jahresturnus einzuhalten. Die Totenwelt selbst wurde als gefährlich und düster erachtet, mit der Folge, dass sich die Begräbnisplätze (Nekropolen) stets außerhalb der Stadtmauern befanden (11).
Dass es nach dem Tod weitergeht, war auch für die alten Griechen gewiss. So befindet einer ihrer größten Philosophen, Platon (427-347 v.Chr.):
„In der unstofflichen Welt gibt es keine Zeit. Der veränderliche, stoffliche Kö-rper ist der zeitweilige Träger der Seele, die ewig besteht…Die Seele, unabhängig vom Körper, tritt in Verbindung zu Verstorbenen. Ihr stehen beim Übergang Schutzgeister zur Seite…Der Tod ist ein Erwachen, ein Sicherinnern der Seele. Während des Lebens hat das Bewusstsein die Wahrheiten aus der unstofflichen Welt vergessen. Kurz nach dem Tod wird die Seele beurteilt…Die Seele ist im Körper gefangen und wird von den Sinnen in ihrer Wahrnehmung beschränkt.“
Sein kongenialer Kumpan Sokrates (469-399 v.Chr.) schlägt in die glei-che Kerbe:
„Dennoch scheint ihr…auch zu fürchten, wie die Kinder, dass nicht gar buch-stäblich der Wind sie, wenn sie aus dem Leibe herausfährt, auseinanderwehe und zerstäube, zumal wenn einer nicht etwa bei Windstille, sondern in recht tüchtigem Sturmwinde stirbt…Ist der Tod wohl etwas anderes als die Trennung der Seele von dem Leibe? Und daß das heiße tot sein, wenn abgesondert von der Seele der Leib für sich allein ist…Ähnlicher also als der Leib ist die Seele dem Unsichtbaren, er aber dem Sichtbaren. …Daß dem Göttlichen, Unsterblichen, Vernünftigen, Eingestaltigen, Unauflöslichen und immer einerlei und sich selbst gleich sich Ver-haltenden am ähnlichsten ist die Seele, dem Menschlichen und Sterblichen und Unvernünftigen und Vielgestaltigen und Auslöslichen und nie einerlei und sich selbst gleich Bleibenden diesem wiederum der Leib am ähnlichsten ist?...Tritt also der Tode den Menschen an, so stirbt, wie es schein, das Sterbliche an ihm, das Un-sterbliche aber und Unvergängliche zieht wohlbehalten ab, dem Tode aus dem We-ge…Wenn also das Unsterbliche auch unvergänglich ist, wäre dann nicht die See-le, wenn sie doch unsterblich ist, zugleich auch unvergänglich?...Ganz sicher also ist die Seele unsterblich“ (12).
Gemäß der Sichtweise der Griechen gelangten die Verstorbenen in die Unterwelt, die einen äußerst trostlosen Ort darstellt. Die Vorstellung von Himmel und Hölle fand sich als erstes in der griechischen Mythologie. Den Dahingeschiedenen war je nach Lebensführung entweder ein Weiterleben auf der „Insel der Glückseligen“, auch Elysion genannt, die am Ende der Welt über den Wassern des Atlantiks verborgen ist, beschieden oder aber sie gingen in den Hades, die Unterwelt, ein. Für die Überfahrt über den Fluss Styx legte man einen Obolus für den Fährmann Charos auf die Au-gen oder in den Mund des Leichnams (13).
Die Ägypter stellten sich das Leben im Jenseits als ewige Fortsetzung ihres biologischen und sozialen Lebens vor. Dabei konnte diese Existenz im Jenseits auf unterschiedliche Weise erfolgen: In den „Gefilden der Seli-gen“ im Reich des Gottes Osiris fand man bessere Umstände vor als im ir-dischen Leben, dramatisch schlechtere Bedingungen hingegen erwarteten den Verstorbenen, wenn er im Jenseits in einer Art „Hölle“ landete. Über das Schicksal der Dahingeschiedenen entschied das Totengericht des Osi-ris. Dabei wurde der Lebenswandel der Verstorbenen „gewogen“: Erfüll-ten die geprüften Taten die Forderungen der Gerechtigkeit nicht ausrei-chend, verfiel der Tote der Verdammnis (14).
Die Menschen im Mittelalter (500-1500 n.Chr.) imaginierten die Seelen ihrer Verstorbenen im Jenseits durchaus körperlich und wie ein Abbild der lebenden Person. So konnten die Seelen im Jenseits auch körperliche Empfindungen und Gefühle wie etwa Schmerz und Freude haben. Dort erhielten sie eine Art „Zwischenkörper“, also sozusagen eine “Light-Vari-ante“ des echten Körpers. Ihren vollen Körper sollten die Verstorbenen erst bei der Auferstehung am Ende der Welt zurückerhalten, dann freilich in einer tadellosen 1A-Version. Laut Thomas von Aquin galt dies auch für jene Zeitgenossen, die von wilden Tieren zerfleischt wurden oder zu Leb-zeiten Körperteile verloren hatten. Weil die Tiere die entsprechenden Arme und Beine einfach wieder ausspuckten. Die Menschen im Mittelalter waren der festen Überzeugung, dass der Tod nur der Übergang in ein bes-seres Leben nach dem Tod war, so dass sie ihn in gewisser Weise weniger dramatisch sahen (15).
Die Frühe Neuzeit (19tes und 20tes Jahrhundert) war geprägt vom Ein-fluss der Reformation (1517-1648).
Diese war eine Art theologische Erneuerungsbewegung und hatte grundlegende Veränderungen in den Jenseitsvorstellungen nach sich gezo-gen. Zu den wichtigsten Elementen der Reformation zählte Luthers Über-setzung der Bibel, die es bisher ausschließlich in Latein gab. Luther und Zwingli übersetzten sie ins Deutsche, John Wycliff ins Englische und viele andere in ihre jeweilige Muttersprache. Die Gutenberg-Bibel aus den Jah-ren 1452-54 ist das erste mit beweglichen Metalllettern gedruckte Buch der Menschheitsgeschichte. Der Buchdruck machte es fortan billiger, eine Bibel zu kaufen, so dass der christliche Glaube zunehmend Verbreitung fand. Die Folge war ein fundamentaler Wandel in den Vorstellungen vom Da-sein nach dem Tode. Die Reformatoren vertraten die Überzeugung, dass Jesus am Kreuz stellvertretend für die Menschen alle Sünden abgebüßt hat. Allein dadurch, also durch diese Gnade, würde ein Mensch in den Himmel kommen, wenn sein Lebenswerk vor dem abschließenden Weltgericht Gnade findet (16).
Auferstehung im christlichen Kontext heißt zunächst einmal, dass alle Menschen nach ihrem Tod ganz nah bei Gott sein werden. Aber keinesfalls mit dem Leib, mit dem sie geboren wurden. Im ersten Brief des Paulus an die Korinther steht zu lesen: "Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib." Wie der aussehen wird, wird nicht beschrieben (17).
Das, was mit dem Körper des Homo Sapiens passiert, wenn das irdi-sche Leben ein Ende findet, hat die Erdbewohner in allen Epochen der Zeitgeschichte umgetrieben. Es ist das wohl bedeutendste ungelöste Rätsel der Menschheit.
II Das Leben danach im Fokus der Naturwissenschaften
„Meine Einstellung zum Tod hat sich nie geändert: Ich bin vehement dagegen“
03 Das Leben nach dem Tod aus materialistischer Sicht
Wo beginnt man eine Suche nach dem Leben nach dem Tod?
Am besten bei denen, die am ehesten eine Antwort wissen, sich am intensivsten um ein solche bemühen sollten und zudem überzeugt davon sind, dass sie diese bereits kennen: Bei den Naturwissenschaftlern.
Die materialistische Weltsicht ist in unserer Gesellschaft der Status quo, sie gilt gemeinhin als kompromisslos akzeptiert. Nicht zuletzt, weil sie uns schon von Kindesbeinen an Schulen und Hochschulen alternativlos ver-mittelt wird. Denn das materialistische Denken schuf elementare wie be-deutende Grundlagen der modernen Naturwissenschaften.
Die philosophische Lehre des Materialismus geht davon aus, dass alles, was wir sehen und anfassen können, Materie ist oder mit Materie zu tun hat. Danach können auch Gedanken und Dinge auf Materie zurückgeführt werden. Dinge indes, die nichts mit Materie zu tun haben - wie zum Bei-spiel Gott – gibt es nach dieser Lehre nicht. Das Credo der materialisti-schen Weltanschauung besagt, dass nur das Stoffliche wirklich existiert und somit die Grundlage der gesamten Wirklichkeit ist. Die Vertreter des Materialismus führen alle Vorgänge und Phänomene der Welt auf Materie und deren Gesetzmäßigkeiten wie Verhältnisse zurück. Selbst Gedanken, Gefühle oder das Bewusstsein können auf Materie zurückgeführt werden. Auch Seele und Geist können somit ausschließlich als Funktionen des Stofflichen interpretiert werden.
Der Materialismus verneint die Existenz einer nicht-stofflichen Seele, somit gibt es aus materialistischer Sicht nichts, das körperlos nach dem Tod des Körpers fortbestehen kann. Also müsste die Seele, so sie denn exi-stiert, stofflicher Natur sein (18). Denn die gegenständliche wie die geistige Wirklichkeit bestehen ausschließlich aus Materie oder sind auf materielle Prozesse zurückzuführen.
In den Augen der Materialisten ist alles, was naturwissenschaftlich nicht belegbar ist, auch nicht existent.
Wie ist diese materialistische Weltsicht entstanden?
Den berüchtigten Stein ins Rollen brachte wohl Sir Francis Bacon (1561-1626). Ihm verdanken wir den auch heute noch gern zitierten Satz:
„Wissen ist Macht. “
Mit Beginn der mechanischen Naturwissenschaft im 17ten Jahrhundert wurden geistige Aspekte sukzessive immer mehr aus der Diskussion über das Leben und die Welt verbannt. Wissenschaftler wie Johannes Kepler, Galileo Galilei und Isaac Newton legten den Grundstein für ein sich zu-nehmend verfestigendes materialistisches Weltbild. Das in der Gesellschaft verankerte religiös geprägte Glaubenssystem hielt dem zunehmend die Oberhand gewinnenden materialistischen Gedankengut nicht stand. Spra-chen doch wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Paläontologie, der Geo-logie sowie aus Biologie, Chemie und Physik unzweifelhaft gegen Adam und Eva, zumindest in dem Sinne, in dem die Bibel die Menschen an sie glauben machte.
Der britische Naturforscher Charles Darwin trug mit seiner Evolu-tionstheorie nicht unwesentlich zu dieser Entwicklung bei. Erklärt dieser Erklärungsansatz doch das Leben, seine Entstehung und Weiterentwick-lung in einer behaupteten Selbstverständlichkeit, sodass der Eindruck ent-steht, alle Fragen dazu seien beantwortet, zudem alle Erkenntnisse verifi-ziert. Evolution wird als bewiesene Tatsache gelehrt und akzeptiert. Wer Zweifel äußert, gilt fortan vielfach als Spinner oder religiöser Fanatiker (19).
Was bedeutet diese materialistische Perspektive für ein mögliches Le-ben nach dem Tod?
Ein körperloses Weiterleben, also der dauerhafte Fortbestand der ei-genen Seele in der Allseele, dem Großen und Ganzen oder dem Paradies, wie immer man es nennen will, muss aus materialistischer Sicht bereits aus begrifflichen Gründen ausgeschlossen werden. Wer eine über das körper-liche Ableben hinausgehende, körperlose seelische Aktivität unterstellt, wird plausibel darlegen müssen, wie es die Seele nach dem Tod des Kör-pers anstellt, weiterhin Gedanken, Erinnerungen, Emotionen und Wahr-nehmungen zu haben. Wie sollen diese, die vor dem Tod körperlich wa-ren, nunmehr im Jenseits körperlos funktionieren?
Ein Wiederauferstehungsglaube hingegen erscheint grundsätzlich mit dem Materialismus vereinbar. Allerdings müsste hierfür eine durchge-hende Kontinuität des individuellen Lebens, für die gewöhnlich die imma-terielle Seele steht, gegeben sein. Aber eben deren Existenz schließt der Materialismus ja aus. Ergo wird die Person als solche den Aufenthalt in der geistigen Dimension, in der sie zwischen Tod und Wiederauferstehung verweilt, kaum überdauern. Also müsste jemand (Gott?!) den Leib des verstorbenen Menschen für eine Auferstehung wiederherstellen. Ist doch der ursprüngliche Leib der verstorbenen Person zum Zeitpunkt der Auferstehung ja unwiderruflich verwest (20).
Also: Aus Sicht des Materialismus müssen wir uns mit dem begnügen, was wir hier auf Erden an Lebensspanne erhalten. Denn Pflanzen, Tiere -alle Lebewesen sind vergänglich. Warum sollte der Homo Sapiens oder dessen Seele als einzige Art unsterblich sein?
Das frugen sich bereits große Denker über alle Epochen und kamen zu ernüchternden Einsichten:
Der französische Philosoph Paul Henry Tiry d‘Holbach (1723-1789): “Wenn alles entsteht und vergeht, …wie sollte der Mensch von dem allgemeinen Gesetz ausgenommen sein…“ (21).
Der schottische Philosoph David Hume (1711-1776): „Die Schwachheit des Körpers und des Geistes sind in der Kindheit einander genau angepasst, ihre Stärke im Mannesalter…ihr gemeinsamer allmählicher Verfall im Alter. Der weitere Schritt scheint unvermeidlich: ihre gemeinsame Auflösung im Tod“ (22).
Theodor Fontane (1819-1898) in seinem Werk Effi Briest: „Es ist nicht so viel mit uns, wie wir glauben“ (23).
Der deutsche Naturwissenschaftler und Philosoph Ludwig Büch-ner (1824-1899): „Es liegt in der Natur alles Lebendigen, dass es entsteht und vergeht, und noch kein Lebendiges hat jemals eine Ausnahme davon gemacht“ (24).
Der österreichische Psychologe Sigmund Freud (1856-1939): „Es gibt im Leben kaum einen Bereich, wo wir uns so schnell mit Ant-worten zufrieden geben,…, wie in religiösen Fragen, weil wir da-rin einfach nicht verunsichert werden wollen“ (25).
Bertrand Russel (1872-1970), britischer Philosoph: „Ich glaube, dass ich verwesen werde, wenn ich sterbe, und dass nichts von meinem Ego übrigbleibt. Auch das Denkvermögen eines Einzel-nen kann den körperlichen Tod nicht überleben, weil dieser Tod den Aufbau des Gehirns zerstört“ (26).
Der deutsche Dichter Gottfried Benn (1886-1956) polemisierend „Das Hirn verwest genauso wie der Arsch“ (27).
Der deutsch-britische Soziologe Norbert Elias (1897-1990). „Der Tod ist das absolute Ende der Person“ (28).
Bertolt Brecht (1898-1956), deutscher Dramatiker: „Lasst Euch nicht verführen! Es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen, ihr könnt den Nachtwind spüren. Es gibt kein Morgen mehr“ (29).
Die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir (1908-1986): „Ich sterbe ganz und gar“ (30).
Der britische Maler Francis Bacon (1909-1992): “Wir kommen aus nichts und werden zu nichts. Das ist alles“ (31).
All‘ diese berühmten Herrschaften sind sich einig: Menschliches Leben manifestiert sich einzig und allein körperlich. Der Korpus ist der Quell` al-ler Wahrnehmungen und Empfindungen, jedweder Gedanken und sämtli-cher geistiger Ergüsse. Sie vertraten eine philosophische Anschauung, die jedes spirituelle Prinzip zurückweist, nur die Materie als einzige Realität anerkennt und alles für auf diese zurückführbar hält.
Der Tod verbirgt kein Mysterium. Er ist weder ein lösbares Rätsel noch ein ergründbares Geheimnis, sondern einfach nur das Ende des Lebens. Im Augenblick des Todes werden wir lediglich der Gegenwart entrissen.
Mit dem Tod beginnt weder die letzte Reise noch macht man sich auf zur Heimkehr. Er ist kein Übertritt in eine neue Lebensform und keine Transformation in eine andere Dimension.
Der Tod ist das Ende, die Zerstörung des Menschen, mit dessen Eintritt dieser ein für alle Mal seiner Existenz beraubt ist. Trübe Aussichten!
04 Gibt es wirklich nur eine Wahrheit?
Macht es angesichts der ernüchternden Aussichten im letzten Kapitel überhaupt noch Sinn, meine Suche nach einem Leben nach dem Tod fort-zuführen, besser gesagt, sie überhaupt erst zu beginnen?
Ja, denn: Die materialistische Wissenschaft kann keinen Anspruch auf ein allumfängliches Verständnis der Realität für sich beanspruchen. Sie besitzt mitnichten das Monopol der unumstößlichen Wahrheit. Allein schon deshalb nicht, weil sie, wie jedes andere Weltbild auch, letztendlich allein auf als der Weisheit letzter Schluss angesehenen Glaubensgrundsät-zen beruht. So werden Objektivität, Kausalität, also Ursache-Wirkungszu-sammenhänge, ebenso wie Zeit und Raum wie selbstverständlich voraus-gesetzt.
Und so gibt es durchaus mehr als genug schlaue Köpfe, die den zitier-ten materialistisch geprägten Herrschaften die Stirn bieten.
Immanuel Kants zweite Auflage der „Kritik an der Vernunft“, 1787 er-schienen, gilt weltweit als eines der bedeutendsten Werke der Aufklä-rung. Der deutsche Philosoph (1724-1804) glaubte zu wissen: Wir kennen die Wirklichkeit nicht. Sie ist lediglich unsere subjektive Interpretation der Welt, wie wir sie sehen. Unsere Realität ist also das Produkt unserer sub-jektiven Wahrnehmung der Wirklichkeit.
Oliver S. Lazar bemüht in diesem Zusammenhang einen, wie ich finde, vortrefflichen Vergleich: Ein Hund nimmt die Welt mit seinem ausge-prägten Geruchssinn ganz anders wahr als wir. Eine Biene sieht die Welt in ultraviolettem Licht. Eine Fledermaus nimmt die Welt durch das Senden und Empfangen von Ultraschall wahr. Mit einem Menschen, einem Hund, einer Biene und einer Fledermaus haben wir nun bereits vier verschiedene Wahrnehmungen von Realität. Welche entspricht der wahren Wirk-lichkeit?
Ähnlich wie der große Philosoph Immanuel Kant denken viele weitere bekannte Zeitgenossen:
Tenzin Gyatso (*1935, 14ter Dalai Lama): „Das Nicht-Wahrnehmen von etwas beweist nicht dessen Nicht-Existenz.“
Physiker Hans-Peter Dürr (1929-2014): „Es ist grob unzulässig und falsch, unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit mit der Wirklich-keit schlechthin gleichzusetzen. Genau dies passiert jedoch, wenn wir wissenschaftliche Erkenntnis als allumfassend betrachten.“
Der in Deutschland geborene, international renommierte Arzt und Philosoph Karl Jaspers (1883-1969): „Das Unheil menschlicher Exi-stenz beginnt, wenn das wissenschaftlich Gewusste für das Sein selbst gehalten wird und wenn alles, was nicht wissenschaftlich wissbar ist, als nicht existent gilt.“
Ein Philosoph, ein Dalai Lama, ein Physiker und ein Arzt kommen letztendlich alle zu ein und derselben Auffassung. Vielleicht sollten wir uns auf dem Weg zur Erkenntnis nicht allein auf unsere oberflächliche, grobstoffliche Wahrnehmung verlassen. (32).
Bei der Frage nach der Unendlichkeit der Seele und jener nach einem Leben vor der Geburt wie auch nach dem physischen Tod erreichen mate-rialistische Erkenntnisse schnell ihre Grenzen. Dies führt zu der Fehldeu-tung, dass dies alles gar nicht existiere.
Was natürlich keinesfalls im Umkehrschluss bedeutet, dass es dies tut. Darum: Aus wissenschaftlicher Sicht müsste die Antwort, die ich in die-sem Buch suche – Stand Frühjahr 2022 - nein lauten. Aber es gibt durchaus Hoffnung, dass sich dies vielleicht mittelfristig ändert. Denn es existiert ei-ne wissenschaftliche Strömung, die dieses Weltbild vielleicht zum Wan-ken bringen wird. Die Quantenmechanik, die in den 1920er Jahren ihren Anfang fand, und auf die ich in einem späteren Kapitel noch ausführlich eingehe, liefert schlagkräftige Argumente dafür, jede einzelne der genann-ten materialistischen Annahmen infrage zu stellen.
Ob das im Rahmen meiner durchaus überschaubaren Restlebenszeit zu veritablen Ergebnissen führt, sei einmal dahingestellt…
Trotzdem mache ich mich weiter auf meiner Reise zur Erkenntnis. Und gebe im übernächsten Kapitel jenen die Chance, mich zu bekehren, die fel-senfest an ein „Danach“ glauben. Wie sieht es mit den bedeutenden Weltreligionen wohl aus – können die einen „Normalsterblichen“ von einem Dasein nach dem Tod überzeugen?
05 Warum hoffen wir auf ein Leben nach dem Tod?
In Deutschland und vielen anderen Ländern scheint der Glaube an ein Leben nach dem Tod langsam, aber sicher zu verschwinden.
In verschiedenen Befragungen zeigt sich das deutlich: 2021 glaubten lediglich noch 31 Prozent der Befragten an eine Existenz nach dem Tod (33). 2019 waren es noch 40 Prozent gewesen, 2005 sogar 45 Prozent (34). 38 Prozent glauben nicht daran, 26 Prozent gaben „Weiß nicht“ an und 5 Prozent gaben nichts an. Frauen glauben zu 36 Prozent und Männer zu 26 Prozent an ein Weiterleben (35).
Selbst unter den Mitgliedern der Religionsgemeinschaften glauben nicht alle an unseren Fortbestand über den Tod hinaus: Laut einer Studie der Konrad Adenauer Stiftung sind es 68 Prozent der befragten Muslime, 62 Prozent der Katholiken, und nur 42 Prozent der Protestanten.
Überraschend ist auch, dass die älteren Befragten, die auf die Zielgera-de des Lebens eingebogen sind und den Tod vor Augen haben, besonders skeptisch reagieren. Nur 29 Prozent aller Befragten, die älter als 65 Jahre sind, erwarten ein Leben nach dem Tod. Bei den Jüngeren liegt der Anteil hingegen über 40 Prozent, was als Überraschung zu werten ist (36).
Auch, wenn der Glauben daran, dass „da noch etwas ist“, offensichtlich abzunehmen scheint – immer noch glaubt ein Großteil der Menschen auf der ganzen Welt an ewiges Leben im Himmel oder Reinkarnation?
Warum ist das so? Was bewegt „Menschen wie Du und ich“, „Otto Normalbürger“, oder wie immer man sie bezeichnen möchte, jene also, die sich nicht eingehend mit der Materie des Lebens nach dem Tod befassen, dazu, eine Existenz nach unserem irdischen Dasein anzunehmen – wie immer sie auch aussehen mag?
Alles hat einen Sinn hat und nichts geschieht zufällig
Die Religionen sind sich hier einig: Alles im Leben hat einen Sinn. Ist dieser für uns auch bei manchen Geschehnissen kaum erkennbar, erscheint er in vielen Situationen gar ausgeschlossen. Manchmal jedoch verhält es sich so, dass wir uns zunächst keinen Reim darauf machen können, wes-halb und wieso Sachen passiert sind, weil sie uns in diesem Moment alles andere als positiv erscheinen. Später jedoch glauben wir mitunter, den Sinn des Geschehenen zu erkennen oder zumindest zu erahnen. “Alles hat irgendeinen Sinn im Leben!” seufzen wir dann meist. Und folgern aus der Erfahrung, dass auch uns Erdenbürgern sinnlos erscheinende Ereignisse, Schicksalsschläge, persönliche oder globale Tragödien letztendlich sinn-stiftend sind.
Aber warum sollte ein endliches Leben keinen Sinn haben? Hat es die-sen nur, wenn es - wie auch immer - ewig weiter geht? Warum dies den Glauben an ein Leben nach dem Tod untermauern soll, erschließt sich mir
nicht wirklich. Warum bedingt ein Sinn des Lebens ein ewiges Dasein?
Dieses Argument pro „es geht weiter“ wird oft zu Rate gezogen, wenn uns etwas Schlimmes widerfahren ist: man verliert einen geliebten Men-schen an den Tod, den Job, eine Beziehung endet. Dann suchen wir Trost – und den kann die Binsenweisheit, dass „alles seinen Sinn“ hat, zumindest ein wenig verschaffen.
Verhält es sich mit dem Leben nach dem Tod nicht genauso? Man fürchtet das unwiderrufliche Ende der eigenen Existenz („da kommt nichts mehr“) und tröstet sich mit der Aussicht, dass, wenn es denn so kommt, auch dies wohl „seinen Sinn“ haben wird.
Die Ursache von Allem liegt im Karma
Als Karma bezeichnen Hindus und Buddhisten das göttliche Gesetz, nach dem sich jede Tat in diesem Leben auf das nächste Leben auswirkt. Besonders gute oder schlechte Taten haben auch im nächsten Leben noch Folgen. So werden zum Beispiel Betrug oder Neid im nächsten Leben mit Armut oder Krankheit „bestraft“, Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit da-gegen mit Gesundheit und Glück „belohnt“ (37).
Würde Sinn machen. Scheint es sich doch oft so zu verhalten, dass man auf Erden für seine Missetaten nicht (ausreichend) bestraft oder aber für seine Dienste an der Menschheit nicht (genügend) gewürdigt wird.
Aber wäre es nicht einfacher und vor allem logischer, wenn das Karma auf irdischer Ebene seine Erfüllung finden würde? Und kann man aus der über die Jahrhunderte zu beobachten Tatsache, dass dem eben oft nicht so ist, schlussfolgern, dass jeder „irgendwo anders“ das bekommt, was er - im Guten wie im Schlechten - verdient? Wohl kaum. Wo sind die konkreten Anhaltspunkte dafür, dass das „Gute“ oder „Schlechte“, was man auf Er-den tut oder lässt, in einem folgenden Leben abgegolten werden?
Bei dieser Argumentation für ein Leben nach dem Tod scheint insbe-sondere der - durchaus verständliche - Wunsch der Vater des Gedankens zu sein. Einen wirklichen Glauben daraus abzuleiten, ist höchst spekulativ.
Es muss eine gewisse Gerechtigkeit geben
Ein ähnliches, nein eher das gleiche Argument wie das vorherige. Und eines, mit dem sich die Menschen offenbar durchaus anfreunden können.
So glauben einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts INSA Consulere im Auftrag der katholischen Zeitung „Die Tagespost“ (Würz-burg) aus dem Jahr 2021 zufolge 24 Prozent, also jeder vierte Deutsche, dass er nach dem Tod für sein Leben zur Rechenschaft gezogen wird.
Egal, ob nun im Guten oder im Schlechten. 45 Prozent der Befragten sind gegenteiliger Ansicht. 23 Prozent wissen nicht, wie sie zu dieser Frage stehen. Am häufigsten stimmen 30- bis 39-Jährige der Aussage zu (29 Pro-zent), am geringsten ist der Wert bei den über 50-Jährigen (21 Prozent).
Bei den konfessionell gebundenen Bürgern glauben mit 41 Prozent vor allem freikirchliche Christen, dass sie im Jenseits einmal Rechenschaft ablegen müssen (34 Prozent nicht). Von den katholischen Befragten sind 34 Prozent dieser Meinung (36 Prozent nicht), bei den landeskirchlichen Protestanten nur 26 Prozent (41 Prozent nicht). Am stärksten verbreitet ist der Glaube, dass man nach dem Tod zur Rechenschaft gezogen wird, bei Muslimen. 46 Prozent von ihnen glauben dies und 18 Prozent nicht (38).
Wie bereits gesagt – ein durchaus reizvoller Gedanke. Wenn schon nicht auf Erden, dann eben im Himmel oder bei der irdischen Wiederkehr: am Ende bekomme ich doch das, was ich - im Positiven wie im Negativen - verdient habe. Kann ich mich mit anfreunden, ja. Aber allein daraus, dass es „irgendwo gerecht“ wäre, wenn’s denn so ist, einen Glauben an ein Le-ben nach dem Tod zu generieren, ist doch sehr weit hergeholt.
„Weil es Gerechtigkeit geben muss“ ist mir dann doch zu wenig.
Das, was wir in diesem Leben nicht schaffen, können wir im nächsten Leben schaffen“
Wer legt fest, was das „das“ ist, was wir im Leben schaffen müssen? Und was impliziert „das“? Muss man alles, was das „das“ ist, wirklich im Dasein auf Erden abarbeiten? Und reichen dazu ein paar Lebensjahrzehnte nicht aus?
Fragen über Fragen…
Und eine Begründung für einen Glauben an das gewisse etwas „da-nach“, die an Banalität kaum zu überbieten ist.
Zudem eine, die obendrein sehr gefährlich ist: Denn dieser Maxime fol-gend, kommt der Mensch schnell auf die Idee, alles, was unangenehm ist, worauf er keine Lust hat, kurzerhand zu verschieben.
„Im nächsten Leben mache ich Sport.“
„Im nächsten Leben achte ich auf die Umwelt“
„Im nächsten Leben bin ich weniger egoistisch.“
„Im nächsten Leben glaube ich an ein Leben danach“…
Die Welt ist eine Schule, in der man Lektionen lernen kann und Zeit und Gelegenheit hat, diese Lektionen irgendwann wirklich zu lernen (39).
Die Aussage geht in die gleiche Richtung wie die vorige. Wenn die Welt wirklich eine Schule ist: kann man sie dann nicht innerhalb einer Le-bensphase abschließen? Warum werden die zu lernenden Lektionen erst in Leben 3,4 oder 25 begriffen?
Reicht eine Lebensspanne auf Erden nicht aus, um die entsprechenden Lektionen zu lernen? In der uns bekannten Schule lernt man doch auch unmittelbar, in der Weltschule hingegen erst einige Leben später? Sind et-wa die Lerninhalte dessen, was jeder Mensch lernen muss so groß, dass ein Leben dafür nicht ausreicht? Heißt dass, dass die „Cleveren“ so zwei-, dreimal, die weniger Schlauen wieder und wieder die Erde bevölkern? Da komme ich nicht mit.
Das waren sie also, die Hauptgründe, derentwegen wir Menschen an ein Leben nach dem Tod glauben. Man kann von ihnen halten, was man will - für die Majorität der Menschen ist die Perspektive, dass nach dem ir-dischen Leben noch etwas kommt, schlicht und ergreifend eine sinnstif-tende, beruhigende, und nicht zuletzt auch tröstliche Vorstellung. Für die es mehr als genug nachvollziehbare Beweggründe gibt. Nehmen wir die Angst vor dem Nichts, jene vor dem Tod als solchem, Verlustschmerz, aber auch Lebensfreude, der nicht versiegen wollende Drang nach Selbst-verwirklichung und die Gier nach einem Mehr unseres irdischen Daseins.