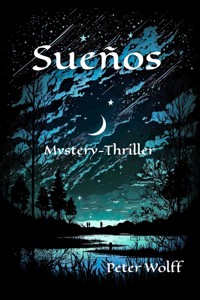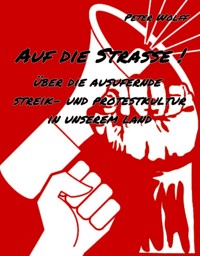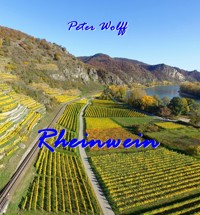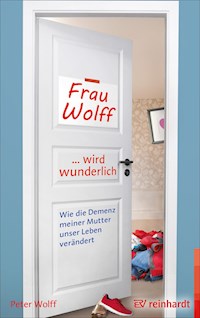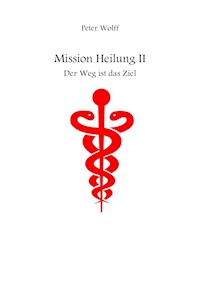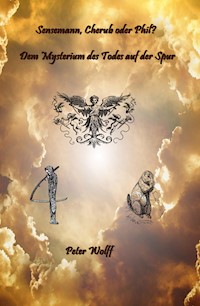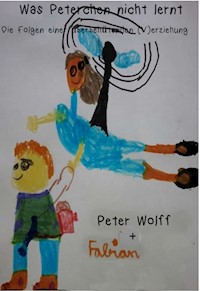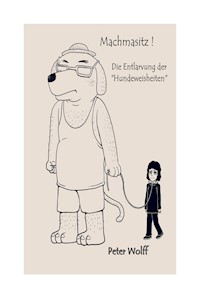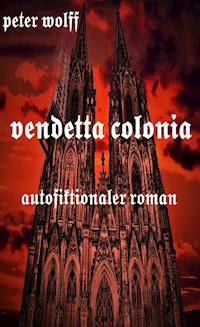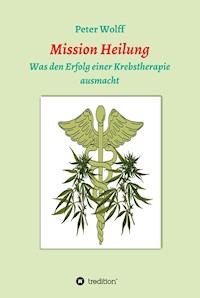2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die anhaltende Zuwanderung Schutz suchender Flüchtlinge ist seit dem Jahr 2015 eines der zentralen politischen Themen in unserem Land und spaltet die deutsche Bevölkerung. Die Kluft zwischen Befürwortern der "Willkommenskultur" und Kritikern der unkontrollierten Zuwanderung wird dabei stetig größer. Peter Wolff fragt sich, warum dies so ist und stellt die Fragen , die einen großen Teil der deutschen Bevölkerung im Zusammenhang mit der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik beschäftigen. Sein Buch leistet Hilfestellung, um sich in den wesentlichen Fragen rund um die Flüchtlingspolitik eine sachlich fundierte Meinung bilden zu können und trägt so womöglich zu einer Entspannung zwischen Befürwortern und Gegnern der "Willkommenskultur" bei. Zudem deckt es Unzulänglichkeiten in der deutschen und europäischen Asylpolitik auf und versucht, Ansatzpunkte zur Verbesserung zu identifizieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Peter Wolff
...und schon bist Du Rassist
wie uns die Flüchtlingskrise stigmatisiert
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Epilog
Impressum neobooks
01
Die anhaltende Zuwanderung Schutz suchender Menschen wird im Jahr 2015 zum zentralen politische Thema in unserem Land und sowohl im März 2020 bedingt durch die Grenz-öffnung durch den türkischen Präsidenten Erdogan wie auch im Februar 2022 durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder brandaktuell.
Die Flüchtlingsfrage spaltet die Menschen hierzulande wie kaum ein zweites Thema. Die Kluft zwischen Befürwortern der „Willkommenskultur“ und Kritikern der unkontrollierten Zuwanderung wird hierzulande fortdauernd größer. Auch und nicht zuletzt, weil unsere Regierung auf die elementaren Fragen ihrer Wähler zur Flüchtlingspolitik keine Antworten zu liefern weiß und ein Klima geschaffen hat, welches einer gemäßigten Betrachtung der Flüchtlingsproblematik kaum noch Raum lässt.
In zunehmendem Maße werden deshalb diejenigen Menschen verunglimpft, die die deutsche Asylpolitik kritisieren und die Gewalttaten von Zuwanderern thematisieren.
Der Autor deckt Unzulänglichkeiten in der deutschen und europäischen Asylpolitik auf und versucht, Ansatzpunkte zur Verbesserung zu identifizieren.
Sein Buch leistet Hilfestellung, um sich in den wesentlichen Fragen rund um die Flüchtlingspolitik eine sachlich fundierte Meinung bilden zu können und trägt so womöglich zu einer Entspannung zwischen Befürwortern und Gegnern der „Will-kommenskultur“ bei.
Carl Betze
...und schon bist Du Rassist
Wie uns die Flüchtlingskrise stigmatisiert
Mit Cartoons des bekannten Karikaturisten Roger Schmidt
© 2020 Carl Betze
Epilog: ©2022 Carl Betze
Autor: Carl Betze
Umschlaggestaltung, Illustration: Carl Betze
weitere Mitwirkende: Roger Schmidt, Karikaturist
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: Paperback 978-3-347-04569-9
Hardcover 978-3-7482-3966-6
e-book 978-3-7482-3967-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhalt
01 „Wir schaffen das“?
02 Woher kommt sie nur, diese Fremdenfeindlichkeit?
03 Flüchtlinge – gab es die schon immer?
04 Seit wann gibt es in Deutschland ein
Recht auf Asyl?
05 Gibt es eine gemeinsame
europäische Flüchtlingspolitik?
06 Nie, Nem, Ne – müssen nicht alle
EU-Staaten Flüchtlinge aufnehmen?
07 Ist Flüchtlingspolitik ein
staatliches Machtinstrument?
08 Ist das noch Willkommenskultur oder
oder bereits Willkommensfanatismus?
09 Handelt die Bundesregierung
nach dem Motto „Flüchtlinge first“?
10 Muss man nicht konsequent zwischen
Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlingen
unterscheiden?
11 Sollten Flüchtlinge zu gemeinnütziger
Arbeit verpflichtet werden?
12 Ist Gastrecht nicht gleich
Benimmverpflichtung?
13 Sollten Antragsprüfung und
Abschiebung vereinfacht werden?
14 Sind wir für alle Zeiten schuldig?
15 Kann Wohnraumnutzung
moralisch verwerflich sein?
16 Schützt der deutsche Staat seine Bürger
vor kriminellen Zuwanderern?
17 Tauchen Zuwanderer häufiger in den
Kriminalstatistiken auf?
18 Manipulieren Medien und Politik durch
Ihre Informationspolitik die
Bevölkerung?
19 Provoziert man in Deutschland die
Gewalt zwischen Deutschen und
Zuwanderern?
20 Ist der politische Schein wichtiger als
die Integration der Zuwanderer?
21 Ist die AfD eine echte Alternative für
für politisch gemäßigte Wähler?
22 Sollte Religionsfreiheit nicht ihre
Grenzen haben?
23 Wie positioniert sich die Kirche
in der Flüchtlingspolitik?
24 Ist Flüchtlingspolitik ein
Marketing-Instrument?
25 Welche Rolle spielen
Prominente in der Flüchtlingsdiskussion?
26 Droht unserem Land eine Überfremdung?
27 Hat man in Deutschland noch
das Recht auf freie Meinungsäußerung?
28 Können wir uns so viele
Flüchtlinge wirklich leisten
29 Profitieren die Flüchtlinge nicht selbst
von einer restriktiveren Asylpolitik?
30 Geht das mit den
Flüchtlingen jetzt so weiter?
31 Ausblick
„Wir schaffen das“?
Wer kennt sie nicht – die oft herangezogenen „Zitate für die Ewigkeit“, die einst zu einem bestimmten Sachverhalt formuliert wurden und dann oft in einem völlig anderen Zusammenhang von zig Menschen rezitiert werden.
„Wir schaffen das!“ - der Ausspruch der deutschen Bundes-kanzlerin Angela Merkel, in der Bundespressekonferenz am 31.August 2015 im Hinblick auf die Flüchtlingskrise in Europa und die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland postuliert, hat längst Kultstatus erreicht und wird meist dann rezitiert, wenn einmal wieder etwas schief gelaufen ist in der deutschen Flüchtlingspolitik.
Der Kern-Slogan der 'neuen Willkommenskultur' steht für die bislang umstrittenste Entscheidung in Merkels Kanzlerschaft, namentlich die mehr als großzügige Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland.
Mit ihrer Politik der offenen Grenzen ohne Obergrenze geht die Kanzlerin in Europa einen deutschen Sonderweg: Während sie sich hierzulande für das „freundliche Gesicht“ der Bundesrepublik feiern lässt, schütteln die Staatenlenker in Rom, Paris,, Warschau, Wien, Budapest und die Köpfe. Nur Schweden hat eine ähnlich großzügige Flüchtlingspolitik be-trieben wie sie Berlin nach wie vor praktiziert. Der Satz „Wir schaffen das“ wird von Teilen der Medien sehr schnell als positives Signal in der Flüchtlingspolitik Deutschlands rezipiert.
Der Ausspruch ist allerdings auch relativ früh Gegenstand von Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik, um vorzubringen, dass Deutschlands Aufnahmekapazitäten vollends erschöpft seien. Am 11.September 2015 zitiert Spiegel Online die Antithese Wir schaffen das nicht“ aus dem Mund des Bundesinnenministers Horst Seehofer, damals noch bayerischer Ministerpräsident: „Ich sehe keine Möglichkeit, den Stöpsel wieder auf die Flasche zu kriegen.“
Bundeskanzlerin Merkel macht zu Beginn der 'Flüchtlingskrise' nicht nur durch das erwähnte Zitat auf sich aufmerksam.
Sie stellt sich zudem im Rahmen des Besuches in einer Erst-aufnahmestelle für Asylbewerber und einer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtige (BfAM) in Berlin-Spandau für Selfies mit Flüchtlingen zur Verfügung. Die Folgen sind bekannt: Die Fotos gehen um die ganze Welt, fortan ist Deutschland verständlicherweise für Flüchtlinge aus aller Herren Länder dieser Welt das gelobte Land.
Auch für jene, die nicht unmittelbar vom Krieg bedroht sind. Doch bevor sie vorschnell über die sogenannten 'Wirtschafts-flüchtlinge' urteilen: Was würden Sie tun, wenn Sie in Armut leben und Ihnen suggeriert würde, dass es ein Land gibt, in dem Sie, auch, wenn Sie keine Arbeit haben, ein Vielfaches an Geld mehr zur Verfügung haben als in ihrer Heimat? Dass sie keinen Hunger mehr leiden müssen und ihre Kinder eine schulische Erziehung erhalten?
Den Menschen, die sich angesichts der „Willkommenspolitik“ von Kanzlerin Merkel auf den Weg nach Europa machen, gebührt kein Vorwurf.
Dieser ist eher der Kanzlerin selbst zu machen, die mit dem von ihr verbreiteten 'Schlaraffenland-Image' eine deutlich größere Flüchtlingswelle gen Alemannia lostrat, als zu erwarten war. Kann eine Bundeskanzlerin, die den Eid auf unser aller Grundgesetz geschworen hat, einfach sagen:
Nö, das machen wir jetzt mal anders? Wir lassen das Asylrecht links liegen und alle, die reinwollen, rein?
So ist es kaum verwunderlich, dass Merkels Flüchtlingspolitik in Ihrem Land auf wenig Gegenliebe stößt und die Bevölkerung zunehmend kritischer wird hinsichtlich der Frage, ob wir es in Deutschland wirklich schaffen, der Flüchtlingsströme sozialverträglich Herr zu werden.
Dem ARD-Deutschlandtrend vom September 2018 zufolge hält eine Mehrheit der Deutschen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung nicht für gelungen. Und zwar meinen dies konkret:
50% im Hinblick auf die Unterbringung und Verteilung der Flüchtlinge
69% im Hinblick auf die Vorbeugung von Gewalt und Kriminalität
69% im Hinblick auf die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt
83% im Hinblick auf die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber.
Darüber hinaus meinen 49% der Befragten, dass die Bundes-regierung die Sorgen beim Thema Zuwanderung nicht ernst nehme (02). Zahlen, die zu denken geben.
02
Woher kommt sie nur, diese Fremdenfeindlichkeit?
Die im letzten Kapitel genannten Zahlen sind sicher-lich größtenteils auf die aktuelle Flüchtlings-politik der Bundesregierung zurückzuführen, zum Teil je-doch basieren sie wohl auch auf einer latenten Frem-denfeindlichkeit, die in unserer Gesellschaft herrscht. Fremdenfeindlichkeit ist in Europa eine bedauerliche Kon-stante der Geschichte. Man kann auf der Zeit-tafel bis weit in die Antike zurückgehen - überall fin-den sich frühe Beispiele von Xenophobie und Frem-denhass. Bereits in der griechischen Antike grenzt man Fremde aus, im alten Rom sieht es nicht anders aus. Vom Reich der Mitte über das europäische Mit-telalter bis zur Ära des modernen Rassismus: Vorur-teile gegenüber Fremden begleiten uns Menschen seit Jahrtau-senden.
Xenophobie, in Form von Araberphobie, Islamopho-bie oder Negrophobie – Ressentiments gegen andere Menschen-gruppen existieren zu allen Zeiten. Die Ur-sachen hierfür sind schwer zu ergründen, die Recht-fertigungen für Fremdenfeindlichkeit in unseren Ge-sellschaften verändern sich häufig (03).
Die Angst oder Scheu vor dem Fremden ist zunächst einmal etwas biologisch Notwendiges, ein Schutz-mechanismus, der lebensrettend sein kann. Dieser Mechanismus muss sich jedoch nicht notwendiger-weise zu Rassismus steigern, im Rahmen dessen die normale Angst vor Fremden umschlägt in Fremden-hass und aggressive Handlungen gegenüber Frem-den.
Xenophobie ist im heutigen Europa zumeist Islamo-phobie. Hauptverantwortlich hierfür ist vor allem der islamische Terrorismus, auch werden islamische Mi-granten oft als wirtschaftliche Bedrohung wahrge-nommen. Das Verhältnis zwischen Morgenland und Abendland, also zwischen muslimisch und christlich geprägter Welt, schürt Ressentiments, der Jahrhun-derte lange Konflikt zwischen Islam und Christentum samt Kriegen und Kreuzzügen hat die Fronten ver-härtet. So behaupten viele Christen, ihre Religion wä-re die des Friedens, während der Islam die Kon-fession der Gewalt sei. Das ist so nicht richtig, denn auch die als friedsam bezeichnete christliche Religion hat Gräueltaten und Vernichtungsstrategien began-gen, wie sie auch der Islamische Staat heute kaum ra-dikaler zustande bringt (04).
Fremdenfeindlichkeit ist hierzulande heutzutage beinahe gleichzusetzen mit Muslimfeindlichkeit.
Eine Studie der der Forscher und Soziologen Oliver Decker und Elmar Brähler von der Universität Leipzig zum Thema Autoritarismus verdeutlicht dies. Für die 328 Seiten lange repräsentative Studie wurden zwischen Mai und Juli 2018 2416 Menschen in Deutschland (West: 1918, Ost: 498) interviewt. Die Forscher beobachten seit 2002 die Einstellungen der Deutschen zum Rechtsextremismus, bislang bekannt unter dem Namen „Mitte-Studien der Universität Leipzig“. Sie erscheint alle zwei Jahre, nun unter dem Namen „Leipziger Autoritarismus-Studie“.
Die Befragung in der Kategorie Ausländerfeindlich-keit zeigt, dass 24 Prozent und damit rund ein Viertel der Deutschen eine ablehnende Haltung gegenüber Ausländern haben.
Deutlich wird dabei ein Ost-West-Gefälle. Während im Westen 22% der Befragten aus-länderfeindlich eingestellt sind, sind es im Osten 31%. Insgesamt stimmen 36% der Deutschen der Aussage zu, dass Ausländer nur hierherkommen, um den Sozialstaat auszunutzen. Über ein Viertel würde Aus-länder wieder in ihre Heimat zurückschicken, wenn in Deutschland die Arbeitsplätze knapp werden. Rund 36% halten die Bundesrepublik durch Ausländer in einem gefährlichen Maß für "über-fremdet". Bei all diesen Antworten stimmen Ostdeutsche öfter zu als Westdeut-sche. Obwohl interkultureller Austausch im Alltag stattfindet, werden Vorurteile offenbar nicht abge-
baut. "Die Ausländer bleiben ein gewohntes Feind-bild“.
Deutlich zeigt sich, dass Menschen mit Abitur viel seltener rechtsextrem sind als jene ohne Hochschul-reife. Außerdem erreichen Männer in allen Katego-rien, höhere Werte als Frauen. Weitaus mehr Männer (26,3%) stimmen zum Beispiel ausländerfeindlichen Aussagen zu als Frauen (22,2%). Ältere Befragte ten-dieren eher zu rechtsextremen Positionen als jüngere.
"Erschreckend hoch ist die Abwertung von Muslimas und Muslimen angestiegen", sagt Studienleiter Elmar Brähler.
44,1% der Befragten finden, dass Muslimen die Zu-wanderung nach Deutschland untersagt werden soll-te. In den neuen Bundesländern sieht das sogar jeder Zweite so. Der Anteil derer, die sich "durch die vielen Muslime wie ein Fremder im eigenen Land fühlen", ist 2018 in Deutschland ebenfalls gestiegen. Die Vor-behalte gegenüber Asylsuchenden sind gleich ge-blieben - allerdings gleich hoch.
Vier von fünf Befragten finden, über Asylanträge sollte nicht großzügig entschieden werden. Dies werten die Forscher als Kritik an Flüchtlingen, nicht aber am Vor-gehen der Verwaltung, die über Anträge entscheidet (05).
Die Ergebnisse der Leipziger Studie sind wenig über-
raschend, verhält es sich doch so, dass in Zeiten einer hohen Zuwanderung die Fremdenfeindlichkeit ten-denziell zunimmt.
Die Fronten zwischen der einheimischen Bevölke-rung und der stetig wachsenden Zahl an Zuwande-rern scheinen verhärtet.
Das Ziel muss sein, sich auf einen Konsens für die universalen Menschenrechte zu verständigen, so schwer dies auch sein, so unerreichbar ein solcher Ist-Zustand aus heutiger Sicht auch erscheinen mag.
Sonst entstehen parallelen Subgesellschaften, die sich gegen feindseliges Verhalten mit Abwehr, Distanz, Rückzug oder aufgrund ihrer schwachen sozialen Position auch mit verdeckter oder offener Aggression wehren.
03
Flüchtlinge – gab es die schon immer?
Flucht und Vertreibung existieren bereits, seitdem die Menschen auf der Erde wandeln. Kriege, Missernten, Verfolgung, wirtschaftliche Not, Umweltkatastro-phen oder fehlende Lebensperspektiven – die Motive, warum Menschen ihre Heimat verlassen, sind viel-fältig.
Schon in der vorchristlichen Bronze- und Eisenzeit gibt es zwischen verschiedenen Stämmen Auseinan-dersetzungen um Jagdreviere, Siedlungsorte und Frauen als Fortpflanzungspartner. Die Überleben-den des unterlegenen Stammes müssen schlussend-lich ihre Heimat verlassen und an anderer Stelle sess-haft werden.
Auch in der Bibel sind Unterdrückung und Flucht allgegenwärtig. So wird Moses von Gott auserkoren, das Volk Israel von seinem Sklavendasein in Ägypten zu befreien, und führt sein Volk ins gelobte Land nach Kanaan. Viele Historiker vertreten die Ansicht, dass der Auszug aus Ägypten im Alten Testament auf wahren historischen Begebenheiten im 13. Jahr-hundert vor Christus beruht.
In der Antike und zur Römerzeit werden viele Volks-gruppen wegen ihres Glaubens und ihrer Kultur vertrieben. Auch das Ende des Römischen Reichs und der Beginn des Mittelalters stehen in engem Zusam-menhang mit massenhaften Flüchtlingsbewegun-gen, die meist unter dem verharmlosenden Be-griff "Völkerwanderung" zusammengefasst werden.
Auf der Flucht vor den Hunnen, einem aus Zentral-asien anrückenden Reitervolk, machen sich viele ger-manische Stämme auf den Weg nach Westen. Sie - darum, sich im Römischen Reich niederlassen zu dürfen, was ihnen 376 nach Christus auch gewährt wird.
Die Integration indes schlägt fehl, es kommt zu Auf-ständen. Immer neue Volksstämme ziehen in den fol-genden Jahrzehnten aus Norden und Osten Richtung Römisches Reich, wo sie sich ein wirtschaftlich und politisch besseres Leben erhoffen. Als Folge der mannigfaltigen, zum Teil mit Gewalt erzwungenen Völkerbewegungen zerfällt Rom in viele kleinere Rei-che, in denen der Grundstein für das heutige Europa gelegt wird.
In den folgenden Jahrhunderten sind es immer wie-der Kriege aufgrund von Territorialinteressen oder infolge religiöser oder rassistischer Überzeugungen, die zu Flucht und Vertreibung führen. Der dreißig-jährige Krieg oder beide Weltkriege im 20. Jahrhun-dert, in deren Folge Millionen Menschen ihre Heimat verlieren, sind die bedeutendsten unter vielen.
Auch Missernten sind Ursachen für Fluchtbewegun-gen. So machen sich Mitte des 19. Jahrhunderts nach mehreren schlechten Kartoffelernten und der dadurch grassierenden Hungersnot knapp zwei Mil-lionen Iren auf den Weg nach Amerika, Australien und Großbritannien.
Seit Ende des 20. Jahrhunderts haben sich die Flücht-lingsbewegungen zunehmend globalisiert. Zwar bil-den kriegerische Konflikte weiterhin oftmals die Ur-sache, doch mehr und mehr spielen auch andere Gründe eine Rolle, infolge derer Menschen ihre Hei-mat verlassen: Armut, Hunger, Umweltkatastro-phen und fehlende Lebensperspektiven. Auch Ein-griffe in die Natur wie zum Beispiel Flussbegradi-gungen oder Staudämme ziehen immer wieder Fluchtbewegungen nach sich.
Die westlichen Industrienationen verheißen zurzeit am meisten Sicherheit und Wohlstand und sind somit zum Ziel von Millionen Flüchtlingen aus armen und konfliktbeladenen Regionen, vor allem aus Afrika und Asien, geworden. Besonders die USA sowie die Staaten der Europäischen Union sind beliebte Ziele.
Die Flüchtlinge nehmen dafür große Strapazen und hohe finanzielle Belastungen in Kauf und riskieren nicht selten ihr Leben – etwa bei der Überfahrt von Nordafrika durch das Mittel-meer. Und selbst wenn ihnen die Einreise gelingt, kommt es oft vor, dass sie nicht als asylsuchende Flüchtlinge anerkannt und zurück in ihre Heimat abgeschoben werden.
Die Hilfsangebote für Flüchtlinge sind auf verschie-denen Ebenen organisiert. So wird 1951 das Flücht-lingswerk (UNHCR), der Vereinten Nationen ge-gründet, das sich für die Rechte der Flüchtlinge und die Einhaltung der Genfer Konvention ein-setzt und in Krisengebieten Hilfe leistet.
Die Europäische Union (EU) richtet 1992 eine Ge-neraldirektion für humanitäre Hilfe ein und ist in na-hezu allen Krisen-regionen der Welt aktiv. Zudem ist die EU einer der größten Geber öffentlicher Entwick-lungshilfe. Programme zur Wirtschaftsförderung, Gesundheits-verbesserung und Armutsbekämpfung sollen dazu beitragen, Gründe für eine mögliche Flucht zu reduzieren.
Auch einzelne Staaten leisten in Form von Not-programmen und bilateralen Vereinbarungen mit Partnerländern Hilfe zur wirtschaftlichen Entwick-lung. Zudem wird auf staatlicher Ebene in Form der Asylgesetzgebung der Umgang mit Flüchtlingen ge-regelt. So bekommt ein Asylberechtigter in Deutsch-land eine auf vorerst drei Jahre befristete Aufenthalts-genehmigung sowie unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf Sozialleistungen.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge leistet Hilfe bei der Integration von Flüchtlingen, die in Deutschland bleiben wollen, zum Beispiel durch Sprachkurse und Rechtsberatung. Außerdem enga-gieren sich viele Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in der Flüchtlingshilfe. Organisationen und Vereine wie Rotes Kreuz, Roter Halbmond, Ärzte oh-ne Grenzen, terre des hommes oder Cap Anamur, die sich dem Gemein-nutz verpflichtet haben, helfen in Notsituationen und versorgen Flüchtlinge vor Ort.
Aufgrund ihrer schlanken Strukturen und teilweise kurzen Entscheidungswege sind NGOs oft flexibler und somit zu schnellerer Hilfe in der Lage als staat-liche Stellen.
Trotz der wachsenden Hilfsangebote von verschie-denen Seiten hat sich die Lage für Flüchtlinge im neu-en Jahrtausend nicht verbessert. Laut einem Bericht der Vereinten Nationen waren 2018 weltweit etwa 71 Millionen Menschen auf der Flucht. Während die Zahl der offiziell anerkannten Flücht-linge seit 1999 tendenziell unverändert bleibt, ist die Zahl der sogenannten Binnenflüchtlinge stark ange-stiegen, die innerhalb ihres Heimatlandes zur Flucht gezwungen werden. Binnenflüchtlinge machen mit 41 Millionen inzwischen den größten Anteil der Menschen aus, die ihre Heimat verloren haben (06).
04
Seit wann gibt es in Deutschland das Recht auf Asyl?
Im Jahr 1949 beraten die Mitglieder des Parlamenta-rischen Rates über Artikel 16 des Grundgesetzes, das gesellschaftliche "Wir“ ist noch deutlich enger defi-niert als heute.
Damals meint man allenfalls Spanier oder Russen, wenn man von "Ausländern" spricht. In der Redak-tionsstube der Verfassung denkt man bei politisch Verfolgten sogar zuallererst an Deutsche.
Der erste Entwurf für Artikel 16 lautet: "Jeder Deut-sche, der wegen seines Eintretens für Freiheit, Demo-kratie, soziale Gerechtigkeit oder Weltfrieden ver-folgt wird, genießt im Bundes-gebiet Asylrecht."
Ein Asylrecht für sämtliche politisch Verfolgten Aus-länder erscheint dem Redaktionsausschuss "zu weit-gehend" – immer-hin ist das geteilte Nachkriegs-deutschland ein schwacher Staat mit reichlich eige-nen Vertriebenenproblemen.
Als großzügigere Formulierung überlegt der Rat, "Auslän-der(n), welche wegen ihres Eintretens für Freiheit, Demo-kratie, soziale Gerechtigkeit und Weltfrieden politisch verfolgt werden", Asylrecht zu gewähren. Am Ende sind es die Staatsrechtler Carlo Schmid (SPD) und Hermann von Mangoldt (CDU), die die heutige, weite Formulierung durchsetzen. Schließlich, so Schmid, dürfe man die Asylgewäh-rung nicht davon abhängig machen, "ob der Mann uns politisch nahesteht oder sympathisch ist" (07).
Artikel 16a unseres Grundgesetzes sichert politisch Verfolgten ein individuelles Grundrecht auf Asyl in Deutschland zu. Das ist Ausdruck für den Willen Deutschlands, seine historische und humanitäre Ver-pflichtung zur Aufnahme von Flüchtlingen zu er-füllen.
Das Asylverfahren wird vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), durchgeführt.
Das Anerkennungsverfahren für Asylsuchende ist im Wesent-lichen im deutschen Asylgesetz (AsylG) geregelt.
Asylsuchende werden demnach zeitnah nach ihrer Einreise - das heißt bereits beim Erstkontakt mit einer zur Registrierung befugten Behörde (Bundepolizei oder auch Landespolizei, Aufnahmeeinrichtung, BAMF oder Ausländerbehörde) – erkennungs-dienstlich behandelt. Sofern sie das 14. Lebensjahr vollendet haben werden dabei auch ihre Fingerab-drücke erfasst. Diese Daten werden in dem bundes-weit verfügbaren zentralen Kerndatensystem gespei-chert.
Für die Unterbringung und soziale Betreuung Asyl-suchender sind die Bundesländer zuständig.
Mit Hilfe eines bundesweiten Verteilungssystems werden sie nach einem im Asylgesetz festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Dort angekommen, erfolgt an-hand einer Fast-ID-Überprüfung ein Abgleich mit dem Kerndatensy-stem und die Zugereisten erhalten einen Ankunfts-nachweis, wenn sie sich in die ihnen zugewiesene Aufnahme-einrichtung begeben haben. Mit dem An-kunftsnachweis können sie ihre Registrierung nach-weisen, ab der Ausstellung des Ankunftsnachweises ist der Aufenthalt im Bundesgebiet gestattet (Auf-enthaltsgestattung) und es wird ein vorläufiges Blei-berecht in der Bundesrepublik Deutschland zur Durchführung des Asylverfahrens gewährt.
Nach der Ankunft in der zuständigen Aufnahmeein-richtung stellen die Asylsuchenden einen formellen Asylantrag in der zuständigen Außenstelle des BAMF.
Asylbewerber werden durch Entscheiderinnen und Entscheider des BAMF (unter Hinzuziehung eines Dolmetschers) zu ihrem Reiseweg und Verfol-gungsgründen persönlich angehört. Die Anhörung wird in einer Niederschrift protokolliert, rücküber-setzt und in Kopie ausgehändigt. Aufgrund der An-hörung und gegebenenfalls weiterer Ermittlungen wird über den Asylantrag entschieden. Die Entschei-dung erfolgt in schriftlicher Form, versehen mit einer Rechtsbehelfsbelehrung.
Neben dem Grundrecht auf Asyl gemäß Artikel 16a GG gibt es gemäß den Vorschriften der Qualifika-tions-Richtlinie, des AsylG und des AufenthG drei weitere Schutzformen.
Zunächst kann Schutz auch als Flüchtling gemäß §3,1 des Asylgesetzes (AsylG) gewährt werden.
Ein Ausländer ist Flüchtling im Sinne des Abkom-mens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (BGBl. 1953 II S. 559, 560), wenn er sich
aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe
außerhalb des Landes (Herkunftsland) befindet,
a) dessen Staatsangehörigkeit er besitzt und dessen Schutz er nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen will oder
b) in dem er als Staatenloser seinen vorherigen gewöhnlichen Aufenthalt hatte und in das er nicht zurückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht zurückkehren will.
Ein Ausländer ist nicht Flüchtling nach Absatz 1, wenn aus schwerwiegenden Gründen die Annahme gerechtfertigt ist, dass er
ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat im Sinne der internationalen Vertragswerke, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen zu treffen,
vor seiner Aufnahme als Flüchtling eine schwere nicht-politische Straftat außerhalb des Bundesgebiets begangen hat, insbesondere eine grausame Handlung, auch wenn mit ihr vorgeblich politische Ziele verfolgt wurden, oder
den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwidergehandelt hat (08).
In der Praxis ist es nicht wichtig, welche der beiden Schutz-formen – Art. 16 a GG oder § 3 Abs. 1 AsylG – man erhält. Anerkannte Asylberechtigte erhalten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 1 S. 1 AufenthG; anerkannte Flüchtlinge eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs.2 S.1,1. Alt.AufenthG.
Die Folgen für die Dauer der Aufenthaltserlaubnis (sie wird für drei Jahre erteilt – dann erfolgt eine er-neute Überprüfung) und die Möglichkeit, Unter-stützung vom Staat zu erhalten (Arbeitslosengeld II, Kindergeld, BAföG und anderes) sind dieselben (09).
Kann weder Asyl noch Flüchtlingsschutz gewährt werden, prüft das BAMF im Asylverfahren stets, ob die Voraussetzungen gegeben sind, um subsidiären Schutz im Sinne des § 4 AsylG zu gewähren.
Ein Ausländer ist subsidiär Schutzberechtigter, wenn er stich-haltige Gründe für die Annahme vorgebracht hat, dass ihm in seinem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden droht. Als ernsthafter Schaden gilt dabei:
die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe
Folter, unmenschliche, erniedrigende Behandlung oder Bestrafung oder eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens beziehungsweise der Unversehrtheit einer Zivilperson
willkürliche Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts
Ein Ausländer ist von der Zuerkennung subsidiären Schutzes nach Absatz 1 ausgeschlossen, wenn schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass er ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der internationalen Ver-tragswerke begangen hat, die ausgearbeitet worden sind, um Bestimmun-gen bezüglich dieser Verbre-chen festzulegen. Konkret, wenn er
eine schwere Straftat begangen hat
sich Handlungen zu Schulde kommen lassen hat, die den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen (BGBl. 1973 II S. 430, 431) verankert sind, zuwiderlaufen oder
eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland darstellt.
Diese Ausschlussgründe sind nicht an konkretes Tun gebunden. Sie gelten auch für Ausländer, die andere zu den genannten Straftaten oder Handlungen an-stiften, diese mitplanen oder -vorbereiten oder sich in sonstiger Weise daran beteiligen.
Die Feststellung von 'nationalen' Abschiebungsver-boten folgt §60 (Verbot der Abschiebung) des Auf-enthaltsgesetzes (AufenthG), § 5 und 7. Gemäß §5 darf ein Ausländer nicht abgeschoben werden, so-weit sich aus der Anwendung der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. 1952 II S. 685) ergibt, dass die Abschiebung unzulässig ist.
§7 schreibt vor, dass von der Abschiebung eines Aus-länders in einen anderen Staat abgesehen werden soll, wenn dort für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht.
Eine erhebliche konkrete Gefahr aus gesundheit-lichen Gründen liegt nur vor bei lebensbedrohlichen oder schwerwiegen-den Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden.
Es ist nicht erforderlich, dass die medizinische Ver-sorgung im Zielstaat mit der Versorgung in der Bun-desrepublik Deutschland gleichwertig ist. Eine aus-reichende medizinische Versorgung liegt in der Regel auch vor, wenn diese nur in einem Teil des Zielstaats gewährleistet ist (10).
Bis es zur Entscheidung über einen Asylantrag kommt, vergehen Monate, manchmal Jahre.
Werden Schutzberechtigte dann gemäß einem der genannten Verfahren anerkannt, erhalten sie zu-nächst eine befristete Aufenthaltserlaubnis für unser Land . Sie sind damit in vielerlei Hinsicht den Deut-schen gleichgestellt, insbesondere haben sie An-spruch auf Sozialhilfe, Kindergeld, Erziehungsgeld, Eingliederungsbeihilfen und Sprachförderung sowie sonstige Integrationshilfen. Doch nicht immer ist der Antrag auf ein Bleiberecht in Deutschland von Erfolg gekrönt.
Wird der Asylantrag abgelehnt, sind die Betroffenen in der Regel zur Ausreise aus Deutschland verpflich-tet (11).
05
Gibt es eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik?
Die Verpflichtung der EU, Schutzbedürftigen zu helfen, ist in der Charta der Grundrechte und im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankert. Die Asylpolitik der Europäischen Union besteht in dem Versuch, in den Mitgliedstaa-ten ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS) für die Durchführung von Asylverfahren und die Unterbringung und Versorgung von Asyl-suchenden zu verwirklichen. Es zielt auf die An-gleichung der Asylsysteme der EU-Mitgliedstaaten, damit die Asylbewerber in allen Mitgliedsstaaten gleichbehandelt werden. Außerdem ermöglicht es den Abgleich von Fingerabdrücken von Asylbe-werbern über die Datenbank EURODAC.
Die Genfer Flüchtlingskonvention definiert 1951 im Auftrag der Vereinten Nationen genau, wer als Flüchtling gilt, um den Betroffenen einen rechtlichen Schutzrahmen zu gewährleisten. Ein Flüchtling ist per Definition eine Person, die sich außerhalb ihres Heimatstaates aufhält, da ihr dort aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeu-gung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe Verfolgung droht.
Die Staaten, die der Flüchtlingskonvention beigetre-ten sind, sichern Flüchtlingen eine Grundversorgung zu. Zudem steht ihnen Religionsfreiheit zu, sie kön-nen ordentliche Gerichte anrufen, ihnen wird ein Rei-sedokument ausgestellt und sie sollen vor Diskri-minierung geschützt werden. Außerdem darf ein Flüchtling nicht in ein Land zurückgeschickt werden, in dem ihm Verfolgung droht.
In der Auslegung der Konvention wenden die Länder verschiedene Regelungen an. Das deutsche Asyl-recht beispiels-weise erkennt Asylbewerbernicht an, wenn sie über einen sogenannten "sicheren Dritt-staat" eingereist sind. Auch muss die Verfolgung ziel-gerichtet und aufgrund der persönlichen Merkmale des Bewerbers erfolgen; allgemeine Notsituationen im Heimatland werden nicht anerkannt.
Nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen Migranten: Menschen, die aus wirtschaftlichen Grün-den ihr Heimatland verlassen oder vor Umweltka-tastrophen, Kriegen oder Hunger fliehen. Die Auf-nahme von Migranten regelt jedes Land individuell, es gibt keine verbindlichen Richtlinien wie bei Flücht-lingen, obwohl beide Gruppen oft die gleichen Wege gehen (12).
Die Wurzeln der europäischen Asyl- und Flücht-lingspolitik stammen aus der Zeit der Römischen Verträge von 1957. Prozess der Entwicklung eines europäischen Binnenmarktes läuft einher mit den Anfängen der Vereinheitlichung der Asylpolitik. Dabei werden besonders große Fortschritte in den 1980er Jahren durch eine immer enger werdende polizeiliche Zusammenarbeit und letztlich durch das Schengener Übereinkommen von 1985 sowie durch die Europäische Akte von 1986 erzielt. Der Maas-trichter Vertrag aus dem Jahr 1992 wird als großer Fortschritt in Bezug auf die Asyl- und Flüchtlings-politik gehandelt, da diese hier erstmals als „Ange-legenheiten von gemeinsamem Interesse“ apostro-phiert werden. Da Entscheidungen in diesem The-menfeld einstimmig getroffen werden müssen, bleibt die Entscheidungshoheit in der Flüchtlings- und Asylpolitik aber weiterhin bei den Mitglied-staaten. Diese treten ihre Entscheidungsbefugnis erst 1997 im Zuge des Amsterdamer Vertrages, der die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine gemeinsame EU-Asylpolitik festlegte, an die EU ab.
Am 1. September 1997 tritt das Dubliner Überein-kommen in Kraft. Es weist demjenigen Staat, in den der Asylbewerber nachweislich zuerst eingereist ist, die Zuständigkeit für das Asylverfahren zu.
Vor einer inhaltlichen Prüfung des Asylantrags wird die Zuständigkeit des Mitgliedstaates geprüft. Gege-benenfalls muss der Asylbewerber in den für sein Asylverfahren zuständigen Mitgliedstaat überstellt werden.
Das Tampere-Programm von 1999 soll die bisherige Asyl- und Flüchtlingspolitik durch ein kollektives Asylsystem und durch eine vergemeinschaftete Mi-grationspolitik untermauern und infolgedessen die EU zu einem „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ entwickeln. Dem liegt die Idee zugrunde, einen einheitlichen Schutzraum, in dem alle Flücht-linge gleichbehandelt werden und jeder Mitgliedstaat das gleiche Schutzniveau erfüllt, zu verwirklichen. Konkret bedeutet das, dass jeder Mitgliedstaat recht-liche Mindeststandards, besonders alle Regelungen der Genfer Flüchtlingskonvention und das Prinzip der Nicht-zurückweisung, verankert hat. 2001 wird nach der Kosovo-Krise die Richtlinie 2001/55/EG (Massenzustrom-Richtlinie) geschaffen, die einen Mechanismus zum vorübergehenden Schutz von Vertriebenen und einen Solidaritätsmechanismus der Mitgliedstaaten für den Fall vor-sieht, dass der Europäische Rat per Beschluss einen „Massenzu-strom“ feststellt. Diese Richtlinie wird in nationale Gesetze umgesetzt, so etwa in Deutschland durch §24 AufenthG, wurde aber bisher (Stand: Dezember 2015) keinmal angewandt.
Seit Anfang des 21. Jahrhunderts bemühen sich die Mitglied-staaten noch intensiver um eine Verge-meinschaftung der Asylpolitik, weshalb im Haager Programm 2004 ein zweistufiger Plan entworfen wird, diese EU-weit zu harmonisieren.
Die Asylaufnahmerichtlinie (2003/9/EG) enthält Mindeststandards für die Aufnahme und Versor-gung von Asylbewerbern, die Qualifikationsricht-linie (2004/83/EG) soll dafür sorgen, dass auch den-jenigen Flüchtlingen subsidiärer Schutz geboten wird, die kein Anrecht auf Asyl haben, aber auf Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht dorthin abgeschoben werden dürfen, wo Ihnen Ge-fahr für Leib und Seele droht. Die Asylverfahrens-richtlinie (2005/85/EG) stellt die Mindestnormen für das Asylverfahren auf.
Das Grünbuch der EU-Kommission