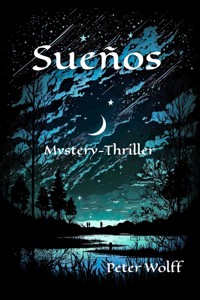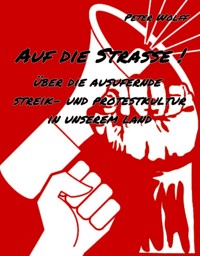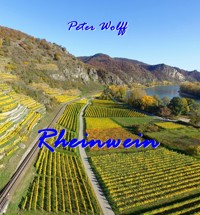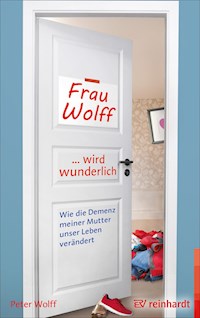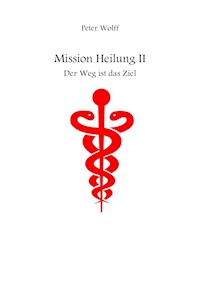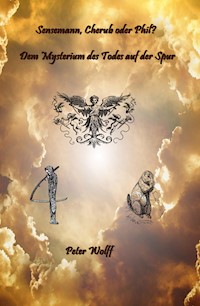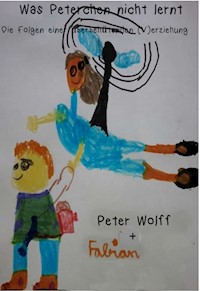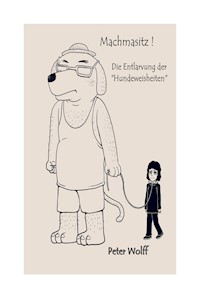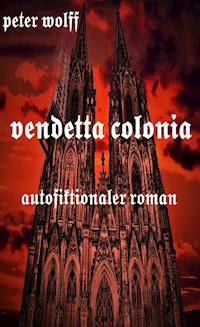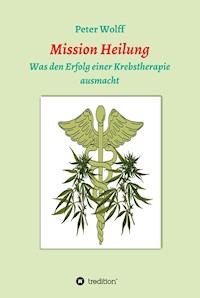2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Was wäre die Menschheit ohne das Gefühl der Angst? Wir schreiben das Jahr 2030: die erste bemannte Marsmission hat Gesteinsbrocken des Roten Planeten zur Erde befördert, die eine unbekannte Kieselsäure enthalten. In Tierversuchen fällt auf, dass die Substanz maligne Zellen bekämpft. Ein Geologe lässt unbemerkt einige Tabletten für einen an Krebs erkrankten Freund drucken. Was er nicht weiß: die Substanz bekämpft nicht nur Krebszellen, sondern unterdrückt zudem das Gefühl der Angst. Und: ihr wohnt ein ansteckender Virus inne. Es entwickelt sich eine Infektionskette, die das soziale Miteinander nachhaltig verändert und die Strafstatistiken explodieren lässt. Als auch feindlich gesinnte diktatorische Staaten in den Besitz des Marsgesteins gelangen und die angstblockierende Kieselsäure für ihre Zwecke einsetzen, droht die Situation zu eskalieren, der Weltfrieden ist ernsthaft bedroht. Zum Glück stellt sich heraus, dass die Angstblockade nur vorübergehender Natur ist. Trotzdem muss dringend ein Gegenmittel gefunden werden. Denn das Virus breitet sich weiter aus und längst planen kriegführende Großmächte, sich das Gestein vor Ort zu besorgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Wolff
Blocked
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Epilog
Quellenverzeichnis
Impressum neobooks
Prolog
Blocked
Peter Wolff
Copyright © 2023 Peter Wolff
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 9798861288613
Imprint: Independently published
„Es gibt keine Grenzen. Weder für
Gedanken noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt“
Ingmar Bergman (*14. Juli 1918, ‚†30. Juli 2007, schwedischer Drehbuchautor, Film- und Theaterregisseur)
Emotionen sind ein essentieller Bestandteil unseres menschlichen Wesens. Sie dominieren unseren Alltag, bewerten wir doch meist unbewusst jede Situation mit Hilfe unserer Gefühle.
Aber was sind eigentlich Emotionen?
Reine Reizreaktionsmuster, die durch Umweltgegebenheiten ausgelöst werden? Eine neurophysiologische Reaktion, die nur im Gehirn stattfindet und die wir nicht beeinflussen können? Etwa ein durch das prägende soziale Umfeld bestimmtes Phänomen? Eine eindeutige und allgemeingültige Definition gibt es bisher nicht.
Die Wissenschaft stützt sich, auch und nicht zuletzt mangels Alternativen, bis heute vornehmlich auf eine Phänomenbeschreibung. Biologisch gesehen sind Emotionen komplexe Verhaltensmuster, die sich im Laufe der Evolution herausgebildet haben. Aber wozu brauchen wir sie?
Unser Emotionsportfolio hilft uns, uns im Alltag orientieren zu können. Es wird durch unsere alltäglichen Erfahrungen ständig erweitert und verfeinert. Nichts, was wir erleben, bleibt ohne Wirkung. Jede Erfahrung, die wir machen, alles, was wir lernen, wird im Gehirn mit dem entsprechenden Gefühl verknüpft, welches wir in dieser Situation empfinden. Je intensiver dieses Gefühl ist, umso deutlicher bleibt es in unserem Gedächtnis verankert.
Jedes Gefühl geht immer mit einer körperlichen Reaktion einher. Je stärker die Gefühlsregung ist, desto deutlicher reagieren wir. Wir lachen, sobald wir uns freuen. Wir weinen, weil wir traurig sind. Wir schreien, wenn wir uns ärgern. Diese Verkörperung von Gefühlen, dieses Zusammenspiel zwischen unseren Gedanken, unseren Emotionen und unserem Körper, ist untrennbar miteinander verbunden (01).
All unser Denken und Handeln ist geleitet von Gefühlen. Egal wie stark unsere Persönlichkeit auch ist: Gefühle sind Gedanken ohne Filter – und eben deshalb machen sie angreifbar. Will man Menschen für eigene Zwecke benutzen, verspricht es deshalb den größten Erfolg, eben dort, an der Achillesferse des Homo Sapiens, anzusetzen.
*
Jahrtausendelang waren die Sterne für den Menschen unerreichbar. Sie befanden sich in einer fernen, einer geheimnisvollen Sphäre. Die Erdlinge konnten sie nur beobachten und sich die Welt der Gestirne in ihrer Fantasie ausmalen.
Mutmaßlich haben bereits unsere frühesten Vorfahren ihren Blick gen Himmel gerichtet und über Sonne, Mond und Gestirne gestaunt. Mit dem Sesshaftwerden der Menschen und dem Beginn der Ackerbaukulturen erlangte die Himmelskunde eine besondere Bedeutung. Sternenkundige Angehörige der Hochkulturen der Sumerer, der Babylonier und der Ägypter hielten fest, wann die Sonne auf- und wann sie unterging, auf welche Art die Mondphasen einen Monat unterteilten, wie die Sonne Tag für Tag stets an einem anderen Punkt erschien und unterging und dabei ganz augenscheinlich einen bestimmten Jahreszyklus durchlief. Solche Beobachtungen dienten als Grundlage für die ersten Kalender, die Himmelskundige schufen – und die fortan als wichtige Hilfsmittel fungierten, mithilfe derer die Menschen in den Agrargesellschaften den günstigsten Zeitpunkt für Aussaat und Ernte justierten (02).
Heute beschert uns die moderne Technik Einblicke in kaum vermutete Tiefen des Alls, und die moderne Raumfahrt macht bereits Reisen in unsere nähere kosmische Umgebung möglich. Und das ist sicher erst der Anfang.
Der Startschuss für das Zeitalter der Raumfahrt fiel im Oktober 1957. Die Sowjetunion, damals ein Konglomerat aus Russland und einigen anderen Ländern, katapultierte den Satelliten Sputnik 1 in die Erdumlaufbahn.
Die Großmächte USA und Sowjetunion wetteiferten darum, so schnell wie möglich zum Mond zu fliegen. Einen Monat nach dem Satelliten Sputnik folgte eine sowjetische Rakete mit einem Lebewesen an Bord: Es war die Hündin Laika. Der erste Mensch im Weltall war der damals 27-jährige Juri Gagarin, wie der Vierbeiner aus der Sowjetunion. Am 12. April 1961 umkreiste er in einer Raumkapsel 108 Minuten die Erde.
Letztendlich jedoch blieb der große Tag schlechthin den USA vorbehalten: Am 16. Juli 1969 startete die Rakete Apollo 11 ihre 400.000 Kilometer lange Reise Richtung Mond. An Bord die drei US-amerikanischen Raumfahrer Neil Armstrong, Michael Collins und Edwin Aldrin. Am 20. Juli 1969 und da just um 03:56 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit setzte der amerikanische Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch einen Fuß auf den Mond. Weltweit über 500 Millionen Menschen waren im Fernsehen live dabei (03).
"Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit". Ältere Leser werden sich vielleicht erinnern.
Den Mond hatte die Menschheit also erobert. Aber damit nicht genug. Fortan gerieten andere Planeten ins Visier unser gen Weltall strebenden Spezies. Insbesondere der Mars. Die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA, die russische Raumfahrtagentur Roskosmos und die Volksrepublik China
strebten als erklärte Fernziele bemannte Marsexpeditionen an (04). In den Jahren zwischen 1960 und 2020 wurden stolze 53 Raumsonden hoch zum Mars geschickt, davon waren 25 amerikanisch, 19 sowjetisch/russisch, zwei europäisch, zwei europäisch-russische Gemeinschaftsprojekte, zwei chinesisch, eine japanisch, eine indisch und eine kam aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (05).
Seit Ende des dritten Jahrzehnts im dritten Jahrtausend unserer Zeitrechnung, ist auf dem roten Planeten, dessen Färbung auf Eisenoxid-Staub, also Rost, zurückgeht, der sich auf der Oberfläche und in der dünnen CO2-Atmosphäre verteilt hat, nunmehr auch das Einsammeln von Gesteinsproben möglich.
Mit der unbemannten amerikanischen Raumsonde `Marspioneer1` transportiert schließlich am Ende die USA im Rahmen einer von der NASA und der Europäischen Weltraummorganisation ESA gemeinsam vorbereiteten Mission als erste Großmacht Gestein aus zwei Regionen des kalten Planeten, benannt nach dem römischen Kriegsgott Mars, zur Erde.
Anno 2030 steht die Menschheit kurz vor der ersten bemannten Marsmission und damit davor, nach dem Mond den zweiten Himmelskörper zu erobern. Die Reisedauer von der Erde bis zum Mars hat sich infolge rasanter Entwicklungen in der Raumfahrttechnologie auf etwa zwei oder drei Monate verkürzt. Eines jedoch ist nach wie vor Fakt: Haben die Astronauten den langen Flug hinter sich, müssen sie 15 Monate auf einer Raumstation in der Marsumlaufbahn oder gar auf dem roten Planeten verweilen. Denn erst dann sind der Mars und die Erde wieder auf derselben Seite der Sonne und ist damit die Möglichkeit für einen Rückflug gegeben (06). Gleich mehrere Nationen planen einen bemannten Marsflug. Wenn die Voraussetzungen für den langen Aufenthalt der Astronauten auf dem Roten Planeten geschaffen sind, soll es endlich losgehen.
*
Professor Doktor Philipp Mähling, Direktor des Integrierten Centrums für Tumorerkrankungen (ICT) in Köln und darüber hinaus einer der führenden Onkologen Deutschlands, kann sich vor Glückwünschen kaum retten.
Sein Institut ist als `Onkologisches Spitzenzentrum` ausgezeichnet worden und wird fortan aus Bundesmitteln gefördert werden. Diese Auszeichnung wird in Deutschland nur an solche Klinika vergeben, die eine außergewöhnlich gute Patientenversorgung sowie bahnbrechende Forschungsleistungen im Bereich der Onkologie nachweisen können. Philipp Mähling und sein Expertenteam haben zwei Ansätze, die als große Hoffnungsträger in der Krebstherapie gelten, entscheidend vorangebracht.
Sie haben im Laufe der letzten Jahre immer mehr Genmutationen entdeckt, zu deren Behandlung zielgerichtete Medikamente entwickelt werden können, die in der Lage sind, das Tumorwachstum zu stoppen. Es handelt sich um kleine, synthetisch hergestellte Moleküle, die als Enzymblocker fungieren und sich spezifisch gegen ein bestimmtes Merkmal von Tumoren richten. Sie entfalten ihre Wirkung an diesem speziellen, vorab identifizierten Angriffspunkt, der das Wachstum bösartiger Zellen antreibt. Bei jedweden anderen Krebszellen, die das signifikante Merkmal nicht aufweisen, wirkt die Substanz nicht. Vor einer Behandlung muss also im Rahmen einer Genexpressionsanalyse stets abgeklärt werden, ob die Tumorzellen des Patienten jenes Merkmal besitzen, gegen das sich das Arzneimittel richtet (07).
Noch vielversprechender sind die Entwicklungen im Bereich mRNA-basierter individualisierter Krebsimpfstoffe. Die Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus im Rahmen der mehrere Jahre währenden Pandemie Anfang der 2020er Jahre ist der finale Durchbruch dieser Idee, die eine Handvoll Forscher am Salk Institute for Biological Studies im kalifornischen La Jolla bereits Ende der 1980er Jahre entwickelt haben: In dem man den menschlichen Zellen den genetischen Bauplan für bestimmte Eiweiße injiziert, kann man sie dazu bringen, sogenannte Antigene selbst herzustellen und dann dem eigenen Immunsystem als Ziel zu präsentieren. So kann man dem Immunsystem von Krebskranken mit Hilfe von mRNA beibringen, bestimmte Eiweiße von Tumorzellen als fremd zu erkennen. Die körpereigene Abwehr, die die Krebszellen zuvor übersehen hatte, kann nunmehr darangehen, die malignen Zellen abzutöten. Weil sich die meisten Krebsarten von Patient zu Patient leicht unterscheiden, müssen Mediziner in einem ersten Schritt analysieren, welche Eiweiße sich am besten als Ziel eignen. Dann passen sie den jeweiligen mRNA-Bauplan spezifisch für den Patienten an (08).
Durch die konsequente Übertragung von neuesten Forschungsergebnissen und die stete Weiterentwicklung dieser beiden Therapieansätze haben Philipp Mähling und Kollegen sowohl die Krebsforschung als auch die Behandlung von Patientinnen und Patienten auf ein signifikant gesteigertes Niveau gehoben. Professor Doktor Mählings Maxime, Forschung und Patientenversorgung zusammenzudenken, hat sich ausgezahlt. Und bietet Hoffnung für Tausende von Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie er selbst: sie sind unheilbar an Krebs erkrankt.
Das Leben geht oft seltsame Wege: Der Mann, der sich dem Kampf gegen den Krebs verschrieben hat, ist bereits in im Hinblick auf die Erkrankung jungen Jahren, zum Ende seines fünften Lebensjahrzehnts, an metastasiertem und damit, zumindest nach aktuellem Wissensstand, unheilbaren Prostatakrebs erkrankt. Philipp Mähling hat Glück im Unglück gehabt: Sein Krebs spricht ausgezeichnet auf die Antiandrogentherapie, erste Wahl bei der Bekämpfung des Prostatakarzinoms, an, sein Zustand ist stabil, die Erkrankung schreitet nur sehr langsam fort. Auch schränkt der Tumor das Leben des ITC-Direktors in keinster Weise ein, er leidet weder unter Symptomen des Krebses noch unter Nebenwirkungen des starken Medikaments.
Aber als Onkologe weiß Professor Mähling natürlich: der Krebs ist nicht
etwa besiegt, sondern nur ruhiggestellt. Auch deshalb arbeitet er, nicht zuletzt auch im eigenen Interesse, weiter mit Hochdruck an der Tumortherapie.
Denn von den neuen Hoffnungsträgern, für deren Etablierung der hochangesehene Onkologe so viel getan hat, profitiert er selbst bislang nicht. Im Rahmen einer Genexpressionstests konnte keine Genmutation identifiziert werden, so dass die hierfür entwickelten Medikamente für ihn nicht infragekommen. Und eine mRNA-basierte Impfung war deshalb nicht erfolgreich, weil die Krebszellen in Philipp Mählings Fall offenbar an Stellen wachsen, die von Immunzellen nicht erreicht werden können. Noch nicht, denn auch daran arbeiten er und sein Team.
Unterstützung erhält der Vollblutarzt dabei von seiner Frau Karen. Diese ist Apothekerin mit Zusatzausbildung in Klinischer Pharmazie und Klinischer Chemie und ihrem Mann so stets eine fachkundige Beraterin, wenn es um Arzneimittel geht. Kennengelernt haben sich beide auf einem Kongress in Straßburg, auf dem Philipp einen Vortrag über den vielversprechenden Ansatz der Genmutationsanalyse im Rahmen der Krebstherapie hielt und Karen interessierte Zuhörerin war. In einer Pause zwischen den Vortragsteilen trafen sich der gebürtigen Bergisch Gladbacher, der an der `kölschen Riviera` im Kölner Stadtteil Rodenkirchen aufwuchs, und seine zukünftige Frau zufällig an einem Imbissstand.
Karen Mähling, geborene Henkes, stammt aus dem Badischen, sie hatte es nicht weit in die `Stadt der tausend Kirchen`, die von 1871 bis 1920 Zentrum eines gleichnamigen deutschen Landkreises im Bezirk Unterelsaß des Reichslandes Elsaß-Lothringen war. Karen und Philipp haben kurz nach Phillips Krebsdiagnose geheiratet, die attraktive, zierliche brünette Frau ist seither im `neuen Leben` des erfolgreichen Onkologen der Fels in der Brandung. Sie gibt ihm die Kraft, der Krankheit entschlossen und stets positiv gegenüberzutreten, einfach weiterzuleben und an einen positiven Ausgang der schlimmen Geschichte zu glauben.
Dank Karen hat Philipp beinahe vergessen, dass ein Tumor in seinem Körper sein Unwesen treibt. Karen und Philipp Mähling führen eine Bilderbuchehe. Schade nur, dass diese infolge der radikalen Prostatektomie, derer sich Philipp unterziehen musste, da sein Tumor bereits gestreut hatte, kinderlos bleiben wird.
*
Im großen Europäischen Weltraum-Astronomiezentrum ESAC (European Space Astronomy Centre) in Villafranca, Spanien, laufen die wissenschaftlichen Daten aller astronomischen und planetaren ESA-Missionen in sogenannten `science operation centres` zusammen und werden dort archiviert. Hier werden sich die Experten der ESA daranmachen, die Geheimnisse des Marsgesteins, das der `Marspioneer 1` im Rahmen zweier Missionen zur Erde beförderte, zu entschlüsseln. Die Arbeit ist Teil des Planet Next-Generation Sample Analysis (PNGSA) - Programms, in dessen Rahmen man sich neuer technologischer Mittel zunutze machen möchte. Im Vordergrund steht bei den Untersuchungen in den Labors in der kleinen Stadt in der Provinz Verona nahe der Grenze zur Lombardei dabei die Frage, ob auf dem roten Planeten möglicherweise Leben existiert. Forscher vermuten große Wassermengen unter der Oberfläche des Gestirns. Es ist nicht auszuschließen, dass es in diesen unterirdischen Ozeanen Einzeller und Bakterien gibt. Viele Wissenschaftler vermuten zudem, dass der Mars entgegen früherer Annahmen auch heute noch vulkanisch aktiv ist (09). Auch dieses Szenario soll im ESAC evaluiert werden.
Weiteren Fragestellungen im Hinblick auf das erste auf dem roten Planeten abgebaute Gestein wird in anderen Forschungseinrichtungen rund um den Globus, die das Glück hatten, mit Gesteinsproben bedacht zu werden, auf den Grund gegangen. So auch in Deutschland am Institut für Geologie und Mineralogie an der Universität zu Köln. Hier wird man sich darauf konzentrieren, potenzielle biologisch-medizinische Eigenschaften der Substanzen aus dem Marsgestein zu erforschen.
Marsgestein ist eine Sammelbezeichnung für die Gesteine des PlanetenMars. Analysen von Marsgestein, im Rahmen derer Gesteine auf dem Wanderstern vor Ort mit Hilfe von Landegeräten untersucht und analysiert wurden, haben bereits die frühen Marsmissionen, so die Pathfinder-Mission 1987, durchgeführt.
Entsprechend der Lage des Mars innerhalb des Sonnensystems – in der Zone der terrestrischen Planeten – sind auf seiner Oberfläche, wie auch auf der Erde und dem Erdmond, vor allem silikatische Gesteine, also solche, die reich an Kieselsäure sind, zu erwarten. Diese können entweder vulkanisch-plutonischen Ursprungs, und damit von magmatischen Gesteinen stammend, metamorph, was bedeutet, durch die naturgemäße Erhöhung von Druck und/oder Temperatur tief in der Erdkruste entstandene mineralogisch veränderte Gesteine (10), oder aber sedimentär, also durch den Transport, die Ablagerung und die anschließende Verfestigung von Lockersedimenten an Land und im Meer, entstanden sein (11).
Auf der Erde sind bislang mehr als 200 Meteoriten bekannt, deren chemische Zusammensetzung eine Herkunft vom roten Planeten nahelegt. Man entdeckte darin kleine Gaseinschlüsse und konnte zudem Isotopenverhältnisse feststellen, wie sie Raumsonden in der Marsatmosphäre gemessen haben. Am häufigsten fand man Basalte, ein basisches Ergussgestein bestehend aus einer Mischung von Calcium-Eisen-Magnesium-Silikaten und calcium- wie natriumreichem Feldspat, zudem quarzreiche Tiefengesteine wie Andesit, wobei es sich um ein matt-gräuliches Ergussgestein aus Vulkangebieten handelt, und Olivin, ein in diversen Kristallen vorkommendes Mineral magmatischen Ursprungs (12).
Mithilfe der zur Erde transportierten Steine hoffen Forscher und Geologen weltweit weitere, womöglich sogar bislang unbekannte Gesteinsarten zu entdecken. Vielleicht finden sich in dem Gefels vom fernen Planeten Substanzen, die auf der Erde nicht vorkommen und die der Menschheit neue Einblicke in die Welt, in der wir leben, verschaffen, ja, die ihr neue Möglichkeiten eröffnen.
*
Die kriegerischen Konflikte auf der Welt dauern auch zu Beginn des dritten Jahrzehntes im dritten Jahrhundert fort.
Bereits seit gut fünfzehn Jahren kämpfen prorussische Separatisten im Ukraine-Krieg für die Sezession der Ostukraine und die Souveränität der proklamierten Volkrepubliken Donezk und Luhansk beziehungsweise deren finalen Anschluss an Russland. Die Föderation unterstützt diese Milizen durch die Abstellung von Freischärlern, einem militärischen Freiwilligenverband, und durch Lieferungen von schweren Waffen bis hin zu Panzern.
Auch die seit 2015 währende türkische Offensive gegen die Partiya Karkerên Kurdistan (PKK), die Arbeiterpartei Kurdistans, ist erneut entflammt. Bereits seit 25 Jahren führt die PKK nach zwischenzeitlicher Beruhigung einen Guerillakrieg mit dem Ziel einer kurdischen Staatsgründung.
Im Bürgerkrieg in Syrien kämpfen Oppositionelle gegen die Machthaber. Neben der demokratischen Nationalkoalition syrischer Revolutions- und Oppositionskräfte sind auch die dschihadistischen Milizen sowie die kurdischen Streitkräfte in den Krieg verwickelt und bekämpfen einander. Auch der Iran und Russland, die die Regierung unterstützen, sowie die USA, die Türkei, Frankreich, Großbritannien und Israel nehmen Einfluss auf das Geschehen. Nach dem Rückzug der US-Truppen aus dem Irak im Jahr 2003 kommt es vermehrt zu Angriffen militanter Gruppen gegen die schiitische Mehrheitsbevölkerung des Landes, aus denen 2014 die sogenannte Irakkrise und das Erstarken des IS hervorgehen. Die Grenzen zwischen dem Krieg in Syrien und jenem im Irak sind in der Folge verschwommen (13).
Neben den politischen Krisenherden bedroht auch die zunehmende Produktion von Atomwaffen in allen Ecken des Globusses den Weltfrieden. Garantieren doch Kernwaffen mehr denn je einen Platz in der ersten Reihe der Geopolitik. Zusätzlich zu den fünf sich zum Besitz von Atomwaffen bekennenden Staaten USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien gibt es vier Staaten, bei denen es als sicher gilt, dass sie über Nuklearwaffen verfügen: Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea (14). Auch der Iran hat auf die wachsenden Spannungen im Verhältnis zu Israel reagiert und soll mittlerweile, von der Führung in Teheran noch unbestätigt, über Atomwaffen verfügen. Gleiches sagt man nicht zuletzt auch der Türkei, die von vielen Konfliktherden umgeben ist, nach. Schließlich liegt Syrien quasi vor der Haustür, Saudi-Arabien ist nicht weit entfernt, ebenso wenig wie der Iran. Auch im Verhältnis zu Griechenland und der NATO knistert es.
Nicht zuletzt haben zudem im Fernen Osten die Atomwaffen Einzug gehalten. Japan rüstet auf – hat man doch unverändert ungelöste Grenzkonflikte mit China. Und mit Nordkorea wartet vor der Haustür eine weitere Atommacht, die in Sachen Kernwaffen unterwegs ist.
Südkoreas Angst vor dem Nachbarn im Norden hat dazu geführt, dass Seoul aus dem Atomwaffen-Sperrvertrag ausgetreten ist und nun eine eigene Atombombe entwickelt hat.
So sehr sich die Vereinten Nationen auch um den Weltfrieden bemühen - die politische Instabilität rund um den Globus ist unübersehbar und wie geschaffen für staatspolitische Egoismen, die jegliche Friedensbemühungen massiv bedrohen.
*
Die Arbeitsgruppe Geo- und Kosmochemie am Institut für Geologie und Mineralogie an der Universität zu Köln konzentriert sich auf die Entwicklung und Anwendung neuartiger Analysetechniken auf den Gebieten der Isotopen- und Spurenelement-Geochemie.
Felix Stickel, Geoforscher und Direktor des Instituts, geht beinahe ehrfürchtig vor einem massiven Stahlschrank in die Hocke und gibt auf dem Tastenfeld eine Zahlenkombination ein, die außer ihm und seinen Mitarbeitern niemand kennen darf. Dann dreht er an einem Rad, die massive Tür schwingt auf. Sie gibt den Blick auf eine Reihe Glasbehälter frei, die sich den Platz auf den Schrankböden mit Plastikkisten teilen, in denen die Forscher durchsichtige Kunststofftüten gesammelt haben. Das Plastik schließt Metallgefäßchen ein, die an einen Lippenstift oder eine Zündkerze erinnern. Sie enthalten jeweils wenige Gramm Gestein, das eine einmalige Bedeutung hat: handelt es sich doch um die ersten von Menschenhand gesammelten Gesteinsproben vom Mars, sie wurden vor knapp einem Jahr von amerikanischen Astronauten im Rahmen der Mission Mars Sample Return an verschiedenen Stellen des Mars eingesammelt.
Ein großer Teil davon wird bis heute in Houston aufbewahrt, im Gebäude 31N des Johnson Space Center der US-Weltraumbehörde NASA. Die Kölner Universität gehört zu den glücklichen Einrichtungen, welche eine Probe des Marsgesteins erhalten hat. Was alles andere als einfach war: die Proben mussten, begleitet von einem detaillierten Plan, der beschreibt, welche aktuelle Forschungsfrage mit der Untersuchung des Gesteins auf welche Weise beantwortet werden soll, bei einem Kurator beantragt werden.
In Erwartung des kostbaren außerirdischen Gefelses und Gerölls hat Felix Stickel die Entscheidungsträger in der nordrheinwestfälischen Finanzverwaltung davon überzeugen können, zusätzliche Mittel für sein Institut zur Verfügung zu stellen. So konnte das Reinraumlabor für terrestrische und außerirdische Proben endlich mit zwei Thermo Neptune Multi Collector ICP-Massenspektrometern für radiogene und stabile Isotopenmessungen und einem iCAP-Quadrupol-ICP-Massenspektrometer für die konventionelle Spurenelementanalyse ausgestattet werden. Ein Panalytical Zetium XRF-System und eine Elektronenmikrosonde JEOL JXA-8900RL ergänzen diese technische Ausstattung.
Endlich ist der Tag X gekommen. Morgen wird Felix Stickel mit seinem Team in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Biologische Untersuchungen planetarer Gesteine (BUpG) mit der Analyse des Marsgesteins beginnen.
*
Nachdem sich die Situation 2025 etwas entspannt hatte und eine Einigung beinahe in Sicht schien, ist der Konflikt zwischen Moskau und Kiew anno 2030 erneut entflammt. Russland startet von Neuem einen massiven Truppenaufmarsch an der Demarkationslinie zur Ukraine. Im Rahmen der massiven Aufrüstung gruppieren sich um die 400.000 Soldaten in dem Gebiet rund um die 2.000 Kilometer lange Grenze zur Ukraine. Dabei handelt es sich konkret um rund 75 taktische Verbände – ausgerüstet unter anderem mit Panzern, anderen Artilleriegeschützen zudem mit Flugzeugen. Die Welt sorgt sich, dass Moskau nach der Annexion der Krim 2014 einen weiteren Angriff auf die Ukraine vorbereitet, um sein Territorium zu vergrößern.
Russland selbst gibt keine Auskunft über eigene Truppenbewegungen. Die Meldungen über die rege Betriebsamkeit nahe der ukrainischen Grenze fußen im Wesentlichen auf Fotos und Videos von russischen Bürgern, die Kolonnen mit Militärfahrzeugen und auch entsprechende Eisenbahntransporte dokumentieren. Auch westliche Geheimdienste wissen mitunter über entsprechende Aktivitäten der russischen Föderation zu berichten.
Auf der Gegenseite fordert eben dieses Verhalten entsprechende Reaktionen geradezu heraus. So sind radikale Rebellenführer der beiden selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk bereit, um ihre Unabhängigkeit von Russland zu kämpfen. Das `Regiment Asow` ist eine radikal nationalistische ukrainische Kampfeinheit, die im Jahr 2014 gegründet wurde, mit dem Ziel, Freiwillige im Kampf gegen prorussische Rebellen im Osten des Landes zu organisieren. Sie ist dem ukrainischen Innenministerium unterstellt und benutzt ein geschichtsträchtiges Symbol: die Wolfsangel, eine heraldische Figur, die auf das Jagdgerät zurückgeht und früher gern von Nazis benutzt wurde, unter anderem von der Hitlerjugend. Immer mehr Freiwillige sammeln sich in den Camps des `Regiment Asow` nahe Kiew. In diesen Trainingslagern lernen Kinder und Jugendliche in der Ukraine, wie es sich anfühlt, ein Soldat zu sein. Schon am ersten Tag üben sie, mit der Kalaschnikow umzugehen (15). Unterstützung erhalten die ukrainischen Freiheitskämpfer durch die Staaten der NATO: Westliche Partner der Ukraine liefern zusätzliches Kriegsgerät und schicken Soldaten zur Unterstützung in die Krisenregion. Verschiedene diplomatische Bemühungen der USA und der NATO um eine Entschärfung des Konflikts verliefen bislang erfolglos. Von einer Annäherung, geschweige denn einer Einigung zwischen Russland und der Ukraine ist man noch weit entfernt.
*
Die Testmethoden in der modernen Wissenschaft werden traditionell mit ihren lateinischen Namen bezeichnet. Die entsprechenden Benennungen beschreiben dabei im Wesentlichen die vorhandene Umgebung, in der der Test stattfindet.
Unter `In Vitro` (lateinisch: `im Glas`)-Tests versteht man Experimente an biologischer Materie, an Zellen oder Gewebe, die unter kontrollierten künstlichen Bedingungen außerhalb eines lebenden Organismus durchgeführt werden. So wird eine detaillierte zelluläre und molekulare Analyse im Vergleich zur Verwendung eines ganzen Organismus möglich. In-vitro-Experimente wurden historisch in einer Petrischale durchgeführt. Im Zeitverlauf wurden dann jedoch auch Reagenzgläser, Röhrchen oder Flaschen verwendet und die Untersuchungen gestalteten sich immer komplexer (16). Allerdings lassen sich die in-vitro gewonnenen Erkenntnisse nicht ohne weiteres auf die Vorgänge im lebenden Organismus übertragen (17).
In-vivo , also `im Lebenden`-Tests evaluieren solche Abläufe beziehungssweise Reaktionen, die im lebenden Organismus unter physiologischen Bedingungen stattfinden. Die wichtigsten Arten von In-vivo-Tests sind Tierversuche und klinische Studien am Menschen.
Tierversuche eigenen sich, um die Sicherheit neuer medizinischer Behandlungen zu bewerten. Sie stehen quasi in der Mitte zwischen In-vitro-Experimenten und Versuchen am Menschen. Meist werden im Labor gezüchtete Mäuse oder Ratten, die genetisch nahezu identisch sind, in Tierversuchen eingesetzt. So verfügt man über ein Maß an Kontrolle, welches in klinischen Studien nicht möglich ist. Erscheint eine Substanz In-vitro und in Tierversuchen als sicher und wirksam, folgen klinische Studien am Menschen. In-vivo-Tests sind ein wesentlicher Aspekt der medizinischen Forschung. Sie liefern überaus wertvolle Informationenen über die Wirkung einer bestimmten Substanz in einem kompletten, lebenden Organismus (18).
Carola Deichberg arbeitet am Institut für Biologische Untersuchungen planetarer Gesteine (BUpG), das vor knapp zehn Jahren dem Forschungszentrum Jülich angegliedert wurde. Sie hat in ihrem Labor alle Vorbereitungen getroffen, um potenziell interessante Substanzen aus dem Marsgestein In-vivo an ihren Versuchstieren zu untersuchen.
*
Philipp Mähling hatte einmal wieder einen äußerst anstrengenden Tag. Neben zwei komplizierten Operationen und einem langen Meeting mit führenden Onkologen aus Nordrhein-Westfalen musste er sich auch mit der eigenen Erkrankung beschäftigen, da sein Tumormarker kontinuierlich gestiegen ist.
Die Therapie des Prostatakarzinoms hat sich in den letzten Jahrzehnten radikal verändert. Während früher nur die operative Behandlung durch Entfernung des Hodengewebes, besser bekannt als Kastration, zur Verfügung stand, werden heute überwiegend medikamentöse Behandlungen durchgeführt. Die Hormonbehandlung ist für Männer mit Prostatakrebs die sogenannte `Therapie der ersten Wahl`. Denn bei nahezu allen Patienten mit Prostatakrebs wachsen die Tumorzellen zunächst in Abhängigkeit vom männlichen Geschlechtshormon Testosteron.
Daher hat sich der Entzug des männlichen Hormons, auch als Androgen bezeichnet, als wirksame Behandlung bei Prostatakrebserkrankungen gezeigt (19).
Bei Philipp Mähling ist nach gut drei Jahren Antiandrogentherapie, in denen er alle drei Monate eine Depotspritze, die die Bildung von Testosteron blockiert, erhalten hat, eine Therapieerweiterung geboten. Er muss, da sein Krebs eine Resistenz gegen die Antiandrogenspritze gebildet hat, zusätzlich ein Medikament einnehmen, welches die Fähigkeit der Krebszellen, Testosteron aufzunehmen, blockiert.
Der Onkologe ist, tief in solch trüben Gedanken versunken, vor seinem neuen Großbildfernseher eingeschlafen, als ihn sein iPhone unsanft weckt. Eigentlich ist ihm nicht nach telefonieren, aber als er sieht, wer der Anrufer ist, greift er zum iPhone.
Philipp Mähling hat Felix Stickel beim Eishockey kennengelernt. Dieser hatte lange Jahre eine Dauerkarte für Heimspiele des Kölner Eishockey-Klubs, in Köln nur KEC oder Kölner Haie genannt. Und just neben ihm saß ein Studienkollege Philipp Mählings. Als dieser krankheitsbedingt auf ein Spiel verzichten musste, ging der damalige Medizinstudent an seiner statt ins legendäre Stadion an der Lentstraße. Sofort waren sich die Zufalls-Sitznachbarn sympathisch, tauschten nach dem Spiel Telefonnummern aus und verabredeten sich bereits wenig später auf ein Kölsch im Thieboldseck am Kölner Neumarkt. Der Anfang einer Männerfreundschaft, die nun bereits Jahrzehnte Bestand hat.
„Hallo Philipp, hier spricht Felix.“
„Felix, alter Knabe. Wir haben viel zu lange nichts voneinander gehört. Ich hatte Dir ein- oder zweimal gemailt, aber…“
„Ich weiß, Philipp, ich weiß. Ich bin kaum zum Atmen gekommen in letzter Zeit, ich sag’s Dir.“
„Schon gut, Felix, kann ich mir vorstellen. Außerdem hatte ich auch viel um die Ohren.“
„Wie läuft’s denn so bei Dir? Was macht der Job? Zu Hause alles im grünen Bereich? Und vor allem: wie steht’s um die Gesundheit – hast Du Dein ungebetenes Haustier noch im Griff?“
„Es ist stressig, aber wir kommen klar in der Klinik, zu Hause ist alles bestens. Und der Krebs – ich bin immer noch absolut symptomfrei, aber der PSA-Wert macht Sorgen. Er steigt trotz der Dreimonatsspritze kontinuierlich an. Und bei Dir?“
„Also, Privatleben hab‘ ich keins momentan“
„Keine neue Dame, von der ich wissen sollte?“
„Für so etwas habe ich keine Zeit, Philipp…“
„Stimmt, der Rote Planet…“
„Genau. Aber lassen wir meine Wenigkeit mal außen vor. Es geht hier um Dich.“
„Um mich? Was kann ich für Dich tun, Felix?“
„Nein, Du verstehst nicht. Ich glaube, also, sagen wir besser, hoffe, ich kann etwas für Dich tun.“
„Wie meinst Du das?“
„Nun, wir haben da etwas festgestellt, was für Dich interessant sein könnte.“
„Jetzt machst Du mich aber ziemlich nervös, mein Guter.“
„Ich habe gestern vom ISE die Ergebnisse der ersten Analyse des Gesteins, welches vom Mars stammt, erhalten.“
„ISE?“
„Institut für Seltene Erden und Metalle.“
„Aha…aber, soviel ich weiß…ich meine, ist es nicht so, dass man Gesteine auf dem Mars nur vor Ort untersuchen kann?“
„Nein, hast Du das nicht mitbekommen? Zum ersten Mal war es möglich, Material vor Ort abzubauen und mit zur Erde zu nehmen.“
„Doch, stimmt, da war was. Es geht immer weiter, was ?!“
„Tja, die Menschheit als solche gibt keine Ruhe, so lange es noch irgendwelche Geheimnisse auf unserem Globus zu entdecken gibt.“
„Da hast Du wohl Recht.“
„Jedenfalls hat der Rover Patience Proben mit zur Erde gebracht und…“
„Patience? Wer kommt denn auf so einen Namen?“
„In diesem Fall ein 12jähriger Schüler namens Michael Naysmith.“
„Wie bitte?!“
„Die NASA ist dafür bekannt, dass sie tatsächlich Schülerwettbewerbe für die Namensgebung Ihrer technischen Neuentwicklungen ausruft. In diesem Fall wurden sage und schreibe 32.000 Beiträge aus allen US-Bundesstaaten eingesandt. In die Schlussrunde kamen letztendlich zehn Vorschläge. Daraufhin startete die NASA eine öffentliche und weltweite Online-Abstimmung, bei der über 800.000 Stimmen eingingen. Tja, und `Patience` lag dann am Ende hauchdünn vorn.“
„Kann ich verstehen. Der Name macht ja Sinn. Wir müssen Geduld haben bei der Erforschung des Roten Planeten.“
„Die mussten wir in der Tat haben, Philipp. Eine aufregende Zeit war das. Nach der Landung musste man den Rover für gut zwei Wochen im Schlafmodus belassen. Während der Sonnenkonjunktion besteht keine Verbindung zum roten Planeten und den dort befindlichen Fahrzeugen. Eine Sonnenkonjunktion entsteht, wenn sich die Sonne zwischen die Erde und einem anderen Planeten befindet (20). In diesem Fall zwischen uns und dem Mars – und das war ausgerechnet nach der Landung der Fall.“
„Soll man kaum glauben, das war ja dann wirklich großes Pech.“
„Na ja, der Flug hat halt länger gedauert als geplant, es gab da kleinere Probleme. Aber jetzt wieder zu Dir.“
„Gern. Da bin ich ja mal gespannt, was ich mit der Buddelei auf dem Mars zu tun habe…“
„Das darfst Du auch.“
„Also?“
„Der Mars-Rover Patience hat unter anderem die oberste Schicht
Steins an einem Felsvorsprung abgeschürft. Was er darunter gefunden hat, hat man bei der NASA noch nie zuvor gesehen. Es handelt sich um blaugrau schimmernde Basalte, die eine spezielle Form von Kieselsäure enthalten, wie sie auf unserem Planeten nicht vorkommt.“
„Wow! Was ist das noch genau – Kieselsäure?“
„Als Kieselsäuren werden die Sauerstoffsäuren des Siliciums bezeichnet. Sie entstehen durch Zersetzung von Siliciumtetrahalogeniden mit Wasser (21). Bei der Substanz, die im Marsgestein gefunden wurde, handelt es sich um eine viel stärkere Orthokieselsäure, als wir sie hier auf der Erde kennen. Und diese Substanz wird nunmehr entschlüsselt und im Labor wie an Versuchsmäusen auf vielfältige Weise biologisch-medizinisch analysiert. Unter anderem wird auch ihre Wirkung auf maligne Zellen getestet.“
„Bingo! Wann hast Du die Ergebnisse?!“
„Ich denke, in vier oder fünf Tagen. Du bist der Erste, der außerhalb des Instituts von den Ergebnissen erfahren soll, dass verspreche ich Dir.“
„Ich sitze von heute an vor dem Telefon, hombre. Danke, Felix.“
„Nicht dafür. Bis dann.“
*
Mit der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg wurde der Grundstein für einen neuen Konflikt gelegt, der auch anno 2030 noch andauert: die Teilung Koreas.
Die koreanische Halbinsel war seit 1910 japanische Kolonie und sollte nun wie andere Besatzungsgebiete Japans unter den Siegermächten USA und UdSSR aufgeteilt werden. Im Gegensatz zur Nachkriegsteilung in Deutschland, die selbstverschuldet war, schließlich hat Hitler-Deutschland den Krieg begonnen, ist Korea brutal als Kolonialbesitz Japans ausgebeutet worden. Es entstanden zwei komplett unterschiedliche politische und auch wirtschaftliche Systeme, die sich in beiden Teilen des einstmals geeinten Landes seit Kriegsende herausgebildet haben.
In Südkorea ist der nördliche Teil des Landes ehr sozialistisch und autokratisch orientiert, während im kapitalistischen, diplomatisch nach Westen orientierten Südkorea mit der Zeit eine parlamentarische Demokratie etabliert wurde. Nordkorea hingegen verfolgt eine auf einem altkoreanischen Herrscherkult basierende eigene sozialistische Philosophie: Eine Politik der Abschottung und Wehrhaftigkeit, einen kriegerischen Nationalismus. Im Konflikt zwischen beiden Ländern geht es insbesondere um die Vorherrschaft auf der Koreanischen Halbinsel, den Streit um das nordkoreanische Kernwaffenprogramm und nicht zuletzt die Interessen verbündeter Drittstaaten.
Die südkoreanische Außenpolitik ist geprägt von der strategischen Partnerschaft zu den Vereinigten Staaten von Amerika, die Truppenkontingente im Land stationieren und große Beträge an `militärischer Entwicklungshilfe` an den Partnerstaat vergeben. Auch die Vereinten Nationen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, den Frieden durch internationale Zusammenarbeit und kollektive Sicherheit zu erhalten und denen weltweit 193 Staaten angehören, stehen Südkorea in seinem steten Bemühen um einen baldigen Stopp des nordkoreanischen Kernwaffenprogramms bei.
Nordkorea steht in einem engen Verhältnis zur Volksrepublik China, die das Land militärisch und auch wirtschaftlich unterstützt. Auch Russland hat sich vertraglich zu wirtschaftlichem Beistand verpflichtet, eine bis 1996 vorhandene zusätzliche militärische Beistandsklausel existiert jedoch nicht mehr (22).
*
Carola Deichberg hat einen für ihre Generation eher ungewöhnlichen Musikgeschmack. Sie hat ein Faible für Schlager, insbesondere für jene der 1970er Jahre. Die Musik einer Zeit, in der sie noch nicht einmal geboren war, begleitet sie bereits, seitdem sie ein Teenager war. Während man in Ihrer Clique auf Oasis, die Red Hot Chili Peppers, Nirvana und REM stand, hielt sie Rex Gildo, Jürgen Marcus, Chris Roberts und Bernd Clüver die Treue.
Die Forscherin hat es sich zur Gewohnheit gemacht, ihre Versuchstiere nach ihren Heroen aus den 70ern zu benennen. So wird auch die gefundene Substanz aus den Gesteinsproben vom Mars an `Schlagersängerinnen und -sängern` der 70er getestet: Bernd Clüver, Tina York, Lena Valeitis, Jürgen Marcus, Michael Holm, Ingrid Peters – einigen wird ein kleiner Lungen-, Brust-, Darm- oder Prostata-Tumor implantiert, andere erhalten eine Injektion mit Krebszellen unterschiedlicher Krebsvarianten. Danach werden sie mit der unbekannten Substanz, die in einigen der Felsbrocken vom Mars gefunden wurde, geimpft.
Laborproben des Marsgesteins haben bereits erstaunliches zutage gefördert: die Kieselerde aus dem blaugrauen Basalt vom roten Planeten hat im Reagenzglas eine signifikante Wirkung auf maligne Zellen gezeigt. Wird sich diese Wirkung bei den Versuchsmäusen bestätigen?
Moleküle, Zellen, Organe und deren Funktionen sind bei Mäusen und Menschen sehr ähnlich. So sind Mäuse ganz besonders geeignet zur Entschlüsselung der Funktion der Gene und für Untersuchungen pathologischer, also krankhafter Prozesse im Kontext des gesamten Organismus.
Aufgeregt holt Carola Deichberg einige Tage nach der ersten Injektion einen nach dem anderen `Schlagerstar` aus den Käfigen. Sie untersucht zunächst das Blut der krebskranken Mäuse. Und staunt nicht schlecht – es lassen sich keine malignen Zellen mehr identifizieren. Und es kommt noch besser: bei den Mäusen, denen ein solider Tumor infiziert wurde, zeigt eine MRT-Untersuchung deutlich weniger, in einigen Fällen sogar keinerlei bösartiges Gewebe mehr. Begeistert verfasst Carlos Deichberg einen Bericht über die bemerkenswerten Ergebnisse der Tierversuche und leitet diesen unmittelbar an den Institutsleiter und auch an den Direktor des Instituts für Geologie und
Mineralogie, der reges Interesse an den Untersuchungen an den Mäusen zeigt, weiter.
Carola Deichberg hat Felix Stickel auf einem Symposium über neue molekulare Analyseverfahren kennengelernt. Seitdem ist der Kontakt nie wirklich abgebrochen. So entschließt sie sich, den Geologen auch persönlich über die erfreulichen Untersuchungsergebnisse zu informieren.
„Hallo Felix. Ich habe erste Ergebnisse für Dich. Hast Du den Bericht schon gelesen?“
„Nein, bin noch dazu gekommen, meine Emails abzuarbeiten.“
„Dann sag‘ ich es Dir persönlich: Chris Roberts, Lena Valeitis und die anderen Barden haben tatsächlich ein zweites Leben geschenkt bekommen…der Krebs ist geschrumpft oder verschwunden!“
„Sagenhaft! Bei allen Krebsarten?“
„Ja – sowohl bei den soliden Tumoren als auch bei den malignen Zellen – das Zeug wirkt!“
„Nach nur einer Injektion?“
„Ja“
„Und was ist mit den Nebenwirkungen?“
„Bislang nichts Auffälliges. Heino & Co. sind gut drauf und verhalten sich völlig normal Die Blutwerte sind auch alle ok. Die werde ich aber morgen nochmals überprüfen.“
„Das sind ja wirklich tolle Nachrichten, Carola.“
„Das kann man wohl sagen.“
„Das könnte die Krebstherapie revolutionieren.“
„Und wer weiß: vielleicht befinden sich noch weitere fremde Substanzen mit erstaunlichem Wirkungsspektrum im Gestein.“
„Das mag sein. Wir fangen ja gerade erst an, die Proben aus den zwei Marsregionen zu untersuchen. Die Kieselsäure in dem silikatischen Gestein ist bislang die einzige unbekannte lösliche Substanz, die wir isolieren konnten.“
„…und an der wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten mit Hochdruck weiter forschen werden nach diesen primären Ergebnissen an den Schlagerstars. Ich halte Dich auf dem Laufenden, Felix.“
„Ich bestehe darauf, Carola. Danke!“
Felix Stickel sammelt sich kurz, dann greift er erneut zum Telefonhörer und wählt Philipp Mählings Nummer.
„Philipp, hier spricht Felix. Wir haben erste Ergebnisse.“
„Dann spann` mich nicht auf die Folter!“
„Unter anderem zeigte sich, dass in die in den Basalten enthaltende Form von Kieselsäure irgendeine Substanz enthält, die eine recht große Palette ganz verschiedenartiger Bakterien und Viren restlos und in Nullkommanix abtötet. Und nicht nur die, sondern auch Krebszellen.“
„Und die Nebenwirkungen?“
„Bislang keine zu beobachten. Aber da werden wir natürlich regelmäßig nachkontrollieren.“
„Philipp?!“
„Ja, ja, Felix, ich bin noch dran. Es ist nur…solche Nachrichten verschlagen mir die Sprache, weißt Du.“
„Es ist wirklich fantastisch. Den Schlagerstars geht es bestens.“
„Schlagerstars?!“
„Den Mäusen, meinte ich. Den Mäusen.“
„Ach so. Aber wie…bis das Zeug erstmal zugelassen ist. Meinst Du…“
„Warten wir erst einmal die Nachkontrollen ab. Und sollten sich dann wirklich die Ergebnisse bestätigen und keine Nebenwirkungen auftreten…“
„Ja?!“
„Ich hab‘ da jemanden an der Hand, der mir durchaus ein paar Tabletten mit der Kieselsäure vom Mars für Dich pressen oder drucken kann. Dürfte innerhalb weniger Tage über die Bühne gehen. Du hast doch bald Geburtstag – da brauche ich wenigstens nicht zu überlegen, was ich Dir schenke, alter Knabe…“.
*
Wissen bedeutet Macht – das war schon den Menschen der Antike bewusst. Und so verwundert es wenig, dass das Wirken von Spionen sich über viele Jahrtausende in der Menschheitsgeschichte zurückverfolgen lässt.
Schon immer waren Machthaber an militärischen, politischen oder aber wirtschaftlichen Informationen sowohl aus anderen Staaten als auch aus dem Inneren des eigenen Landes interessiert. Die Gründe für Spionagetätigkeiten haben sich also im Laufe der Zeit kaum verändert, die Mittel und Methoden von Agenten und Spionen indes schon.
In den ersten Großreichen der Antike boten sich aufgrund des umfangreichen Beamtenapparates beste Voraussetzungen zur Spionage.
Die Ägypter titulierten in der Phase des »Neuen Reiches« (1550-1070 v. Chr.) die für solche Aufgaben zuständigen Beamten als `die Augen des Pharaos` Ähnliches wird für den Perserkönig Kyros den Großen (ca. 590-530 v. Chr.) berichtet, der `viele Augen und Ohren`, also Agenten, die für ihn Informationen sammelten, gehabt haben soll.
Natürlich bedienten sich auch Griechen und Römer geheimdienstlicher Mittel. Einige der gebräuchlichsten Begriffe zu diesem Thema leiten sich aus der römischen Sprache ab: Der Ausdruck Spionage stammt vom lateinischen spicere (sehen, schauen, spähen) und auch die geläufige Bezeichnung `Agent` findet sich bereits in römischer Zeit: Beamte, die geheimdienstliche Aufgaben wahrnahmen, hießen agentes in rebus, übersetzt in etwa `Beauftragte in allgemeinen Angelegenheiten`.
Im Mittelalter dienten den Herrschern in Europa vor allem Geistliche als Agenten, verfügten doch die Kirchen über ein europaweites Netz aus Standorten wie Bischofssitzen oder Klöstern, welche über ein Kuriersystem verbunden waren. Die Geistlichen waren zudem des Schreibens mächtig und beherrschten zum Teil mehrere Sprachen.
Ab dem 15. Jahrhundert wurde Spionage immer professioneller betrieben, nachdem die Agenten zuvor eher `nebenbei` spionierten. In England entstand unter Königin Elisabeth I. (1533-1603) der erste institutionalisierte englische Geheimdienst. In Frankreich überwachte Kardinal Richelieu (1585-1642) mit dem `Cabinet Noir` den Briefwechsel von Diplomaten und politisch verdächtigen Personen. Die Alberti-Scheibe war eines der ersten Geräte zur Verschlüsselung von Nachrichten. Dieses frühe System der Postüberwachung wurde durch die `Geheime Ziffernkanzlei` in Wien, die von circa 1716 bis 1848 Bestand hatte, perfektioniert.
Neue technische Entwicklungen wie Telegraf, Telefon und Fotografie veränderten ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Arbeit der Geheimdienste nachhaltig. Informationen konnten nun auf völlig neue Art, etwa durch bildgebende Verfahren, gesammelt werden, zudem beschleunigte sich die Übertragung der Daten immens. Der Mensch als Quelle trat dabei im Laufe der Zeit immer mehr in den Hintergrund, die technische Informationserfassung lief ihm zunehmend den Rang ab.
In den großen beiden Weltkriegen erwiesen sich die Geheimdienste oft als entscheidendes Mittel zur Beeinflussung des Kriegsverlaufs – etwa durch das Entschlüsseln der deutschen Chiffriermaschine `Enigma` durch den britischen Geheimdienst. Der anschließende Kalte Krieg war geprägt von massiven Spionage-Operationen von westlicher wie auch von östlicher Seite. Neben der militärischen Aufklärung wurden Geheimdienste nunmehr auch intensiv zum Machterhalt politischer Regime genutzt.
Mit dem Einzug des Mediums Internet und den damit verbundenen neuen Möglichkeiten zur Spionage infolge der exponentiell anwachsenden Menge an Informationen, hat sich das Aufgabenspektrum für Geheimdienste deutlich erweitert (23).
Der russische Geheimdienst ist dem Vernehmen nach wohl durchaus einer der aktiveren seiner Art. Immer wieder wird davon berichtet, dass die Großmacht aus dem Osten Europas als Diplomaten getarnte Agenten zu Spionageaktvitäten auch nach Deutschland schickt. Bedingt durch ihren Status als Diplomaten genießen sie vollumfänglichen Schutz vor den Strafverfolgungsbehörden in Deutschland.
Aber auch als Asylbewerber getarnte Spitzel soll der russische Geheimdienst FSB nach Deutschland geschleust haben. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der FSB Tschetschenen mit gefälschten Dokumenten ausgestattet hat, die `belegen`, dass die Männer in ihrer Heimat von Behörden verfolgt werden, woraufhin diese in Europa Asyl erhielten. Mit diesen `politisch verfolgen` Tschetschenen, die sich vornehmlich in muslimischen Gemeinden in Deutschland, Großbritannien und Frankreich integriert haben, hat der Geheimdienst der russischen Föderation, so heißt es, ein regelrechtes Netzwerk aufgebaut. Die Spione fokussieren sich dabei hauptsächlich auf die Bereiche Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Militär. Ihre Überwachung fällt insbesondere deshalb schwer, weil sich die Agenten aufgrund ihrer äußerst guten
Ausbildung weitestgehend der Kontrolle durch deutsche Behörden entziehen. So sind nur etwa zehn Prozent der russischen Spionageaktivitäten in Europa bekannt (24).
Und auch aus dem Fernen Osten droht den deutschen Behörden Ungemach. Österreich gilt seit Jahrzehnten als zentraler Standort für Nordkoreas Spione in Europa. Das Land unterhält in Wien eine seiner größten Botschaften im Abendland. Außerdem ist Österreich für seinen laxen Umgang mit Spionen bekannt. Das nutzten die Nordkoreaner aus, um korrupten Unternehmen Kriegswaffen abzukaufen und die nukleare Aufrüstung voranzutreiben. Aufgrund bestehender Sanktionen ist es dem Regime nämlich keinesfalls möglich, sich auf legalem Weg Güter für sein Nuklearprogramm zu besorgen. Nicht zuletzt ist Wien auch deshalb ein Hotspot für den nordkoreanischen Geheimdienst, weil hier die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) angesiedelt ist.
Nordkorea ist bestrebt, weiter aufzurüsten. Und so hat das Büro 121, eine Unterabteilung des nordkoreanischen Geheimdienstes, die Teil des `Amtes für Allgemeine Aufklärung`, einer Spionageabteilung des Militärs, deren Schwerpunkt versteckte Aktionen im In- und Ausland sind (25), ist, begonnen, seine Aktivitäten auch auf die Nachbarländer Österreichs auszuweiten. In Bern und Genf sind die Nordkoreaner mittlerweile stark präsent und geschäftlich aktiv, auch im an Österreich angrenzenden deutschen Freistaat Bayern hat man es mittlerweile geschafft, Mitarbeiter des Geheimdienstes zu installieren und mit dem illegalen Einkauf von Waffen und Technologie zu beauftragen.
Während es den nordkoreanischen Spionen in Europa hauptsächlich um Technologiewissen und die Beschaffung von Kriegsausrüstung geht, sind politische Motive der Grund dafür, dass seitens Nordkoreas auch Agenten in den Nachbarstaaten installiert werden. Sie sollen an der `politischen Unterwerfung` der ungeliebten Nachbarn arbeiten.
Die Tokioter Polizei macht sich Sorgen wegen nordkoreanischer Flüchtlinge, die, in Japan lebend, mitunter als Spione für das Regime in Pjongjang arbeiten. Auch Südkorea kämpft seit Jahren gegen das bedrohliche Problem scheinbarer Überläufer. So versuchten in den letzten Jahren immer wieder gleichfalls als Flüchtlinge getarnte nordkoreanische Spione hohe südkoreanische Funktionäre zu ermorden.
*
Carola Deichbergs Schlagerstars zeigen auch in den nachfolgenden Untersuchungen keinerlei Auffälligkeiten. Bis auf jene, dass die meisten von Ihnen krebsfrei sind und die übrigen nur noch eine geringe Tumormasse aufweisen.
Ergebnisse, die auch die Pharmaunternehmen brennend interessiert.
Doktor Arjen Berghuis ist stellvertretender Leiter der Divison Pharmaceuticals beim börsennotierten Pharmakonzern aus dem Linksrheinischen nahe Köln.
In seiner umsatzstärksten Division fokussiert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Entwicklung und die Vermarktung von innovativen Spezial-Medikamenten mit signifikantem klinischem Nutzen und medizinischem Mehrwert. In den Therapiegebieten Herz-Kreislauf, Onkologie, Gynäkologie, Hämatologie und Augenheilkunde will man mit innovativen Produkten einen therapeutischen Nutzen für die Patienten erzielen und dabei auch den wachsenden Anforderungen von Ärzten und Kostenträgern Rechnung tragen.
Arjen Berghuis, Forscher mit Leib und Seele, ist stets auf der Suche nach kleinen Molekülen, Biologika, oder anderen Substanzen, die sich als neue Wirkstoffe eignen könnten. So reagiert er äußerst interessiert, als ihm Felix Stickel von dem Basalt mit der unbekannten Kieselsäure, die eine erstaunliche Wirkung auf Krebszellen hat, im Marsgestein berichtet.
Als promovierter Arzt ist Doktor Arjen Berghuis prinzipiell berechtigt, auch ohne Herstellungserlaubnis zum Zweck der persönlichen Anwendung bei einem bestimmten Patienten Arzneimittel herzustellen. In seinem Labor bedient er sich des 3D-Drucks per Tintenstrahl, um konstante Volumen eines Pulvers oder Granulates zu verpressen. Dabei werden einzelne Tropfen eines Klebemittels auf eine dünne Schicht wirkstoffhaltigen Pulvers aufgebracht und trocknen gelassen. Dieser Vorgang wird sehr oft wiederholt, bis man am Ende eine aus vielen dünnen Schichten aufgebaute Tablette erhält. Beim Festwerden der einzelnen Schichten laufen dieselben Mechanismen ab wie bei der Feuchtgranulation: das Klebemittel bildet Brücken zwischen den Pulverpartikeln und es kommt zur Lösung und Rekristallisation von Partikeln.
Extrusion ist das weltweit am meisten eingesetzte 3-D-Druckverfahren, das sich auch in der pharmazeutischen Industrie stetig wachsender Beliebtheit erfreut. Dabei wird das zu druckende Material robotergesteuert durch Düsen gepresst. (26).
Schnell hat Arjen Berghuis 20 Tabletten für den Freund von Felix Stickel gepresst.
*
Seit Philipp Mähling von der erstaunlichen Wirkung der Kieselsäure aus dem Marsgestein auf die Krebszellen der Labormäuse erfahren hat, findet er kaum mehr Ruhe. Bereits wenige Tage später greift er zum Telefonhörer.
„Ich rufe jetzt bei Felix an wegen der Tabletten, Karen.“
„Bist Du wirklich sicher, dass Du das Zeug vom Mars einnehmen willst?“
„Den Labormäusen geht es blendend und die Wirkung auf die bösen Zellen scheint wirklich sagenhaft zu sein.“
„Aber Du bist doch unter der Therapie momentan völlig stabil. Warum denn jetzt schon?“
„Schatz, der Krebs ist nicht tot, er schläft nur. Da sind noch genug Zellen in meinem Körper unterwegs, die da nicht hingehören. Je schneller man denen den Garaus macht, umso besser.“
„Ich merke schon, Du bist nicht davon abzuhalten.“
„Ich rufe Felix jetzt an, ja?!“
Karen Mähling schüttelt den Kopf und lächelt ihren Mann besorgt an, als dieser zum Smartphone greift.
„Hallo Felix, Philipp hier. Ich wollte mal kurz nachhören, wie es mit meiner persönlichen Marslandung aussieht…“
„Gutes Timing, mein Freund. Doktor Berghuis hat ein paar Tabletten per 3D gedruckt, Philipp. Er schickt mir gleich einen Boten vorbei. Wenn Du möchtest, kannst Du die Zauberpillen schon heute abholen. Entweder hier im Institut oder Du kommst heute Abend auf ein Kölsch bei mir vorbei.“
„Ich tendiere zum Kölsch.“
„Gut, Junge. Ab 19:00 bin ich für Dich da.“
„Ich hab‘ die Analyse der CTCs schon vorliegen. Damit wir die Anzahl der Tumorzellen, die in mir ihr Unwesen treiben, dann vor und nach der Einnahme vergleichen können.“
„Perfekt.“
„Ich bringe uns zwei Pizzen mit.“
„Gute Idee. Frutti di Mare bitte.“
„Wird gemacht.“
Bereits um 18:00 macht sich Philipp Mähling mit dem Fahrrad auf den Weg zu seinem Freund.
Das „Da Carlo“, eine kleine, aber sehr beliebte Pizzeria, liegt quasi auf dem Weg. Philipp hat die Pizzen telefonisch vorbestellt und muss kaum fünf Minuten warten. So kommt er deutlich zu früh beim befreundeten Geologen an und drückt auf den Klingelknopf.
„Ja?“, ertönt es aus der Sprechanlage
„Signore Stickel, Ihr Pizzabote ist da.“
„Der es wohl kaum erwarten konnte, wenn ich auf die Uhr schaue. Komm‘ hoch.“
Philipp Mähling hastet die Treppe hinauf in die vierte Etage, auf der Felix Stickel ein äußerst großzügiges Dachgeschossappartement mit herrlicher 30m2-Terrasse und stylischer Außensauna bewohnt. Schließlich soll die vorzüglich riechende Pizza nicht kalt werden.
„Hhhmmm, die duftet aber.“
„Das Da Carlo ist und bleibt der beste Italiener im Umkreis, was?!“
„Absolut. Lass‘ es Dir schmecken. Und nach dem Essen nehme ich die erste Tablette.“
„Du auch. Dann hau` rein, damit Du eine gute Unterlage für den Nachtisch vom Roten Planeten hast…“.
Genüsslich verspeisen die beiden Männer ihre reichlich belegte und noch ofenfrische Pizza.
„Ich hole mir jetzt ein Bier“, Felix Stickel geht bestens zum Kühlschrank.
„Bringst Du mir auch eins?“
„Also, wir haben den Schlagerstars begleitend zur Injektion keinen Alkohol serviert, mein Freund…“.
„Ach komm`, Felix.“
„Im Ernst, vielleicht beeinträchtigt der Alkohol in irgendeiner Weise die Wirkung von dem Zeug.“
„Du hast gewonnen, Felix. Ich nehm‘ ein alkoholfreies, wenn Du sowas im Angebot hast.“
„Tatsächlich habe ich mir gestern einen Kasten geholt – war im Angebot.“
„Dann hol` mir bitte eins und bring die Pillen mit.“
„Ich würde sagen, Du nimmst erst einmal nur eine – und lässt nach einer Woche dann nochmal die CTCs im Blut messen. Sollte sich nichts getan haben, kannst Du die Dosis erhöhen.“
“So machen wir es.“
„Dann kommt jetzt der große Augenblick, Philipp. Jetzt wirst Du zum wahren Marsianer…“
„Eins, zwei, drei und … runter damit.“
Philipp Mähling schluckt die Tablette mit der geheimnisvollen Kieselsäure vom Mars und schließt die Augen.
*
Als 1979 eine landesweite Revolution die Monarchie im Iran beendet und konservative Geistliche unter Führung von Ruhollah Chomeini die Macht übernehmen, die eine autoritäre schiitische Theokratie durchsetzen, fliehen viele Iraner aus ihrer Heimat. 1980 beginnt ein acht Jahre andauernder Krieg zwischen Iran und Irak, der über eine Million Menschen das Leben kostet und viele zur Flucht zwingt. Als vielversprechende Reformvorhaben Mitte der 1990er Jahre brutal verhindert werden und es zu den sogenannten Kettenmorden an oppositionellen Intellektuellen kommt, verlässt eine weitere Welle politisch erschütterter Menschen das Land (27).
Einer davon ist Omid Heydari, der mit seiner Frau Nilofar und dem 10jährigen Sohn Arian in Köln ansässig wird und als Ingenieur bei den Ford-Werken arbeitet.
Auch, wenn die Heydaris fortan in einem völlig neuen Kulturkreis leben, behalten sie das in der Heimat praktizierte Rollenverständnis von Mann und Frau bei. Die iranische Gesellschaft ist traditionell strengpatriarchalisch. Mit einer fortschreitenden Modernisierung verbessert sich zwar die gesellschaftliche Stellung der Frauen, die in den 1960er Jahren beispielsweise das Wahlrecht und das Recht, Abtreibungen durchführen zu lassen, erhalten.
Dennoch ist die gesetzliche wie gesellschaftliche Diskriminierung von Frauen im Iran nach wie vor vielfältig.Frauen sind durch die im Iran angewandte Scharia in fast allen Rechtsbereichen stark benachteiligt. So dürfen sie verschiedene Berufe, wie das Richteramt, nicht ausüben, sie dürfen ohne Einwilligung des Mannes nicht verreisen und es bestehen vielerlei Benachteiligungen beim Zeugenrecht, so zum Beispiel beim Scheidungs- und beim Sorgerecht. Geradezu absurd erscheint das iranische Verständnis vom Eherecht. Denn im Iran haben Ehemänner `das Recht` auf die sexuelle Verfügbarkeit der
Ehefrau und dürfen dies auch mit Gewalt durchsetzen; Vergewaltigung in der Ehe ist damit kein juristischer Tatbestand. Auch allgemeine häusliche Gewalt des Ehemanns gegen die Frau ist weitgehend erlaubt. So darf der Mann seine Frau schlagen, wenn er `Ungehorsam fürchtet` (28).
Omid und Nilofar Heydari führen eine gute Ehe, ungeachtet der Tatsache, dass das Familienoberhaupt das iranische Rollenverständnis von Mann und Frau auch in der Wahlheimat Köln praktiziert und auch seinem Sohn Arian vermittelt. So registriert es Omid Heydari mit Erleichterung, als sein Sohn Anfang der 2020er Jahre die fünf Jahre jüngere Zeinab Daei, deren Eltern gleichfalls mit der 1990er Welle ihr Glück in Deutschland suchten, kennenlernt. Denn im Hause Daei lebt man wie auch bei den Heydaris die iranischen Traditionen konsequent weiter.
Als Zeinab und Arian heiraten, besteht dieser darauf, dass seine Frau auch in der Ehe ein Kopftuch trägt, zudem lange Kleidung an Armen und Beinen. Auch eine traditionelle Tschador, die lediglich Partien des Gesichts freilässt, sieht er gern an seiner Frau.Die Einhaltung dieser Kleidungsgebote für seine Frau kontrolliert Arian beinahe so, wie es die Sittenpolizei in seinem Vaterland tut.Auf Unstimmigkeiten mit seiner Zeinab reagiert der erfolgreiche Architekt bisweilen mit Gewalt. Oft belässt er es bei einer schallenden Ohrfeige, es kommt jedoch durchaus vor, dass Zeinab stärkere Gewaltausbrüche über sich ergehen lassen muss. Im Laufe der Ehejahre nimmt die Häufigkeit der körperlichen Übergriffe zu. Oft sieht sich Zeinab ohne jeden ersichtlichen Grund den Attacken ihres Mannes ausgesetzt. Arian kompensiert den Stress, mit dem er im Berufsleben konfrontiert wird, immer öfter damit, dass er seine daraus resultierenden Aggressionen an der Gattin auslässt. Diese nimmt die ständigen Repressalien, so, wie es ihr jahrelang in der ihr zuteilgewordenen Erziehung vermittelt wurde, klaglos hin. Ebenso wie die an Vergewaltigung grenzenden sexuellen Übergriffe, die sie sich bisweilen gefallen lassen muss.
Zeinab Heydari erzählt niemandem von der zunehmenden Gewalt, der sie sich in ihrer Ehe ausgesetzt sieht. Sie kaschiert die augenscheinlichen Folgen der Schläge ihres Mannes so gut es geht und hofft, dass es ihr gelingt, ein blaues Auge oder eine aufgeplatzte Lippe vor der Nachbarschaft und ihren Arbeitskolleginnen, Zeinab arbeitet als Modeschneiderin in einer Textilfirma, zu verbergen. Auch, als dies immer seltener der Fall ist, vertraut sie sich niemandem an.
In Deutschland leben anno 2030 laut Angaben des Statistischen Bundesamts an die 200.000 Iraner:innen, wobei Personen aus der zweiten Generation wie Zeinab und Arian Heydari von amtlicher Seite noch aus der Zählung fallen. Eingewanderte aus dem Iran genießen in Deutschland den Ruf, `besonders gut integriert` zu sein. Sie gelten als gebildet, erfolgreich und säkular, haben fast keine sozialen Probleme und arbeiten in angesehenen Berufen. Diesem Ruf ihrer Landsleute will Zeinab Heydari gerecht werden. Und so versucht sie, die zunehmende Angst vor ihrem Mann, das Gefühl der Machtlosigkeit des Ausgeliefertseins in der Ehe, bestmöglich zu verdrängen.
Ungeachtet der psychischen Schäden, die eben dies bei ihr anrichtet.
Als Arians Firma in ernste Schwierigkeiten gerät, werden die Attacken auf seine Frau immer brutaler. Bereits, wenn Zeinab das abebbende Motorengeräusch hört, wenn der Ehemann von der Arbeit zurückkommt und seinen Wagen im Hinterhof parkt, bekommt sie oft eine Gänsehaut und beginnt am ganzen Leib zu zittern.
Zeinab steht am Fenster der großzügigen Erdgeschosswohnung in Köln-Rodenkirchen und sieht ihren Mann mit grimmigem Gesicht das Haus betreten. Die Iranerin ahnt, nein, sie weiß, was jetzt kommen wird. Arian öffnet die Wohnungstür und feuert Mantel und Aktenkoffer in die nächstbeste Ecke. Wortlos und mit wuterfülltem Blick geht er schnurstracks auf seine Gattin zu.
„Fass mich nicht an!“, bedeutet sie ihrem sichtlich überraschten Mann.
„Was?!“
„Hast Du es auf den Ohren? Lass Deine dreckigen Finger von mir.“
„Meine dreckigen…wie redest Du denn mit mir?!“
„Genauso, wie Du es verdient hast!“
„Du …na warte, Dir werd` ich`s zeigen!“
Arian verpasst seiner Frau eine heftige Ohrfeige und macht sich vehement an ihrer Bluse zu schaffen.
„Ein letztes Mal: Lass das!“
Doch der Widerstand seiner Frau macht Arian Heydari nur noch aggressiver, er lässt nicht von ihr ab.
„Du wagst es tatsächlich, Dich zu wehren, ja?“
„Das hätte ich schon lange tun sollen.“
Mit aller Wucht lässt Zeynab ihr Knie nach vorne schnellen und trifft den verdutzten Ehemann in den Genitalien. Begleitet von einem lauten Schmerzensschrei lässt er von ihr ab und sinkt in die Knie.
„Du verdammte Schlampe! Das wirst Du büßen!“
Zeinab Heydari greift sich den massiven Kerzenständer, der auf dem Sideboard steht und baut sich vor ihrem auf dem Boden kauernden Mann auf.
„Zeynab! Ich befehle Dir…“
„Die Zeiten von Befehl und Gehorsam sind vorbei. Ein für alle Mal.“
„Du wirst jetzt sofort…“
„Wag` es nicht, mir noch einmal Gewalt anzutun. Morgen gehe zuerst zur Polizei und zeige Dich an. Und dann zum Anwalt und reiche die Scheidung ein, Du verfluchter Mistkerl!“
*
Schon lange ist in der Onkologie bekannt, dass die meisten an Krebs erkrankten Menschen nicht etwa an ihrem bösartigen Primärtumor, sondern vielmehr an dessen Metastasen, die sich über die Blutbahnen in lebenswichtigen Organen absiedeln, sterben.
Doktor Udo Hallmann, Facharzt für Transfusionsmedizin, hat sich in seinem Labor auf die Krebszellendiagnostik spezialisiert.
Zirkulierende Tumorzellen sind Zellen, die sich von einem Primärtumor gelöst haben und in die Lymphgefäße gelangt sind oder im Blutkreislauf zirkulieren. Da es sich bei den Primärtumoren um Epithelialtumore handelt, spricht man von zirkulierenden epithelialen Tumorzellen (29). Mit der Celltrac-Methode kann Doktor Hallmann die Zahl der zirkulierenden Tumorzellen im Blut bestimmen. Auch kleinste Mengen maligner Zellen sind mit dem von ihm praktizierten Verfahren nachweisbar. Udo Hallmanns Labor leistet mit seiner Diagnostik wertvolle Dienste, um den Therapieverlauf einer Krebsbehandlung zu überwachen und gegebenenfalls zu modifizieren.
Philipp Mähling hat noch am Tag vor der Einnahme der ersten Pille mit der Marssubstanz eine Zellzählung vornehmen lassen. Nach einer Woche, in der er jeden Tag am Morgen eine Pastille eingenommen hat, hat er das Prozedere wiederholt und erwartet voller Ungeduld das Gespräch mit Doktor Hallmann.
Die Viertelstunde, die er im Wartezimmer Platz nehmen muss, kommt Philipp Mähling vor wie eine Ewigkeit. Endlich ist er an der Reihe. Der promovierte Transfusionsmediziner begrüßt seinen Patienten mit einem breiten Lächeln.
„Nehmen Sie Platz, Herr Kollege.“
„Danke.“
„Es ist wirklich ganz erstaunlich, Herr Professor. Nicht etwa, dass sich die Zahl zirkulierender Tumorzellen in Ihrer Probe lediglich reduziert hätte. Nein, es sind keine CTCs, keine malignen Zellen mehr nachweisbar.“
„Das ist ja…Entschuldigung.“ Philipp Mähling laufen Tränen über die Wangen.
„Sie brauchen sich Ihrer Tränen nicht zu schämen, guter Mann. Da oben meint es scheinbar jemand auffallend gut mit Ihnen.“
„Und dabei bin ich doch gar nicht gläubig…“
„Wie sagt man so schön: Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf…“
„Der Herr…oder wer auch immer…ich bin einfach nur dankbar, nur erleichtert, nur…es ist so unglaublich, wissen Sie.“
„Ich kann nur ahnen, wie Sie sich fühlen, Herr Professor.“
„Ich kann es ja selber nur schwer beschreiben. Selig trifft es vielleicht noch am ehesten.“
„Ich weiß nicht, wie die von Ihnen erwähnte Eigentherapie aussieht, aber es sieht so aus, als hätten Sie damit einen Volltreffer gelandet.“
Als Philipp Mähling glückselig das Laborgebäude verlässt, greift er unmittelbar zu seinem Smartphone.
„Felix, ich komme gerade aus dem Labor. Alles weg!“
„Was?!“
„Es sind keine Tumorzellen mehr nachweisbar in meinem Blut.“
„Das ist ja fantastisch! Und Dir geht es nach wie vor gut?“
„Gut? Mir geht es blendend!“
„Unfassbar! Ich hatte gehofft, dass die `rote Substanz` auch bei Dir wirkt,
aber so richtig geglaubt…ich weiß nicht…“
„Was Bernd Clüver kann, kann ich schon lange, mein Freund.“
„Ich würde vorschlagen, Du nimmst erst einmal keine weitere Pille und machst in einem Monat nochmals eine Untersuchung. Schließlich kann es sein, dass bei den Mäusen doch noch Nebenwirklungen auftreten. Es gibt auch Langzeitfolgen bei Medikamenten – aber das weißt Du ja besser als ich.“
„Ist in Ordnung, Chef.“
*
Der Mensch hat der Maus viel zu verdanken. Sie hat etwa so viele Gene wie wir und eignet sich hervorragend als Modell in der biomedizinischen Forschung. Millionen von Versuchsmäusen bevölkern die Labore rund um den Globus. Vor allem in Forschungsgebieten wie Krebsforschung, Immunologie und Neurobiologie werden sie regelmäßig eingesetzt (30).
Die Tiere am BupG stammen von professionellen Versuchstier-Züchtern. Für eine eigene Zucht werden zu selten Versuchsmäuse benötigt. Das Institut legt sehr viel Wert auf eine tierschutzgerechte Haltung, die die natürlichen Grundbedürfnisse der Versuchsmäuse bestmöglich berücksichtigt. Die Käfige bestehen aus transparentem Kunststoff und haben eine Fläche von mindestens 370 Quadratzentimetern. In Abhängigkeit vom Körpergewicht leben darin zwischen drei und sechs Tiere. Die Käfige sind 14 Zentimeter hoch und werden von einem Gitterdeckel abgeschlossen, welchen die Tiere zum Klettern nutzen können. In jedem Käfig befinden sich eine Futtertraufe und eine Trinkflasche. Und jeder enthält Streu aus Holzspänen. Kleine Maushäuser bestehend aus bordeauxrotem, transparentem Kunststoff dienen als Rückzugsmöglichkeiten. Papierstreifen, Holzwolle oder Hanf ermöglichen den Nestbau und Beschäftigung. Eine vollautomatische Klima- und Lichtregelung sorgt dafür, dass die Mäuse unter stets konstanten Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lichtbedingungen ihr Dasein fristen.
Carola Deichberg ist gerade dabei, weitere Labortests mit dem geheimnisvollen Marsgestein durchzuführen, als ihre Konzentration jäh unterbrochen wird. Seltsame Geräusche dringen aus dem Versuchslabor an ihr Ohr. Ein Quieken, ein Zirpen erregt die Aufmerksamkeit der Forscherin. Sie begibt sich zu den Käfigen der Versuchstiere und wird, als sie die Tür des Labors öffnet, auch eines Fauchens gewahr, wie man es normalerweise nur hört, wenn Mausböckchen miteinander kämpfen. Und tatsächlich: Jürgen Marcus, der sich eigentlich immer in seine Behausung zurückzieht, wenn sich ihm eine andere Maus nähert, befindet sich im heftigen Clinch mit Bernd Clüver. Auch Lena Valeitis, eine sehr schüchterne Maus, die meist allein in einer Ecke hockt, faucht, obwohl Mäuseweibchen dies meist nur zur Verteidigung ihrer Jungen tun, ohne ersichtlichen Grund ihre männlichen Artgenossen an.
Carola Deichberg weiß, dass Mäuse, die fauchen, unter großer Anspannung stehen. Sie muss handeln. Mäuse sind von Natur aus äußerst soziale Tiere und sollten deshalb unbedingt in Gruppenhaltung untergebracht sein.
In diesem Fall jedoch müssen die Tiere, zumindest vorübergehend, getrennt werden. Die `Mäusefachfrau` greift nach Jürgen Marcus, der sich stets in sein Maushaus zurückzieht, wenn sie in den Käfig greift, um Futter und Wasser darin zu platzieren. Diese Mal jedoch tritt er die Flucht nach vorn an – und beißt zu. Völlig perplex stößt die überraschte Forscherin einen spitzen Schmerzensschrei aus und schaut auf ihre blutende Hand. Zum Glück ist sie den Umgang mit Versuchsmäusen gewohnt und weiß, was im Falle eines Bisses zu tun ist. Sie spült die Wunde aus und behandelt sie mit einem hochwirksamen Antiseptikum in Form einer alkoholischen Lösung von Jod, Brillantgrün, Wasserstoffperoxid und Chlorhexidin.
Ein Mäusebiss selbst kann neben Sodoku, der sogenannten `Rattenbisskrankheit`, zudem auch Tetanus, Leptospirose und Pseudotuberkulose verursachen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Biss eine Infektion mit einer gefährlichen Krankheit hervorruft, ist allerdings sehr gering. Obwohl allgemein angenommen wird, dass der Speichel von Mäusen eine Brühe mit Mikroben und Viren ist, kommt es in der Tat nur selten zu Krankheitsinfektionen (31).