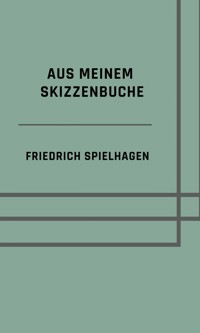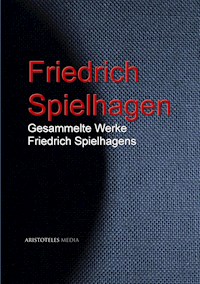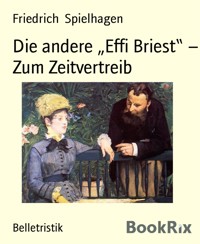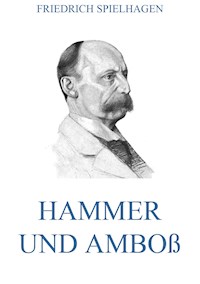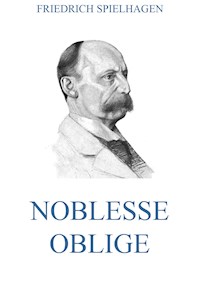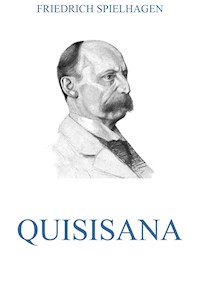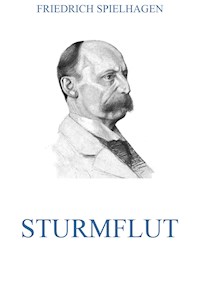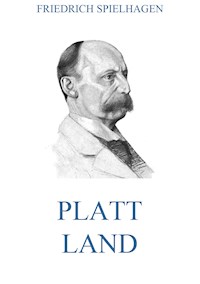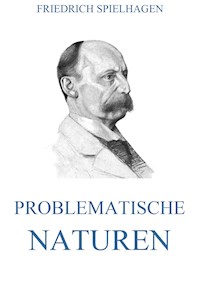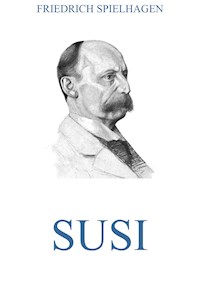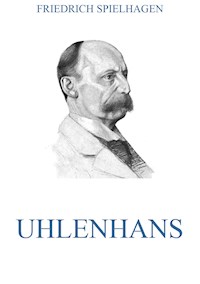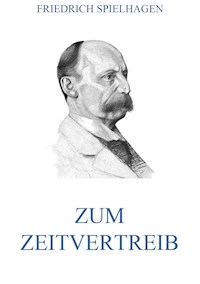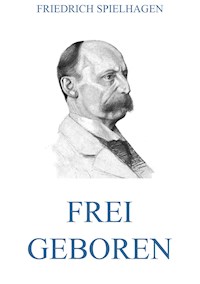
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Rückblick einer Frau auf ihr bewegtes Leben. Friedrich Spielhagens Werke sind stark geprägt von seiner Liebe zum Meer, die er in seiner Zeit in Stralsund entwickelte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frei geboren
Friedrich Spielhagen
Inhalt:
Friedrich Spielhagen – Biografie und Bibliografie
Frei geboren
Vorwort.
Erstes Buch.
Zweites Buch.
Drittes Buch.
Viertes Buch.
Epilog.
Frei geboren, F. Spielhagen
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849636371
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Spielhagen – Biografie und Bibliografie
Romanschriftsteller, geb. 24. Febr. 1829 in Magdeburg als Sohn eines preußischen Regierungsrates, verbrachte sein Jugend in Stralsund (ein großer Teil seiner späteren Romane spielt an diesem Teile der Ostseeküste und auf der Insel Rügen), absolvierte hier das Gymnasium, studierte von 1847 an anfangs die Rechte, dann Philologie und Philosophie in Berlin, Bonn und Greifswald, war einige Zeit als Lehrer tätig, widmete sich aber bald ausschließlich der Literatur. Neben Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen, von denen wir die »Amerikanischen Gedichte« (Leipz. 1856, 3. Aufl. 1871) nennen, veröffentlichte er schon in Leipzig die Novelle »Klara Vere« (Hannov. 1857) und das Idyll »Auf der Düne« (das. 1858), die jedoch nur geringe Beachtung fanden. Eine um so glänzendere Aufnahme fand der erste größere Roman Spielhagens: »Problematische Naturen« (Berl. 1860, 4 Bde.; 22. Aufl., Leipz. 1900), mit seiner abschließenden Fortsetzung: »Durch Nacht zum Licht« (Berl. 1861, 4 Bde.). Dieser Roman gehörte durch Lebendigkeit des Kolorits und eine in den meisten Partien künstlerisch ansprechende Darstellung zu den besten deutschen Romanen seiner Zeit. S. war inzwischen 1859 von Leipzig nach Hannover und Ende 1862 nach Berlin übergesiedelt, wo er kurze Zeit die »Deutsche Wochenschrift« und das Dunckersche »Sonntagsblatt« redigierte. Auch von der Herausgabe von Westermanns »Illustrierten deutschen Monatsheften«, die er 1878 übernommen, trat er 1884 wieder zurück. Sein zweiter großer Roman: »Die von Hohenstein« (Berl. 1863, 4 Bde.), der die revolutionäre Bewegung von 1848 zum Hintergrund hatte, eröffnete eine Reihe von Romanen, welche die Bewegungen der Zeit zu spiegeln unternahmen. War hierdurch ein gewisses Übergewicht des tendenziösen Elements gegenüber dem poetischen unvermeidlich, und standen die Romane: »In Reih' und Glied« (Berl. 1866, 5 Bde.) und »Allzeit voran!« (das. 1872, 3 Bde.) wie die Novelle »Ultimo« (Leipz. 1873) allzu stark unter der Herrschaft momentan in der preußischen Hauptstadt herrschender Interessen, so erwiesen andre freiere Schöpfungen den Gehalt, die Lebensfülle und die künstlerische Gewandtheit des Verfassers. Neben der Novelle »In der zwölften Stunde« (Berl. 1862), den unbedeutenderen: »Röschen vom Hofe« (Leipz. 1864), »Unter Tannen« (Berl. 1867), »Die Dorfkokette« (Schwerin 1868), »Deutsche Pioniere« (Berl. 1870), »Das Skelett im Hause« (Leipz. 1878) und den Reiseskizzen: »Von Neapel bis Syrakus« (das. 1878) schuf S., unabhängiger von den momentanen Tagesereignissen oder sie nur in ihren großen, allgemein empfundenen Wirkungen auf das deutsche Leben darstellend, die Romane: »Hammer und Amboß« (Schwer. 1868, 5 Bde.), »Was die Schwalbe sang« (Leipz. 1872, 2 Bde.) und »Sturmflut« (das. 1876, 3 Bde.), ein Werk, worin der Dichter, besonders im ersten und letzten Teile, auf der vollen Höhe seiner Darstellungskunst steht, und worin er in glücklicher Symbolik das Elementarereignis der Ostseesturmflut mit der wirtschaftlichen Sturmflut 1873 im Zusammenhange erzählt; den Roman »Platt Land« (das. 1878, 3 Bde.), die seine, nur etwas allzusehr zugespitzte Novelle »Quisisana« (das. 1879) sowie die Romane: »Angela« (das. 1881, 2 Bde.), »Uhlenhans« (das. 1884, 2 Bde.), »An der Heilquelle« (das. 1885), »Was will das werden« (das. 1886, 3 Bde.), »Noblesse oblige« (das. 1888), »Ein neuer Pharao« (das. 1889), »Sonntagskind« (das. 1893, 3 Bde.), »Susi« (Stuttg. 1895), »Zum Zeitvertreib« (Leipz. 1897), »Faustulus« (das. 1898), »Opfer« (das. 1900), »Frei geboren« (das. 1900), »Stumme des Himmels« (1903). Eine Abnahme der dichterischen Kraft Spielhagens ist seit der »Sturmflut« nicht zu verkennen; seine Darstellungsweise geriet immer mehr in den Stil des in sich selbst eingesponnenen Reflektierens, statt des einfach konkreten Gestaltens. Auch kam S. über den Standpunkt des liberalen Achtundvierzigers und des Liberalen aus der Konfliktszeit nicht mehr recht hinaus, und der große Meister der Zeitschilderung verstand nicht mehr den »neuen Pharao«. Nur in den kleineren Werken: »Deutsche Pioniere« und »Noblesse oblige«, streifte S. vorübergehend das Gebiet des historischen Romans. Mit dem nach einer eignen Novelle (Berl. 1868) bearbeiteten und an mehreren Theatern erfolgreich aufgeführten Schauspiel »Hans und Grete« (das. 1876) wendete er sich auch der Bühne zu. Größern Erfolg hatte das Schauspiel »Liebe für Liebe« (Leipz. 1875), in dem die Kritik neben novellistischen Episoden einen wahrhaft dramatischen Kern anerkannte. Außerdem brachte er die Schauspiele: »Gerettet« (Leipz. 1884), »Die Philosophin« (das. 1887) und »In eiserner Zeit«, Trauerspiel (das. 1891). Von S. erschienen ferner: »Vermischte Schriften« (Berl. 1863–68, 2 Bde.), »Aus meinem Skizzenbuch« (Leipz. 1874), »Skizzen, Geschichten und Gedichte« (das. 1881), »Beiträge zur Theorie und Technik des Romans« (das. 1883), »Aus meiner Studienmappe« (Berl. 1891), »Neue Beiträge zur Theorie und Technik der Epik und Dramatik« (Leipz. 1898), »Am Wege«, vermischte Schriften (das. 1903) und eine Sammlung seiner formschönen »Gedichte« (das. 1892) und »Neuen Gedichte« (das. 1899). Die letzte Ausgabe seiner »Sämtlichen Romane«, die alle zahlreiche Auflagen erlebten, erschien in 29 Bänden (Leipz. 1896 ff.). S. schrieb auch seine Selbstbiographie: »Finder und Erfinder, Erinnerungen aus meinem Leben« (Leipz. 1890, 2 Bde.), die aber wesentlich nur die innere und äußere Entstehungsgeschichte seiner »Problematischen Naturen« erzählt. Vgl. Karpeles, Friedrich S. (Leipz. 1889), und die Festschrift zu Spielhagens 70. Geburtstag: »Friedrich S.« (das. 1899).
Frei geboren
Vorwort.
Ich kannte die Geschichte ihres Lebens nur in den großen Zügen. Und so – skizzenhaft umrissen – sollte sie eine Episode meines Romans "Opfer" bilden.
Ein Vorhaben, das ich gern fallen ließ, als ich in den Besitz der ausführlichen Schilderung ihrer Schicksale gelangte, die sie der treuen Pflegerin in die Feder diktiert hatte, und zu deren Herausgabe mir die Autorisation wurde.
Eines weiteren Kommentars bedürfen diese Bekenntnisse nicht.
Über die Ursache des Todes der merkwürdigen Frau sind wir nicht genauer unterrichtet und auf Vermutungen angewiesen.
Er erfolgte ungefähr einen Monat nach dem Schluß des Diktats, unmittelbar auf den Zusammenbruch des Bankhauses Bielefelder & Sohn, den, wie man sich erinnern wird, der famose Millionendiebstahl seines ersten Kassierers nicht sowohl einleitete als besiegelte.
Neben vielen andern ging dabei auch ihr Vermögen völlig verloren.
Ich weiß nicht, ob die Stolze, nachdem sie so lange Jahre hindurch die Wohlthäterin zahlloser Armer gewesen, es ertragen hätte, nun ihrerseits der Mildherzigkeit der privaten, wohl gar der öffentlichen Armenpflege anheimzufallen. Aber ich bin überzeugt: mit der Möglichkeit, weiter, wie bisher, in ihrer großherzigen, königlichen Weise helfen zu können, wäre der Dulderin der letzte karge Wert ihres Lebens entschwunden.
So mag es gar wohl sein, daß sie, wie sie frei geboren war, auch frei gestorben ist.
Fr. Sp.
Erstes Buch.
Vergangene Nacht war es, daß mir der Gedanke kam. Ich hatte gestern abend keine größere Dosis Morphium genommen, als mir Dr. S. erlaubt hat, wenn meine Schmerzen anfangen, unerträglich zu werden, will sagen: meine wahrlich erprobte Geduld zu erschöpfen. Er vertraut meiner Erfahrung und Ehrlichkeit völlig und hat mir längst überlassen zu bestimmen, wann der kritische Moment eintritt. So hatte ich geschlafen, die ersten Stunden gewiß ruhig; dann, als die Wirkung des Morphiums erschöpft war, von Träumen geängstigt. Ich kenne das: ängstliche Träume gehen fast immer dem Erwachen voraus; auch lege ich diesen Hirngespinsten sonst keinen Wert bei; sind sie doch für gewöhnlich nach dem Erwachen schnell wieder zerflattert! Heute nacht war das nicht der Fall. Dazu waren sie zu deutlich gewesen und zu qualvoll. Ich durchlebte die Episode meines Aufenthalts in Dr. Resbers Hause noch einmal in allen entscheidenden Scenen. Die Umgebung, die Zimmer, der kleine Garten – das Räumliche mit einem Worte zeigte sich nur in verschwimmenden Umrissen; auch spielte sich alles in einer magischen Dämmerung ab, die von Tag und Nacht gleich entfernt war, oder von beiden gleich viel hatte. An dieser Schattenhaftigkeit partizipierten auch in ihrer Gestalt er, seine Frau, die Tochter, das Dienstmädchen, alle erscheinenden personae dramatis, ich selbst eingeschlossen, die ich überhaupt mich nicht sah, nur fühlte; von der ich nur wußte, daß ich es war. Das alles wäre nun ja nichts Besonderes gewesen und besonders Ängstliches. Das Ängstliche, ja Furchtbare bestand in etwas anderm; darin, daß die beiden Hauptpersonen: er und ich die Rollen ausgetauscht hatten: ich die Liebende, Verlangende, Verzweifelte; er der Ruhige, Ablehnende, in der Katastrophe klug sich Salvierende war. Rasend im Schmerz meiner unerwiederten Liebe, schluchzend, stöhnend, schreiend erwachte ich: meine gute Lent hatte Mühe, mich zu beruhigen. Es war drei Uhr. Ich wußte, daß ich nicht wieder einschlafen würde. Die Schmerzen waren erträglich. So hatte ich vollauf Zeit und Kraft, über den seltsamen Traum nachzudenken.
Das war so einfach nicht. Es dauerte eine geraume Weile, bis ich die Dinge, die der Traum, so zu sagen, auf den Kopf gestellt, wieder auf die Füße gebracht hatte. Und in dem Augenblicke, als ich Wirklichkeit und Traum reinlich geschieden zu haben glaubte, drohte eine viel ärgere Verwirrung hereinzubrechen. Wie nun, wenn der Traum nur in Tiefen der Seele hinabgestiegen wäre, dahin das wache Bewußtsein nicht reicht, und so mit mächtiger Hand die wahre Wirklichkeit ans Licht gehoben, ich trotzalledem Dr. Resber geliebt und nur aus Laune, Eigensinn ihn zurückgewiesen und damit mein Lebensglück verscherzt hätte? Konnte es der Fall sein? Wie selten sind wir uns über unser seelisches Verhältnis zu einer andern Person völlig klar! Wie oft muß nicht eine zeitweise Trennung oder der Tod uns darüber belehren, was wir in Wirklichkeit für sie empfinden, oder empfunden haben? Und wie schmerzlich dann die zu späte Einsicht, die vielleicht vor einem Unwiederruflichen, nicht wieder gut zu Machenden steht! Und wir verzweifelt eine Stunde der vergeudeten Zeit zurückwünschen; eine Minute nur, um sagen zu können: ich habe dich ja so sehr geliebt!
Wenn dem aber so ist, woher kommt es? Offenbar aus unserer Flüchtigkeit, Gedankenlosigkeit. Daher, daß wir die Sklaven des Augenblicks sind, die Knechte unsrer Launen, unsers körperlichen Befindens; von Eindrücken, denen wir keine Widerstandskraft entgegensetzen, so daß sie, die sonst federleicht sein würden, zentnerschwer wiegen. Und dann kommen Träume, die mit all dem Unfug reine Bahn machen, uns die Dinge zeigen, wie sie wirklich sind; einen Spiegel vorhalten: so siehst du in Wirklichkeit aus!
Ein beschämender Zustand und ein verzweifelter, weil aus ihm kein Entrinnen ist. Doch nur wäre, wenn wir in jedem Augenblicke unsre ganze Kraft beisammen hätten. Das ist wider die Natur. Auch Homer schläft zuweilen; selbst Schiller hat sicherlich seine schwachen Stunden gehabt, wenn er gleich einmal einem jungen Mädchen sagen konnte: man müsse so leben, als ob jeder Tag unser letzter sei.
Aber was der Augenblick in seiner Ohnmacht uns versagt, das kann, müßte für jeden Menschen, der etwas auf sich hält, die Folgezeit bringen: gewissenhaftes Nachdenken des Geschehenen, das sich fürder nicht durch die brutale Gewalt des Moments imponieren läßt; die Verdunkelungen entfernt, mit der sie das reale Bild unseres Lebens befleckte, undeutlich machte, entstellte. Es ist möglich, daß es durch diese Restauration nicht schöner wird. Gleichviel, ob schöner oder häßlicher: es wird, was sehr viel wichtiger, an Wahrheit gewinnen.
Und zwar müßte dieses Nachdenken schriftlich sein; man müßte die Resultate schwarz auf weiß haben. Damit, wenn man wieder einmal von einem Traum geängstigt wird, der uns vorgaukelt: wir hätten uns in einer wichtigen Periode unsres Lebens gröblich über uns selbst getäuscht und den verhängnisvollen Irrtum so weiter durch das Leben geschleppt, sofort an einen höheren Richter appelliert werden kann: an unsre Aufzeichnungen, in denen von Seite so und so bis so und so die Sache dargestellt ist, wie wir sie im vollen Licht des Bewußtseins und der redlichsten Selbstprüfung gesehen haben.
Also was man eine Autobiographie nennt.
Die aufzusetzen Goethe irgendwo jeden, der das vierzigste Jahr zurückgelegt hat, dringend mahnt.
Um dann auf seine eigene als Nebentitel "Wahrheit und Dichtung" zu setzen!
Doch wohl, um damit auszudrücken: Wir mögen uns stellen, wie wir wollen: die Phantasie läßt sich nicht ausschalten, und die arge Schmeichlerin narrt selbst den Redlichsten.
Und es käme bestenfalls etwas zu stande, was wohl realer als ein Traum ist, aber darum auf unbedingte Glaubwürdigkeit noch längst keinen Anspruch machen kann.
Aber gerade auf die kommt es mir an: ein Zwitterding zwischen dem, was möglich gewesen wäre, und dem, was sich aus dem Brodel aller Möglichkeiten als Wirklichkeit niedergeschlagen, hätte für mich schlechterdings keinen Sinn.
Ich will mich ja keinem verehrlichen Publikum präsentieren, vor dem man doch, und wäre man noch so wenig eitel, unwillkürlich ein wenig Toilette macht und posiert; bei dem innigsten Bestreben, wahrhaftig zu sein, hier mit einem Worte zurückhält, das ein zartes Seelchen beleidigen könnte, dort einen Gedanken verschweigt, der, ausgesprochen, den Seelenfrieden vieler guten Leute und schlechten Musikanten allzu empfindlich stören würde. Und was dann dergleichen Vorsichten und Rücksichten weiter sind, die beobachten muß, wer sich einer großen und gemischten Gesellschaft gegenüber befindet.
Mein Publikum ist das denkbar kleinste. Es besteht, wenn ich von mir, wie billig, absehe, aus meiner guten Lent, der ich dies alles in die Feder diktieren muß, und die ich auch wieder eigentlich nicht als Publikum rechnen kann, da sie mich bereits seit so vielen Jahren kennt, und wohl besser kennt, als ich mich selbst –
Bitte, liebe Lent, schreibe das nur ruhig hin! Erstens ist es wahr, und zweitens, wenn du von dem Papier auf und mich mit deinen klugen, treuen Augen anblickst, so verstößt das gegen die Abmachung, die wir vor einer Stunde getroffen haben, und stört mir die nachtwandlerische Sicherheit, die mir zu meinem Geschäft unbedingt nötig ist. – Wie weit waren wir? Richtig: ich mich selbst; und vielleicht meiner lieben Friederike. Vielleicht! ich werde es mir noch überlegen. Jedenfalls, kommen diese Blätter je in ihre reinen Hände, so lebe ich nicht mehr. Und zu der Liebe, die das himmlische Mädchen für die Lebende hatte, gesellt sich die Pietät für die Tote. Da darf ich dann vollends meiner Sache sicher sein.
Eine große Hilfe bei diesen Aufzeichnungen und eine wesentliche Erleichterung der Mühe, die ich meiner guten Lent mache – bitte, jedes Wort, wie es aus meinem Munde geht, wird niedergeschrieben! – verspreche ich mir von dem Tagebuche, das ich schon als junges Mädchen in dem Kloster begonnen, freilich nichts weniger als regelmäßig fortgeführt und an dem ich seit vielen Jahren keine Zeile mehr geschrieben habe. Ich werde die Blätter – ich wollte, es wären ihrer mehr – an den betreffenden Stellen einfügen, notabene: nicht ohne vorherige, sehr sorgsame Prüfung auf ihre Treue und Redlichkeit hin. Ich hoffe nach der Seite das beste. Ich war von jeher eine leidlich ehrliche Seele, die freilich eine bedenkliche Neigung hatte, mit andern streng ins Gericht zu gehen, aber sich selbst nicht schonte, wenn die Reihe an sie kam. –
So, liebe Lent, da wollen wir für heute aufhören. Morgen, denke ich, kommen wir zu der eigentlichen Geschichte, bei der wir mit dem Anfang anfangen werden. Das geschieht, soviel ich weiß, in jeder gewissenhaften Autobiographie, und ich glaube, mit Recht. Es ist nicht gleichgiltig, von wem wir abstammen. Im Gegenteil! Wer die Reihen seiner Ahnen väterlicher- und mütterlicherseits nur weit genug zurückverfolgen könnte, würde sicher finden, daß er in allen seinen physischen, Temperaments-, Charakter- und seelischen Eigenschaften gar nichts Eigenes hat, sondern schlechthin der glücklich-unglückliche Erbe seiner Vorfahren ist.
#####
Da thut es mir dann um so mehr leid, daß ich von diesen meinen Vorfahren so sehr wenig weiß, trotzdem die Kesselbrooks notorisch eine adlige Familie sind, deren Stammbaum nach einigen bis in das vierzehnte, nach andern sogar bis in das zwölfte Jahrhundert sich verfolgen läßt. Ihre Heimat soll Westfalen, und sie sollen da einstmals reich begütert gewesen sein. Doch das ist lange her. Schon seit vier oder fünf Generationen mindestens ist bei ihnen von Gütern und obligaten Schlössern nicht mehr die Rede. Daran, daß W. ihre ursprüngliche Heimat, erinnert nur der Umstand, daß ein Clemens v. K. kurz nach dem 30jährigen Kriege der Gründer des Erziehunginstituts für adliche Fräulein bei der kleinen Stadt L. gewesen ist. Oder wohl nur Mitgründer, da für seine Familie kein anderer Vorteil aus der Gründung resultierte, als eine Freistelle. Und auch von diesem Recht scheint ein sehr bescheidener Gebrauch gemacht worden zu sein. Wenigstens ließ sich, als ich eintrat, feststellen, daß der Name Kesselbrook seit einem Jahrhundert in den Klosterbüchern nicht figuriert hatte. Offenbar war die Sache in Vergessenheit geraten, bis mein Vater als Regimentskommandeur nach dem benachbarten M. kam und von seinem Jugendfreund, dem Rechtsanwalt Piper, den er dort wiederfand, und der von Berufs wegen oft in alten Akten zu stöbern hatte, auf die noch immer nicht verjährten Ansprüche hingewiesen wurde. Wofür ihm dann mein Vater aus guten Gründen sehr dankbar war.
Denn, wie schon angedeutet, wir K.'s gehörten längst zum armen Adel, und es hätte wohl noch übler um die Familie gestanden, wäre sie in ihrem Nachwuchs zahlreicher gewesen. Ja, es ist ein Wunder fast, daß sie sich bis zu meinem Vater und seinem Bruder im Mannstamm behauptet hat. Seltsamerweise brachte sie es kaum je über zwei, höchstens drei männliche Sprossen, die dann unweigerlich Offiziere wurden und sich in aller Herren Ländern mit den betreffenden Feinden herumschlugen, was dann nicht wenigen ihr junges Leben kostete, so daß die Familie mehr als einmal auf den zwei Augen des einzig noch überlebenden K. stand. So war es der Fall mit meinem Großvater, der General in preußischen Diensten und ein Liebling des Kronprinzen, späteren Königs Friedrich Wilhelm IV. war, was nun nachträglich seinen beiden Söhnen in ihrem Avancement sehr zu statten kam, und noch mehr genützt haben würde, hätte sich nicht auch er zu der leidigen Gewohnheit der K.'s bekannt, im besten Mannesalter zu sterben.
So habe denn auch ich, als der Vater – kaum in der Mitte der vierzig – uns, meiner Schwester Lida und mir – sie elf-, ich zehnjährig – durch den Tod entrissen wurde, nur die Erinnerung an einen stattlich schönen Mann, wo er auch ging und stand, besonders aber, wenn er im Sattel war, wohin, wie er sagte, ein Soldat überhaupt von Rechts wegen gehöre. Und daß es sein größter Kummer sei, mit dem schmalen Kesselbrook'schen Beutel Infanterist sein zu müssen, während er, ein geborener Kavalleriegeneral, es mit dem alten Ziethen und mit dem Feldmarschall Vorwärts selbst aufgenommen haben würde.
So hat er mehr als einmal zu mir gesprochen, wenn ich ihn, das neunjährige Ding, auf einem Pony, den er eigens für seinen Liebling angeschafft, bei einem Spazierritt begleiten durfte – zum Entsetzen der guten Spießbürger und ihrer Frauen und Töchter, die einmütig dafür hielten, daß es mit einem Kinde, dem man so früh solche Freiheiten gewähre, unbedingt ein schlechtes Ende nehmen müsse. Und ein Vater sich schämen solle, der, anstatt eine mütterliche Waise doppelt zu hüten, sie solchen Gefahren des Leibes und der Seele preisgebe.
An solchen Vorwürfen war eines wohl zweifellos richtig: der Vater verzog mich in jeder Weise. Verlangte ich ein Spielzeug – ich bekam es; gefiel mir eine Gouvernante nicht, wurde sie unbedingt weggeschickt. Meine Schwester Lida, trotzdem sie die ältere war, stand immer und überall in zweiter Linie. Dabei war sie nicht nur die ältere, sondern auch die weitaus hübschere, ja einfach ein bildschönes Kind, aus dem dann später auch ein bildschönes Mädchen wurde. Weiter sagten alle, daß sie unsrer verstorbenen Mutter mit jedem Tage ähnlicher werde. Ich kann das nicht beurteilen, denn, als uns die Mama genommen wurde, waren wir erst 4 und 3 Jahre alt; und außer ein paar schlechten Daguerreotypen und einem noch schlechteren Pastellbildchen, die wir von ihr haben, ist nichts vorhanden, wonach ich mir eine Vorstellung von ihrer Erscheinung machen könnte. Doch werden die Leute schon recht gehabt haben; und dann ist es eigentlich zu verwundern, daß ich und nicht Lida der Liebling des Vaters war.
Oder auch eigentlich nicht zu verwundern, wenn ich den Indiskretionen von Tante Anna trauen darf. Sie hat freilich den Papa nie leiden können; aber ihre kleinen grauen Augen sahen scharf, und sie deutete wiederholt mehr als an, daß die Ehe meiner Eltern ebenso kurz wie unglücklich gewesen sei. Vielleicht gerade nur, weil sie so kurz. Sind doch in so vielen Ehen die ersten Jahre, bevor die Differenzen der Temperamente und Charaktere sich einigermaßen ausgeglichen, das Bildungsniveau hinauf und hinab sich in etwas applaniert hat, die stürmischsten, leidvollsten. Möglicherweise ist der Grund auch ein anderer gewesen, der etwas weiter von dem allgemeinen Menschenlose abliegt. Mein Vater war nicht nur ein ungewöhnlich schöner, sondern auch bezaubernd liebenswürdiger Mann. Solchen Männern pflegen die Frauen, wie ihrer viele sind, auf halbem Wege entgegenzukommen. Und solche Männer pflegen nicht darauf zu warten, sondern gehen gern den ganzen Weg und auch wohl darüber hinaus. Ich würde es begreiflich finden, hätte mein Vater zu dieser gefährlichen Kategorie gehört; und da ist ja das Unglück bald fertig für eine Frau, die jung und unschuldig in die Ehe kommt und doch Augen hat, zu sehen. Ach, der vielen, vielen Evatöchter, die, erwachend, innewerden, daß ihr Paradies nichts war als ein kurzer schöner Traum! Arme Mutter, wenn es sich denn wirklich so verhalten hat! Schlimmer Vater, der du in dem Übermute deines Reichtums die kostbare Perle so wenig achtetest!
Doch das alles sind Vermutungen, aus denen sich sichre Schlüsse auf keine Weise ziehen lassen. Alles in allem möchte ich glauben, daß, wie Lida ganz das Kind unsrer Mutter, so ich das unsres Vaters war. Wie ich das verstehe, wird sich wohl aus dem Folgenden noch deutlicher ergeben.
Des Vaters oft gegen seine Freunde ausgesprochener Wunsch, nicht im Bette zu sterben, war in Erfüllung gegangen. Bei dem großen rheinischen Manöver vom Jahre 51 hatte er sich auf einem wilden Ritt über Gräben und Hecken weg das Genick gebrochen und war auf der Stelle tot gewesen. Daß er ein Testament hinterließ, war nicht eine Folge seiner Vorsicht: sein Freund, der Rechtsanwalt, dem ein plötzlicher Tod des Tollkühnen als etwas sehr wohl Mögliches erschienen sein mochte, hatte gleich nach dem Ableben der Mama darauf gedrungen, daß für uns nach dieser Seite gesorgt werden müsse. Das kleine zurückgelassene Vermögen stammte von der Mama; aber, da sich die Eltern bei der Verheiratung gegenseitig zu Universalerben eingesetzt, hatte der Vater darüber disponieren können. Auf den Rat des rechtsverständigen Freundes war dies in der Weise geschehen, daß auf Lidas Teil zwei Drittel des Ganzen kamen, während mir die Freistelle in dem Kloster – die ich auf alle Fälle mit dem zehnten Jahre antreten sollte – als Entschädigung für mein geringeres Erbe angerechnet wurde. Der Rechtsfreund sagte mir später, er habe dies Arrangement getroffen, weil er der Meinung gewesen, daß Lida bei ihrer auffallenden Schönheit bald genug einen Mann finden werde, falls das nötige Vermögen in Reserve stehe; ich dagegen möglicherweise für das spätere Leben auf meinen guten Kopf und meine Talente angewiesen sei und mir deshalb eine sorgfältige Bildung aneignen müsse, wie sie mir das durch seine Erziehungsresultate berühmte Kloster garantiere.
Ob diese Bestimmungen mit der Billigkeit und Gerechtigkeit völlig vereinbar sind, will ich dahingestellt sein lassen. So viel ist mir sicher, daß, als sie getroffen wurden, ich ein verzweifelt häßliches Ding gewesen sein muß. Der Rechtsfreund, als er mir jene vertraulichen Mitteilungen machte, deutete sogar etwas derart an. Nicht ohne sogleich galant hinzuzufügen: es sei so schwer, vorauszusehen, wie sich neunjährige Kinder später entwickeln würden. Besonders Mädchen. Da könne man beinahe als Regel gelten lassen, daß sie die gewiegtesten Kenner Lügen straften und das Gegenteil der Prophezeiung eintrete.
Ich erwiderte lachend, ich wolle schon zufrieden sein, wenn in diesem Falle, wie in so vielen, die Wahrheit in der Mitte liege.
Doch hier habe ich einen Sprung von neun Jahren gemacht. Ich muß in der chronologischen Folge bleiben, wenn ich den Faden in der Hand behalten und das Gewebe meines Lebens, das ich schlichten will, nicht erst recht in Verwirrung bringen soll.
Also zurück zu meines ritterlichen Vaters allzufrühem Tod!
Und nun thue dich auf, du alte, mit dichtem Epheu übersponnene Klosterpforte, die du der Eingang zu einer Stätte warst, an der ich meine ganze eigentliche Jugend verbringen sollte, und an die ich noch jetzt mit tiefster Wehmut und innigster Dankbarkeit zurückdenke! Bin ich doch da – nicht auf Momente, sondern lange Zeit hindurch – so glücklich gewesen, wie ich meiner Natur nach wohl überhaupt werden kann. Ja, ich möchte sagen: ich bin vollkommen glücklich gewesen, und die kleinen und großen Leiden, an denen es gewiß nicht gefehlt hat, waren nichts als das Kupfer, mit dem man das Gold legiert, damit es den nötigen Widerstand leisten mag gegen die stumpfe Welt, durch deren rauhe Hände zu gehen, seine trübe Zukunft ist.
#####
Schon mir die äußere Situation lebhaft in Erinnerung zu rufen, erfüllt mich mit Entzücken.
Ein paar tausend Schritte vor dem Südthore der alten Stadt gelegen auf der Höhe eines mählich ansteigenden Hügels, der auf der andern Seite jäh in das tiefe schmale Bett des Flüßchens abfiel, war das Kloster inmitten seines herrlichen Parkes mit den ehrwürdigen Bäumen und seinen wohlgepflegten Blumen- und Gemüsegärten ein Asyl der Ruhe und des Friedens, in das von der verworrenen Welt draußen kaum ein Ton drang. Selbst in der Stille der Sommernacht, wenn wir unsere Schlafstubenfenster offen hatten (gegen den Willen von chère Maman, die in diesem Punkte von der alten Schule war), gelegentlich nur das halb erstickte Bellen eines Hundes in einem der Dörfer der Nachbarschaft, oder das dumpfe Rollen eines Zuges auf der Zweigbahn, die in einem weiten Bogen um den Klosterberg herum unten durch das Thal von der Stadt nach der Hauptbahn lief. Und im Winter, wo wir manchmal im Schnee wie vergraben waren, das Krächzen der Krähen in den Wipfeln der Eichen im Park und das klägliche Geschrei der Käuzchen in dem Glockenturm der Klosterkapelle. Aber Krähen und Käuzchen gehörten doch auch zu unsrer Welt, wie die Finken, Meisen und Amseln, die im Frühjahr und Frühsommer mit ihrem Gesang das ganze grüne Revier erfüllten; und die Nachtigallen, die hier zahlreicher waren und voller, inniger schlugen, als ich es je wieder im Leben gehört. War aber der Park mit seinem tiefen Schatten, den sonnigen Grasplätzen, auf denen wir Haschens und Reifen spielten, in dessen breiten, sauberst gehaltenen Gängen wir Arm in Arm promenierten, ein lieblicher Aufenthalt, und so der Blumengarten, der daran stieß, mit seinen Hyazinthen, Levkojen, Rosen- und Resedabeeten, über denen sich die bunten Schmetterlinge wiegten – meine Schwärmerei blieb die Terrasse hinter dem Kloster, die, der Kante des Felsens aufgesetzt, unmittelbar über dem Flüßchen zu hängen schien, das hundert Fuß tiefer in seinem schmalen Bett zwischen großen und kleinen weißgewaschenen Steinen plätschernd und murmelnd nach rechtshin die Ebene suchte. Das Wasser erschien beinahe braun und war doch so klar, daß man die Fischchen deutlich sah, die an tieferen Stellen, kaum sich regend, gegen den Strom standen; oder die Forellen, wenn sie unter einem Stein hervorschossen, um alsbald wieder in ihr Versteck zurückzuschlüpfen. Drüben, wenn auch hier und da die Felswand sichtbar wurde, stieg der Hang mähliger auf, das diesseitige Ufer um ein Bedeutendes überragend, und von unten bis zum obersten Rand dicht mit Busch und Baum bewachsen; die Bäume zumeist Tannen, aber dazwischen auch Buchen, deren helles Grün im Frühjahr sich gar herrlich von dem dunklen Grunde des Nadelholzes abhob.
Warum dieser Platz es mir so angethan, wüßte ich kaum zu sagen. Die breite Terrasse selbst war kahl und wohl ein wenig vernachlässigt; der Estrich des Fußbodens hatte große Lücken, die Stäbe des eisernen Geländers waren zum Teil verbogen, arg vom Rost benagt; dazu bot sie, nach Westen blickend, nur in den früheren Morgenstunden Schatten. Wenn die Sonne darüber hinter den Waldrand getaucht war, wehte es kühl durch die enge Schlucht, atmete es feucht von dem Wasser herauf, und uns dann da aufzuhalten, war streng verboten. Es war nur eine Stimme, die Terrasse sei dazu angethan, die Lebenslustigste melancholisch zu machen, und ganz unbegreiflich, wie gerade ich Gefallen daran finden könne. Ich solle doch nur sagen: welchen? Und was mir durch den Kopf gehe, wenn ich, auf das Geländer gestützt, stundenlang – vorausgesetzt, daß man mich gewähren lasse – hinab in das braune Wasser starre, das heute wie gestern sein eintöniges Lied murmele, oder hinüber auf die grüne Wand, die doch ebenso das Bild der ödesten Monotonie sei?
Ich ließ sie reden und spotten. Für mich hatte das Lied des Wassers unzählige und immer andere Weisen; für mich war der Wald drüben nicht stumm. Er erzählte mir viele, viele Geschichten, die sich darin freilich alle glichen, daß sie keinen Anfang und auch kein Ende hatten.
Sie sagten: ich dichte in jenen Stunden und habe mein Pult voll von Poesieen. Sie irrten sich. Ich habe nie auch nur den Versuch gemacht, niederzuschreiben, was mir da durch den Kopf ging. Ich wußte, es würde ganz vergeblich sein: als wenn man die Wellen auseinanderhalten wollte, welche eine lebhafte Flut an den Strand treibt, oder die Wolken, die vor einem starken Winde her an dem Himmel dahinjagen. Wellen und Wolken – Phantasieen, wie sie ein junges Menschenhirn durchschweben; Ahnungen einer Zukunft mit ihren Möglichkeiten, aus denen niemals Wirklichkeiten werden; wallende, brauende Nebel, die Chaos bleiben und dahinschwinden ins Unendliche, aus dem sie heraufstiegen, es sei denn, daß ein Künstlergenie sie mit seiner Wunderhand ergreift und aus dem quirlenden Urstoff leuchtende Gebilde formt.
Aber diese himmlische Kraft war mir versagt. Was mir faßlich werden sollte, das mußte ich erleben. Und ein Thor, wer von dem Leben verlangt, was ihm einzig nur die Kunst gewähren kann! Das Leben kultiviert mit Vorliebe jenes bekannte fürchterlichste aller Genres; wird es interessant, ist es immer auf Kosten unsrer Nerven; und seine Tragik, wenn es so weit kommt, hat die schlimme Eigenschaft, uns zu zermalmen, ohne uns zu erheben.
Übrigens kamen mir verhältnismäßig selten jene versonnenen, träumerischen Stunden, in denen ich mich aus der Schar der Gefährtinnen zu meinem Lieblingsplätzchen stahl, mit den Wassern, den Bäumen und Wolken geheime Zwiesprach zu pflegen; denn mit der Lebenslustigsten, die der Ort melancholisch machen könne, war niemand anderes als ich selbst gemeint. Ja, die intensivste Lebenslust, das Erbteil meines Vaters, pulste durch meine jungen Adern; blitzte mir – so sagten sie wenigstens – aus den grauen Augen, und suchte sich in tausend übermütigen Streichen Luft zu machen. Ich war in diesem Punkte so berüchtigt, daß man alles, was von der Sorte geleistet wurde, mir auf die Rechnung schrieb: Das hat gewiß wieder Antoinette angestellt! das kann nur Antoinette gethan haben! Und es blieb auf mir sitzen, war ich auch zufällig einmal unbeteiligt, weil ich die seltsame Neigung hatte, über das komische Quiproquo unbändig zu lachen, was natürlich als Eingeständnis der Schuld angesehen wurde. Auch kann mein Übermut, alles in alles, nur ein harmloser gewesen sein, und die Kosten meiner wilden Streiche muß ich, als Regel, getragen haben; es wäre sonst unmöglich gewesen, daß ich bei den älteren, gleichaltrigen und jüngeren Mitschülerinnen gleich beliebt war; bei den Lehrern und den "Schwestern" in gutem Ansehen stand, und selbst die gestrenge chère Maman, wenn sie mich offiziell hatte schelten müssen, mir privatim einen Kuß auf die Stirn drückte und, mir die Wangen streichelnd, lächelnd sagte: du mußt nun aber wirklich anfangen vernünftig zu werden, Antoinette!
Ach, die liebe, die gute chère Maman, die eigentlich, da sie ein altes Fräulein war, auf diesen Titel kein Anrecht hatte und uns allen doch die sorgsamste, beste, liebevollste Mutter war! Wie deutlich ich ihr bleiches Gesicht sehe, das immer noch die Spuren einstiger Schönheit zeigte und in dessen großen braunen Augen das Jugendfeuer nicht erloschen, nur seltsam verklärt war! Unmöglich, in ihrer Gegenwart einen schlimmen Gedanken zu hegen, ein häßliches Wort über die Lippen zu bringen! Sie heiligte alles, was in ihre Nähe kam. Und wirkte einzig nur durch ihre unendliche, sich stets gleiche Güte; denn, was ich eben von ihrem Schelten sagte, so war es kein Eifern, kein Heftig- und Leidenschaftlichwerden, wie bei anderen, nur ein erhöhter Ernst im Ausdruck und im Ton der Stimme – so wenig scheinbar und doch von einer stillen Kraft, gegen die es keinen Widerstand gab.
Und dabei – eine seltenste Vereinigung – hielten ihre Weisheit und Klugheit mit ihrer Güte gleichen Schritt. Wie ihr Blick klar in die Seelen ihrer Zöglinge sah, und sie zum Guten und Schönen zu leiten und zu erheben wußte, hielt sie die ausgedehnte Klosterwirtschaft in musterhafter Ordnung. Das letztere allerdings mit Hilfe der Schwester-Schaffnerin Brigitta, einer höchst resoluten Dame in der Fülle ihrer Kraft mit klarsten graugrünen Augen, die durch die Wände sehen zu können schienen; derben Armen und Händen, die Mannesarbeit spielend verrichteten; einer schallenden Kommandostimme und einem mehr als angedeuteten Bärtchen auf der Oberlippe. Auch sie war trotz ihres barschen Wesens im Grunde eine gute Seele, und wenn sie ihr Lieblingssprichwort "Wer sich grün macht, den fressen die Ziegen", nicht nur gelegentlich herauspolterte, sondern thatsächlich in Ehren hielt, so hatte sie wahrlich dazu ihre gerechtesten Gründe.
Unterstand ihr doch, wie die Außenwirtschaft mit ihren Gärten und Gärtnern, der Molkerei, dem Geflügelhof mit den obligaten Mägden, so die häusliche Ökonomie, in der es für chère Maman, ein halbes Dutzend Schwestern und vierzig bis fünfzig Zöglinge nach allen Seiten hin zu sorgen galt. Und wären wir Mädchen doch noch ungefähr gleichen Alters gewesen! Aber da waren alle Altersstufen vom zehnten bis zum achtzehnten Jahre vertreten. Wie verschieden da die Bedürfnisse, die Ansprüche! Daß trotzdem alles nach dem Schnürchen ging, ist, als ich später selbst einem großen Haushalt vorzustehen hatte, der Gegenstand meines Staunens gewesen. Damals nahm man es freilich als etwas Selbstverständliches hin. Werden wir uns doch fast immer erst nachträglich und zu spät bewußt, daß, was wir wie "Essen und Trinken frei" ansahen, etwas Außerordentliches war, für das sie, die es schufen, das Verdienst, das ihnen nicht angerechnet wurde, das Lob und den Dank, an die niemand dachte, mit in ihr stilles Grab nahmen!
Den Unterricht, mit dem es sehr ernst gehalten wurde, erteilten außer drei von den Schwestern, die als Gelehrte gelten konnten, und einigen jüngeren Lehrerinnen, die, ohne auf die Würde der Schwestern Anspruch zu haben, doch in der Anstalt wohnten, einige Herren von dem Gymnasium der nahe benachbarten Stadt. Ebendaher kamen der katholische und der evangelische Pfarrer, denen unsre Seelen in Sache der Religion anvertraut waren. Es scheint, daß, als nach dem schrecklichen Kriege das Kloster gestiftet wurde, man der Glaubenszänkereien herzlich müde gewesen ist, und die adligen Gründer sich gegenseitig ein Vertrauens- und Versöhnungszeichen geben wollten, als sie festsetzten, daß bei der Aufnahme auf das Glaubensbekenntnis keinerlei Rücksicht genommen werden solle. An dieser Satzung war treulich festgehalten worden, wie oft und wie sehr auch die Gesinnungen der Menschen seit jenen Tagen gewechselt haben mochten, und so waltete auch jetzt hinüber und herüber ein Geist der Duldsamkeit, gewiß nicht ohne Einwirkung der herrlichen chère Maman, die besser als die meisten wußte, daß in dem Hause unsers Vaters viele Wohnungen sind.
Niemand kam diese Duldsamkeit mehr zu gute als mir, aus Gründen, von denen ich später zu sprechen haben werde.
#####
Ich sagte, ich habe mich nie, wie sie es doch rings um mich her thaten, poetisch versucht. Und darüber freue ich mich noch heute. Nichts Kläglicheres als jene Verse, die sie sich gegenseitig in ihre Albums stifteten! Wie oft haben sie meinen Spott wachgerufen: Emilie, das hat Geibel schon mit etwas anderen Worten besser gesagt! – Anna, Goethe ist zwar sehr reich; doch auch die Reichsten darf man nicht so ungeniert bestehlen! –
Hielt ich mich aber auch von dieser Thorheit frei, ohne Tagebuch sollte ich denn doch nicht fortkommen.
Und wie ich jetzt die vergilbten Blätter wieder durchlese, freue ich mich darüber. Sie sind eine große Erleichterung für meine gute Lent, der ich das alles nicht erst in die Feder zu diktieren brauche; und die nun nichts zu thun hat, als sie an dieser Stelle einzuheften. Aber auch mir leisten sie die besten Dienste. Sie rufen mir das Bild des sechzehnjährigen Mädchens wieder viel lebhafter vor die Seele, als es die bloße Erinnerung vermöchte; und so werden sie mir auch für gewisse spätere Episoden die echten Farben auf die Palette bringen.
Die echten Farben! davon bin ich überzeugt. Und ich erinnere mich auch sehr wohl, daß ich mir, bevor ich die Feder zur ersten Seite und zum ersten Wort ansetzte, das heilige Versprechen gab, stets wahr und ehrlich zu sein, im vollen und bewußten Gegensatz zu Adele, die in ihrem Tagebuch – ach! und nicht bloß da! – so greulich flunkerte. Ich glaube bestimmt: es war nur die Empörung über ihre Flunkerei, die mir die Feder in die Hand drückte. Wie könnte ich es anders erklären, daß die erste Eintragung unter dem Datum 24. Mai 1856 nichts enthält, als die Worte:
Nein! wie diese Adele lügen kann!
Es scheint, ich habe vier Wochen gebraucht, mich darüber auszuwundern; denn die nächste ist genau einen Monat später datiert. Inzwischen habe ich mir augenscheinlich klar gemacht, daß ein Tagebuch noch etwas mehr enthalten müsse, als einen Stoßseufzer und ein paar hundert leere goldgeränderte Blätter. Auch hat mich offenbar der Ehrgeiz erfaßt, das Versäumte nachzuholen und es Adelen wenigstens in der Fülle gleich zu thun. Denn jetzt geht es durch eine ganze Reihe von Seiten ununterbrochen munter weiter.
23. Juni.
Das heißt: eigentlich lügt sie nicht, wenn Professor Resber (wie immer) recht hat, der heute in der Stunde sagte: Eigentliche Lüge ist nur, wenn einer mit Bewußtsein die Unwahrheit spricht in der Absicht, sich irgend einen Vorteil zu sichern. Er gab da mehrere Beispiele: es will einer eine Beschämung oder Strafe von sich abwenden und dergleichen. Eine viel schlimmere Lüge sei die, welche darauf ausgeht: einem andern einen Schaden zu bereiten. Die erstere sei noch halb entschuldbar, da sie mit Notwehr identisch (heißt es so?) sei, oder doch sein könne; die zweite sei unter allen Umständen verwerflich und verächtlich.
Nein! dann lügt Adele nicht. Schaden will sie wahrhaftig keinem durch ihre Sentimentalitäten und Großsprechereien; und worin der Vorteil für sie selbst besteht, wenn sie es wieder einmal so weit gebracht hat, daß wir sie gründlich auslachen, vermag ich auch nicht einzusehen.
Carola weinte heute so bitterlich, als wir alle ihre Schwester auslachten. Ich habe mich so geschämt! Natürlich hatte ich am lautesten gelacht.
24. Juni.
Ich liebe Carola. Die andern sagen: sie sei das richtige Gänschen von Buchenau. Das ist nicht wahr. Was sie sagt, ist niemals dumm. Viel Worte kann sie allerdings nicht machen. Aber ist das nötig? Ich rede zum Beispiel entschieden viel zu viel –
Und dann ist sie so sehr schön.
25. Juni.
Carola ist entschieden die schönste von uns allen. Das will etwas sagen. Es sind gewiß ein halbes Dutzend schöne Mädchen hier; aber keine kann sich mit ihr messen. Prof. Resber hat recht (wie immer). Er sagt: sie ist wie ein schönes Lied. Dann fügte er gleich hinzu: eines von Goethe, meine ich. Ich habe ihn gefragt: ob ich nicht Goethe lesen darf? Er schien sich einen Augenblick zu besinnen. Dann sagte er "später".
29. Juni.
Prof. R. gefragt, warum ich so lange auf Goethe warten muß, für den er selbst doch so grenzenlos schwärmt? "Sie sind noch nicht goethereif." – "Was heißt das "goethereif?" – "Das heißt: Goethe ist ein voller, schwerer Wein, den Kinder nicht trinken dürfen." – "Aber ich bin doch kein Kind mehr, Herr Professor!" – "Gewiß nicht. Sie sind sogar über Ihre Jahre hinaus; aber doch nicht so weit, Goethe zu verstehen. Und sich mit Unverstandenem belasten, sich mit Rätseln plagen – ist schon gar nicht Ihre Sache."
Darin hat er wohl nicht recht gehabt. Ich plage mich mit so vielen Rätseln.
Zum Beispiel: warum man einen Menschen lieben muß, wenn er schön ist?
Und ihn nicht lieben kann, wenn er es nicht ist?
Professor R. ist nicht schön.
3. Juli.
Grete Wesselhöfft sagte heute: Carola sei eine Suse. Es fehlte nicht viel, so hätte ich ihr eine Ohrfeige gegeben. Ich klatsche und petze sonst wahrhaftig nicht; aber ich war so empört, daß ich es Professor R. sagen mußte, als wir ihn nach der Schule bis zur äußeren Parkpforte begleiteten und er mich, wie gewöhnlich, an seine Seite gerufen hatte. Er lachte und sagte: Grete ist ein Weltkind. Die schätzen nur die Schlangenklugen. Zu denen freilich gehört Carola nicht. Dafür ist sie denn, Gott sei Dank, keine Anempfinderin. wie ihre Schwester. – Was ist das: Anempfinderin? – Auch ein Goethe'sches Wort. Er hätte auch Nachempfinderin sagen können, insofern diesen Menschen, was sie empfinden sollen, immer erst ein andrer vorempfunden haben muß. Aber Anempfinderin ist doch besser. Das "An" drückt aus, daß, was sie empfinden, ihnen ursprünglich gar nicht eignet; sie es sich nur angeeignet haben. Wie einen fremden Besitz. Auf den sie dann auch mit Sicherheit gar nicht rechnen können. Der ihnen bei der ersten besten Gelegenheit wieder verloren geht. Übrigens sind die Anempfinderinnen und Anempfinder ein sehr zahlreiches Geschlecht. Es giebt so wenige, die aus sich selbst heraus frei und kraftvoll empfinden, gerade so, wie sie selten sind, die aus sich selbst zu denken wagen. Sie gehören zu diesen wenigen. Ich fühlte, daß ich dunkelrot wurde, als er mir das sagte; aber, ich glaube, nicht, weil er es sagte, als weil er mich mit einem so sonderbaren Blick dabei ansah. Er hat ja auch in der Stunde, wenn er vorträgt und dabei in Feuer gerät, so glänzende Augen. Aber in dem Blick war noch etwas anderes. Ich weiß nicht, was.
6. Juli.
Ich weiß es nach zwei Tagen noch immer nicht.
9. Juli.
Und er sagt: ich sei nicht von denen, die sich mit Rätseln plagen!
10. Juli.
Ich habe es jetzt bei chère Maman durchgesetzt, daß ich mit Adele und Carola ein Zimmer bewohne, in dem wir auch schlafen. Um Adele war es mir wahrhaftig nicht zu thun; ich konnte Carola nur nicht ohne sie haben. Wie nur zwei Schwestern so verschieden sein können! Aber ich bin meiner Schwester auch nicht ähnlich, weder äußerlich, noch, glaube ich, innerlich. Wissen kann ich es nicht. Ich habe sie jetzt seit 6 Jahren nicht gesehen. Aus den paar Briefen, die sie mir geschrieben, kann ich nichts schließen. Höchstens, daß sie mit der Orthographie noch immer über den Fuß gespannt ist. Auch kommt es ihr nicht darauf an, "das" anstatt "daß" zu schreiben. Und umgekehrt. Aber Professor R. sagt: Goethe habe bis zu seinem Lebensende nicht orthographisch schreiben können.
Übrigens ist Professor R. seit unsrem Gespräch über "Anempfinden" u. s. w. recht sonderbar zu mir. Er hat mich seitdem nicht wieder an seine Seite gerufen, wohl aber Grete Wesselhöfft schon ein paarmal. Das Weltkind! Nun, wenn sie ihm lieber ist, als ich – meinetwegen! Ich war schon nahe daran, für ihn zu schwärmen, wie die anderen alle. Jetzt habe ich mich schon wiederholt gefragt, ob er nicht auch so etwas von einem Anempfinder hat? ob wohl alles bei ihm echt ist?
Ich mache mir darüber bittere Vorwürfe; aber ich kann mir nicht helfen. Ich glaube nicht, daß ich boshaft bin; aber ich kann doch meine Augen nicht zumachen, wenn ich bei den Menschen etwas bemerke, was mir nicht gefällt. Aber daß ich das nicht für mich behalte, das ist dumm. Ich muß auch gegen Adele vorsichtiger sein und sie nicht so arg verspotten. Sie merkt freilich den ärgsten Spott nicht, oder doch kaum: sie ist zu eingenommen von sich. Aber Carola thut es weh. Und Carola weh thun! Pfui!
12. Juli.
Wir haben uns unsre Familienverhältnisse mitgeteilt: daß ich keine Verwandten habe außer dem Bruder meines Vaters, der in D. das Regiment kommandiert, und bei dem meine einzige Schwester seit dem Tode unsers Vaters ist. Sie sind Waisen, wie wir; Verwandte haben sie nur ganz entfernte, die sie nicht einmal kennen. Der Vater war auch Offizier; hat es aber nur bis zum Major gebracht. Daß er da schon den Abschied bekam, hat er nicht verwinden können. Er ist ein paar Jahre darauf gestorben; die Mutter, die ihn sehr geliebt hat, fast unmittelbar hinter ihm her. Ich möchte fast glauben, sie hat sich das Leben genommen. Jedenfalls eine traurige Geschichte. Vermögen haben sie gar nicht; und hätten sie nicht, wie ich, beide eine Freistelle hier, wüßten sie nicht wohin. Dabei sind die Reckebergs ein noch älteres Geschlecht, als selbst wir Kesselbrooks, und haben hier zu Lande und am Rhein viele Schlösser gehabt, deren Ruinen noch heute bewundert werden. Ach, wie gut kann ich mir Carola denken, als ein solches Schloßfräulein: wie sie auf dem Söller steht und den Fluß hinauf- und hinabblickt, wo alle Städtchen und Dörfer den Reckebergs gehören; oder aus dem Schloßthor reitet auf einem weißen Zelter (ihr Vater hat ihn von dem Kreuzzuge mit Gottfried von Bouillon aus Palästina mitgebracht), den Falken auf der rechten Hand, neben sich den Pagen, der sie aus großen blauen Augen anschmachtet. Ich wollte, ich wäre der Page gewesen und hätte für sie sterben können in dem Kampfe mit dem jungen Raugraf, der die Jagdgesellschaft überfällt mit seinen Mannen, die fliehen, als der Graf von dem Pagen erschlagen ist. Braucht er dann, als er, an seinen frischen Wunden verblutend, in ihren Armen stirbt, ihr zu sagen, daß er sie immer geliebt habe?
An demselben Tage, abends.
Wenn ich mir diese Geschichte nicht anempfunden habe, weiß ich nicht, was Anempfinderei ist! (Siehe Uhland!)
15. Juli.
Die dumme Geschichte geht mir doch noch immer durch den Kopf. In den Pagen, der das Schloßfräulein liebt, habe ich mich so hineingedacht, daß ich manchmal meine, ich sei gar nicht ein Mädchen, sondern ein Knabe. Jedenfalls möchte ich, ich wäre einer. Ich könnte ja Carola nicht mehr lieben, als ich es jetzt schon thue; aber ich könnte später, wenn wir aus dem Kloster sind, und sie dann niemand hat, der sich ihrer annimmt, für sie sorgen, für sie arbeiten, sie beschützen. Wie herrlich wäre das! Jetzt – ach, wer doch ein Mann wäre! Nicht bloß um Carolas willen: auch für mich selbst. Es ist doch schrecklich, daß wir Mädchen alle Augenblicke etwas nicht thun dürfen, was man doch den Knaben ohne weiteres verstattet. Professor R. sagt: seine Schüler in der Sekunda, die auch nicht älter sind, als ich, dürfen in Goethe lesen, soviel sie wollen. Warum kriegen wir in der Litteraturstunde nur immer kleine Bruchstücke aus Faust und Tasso und Iphigenie zu hören? Und so ist es in allem. Ich weiß. ich könnte ebenso gut Latein und Griechisch, Mathematik und all das lernen, wie die Knaben. Professor R. sagt das selbst. Und wenn ich ihm klage, zuckt er die Achseln und sagt: Ja, ja, liebe Antoinette, Sie haben recht. Es ist ein altes Lied. Schon Goethe läßt seine Iphigenie sagen: "Der Frauen Schicksal ist beklagenswert." – Ich: Und das soll nie anders werden, Herr Professor? – Er will wieder die Achseln zucken. Dann aber flammt es in seinen Augen auf: Ja, ja, es wird anders werden. Die Sklaverei, in der man euch hält, wird ein Ende nehmen. Auch ihr werdet freie Menschen werden; eure Kräfte gebrauchen, euch ausleben dürfen; und nicht, wie Iphigenie ewig das Land der Griechen mit der Seele suchen.
Ich war so begeistert von dem, was er sagte, und wie er es sagte: daß ich nach seiner Hand griff und sie küssen wollte. Er zog sie mit einem Ruck aus meiner und sagte ärgerlich, ja wütend: Wenn Sie das noch einmal versuchen, sind wir auf ewig geschiedene Leute!
Ich mochte wohl sehr erschrocken und bestürzt ausgesehen haben, denn er sagte: Nun, nun! Sie brauchen das nicht tragisch zu nehmen. Es verstieß nur zu sehr gegen das, was ich das Ritterliche in mir nenne.
Ist es nicht schrecklich, daß ich, trotzdem mir noch die Thränen in den Augen standen, beinahe laut aufgelacht hätte! Professor R. und ein Ritter! Die stelle ich mir anders vor. Wie meinen Vater. Das war ein Ritter!
20. Juli.
Während ich ein Mann sein möchte, schwärmt Adele für das "Ewig Weibliche". Natürlich hat sie das nicht aus sich selbst. Es ist Schwester Ambrosias drittes Wort. Ich kann Schwester A. nicht leiden. Wir haben bei ihr Handarbeitsstunden! That speaks volumes! Aber sie ist auch eine Anempfinderin. Ich höre es förmlich, wie, was sie sagt, nicht aus ihr selbst kommt, sondern sie es Gott weiß wem nachplappert. Es hat alles so gar kein cachet. Für sie ist die "Häuslichkeit" Trumpf. – Liebe Kinder, ihr gehört ins Haus! Jetzt und in alle Zukunft. In der Häuslichkeit findet ihr euer Glück; draußen seid ihr verloren – So geht das endlos weiter. Ich muß es Adele lassen: ein bißchen höher will sie doch hinaus. Sie bleibt bei Schwester Ambrosias Häuslichkeit, meint aber: es komme ganz darauf an, wie die beschaffen sei. Darüber hat sie gestern Abend Carola und mir im Park, als wir, wie schon oft, uns von den andern entfernt hatten, ordentlich einen Vortrag gehalten: die Häuslichkeit müsse natürlich ein schönes großes Schloß sein mit prächtigen Gärten ringsum, in denen Springbrunnen plätscherten; und vielen Dienern in seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen; und Wagen und Pferden in den Remisen und Ställen – was sie alles ganz hübsch schilderte. Das kann sie; bloß daß ich glaube, sie hatte es irgendwo gelesen. Zuletzt stieg sie sogar auf die halbrunde steinerne Bank, die da vor dem Obelisk mit der Inschrift steht, die keiner mehr entziffern kann, und nun kam die Hauptsache: wir sollten schwören, daß wir künftig in einem solchen Schlosse hausen wollten. Wir seien das unsern Ahnen schuldig, deren Andenken wir nur auf diese Weise ehren könnten. – Carola war ganz gerührt. Ich mußte natürlich wieder einmal lachen und sagte: Schön, Adele! nun sei auch noch so gut und sage uns, wie wir das anfangen sollen? Sie sprang von der Bank herunter und flüsterte mir ins Ohr (mit einem Blick auf Carola, die sich die Augen trocknete): Das sage ich dir später einmal.
Nun bin ich neugierig, was jetzt kommen wird.
21. Juli.
Adele ist wirklich eine gewöhnliche Seele. Als ich sie heute frage: Also wie? antwortet sie: das ist doch ganz einfach: wir müssen sehr, sehr reiche Männer heiraten. Natürlich von Adel, wie wir. – Ist das deine ganze Weisheit? – Was sonst? –
Ich ließ sie stehen. Ich war empört. Einen Mann heiraten, bloß, weil er sehr reich ist!
Was Liebe ist, scheint sie nicht zu wissen.
Als ob ich es wüßte!
Nur, was ich lieben soll, muß schön sein. Ich kann die Männer nicht schön finden. Außer Vater. Er war schön.
25. Juli.
Bin ich nicht doch eine Nach- oder Anempfinderin? Heut nacht im Traum war ich in dem schönen Schloß, von dem Adele am vorigen Sonnabend phantasiert hatte. Ich ging aus einem prachtvollen Saal in den andern: Marmorwände, goldne Tische, Spiegel von der Decke bis auf den Fußboden, wie ich es im Leben noch nie gesehen habe, so daß ich gar nicht weiß, woher mir das alles gekommen ist. Dann trat ich durch eine hohe Thür auf eine große Terrasse, die mit einem rotseidenen Zeltdach überspannt war und auf deren Ballustrade große marmorne Vasen standen, aus denen herrliche Blumen aufschossen und herabhingen. Ich schritt an die Ballustrade heran. Da lag vor mir ein herrlicher Garten: Blumenbeete, Rasenplätze, Springbrunnen, Teiche, auf denen silberne Schwäne schwammen. Es war ganz übernatürlich schön. Ich rief ein paarmal Carola, weil ich wollte, daß sie auch all die Pracht sehen sollte. Aber sie kam nicht. Da hörte ich hinter mir ein Geräusch; das heißt: ein Geräusch hörte ich wohl nicht; ich wußte nur, daß jemand hinter mir herkam. Ich wandte mich. Da trat aus dem Saal ein Offizier, den ich erst für meinen Vater hielt. Als er näher kam, sah ich, es war nicht mein Vater; aber auch in seiner Weise schön mit einem so lieben Lächeln in den Augen, daß ich gar keine Furcht hatte und mich auch weiter nicht verwunderte, als hätte ich ihn schon Jahre lang gekannt, trotzdem ich ganz gut wußte: ich hatte ihn nie vorher gesehen. Er stellte sich mir auch nicht vor, wie es doch Offiziere thun (sie stellten sich mir schon vor, als ich neun Jahre war), sondern lehnte sich neben mir an die Ballustrade. – Ist das nicht schön? sagte ich. – Wunderschön, antwortete er, blickte dabei aber nicht in den Garten, sondern auf mich. – Das verdroß mich, und ich sagte: so etwas sieht man sich doch ordentlich an. – Ach, mein gnädiges Fräulein, das kenne ich schon lange. – Es gehört also Ihnen?– Nein, mein gnädiges Fräulein. – Mir auch nicht. – Das weiß ich. – Wie kommen wir dann beide hierher? – Im Traum, gnädiges Fräulein, wie sonst? – Das ist aber schade. – Jammerschade.
Wie er das sagte, zuckte es in seinem Gesicht, und während er mich immerfort ansah, liefen ihm große Thränen aus den Augen. Da mußte ich auch weinen und bin vor Herzeleid aufgewacht, schluchzend, wenn ich auch die Thränen, die mir stromweis über die Backen liefen, nur geträumt hatte.
#####
Hier findet sich eine Lücke von mehreren Monaten in meinem Tagebuch, und ich erinnere mich sehr genau, wie sie entstanden ist.
Mit mir war eine seltsame Veränderung vorgegangen. Aus dem übermütigen Mädchen, das zu jeder Extravaganz bereit war und ihre Zunge nicht im Zaume halten konnte, war eine scheue, schweigsame Träumerin geworden, die nur noch dann und wann in ihre früheren Gewohnheiten zurückfiel. Und die Ursache? Der seltsame, überaus lebhafte Traum hatte es mir angethan. Ich glaubte jetzt zu wissen, wovon ich vorher kaum eine dämmernde Ahnung gehabt, worüber ich so grausam gespottet; glaubte zu wissen, was Liebe sei: die Liebe des Mädchens, des Weibes zum Manne. Ich liebte meine Traumgestalt: den jungen, schönen Offizier, der mich so innig angeblickt und dann so bitterlich geweint hatte. Er war mir sogar ein paarmal im Traum erschienen, nicht so deutlich, wie das erste Mal; aber ich konnte nicht zweifeln, daß er es war. Ich schämte mich dieser Träume – besonders nachdem mich das Traumbild (oder ich das Traumbild) auf den Mund geküßt hatte, und mochte es meinem Tagebuch nicht anvertrauen, das ich von jetzt noch sorgsamer als vorher in mein Pult schloß. Was mich noch befangener machte, war, daß unter meiner Traumliebe die Liebe zu Carola offenbar gelitten hatte. Ja, ich fand sie nicht einmal mehr so schön; und wenn ich ihr auch noch immer bereitwillig ihre französischen und englischen Arbeiten korrigierte, hielt ich nicht mehr, wie früher, für selbstverständlich: ein schönes Mädchen habe das Recht, so viele Fehler zu machen, wie sie wolle.
Auch Adele war in meiner Achtung nicht gestiegen, trotzdem Professor R. in der Selekta (zu der wir jetzt avanciert waren) ihre deutschen Aufsätze für die besten erklärt hatte. Eine oder die andere fasse wohl das Thema tiefer und wisse ihm originellere Seiten abzugewinnen; aber Adele übertreffe uns alle an Sprachgewandtheit und Formtalent, wenn auch ihr Stil überall auf sein Muster zurückweise. Da dies Muster aber Goethes Prosa seiner besten Zeit sei – das heiße: das beste Deutsch, das je geschrieben – habe er nicht den Mut, sie deswegen zu tadeln. Könne man ein Ganzes nicht werden – und wie wenige könnten das! – so sei das zweitbeste, sich an ein Ganzes anschließen.
Wir durften jetzt in der Selekta – an der auch sechs junge Mädchen aus der Stadt teilnahmen, so daß wir im ganzen zwölf waren – Goethe lesen; aber von dieser Erlaubnis, deren Erfüllung so lange mein sehnlicher Wunsch gewesen, hatte ich nicht viel. Professor R.'s Urteil über unsere Aufsätze hatte mir den größten Dichter so gründlich verleidet, daß ich Jahre gebraucht habe, bis ich den rechten Weg zu ihm fand. Wie denn der geistreiche Mann, der so hinreißend zu sprechen verstand, nicht weniger Unheil als Heil in unsern Köpfen anrichtete. Sein Geist war kein stetig leuchtendes Licht, sondern ein Flackerfeuer, das jetzt jäh aufflammte, dann wieder zusammensank und den, der ihm gefolgt war, im Dunkeln ließ, oder – noch schlimmer – durch zweifelhaften Schein täuschte und in die Irre führte. So hat er wohl sicher Adele auf dem Gewissen, die nur durch ihn und sein übertriebenes Lob, das von ihm gar nicht einmal ernstlich gemeint war, zu ihrer Goethe-Manie gekommen ist, um sich jetzt in den Augen aller Vernünftigen lächerlich zu machen.
Doch das sind nachträgliche Einsichten, die das siebzehnjährige Mädchen nicht haben konnte. Aber ein dunkles Gefühl der Mängel, die diesem außerordentlichen Menschen anhafteten, war doch in mir aufgestiegen und trübte die reine Verehrung, mit der ich früher zu ihm aufgeschaut hatte. Und wie denn in jungen Seelen eine Empfindung niemals das rechte Maß hält, sondern nicht ruht, bis sie sich selbst zu ihrem Extrem gesteigert hat, verwandelte sich schnell genug die frühere Liebe in etwas, das, wenn es nicht Haß war, sich hinreichend gehässig darstellte. Wie ich ihm früher bei seinen kühnen Gedankenflügen willig und bewundernd folgte, wehrte ich mich jetzt trotzig gegen die Verlockung. Und dabei blieb es nicht: es wühlte und kochte in mir, ihm offen zu opponieren, manchmal leidenschaftlich, dann wieder – was ihn noch tiefer kränkte – mit kühler Ruhe und kaum, oder gar nicht verhüllter Ironie. Und eine unschöne Triumphesfreude verhüllte mich, wenn sich – zum Entsetzen der Mitschülerinnen – auswies, daß ich schlagfertiger war, als er; ihm Widersprüche, in die er sich verwickelt hatte, nachwies, den Mangel seiner Logik aufdeckte, und ihn zwang, ein Gefecht abzubrechen, in welchem er unzweifelhaft den kürzeren gezogen. Ich hatte mich dann zu schämen, wenn er das offen anerkannte, ohne sich das Weh, das er doch so tief empfand, merken zu lassen. Nur daß er in solchen Momenten, nachdem er eine kurze Minute, vor sich niederblickend, regungslos dagestanden, die großen Augen zu mir aufschlug mit einem Ausdruck, den ich mir erst deuten konnte, als es für mich und ihn zu spät war.
Ich habe hier lange Seiten meines Tagebuches inhaltlich zusammengefaßt, um schneller zu einer Episode zu gelangen, die, wie sie mir den ersten Einblick in das wirkliche Leben bot, auch sonst in mehr als einer Beziehung meine Zukunft beeinflußt hat.
Man hatte eben in unserm Institut mit allerlei hübschen Scherzen und Gedichten (unter denen sich ein sehr schönes von Prof. R. befand) meinen siebzehnten Geburtstag gefeiert, als ich durch die Nachricht überrascht wurde, daß meine Schwester Lida in Begriff sei, sich zu verloben, und man hoffe, ich werde die Erlaubnis erhalten, bei der Feier gegenwärtig zu sein. Nun wurde freilich eine solche Erlaubnis nur in ganz außerordentlichen Fällen erteilt, und chère Maman, in so großer Gunst ich auch bei ihr stand, hatte anfangs entschieden Nein gesagt, ließ sich dann aber doch erbitten unter der Bedingung, daß ich von einer Vertrauensperson, die niemand geringeres als der Onkel oder die Tante selbst sein dürfe, abgeholt und ebenso wieder zurückeskortiert werde. Vielleicht hatte sie gehofft, die Betreffenden würden sich zu diesem Opfer nicht bereit finden; aber fast umgehend kam die Antwort: man habe das von vornherein für selbstverständlich gehalten, und so werde sich Tante Anna die Ehre geben, am nächsten Sonnabend chère Maman aufzuwarten, um aus ihren teuren Händen die liebe Nichte in Empfang zu nehmen.
Wirklich kam die Tante an dem festgesetzten Tage; blieb über Sonntag im Kloster; ließ sich die Einrichtungen zeigen; fand alles bewunderungswürdig; erklärte, daß mich und alle Mitzöglinge ein beneidenswertes Los getroffen; vergaß in ihrem Enthusiasmus über die "wahrhaft patriarchalische Gastlichkeit" beim Abschied den Leuten ein Trinkgeld zu geben; und am Montag Morgen saßen wir in einem Waggon zweiter Klasse der Zweigbahn, die uns in einer Stunde auf die Hauptbahn brachte. Am Abend waren wir zu D . . . f am Rhein.
Hier nun will ich wieder mein Tagebuch sprechen lassen. Es bringt mir in seiner Naivetät das Bild jener Tage deutlicher zurück, als es die Erinnerung vermöchte.
#####
D . . . f, 5. Okt.
Ich hatte mir die Reise – meine erste große – schöner und amüsanter gedacht. Daß sie nicht besser ausgefallen, ist wohl hauptsächlich Tantes Schuld, die nur für die kurze Strecke der Zweigbahn und die letzte Station vor D . . . f Billets zweiter Klasse genommen hatte, während wir die ganze übrige Zeit dritter fuhren. Als ich sie fragte, warum? erklärte sie: bei der Abfahrt und Ankunft werde man beobachtet; dem müsse man Rechnung tragen. Unterwegs kümmre sich kein Mensch um einen; und das schöne Geld für nichts und wieder nichts zum Fenster hinauswerfen, sei sündhaft. Ich kann nicht finden, daß es für nichts und wieder nichts ist, wenn man für etwas mehr bequeme Plätze in einem reinlichen Wagen hat, anstatt in einem Holzkasten mit zwanzig Menschen eingesperrt zu sein, die gräßlichen Tabak rauchen, sich unvernünftig laut unterhalten, von dem Kindergeschrei und anderen Unannehmlichkeiten gar nicht zu sprechen.