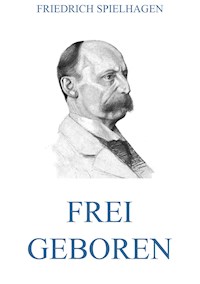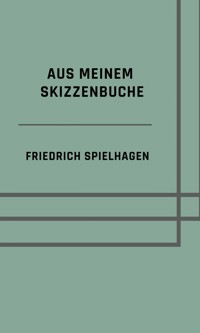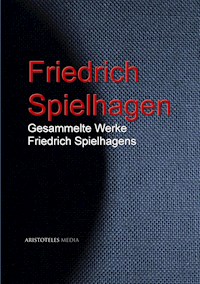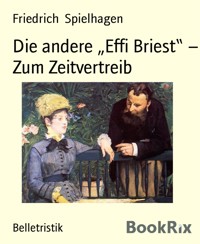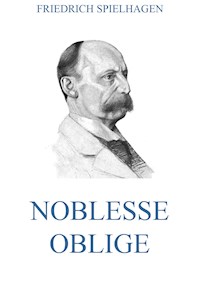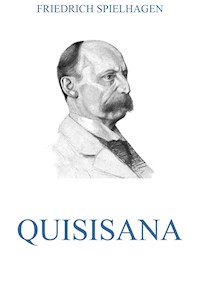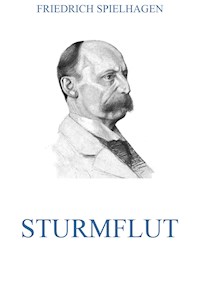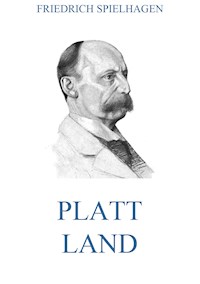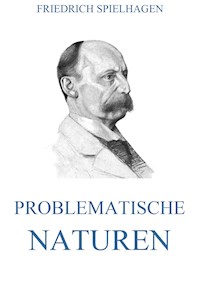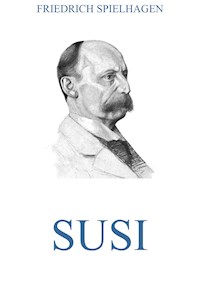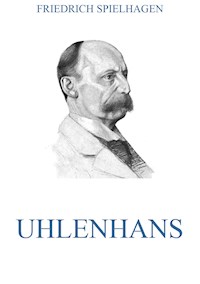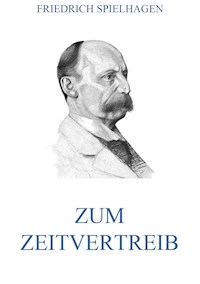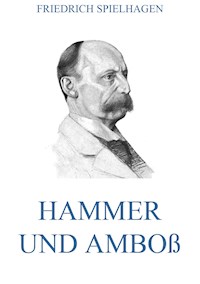
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Entwicklungsroman in fünf Büchern angesiedelt in der Gegend von Schwerin. Der junge Georg Hartwig wird vom eigenen Vater verstossen und vom wilden Schmuggler Malte aufgenommen und erzogen. Nach einer Schmuggelfahrt muss Georg ins Gefängnis, wo er viele Jahre verbringt und dabei auch seine große Liebe findet ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1370
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hammer und Amboß
Friedrich Spielhagen
Inhalt:
Friedrich Spielhagen – Biografie und Bibliografie
Hammer und Amboß
Erster Theil
Erstes Capitel.
Zweites Capitel.
Drittes Capitel.
Viertes Capitel.
Fünftes Capitel.
Sechstes Capitel.
Siebentes Capitel.
Achtes Capitel.
Neuntes Capitel.
Zehntes Capitel.
Elftes Capitel.
Zwölftes Capitel.
Dreizehntes Capitel.
Vierzehntes Capitel.
Fünfzehntes Capitel.
Sechszehntes Capitel.
Siebzehntes Capitel.
Achtzehntes Capitel.
Neunzehntes Capitel.
Zwanzigstes Capitel.
Einundzwanzigstes Capitel.
Zweiundzwanzigstes Capitel.
Dreiundzwanzigstes Capitel.
Vierundzwanzigstes Capitel.
Fünfundzwanzigstes Capitel.
Sechsundzwanzigstes Capitel.
Siebenundzwanzigstes Capitel.
Achtundzwanzigstes Capitel.
Neunundzwanzigstes Capitel.
Dreißigstes Capitel.
Einunddreißigstes Capitel.
Zweiunddreißigstes Capitel.
Dreiunddreißigstes Capitel.
Vierunddreißigstes Capitel.
Fünfunddreißigstes Capitel.
Sechsunddreißigstes Capitel.
Zweiter Theil
Erstes Capitel.
Zweites Capitel.
Drittes Capitel.
Viertes Capitel.
Fünftes Capitel.
Sechstes Capitel.
Siebentes Capitel.
Achtes Capitel.
Neuntes Capitel.
Zehntes Capitel.
Elftes Capitel.
Zwölftes Capitel.
Dreizehntes Capitel.
Vierzehntes Capitel.
Fünfzehntes Capitel.
Sechszehntes Capitel.
Siebenzehntes Capitel.
Achtzehntes Capitel.
Neunzehntes Capitel.
Zwanzigstes Capitel.
Einundzwanzigstes Capitel.
Zweiundzwanzigstes Capitel.
Dreiundzwanzigstes Capitel.
Vierundzwanzigstes Capitel.
Fünfundzwanzigstes Capitel.
Sechsundzwanzigstes Capitel.
Siebenundzwanzigstes Capitel.
Achtundzwanzigstes Capitel.
Neunundzwanzigstes Capitel.
Dreißigstes Capitel.
Einunddreißigstes Capitel.
Zweiunddreißigstes Capitel.
Dreiunddreißigstes Capitel.
Hammer und Amboß, F. Spielhagen
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849636388
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Spielhagen – Biografie und Bibliografie
Romanschriftsteller, geb. 24. Febr. 1829 in Magdeburg als Sohn eines preußischen Regierungsrates, verbrachte sein Jugend in Stralsund (ein großer Teil seiner spätern Romane spielt an diesem Teile der Ostseeküste und auf der Insel Rügen), absolvierte hier das Gymnasium, studierte von 1847 an anfangs die Rechte, dann Philologie und Philosophie in Berlin, Bonn und Greifswald, war einige Zeit als Lehrer tätig, widmete sich aber bald ausschließlich der Literatur. Neben Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen, von denen wir die »Amerikanischen Gedichte« (Leipz. 1856, 3. Aufl. 1871) nennen, veröffentlichte er schon in Leipzig die Novelle »Klara Vere« (Hannov. 1857) und das Idyll »Auf der Düne« (das. 1858), die jedoch nur geringe Beachtung fanden. Eine um so glänzendere Aufnahme fand der erste größere Roman Spielhagens: »Problematische Naturen« (Berl. 1860, 4 Bde.; 22. Aufl., Leipz. 1900), mit seiner abschließenden Fortsetzung: »Durch Nacht zum Licht« (Berl. 1861, 4 Bde.). Dieser Roman gehörte durch Lebendigkeit des Kolorits und eine in den meisten Partien künstlerisch ansprechende Darstellung zu den besten deutschen Romanen seiner Zeit. S. war inzwischen 1859 von Leipzig nach Hannover und Ende 1862 nach Berlin übergesiedelt, wo er kurze Zeit die »Deutsche Wochenschrift« und das Dunckersche »Sonntagsblatt« redigierte. Auch von der Herausgabe von Westermanns »Illustrierten deutschen Monatsheften«, die er 1878 übernommen, trat er 1884 wieder zurück. Sein zweiter großer Roman: »Die von Hohenstein« (Berl. 1863, 4 Bde.), der die revolutionäre Bewegung von 1848 zum Hintergrund hatte, eröffnete eine Reihe von Romanen, welche die Bewegungen der Zeit zu spiegeln unternahmen. War hierdurch ein gewisses Übergewicht des tendenziösen Elements gegenüber dem poetischen unvermeidlich, und standen die Romane: »In Reih' und Glied« (Berl. 1866, 5 Bde.) und »Allzeit voran!« (das. 1872, 3 Bde.) wie die Novelle »Ultimo« (Leipz. 1873) allzu stark unter der Herrschaft momentan in der preußischen Hauptstadt herrschender Interessen, so erwiesen andre freiere Schöpfungen den Gehalt, die Lebensfülle und die künstlerische Gewandtheit des Verfassers. Neben der Novelle »In der zwölften Stunde« (Berl. 1862), den unbedeutendern: »Röschen vom Hofe« (Leipz. 1864), »Unter Tannen« (Berl. 1867), »Die Dorfkokette« (Schwerin 1868), »Deutsche Pioniere« (Berl. 1870), »Das Skelett im Hause« (Leipz. 1878) und den Reiseskizzen: »Von Neapel bis Syrakus« (das. 1878) schuf S., unabhängiger von den momentanen Tagesereignissen oder sie nur in ihren großen, allgemein empfundenen Wirkungen auf das deutsche Leben darstellend, die Romane: »Hammer und Amboß« (Schwer. 1868, 5 Bde.), »Was die Schwalbe sang« (Leipz. 1872, 2 Bde.) und »Sturmflut« (das. 1876, 3 Bde.), ein Werk, worin der Dichter, besonders im ersten und letzten Teile, auf der vollen Höhe seiner Darstellungskunst steht, und worin er in glücklicher Symbolik das Elementarereignis der Ostseesturmflut mit der wirtschaftlichen Sturmflut 1873 im Zusammenhange erzählt; den Roman »Platt Land« (das. 1878, 3 Bde.), die seine, nur etwas allzusehr zugespitzte Novelle »Quisisana« (das. 1879) sowie die Romane: »Angela« (das. 1881, 2 Bde.), »Uhlenhans« (das. 1884, 2 Bde.), »An der Heilquelle« (das. 1885), »Was will das werden« (das. 1886, 3 Bde.), »Noblesse oblige« (das. 1888), »Ein neuer Pharao« (das. 1889), »Sonntagskind« (das. 1893, 3 Bde.), »Susi« (Stuttg. 1895), »Zum Zeitvertreib« (Leipz. 1897), »Faustulus« (das. 1898), »Opfer« (das. 1900), »Frei geboren« (das. 1900), »Stumme des Himmels« (1903). Eine Abnahme der dichterischen Kraft Spielhagens ist seit der »Sturmflut« nicht zu verkennen; seine Darstellungsweise geriet immer mehr in den Stil des in sich selbst eingesponnenen Reflektierens, statt des einfach konkreten Gestaltens. Auch kam S. über den Standpunkt des liberalen Achtundvierzigers und des Liberalen aus der Konfliktszeit nicht mehr recht hinaus, und der große Meister der Zeitschilderung verstand nicht mehr den »neuen Pharao«. Nur in den kleinern Werken: »Deutsche Pioniere« und »Noblesse oblige«, streifte S. vorübergehend das Gebiet des historischen Romans. Mit dem nach einer eignen Novelle (Berl. 1868) bearbeiteten und an mehreren Theatern erfolgreich aufgeführten Schauspiel »Hans und Grete« (das. 1876) wendete er sich auch der Bühne zu. Größern Erfolg hatte das Schauspiel »Liebe für Liebe« (Leipz. 1875), in dem die Kritik neben novellistischen Episoden einen wahrhaft dramatischen Kern anerkannte. Außerdem brachte er die Schauspiele: »Gerettet« (Leipz. 1884), »Die Philosophin« (das. 1887) und »In eiserner Zeit«, Trauerspiel (das. 1891). Von S. erschienen ferner: »Vermischte Schriften« (Berl. 1863–68, 2 Bde.), »Aus meinem Skizzenbuch« (Leipz. 1874), »Skizzen, Geschichten und Gedichte« (das. 1881), »Beiträge zur Theorie und Technik des Romans« (das. 1883), »Aus meiner Studienmappe« (Berl. 1891), »Neue Beiträge zur Theorie und Technik der Epik und Dramatik« (Leipz. 1898), »Am Wege«, vermischte Schriften (das. 1903) und eine Sammlung seiner formschönen »Gedichte« (das. 1892) und »Neuen Gedichte« (das. 1899). Die letzte Ausgabe seiner »Sämtlichen Romane«, die alle zahlreiche Auflagen erlebten, erschien in 29 Bänden (Leipz. 1896 ff.). S. schrieb auch seine Selbstbiographie: »Finder und Erfinder, Erinnerungen aus meinem Leben« (Leipz. 1890, 2 Bde.), die aber wesentlich nur die innere und äußere Entstehungsgeschichte seiner »Problematischen Naturen« erzählt. Vgl. Karpeles, Friedrich S. (Leipz. 1889), und die Festschrift zu Spielhagens 70. Geburtstag: »Friedrich S.« (das. 1899).
Hammer und Amboß
Erster Theil
Erstes Capitel.
Wir standen in der tiefen Nische an einem offenen Fenster unseres Classenzimmers. In dem klösterlich stillen Schulhof lärmten die Spatzen, und einzelne Strahlen der Spätsommersonne glitten an den altersgrauen Mauern herab auf das grasumsponnene Pflaster; aus dem hohen, sonnelosen, mit der abgestandenen Luft einer ganzen Schulwoche erfüllten Zimmer tönte das Summen der leisen Zwiegespräche unserer Mitschüler, die, außer uns, bereits sämmtlich auf ihren Plätzen über ihren Sophokles gebeugt saßen und des Kommens des »Alten« harrten, das jeden Augenblick erfolgen konnte, denn das akademische Viertel war bereits verflossen.
»Im schlimmsten Falle brennst Du durch,« sagte ich, als jetzt die Thür aufging und er hereintrat.
Er – der Professor Doctor Lederer, Director des Gymnasiums und zugleich Ordinarius unserer Prima – in dem Schüler-Rothwelsch »der Alte« genannt – war eigentlich nicht gerade alt, sondern ein Mann in der zweiten Hälfte der Vierziger, dessen kleiner, bereits ergrauender Kopf auf einer steifen schneeweißen Halsbinde ruhte, und dessen sehr langer und wunderbar dürrer Leib Jahr aus Jahr ein, Sommer und Winter in einen Rock von feinstem glänzend schwarzen Tuch geknöpft war. Seine schlanken, äußerst sorgfältig gepflegten Hände mit den langen, spitzigen Fingern waren, wenn sie sich – was häufiger vorkam – dicht vor meinen Augen in nervöser Erregung hin- und herbewegten, stets der Gegenstand meiner bewundernden Aufmerksamkeit gewesen – ein paar Mal war ich der Versuchung kaum entgangen, plötzlich zuzufassen und dies Kunstwerk von einer Hand in einer meiner groben braunen Fäuste zu zerquetschen.
Professor Lederer legte den Weg von der Thür bis zum Katheder stets in zwölf gleichmäßigen, unendlich würdevollen Schritten zurück, Haupt und Augen ein wenig gesenkt, mit der strengen Miene concentrirtesten Nachdenkens, anzuschauen wie ein Opferpriester, der auf den Altar zuschreitet, oder auch wie Cäsar, der in den Senat geht, auf jeden Fall wie ein Wesen, das, weit entrückt der modernen plebejischen Sphäre, Tag für Tag in dem Lichte der Sonne Homer's wandelt und sich dieses wunderbaren Factums vollkommen bewußt ist. Deshalb war es auch nicht wohlgethan, den classischen Mann auf diesem kurzen Wege aufzuhalten; eine abwehrende Handbewegung war in den meisten Fällen die ganze Antwort; aber der sanguinische Arthur war so sicher, mit seinem Gesuche nicht abgewiesen zu werden, daß es ihm auf eine Chance mehr gegen ihn nicht eben ankam. So vertrat er denn dem Professor den Weg und brachte seine Bitte vor, von den Stunden des heutigen Tages – es war ein Sonnabend – dispensirt zu werden.
»Nimmermehr!« sagte der Professor.
»Behufs einer Vergnügungsfahrt,« sprach Arthur weiter, durch den grollenden Ton des gestrengen Mannes keineswegs eingeschüchtert – er war sehr schwer einzuschüchtern, mein Freund Arthur – »behufs einer Vergnügungsfahrt auf dem Dampfschiffe meines Onkels zur Exploration der Austernbänke, die mein Onkel vor zwei Jahren angelegt hat, wissen Sie, Herr Professor, ich habe auch ein Gesuch meines Vaters!« – Und Arthur producirte das betreffende Blatt.
»Nimmermehr!« wiederholte der Professor. Sein bleiches Gesicht war vor Zorn ein wenig geröthet; seine weiße Hand, von der er bereits den schwarzen Handschuh abgestreift hatte, war in einer oratorischen Geste gegen Arthur erhoben; seine blauen Augen hatten eine tiefere Färbung angenommen, wie Meerwasser, wenn ein Wolkenschatten darüber hinzieht.
»Nimmermehr!« rief er zum dritten Male; schritt an Arthur vorüber nach dem Katheder; erklärte, nachdem er stumm die weißen Hände gefaltet, daß er zu aufgeregt sei, um beten zu können, und nun kam eine gestotterte Philippika – der würdige Mann stotterte stets, wenn er aufgeregt war – gegen die Pest der Jugend: die Weltlust und Vergnügungssucht, der gerade Diejenigen, auf welchen der Geist Apollos und der Pallas Athene am wenigsten ruhe, am meisten verfallen seien. Er sei ein milder und humaner Mann und wohl des Dichterwortes eingedenk, daß man zur rechten Zeit, am rechten Ort den strengen Ernst fahren lassen, ja gelegentlich zechen und mit den Füßen im Tanz den Boden stampfen dürfe – aber dann müsse die Ursache der Wirkung angemessen sein; – ein Virgil müsse uns aus der Fremde heimkehren, eine Kleopatra durch ihren freiwillig unfreiwilligen Tod das Gemeinwohl von einer drohenden Gefahr erlöst haben. Wie aber könne jemand, der notorisch zu den schlechtesten Schülern gehöre, ja unbedingt der schlechteste sein würde, wenn ihm nicht Einer, der nach dieser Richtung unerreichbar sei – hier suchten des Professors blöde Augen mich – den Rang ablaufe, – wie könne ein Solcher nach einem Kranze greifen, welcher nur die vom Schweiße des Fleißes rieselnde Stirn kühlen dürfe! Sei er – der Redner – zu streng? er glaube nicht, obgleich niemand es inniger wünschen könne, als er, niemand sich inniger freuen würde, als er, wenn jetzt der hart Gescholtene den Beweis seiner Schuldlosigkeit sofort anträte und den herrlichen Chor der Antigone, welcher das Thema unserer heutigen Vorlesung sei, ohne Anstoß übersetzte. »Von Zehren, beginnen Sie!«
Der arme Arthur! Ich sehe noch heute, nach so viel Jahren, sein schönes, damals schon etwas verlebtes Gesicht, welches sich vergeblich Mühe gab, das aristokratisch gleichgültige Lächeln auf den seinen Lippen festzuhalten, als er jetzt das Buch aufnahm und ein paar Verse des griechischen Textes nicht eben geläufig las. Während dieser kurzen Lectüre verschwand das verächtliche Lächeln mehr und mehr und ein Blick hülfesuchender Verlegenheit aus den langgeschlitztes Augen irrte herab zu seinem Nachbar und Pylades. Lieber Himmel, wie konnte ich ihm helfen! und wer wußte besser als er, daß ich ihm nicht würde helfen können! So geschah das Unabänderliche. Er machte aus einem »Strahl des Helios« einen »Schild des Aeolus« und brachte noch vieles Aehnliche, Unerhört-Ungehörige vor. Die Anderen feierten ihr besseres Wissen durch Salven von Gelächter, und selbst die classischen Züge des Professors erhellte ein grimmiges Lächeln des Triumphes über den in den Staub getretenen Gegner.
»Die Hunde!« murmelte Arthur mit bleichen Lippen, als er sich, nachdem das peinliche Verhör ein paar Minuten gedauert, wieder setzte. »Weshalb hast Du mir nicht zugesagt?«
Es blieb mir keine Zeit, eine so thörichte Frage zu beantworten, denn jetzt kam die Reihe an mich. Aber ich hatte keine Lust, mich, meinen Mitschülern zum Spaß, der gelehrten Folter zu unterwerfen, sondern erklärte, daß ich noch weniger vorbereitet sei, als mein Freund, und daß ich durch dieses Bekenntniß dem Zeugniß, welches mir der Herr Professor vorhin ja selbst ausgestellt hätte, zu entsprechen hoffe.
Ich begleitete diese Worte mit einem drohenden Blick gegen die Andern, der ihr Gelächter alsbald verstummen machte; und auch der Professor, sei es, daß er weit genug gegangen zu sein glaubte, sei es, daß er meine freche Rede einer Erwiderung für unwürdig hielt, wandte sich mit einem Achselzucken ab und strafte uns, während er gegen die Andern ungemein liebenswürdig war und die gelehrtesten Witze zum Besten gab, den noch übrigen Theil der Stunde hindurch mit stiller Verachtung.
Die Thür hatte sich hinter ihm geschlossen. Arthur stand vor der ersten Bank und rief: »Ihr habt Euch einmal wieder erbärmlich benommen; aber mir fällt es nicht ein, hier zu bleiben Der Alte kommt heute nicht wieder; wenn die Andern nach mir fragen, sagt nur: ich wäre krank.«
»Und dasselbe gilt für mich!« rief ich, neben Arthur tretend und ihm einen Arm auf die Schulter legend. »Ich gehe mit. Ein Lump, der seinen Freund verläßt!«
Einen Augenblick später hatten wir uns zwölf Fuß hoch aus dem Fenster auf den Schulhof hinabgleiten lassen und standen nun zwischen zwei Mauerpfeilern, eng aneinander gedrückt, damit uns der Professor, wenn er aus dem Schulgebäude in seine Wohnung ging, nicht erblicke, den weitern Plan überlegend.
Es gab zwei Möglichkeiten, von dem rings eingeschlossenen Hinterhof, auf dem wir uns jetzt befanden, in's Freie zu gelangen: durch die langen, winkeligen Kreuzgänge des Gymnasiums – eines uralten Benedictiner-Klosters – auf die Straße, oder durch die Wohnung des Professors, die mit einer Ecke den Hof begrenzte, direct auf die Promenade, zu welcher die längst demolirten Stadtwälle umgeschaffen waren und die fast das ganze Städtchen umkreiste. Der erste Weg war gefährlich, denn es geschah häufig, daß ein oder das andere Lehrerpaar noch lange nach dem officiellen Anfang der Lection in den kühlen Gängen plaudernd auf- und abpromenirte – und wir hatten keine Minute zu verlieren; der zweite war noch viel gefährlicher, denn er führte direct durch die Höhle des Löwen; aber er war der bei weitem kürzere und jeden Augenblick praktikabel; wir entschieden uns deshalb für denselben.
An der Mauer, dicht unter den Fenstern unserer Klasse, in welcher die zweite Lection bereits begonnen hatte, hinschleichend, kamen wir bis zu der schmalen Pforte, die auf den kleinen Hof der Professorwohnung führte. Hier war Alles still; durch die offen stehende Hinterthür konnten wir auf den weiten, mit Steinfliesen gepflasterten Flur des Hauses sehen, wo der Professor, der eben zurückgekommen war, sich mit seinem jüngsten Söhnchen, einem hübschen schwarzköpfigen dreijährigen Buben, haschte, indem er mit seltsam langen Schritten hinter demselben herlief und dabei vorsichtig in die weißen Hände klatschte. Das Kind lachte und jauchzte und einmal kam es sogar auf den Hof gelaufen, gerade auf unsern Versteck, der aus einem Haufen Klobenholz bestand, zu: noch ein paar Schrittchen der kleinen Beine und wir waren entdeckt.
Ich habe hernach oft daran gedacht, wie an diesen paar Schrittchen im Grunde nicht weniger als mein ganzes Leben gehangen hat. Kam das Kind bis zu uns, so konnten wir nur hinter dem Holzstoß – an welchem man übrigens vom Schulgebäude zur Directorwohnung vorüber mußte – hervortreten, als zwei Schüler, die sich zu ihrem Lehrer begeben, ihn wegen des Aergers, den sie ihm bereitet haben, um Verzeihung zu bitten. Wenigstens gestand mir Arthur, daß ihm, als das Kind auf uns zugekommen, blitzschnell dieser Gedanke durch den Kopf gefahren sei. Dann hätte es noch eine Strafpredigt gegeben, aber in milderm Tone – denn der Professor war im Grunde seines Herzens ein guter Mann, der das Beste wollte; – wir wären in die Klasse zurückgekehrt, hätten schlimmstenfalls den Mitschülern gegenüber unsern Entweichungsplan für einen schlechten Scherz ausgegeben und – ja ich weiß selbst nicht, was dann geschehen wäre, sicher nicht das, was wirklich geschah.
Aber die trippelnden Beinchen kamen nicht bis zu uns; der mit langen Schritten hinterher eilende Vater erhaschte das Kind und hob es, in überströmender Vaterfreude, hoch in die Höhe, daß die dunkeln Locken des Bübchens in der Sonne blitzten – dann trug er es kosend zum Hause zurück, in dessen Thür die Frau Professorin im Schmuck auf Papilloten gewickelter Locken und einer weißen Küchenschürze erschien; dann verschwanden Vater, Mutter und Kind – die offen gebliebene Thür zeigte auf einen leeren Hausflur – jetzt, oder nie war es Zeit.
Mit jenem hochklopfenden Herzen, das nur in der Brust eines Schülers Raum hat, der einen dummen Streich macht, schlichen wir bis zur Thür, über den sonntäglich stillen Flur, wo in den schrägen Sonnenstreifen, welche durch die gothischen Fenster fielen, die bunten Staub-Atome tanzten. Die Glocke der Hausthür gab, als wir dieselbe langsam öffneten, einen schrillen Warnungsruf, aber schon winkten uns die breitkronigen Bäume der Wallpromenade; eine halbe Minute später waren wir zwischen den dichten Gebüschen der Anlagen verschwunden und eilten mit großen Schritten, die manchmal in einen kurzen Trab fielen, dem Hafen zu.
»Was wirst Du Deinem Vater sagen?« fragte ich.
»Gar nichts, denn er wird nicht fragen,« erwiederte Arthur; »oder wenn er fragt: daß ich frei bekommen habe; was sonst? Es wird famos werden; ich werde mich famos amüsiren.«
Wir eilten eine Weile schweigend nebeneinander her. Zum ersten Male fiel mir ein, daß ich doch eigentlich um nichts und wieder nichts aus der Schule gelaufen sei. Wenn Arthur hernach ein paar Tage Carcer trafen, so hatte er sich doch wenigstens »famos amüsirt;« und die Sache hatte also für ihn gewissermaßen einen Sinn. Ueberdies waren seine Eltern sehr nachsichtig – er riskirte mit einem Worte so gut wie nichts. Ich dagegen lief die Gefahr der Entdeckung und der Strafe ohne alle Entschädigung, und mein strenger, alter Vater verstand überhaupt keinen Scherz, in solchen Dingen am wenigsten. Ich hatte wieder einmal, wie schon so oft, für einen Andern die süßen Kastanien aus dem Feuer holen helfen. Indessen was that's! Hier bei dem eiligen Lauf unter den wehenden Bäumen war es jedenfalls besser als in der dumpfigen Klasse, und für mich, wie ich damals gesinnt war, trug jeder dumme, übermüthige Streich seine Belohnung in sich selbst. Ich empfand es deshalb als eine besondere Großmuth meines sonst sehr egoistischen Freundes, als dieser plötzlich sagte: »Höre, Georg, Du solltest mitkommen. Der Onkel hat mir noch speciell aufgetragen, so viel Freunde als möglich mitzubringen. Ich sage Dir: es wird famos werden. Elise Kohl und Emilie Heckepfennig sind auch dabei. Ich will Dir ausnahmsweise Emilie lassen. Und dann die Austern und der Champagner und die Ananas-Bowle – Du solltest wirklich mitkommen.«
»Und mein Vater?« sagte ich; aber ich sagte es nur, denn mein Entschluß, von der Partie zu sein, stand bereits fest. Emilie Heckepfennig – Emilie mit ihrem Stumpfnäschen und ihren lachenden Augen, die mich immer ganz besonders auszeichnete und mir neulich beim Pfänderspiel einen herzhaften Kuß gegeben, zu dem sie gar nicht verpflichtet war, und die mir Arthur, der Fant, ausnahmsweise lassen wollte! Ich mußte mit, jetzt mußte ich es; mochte daraus kommen, was wollte.
»Meinst Du, daß ich so erscheinen kann?« fragte ich, stehen bleibend, mit einem Blick auf meinen Anzug, der einfach und sauber – ich hielt darauf – aber keineswegs gesellschaftlich war.
»Warum denn nicht,« erwiederte Arthur; »was ist daran gelegen! Und übrigens haben wir keine Minute zu verlieren.«
Arthur, der in seinen besten Kleidern war, hatte mich nicht angesehen und seinen Schritt nicht gemäßigt. Wir hatten in der That keine Minute zu verlieren, denn, als wir jetzt durch ein paar enge Gäßchen zum Hafen gelangten, tönte uns die Signalglocke des Dampfers entgegen, der an der Landungsbrücke zur Abfahrt bereit lag. Die vierschrötige Gestalt des Kapitäns stand auf dem Radkasten. Wir drängten uns eilig durch die dichte Schaar der Gaffer auf der Brücke und stürzten über das Laufbret, als man es eben auf das Schiff ziehen wollte und die Räder ihre erste Umdrehung machten, mitten hinein in die auf dem Deck versammelte bunte Gesellschaft.
Zweites Capitel.
»Wie Du mich erschreckt hast!« sagte Frau von Zehren, indem sie ihren Sohn bei beiden Händen ergriff; – »wir hielten schon das Unmögliche für möglich und glaubten, Professor Lederer habe Dir die Erlaubniß verweigert. Siehst Du wohl, Zehren, daß ich recht hatte?«
»Nun, mir ist es ja auch recht,« erwiederte der Steuerrath; »die jungen Damen waren schon trostlos über Dein Ausbleiben, Arthur; oder habe ich zu viel gesagt, Fräulein Emilie, Fräulein Elise?« – Und der Steuerrath wandte sich mit einer galanten Handbewegung an die Mädchen, die kichernd ihre breitgeränderten dunkeln Strohhüte gegeneinander neigten. – »Nun aber mußt Du den Onkel begrüßen,« fuhr er leiser fort; – »wo ist denn der Onkel?« und er ließ seine Augen über die auf dem Deck herumschwärmende Gesellschaft schweifen.
Der Commerzienrath Streber kam eben dahergeschossen. Seine kleinen hellblauen Augen blitzten ärgerlich unter den grauen buschigen Brauen hervor; den langen Schirm seiner unmodischen Mütze hatte er aus der kahlen Stirn geschoben; der linke Aermel seines weiten blauen Fracks mit den goldenen Knöpfen war ihm halb von der Schulter gerutscht; seine in gelben Nankinghosen steckenden Beinchen hatten es sehr eilig.
»Wo hat denn der verdammte Johann die –«
»Erlauben Sie, werther Herr Schwager, daß Ihnen mein Arthur –«
»Ist gut!« rief der Commerzienrath, ohne den Präsentirten anzusehen; – »aha! da ist der Schlingel!« – und er schoß unaufhaltsam weiter, auf seinen Bedienten zu, der eben mit einem Präsentirbret voll Gläser aus der Kajütenthür auftauchte.
Der Steuerrath und die Steuerräthin tauschten untereinander ein paar Blicke aus, in welchen »der alte Grobian« oder etwas derart ziemlich deutlich zu lesen war. Arthur hatte sich zu den jungen Mädchen gewandt und etwas gesagt, was jene veranlaßte, hell aufzulachen und mit ihren Sonnenschirmen nach ihm zu schlagen; ich, um den sich niemand kümmerte, wandte mich ab und suchte das stillere Vorderdeck auf, wo ich auf einer Rolle Schiffstaue Platz nahm und, den Rücken gegen die Ankerwinde gelehnt, in den hellen Morgen und auf das helle Meer hinauszublicken begann.
Denn das Schiff hatte unterdessen den Hafen verlassen und fuhr längst der Küste linker Hand dahin, auf welcher die rothen Dächer der Schifferhäuschen durch Busch und Baum blickten, während auf dem schmalen weißen Strande hier und da einzelne Gestalten sichtbar wurden, Schiffer oder auch Badegäste, die nach dem vorüberbrausenden Dampfer schauten. Rechter Hand trat das flache Ufer immer mehr zurück; vor uns – aber in weiterer Ferne – glänzten die Kreide-Felsen der Nachbarinsel herüber über die blaue Meeresfläche, die jetzt, unter einem lebhafteren Wind, sich zu kräuseln begann, während unzählbare Scharen von Seevögeln bald vor dem daherbrausenden Schiff in den Wind flogen, bald, die klugen Köpfchen drehend, auf den bewegten Wassern tanzten und mit ihrem eintönigen Geschrei die Luft erfüllten.
Es war ein heller köstlicher Morgen; ich sah es wohl, aber fühlte es nicht recht. Meine Stimmung war sonderbar trüb. Sie würde ausgezeichnet gewesen sein, wäre des Herrn Commerzienrath »Pinguin,« der mit einer Schwerfälligkeit, die seinem Namen entsprach, durch das Wasser sich arbeitete, ein schönes, schnelles Schiff gewesen, nach China bestimmt oder Buenos-Ayres oder sonst ein paar tausend Meilen weit weg, und ich als Passagier, mit einem großen Beutel voll Gold, ja meinetwegen selbst als Matrose an seinem Bord, mit der Gewißheit, nun und niemals wieder die verhaßten Thürme meiner Vaterstadt zu schauen, die da eben auf dem blendenden Morgenhimmel mit dem sonnedurchleuchteten Morgendunst verflossen. Aber jetzt! – was war es nur, was mich so melancholisch machte? Das Bewußtsein meines Ungehorsams, die Furcht der, nach menschlicher Berechnung, unausbleiblichen unangenehmen Folgen? Gewiß nicht! Das Aeußerste konnte doch nur sein, daß mich mein strenger Vater aus dem Hause jagte, wie er es schon oft genug zu thun gedroht, und diese Möglichkeit sah ich als eine Befreiung von einem Joch an, das mir mit jedem Tage unerträglicher däuchte, und begrüßte sie deshalb, als sie sich jetzt im Geiste darbot, mit einem Lächeln grimmiger Zufriedenheit. Nein, das war es nicht!
Was aber sonst?
Ja, mein Gott, wer will denn aus der Schule gelaufen sein mit einem Eifer als gälte es, das Höchste zu erringen, und hernach, in einer fröhlichen Gesellschaft, auf dem Deck eines Dampfers, abseits auf einer Taurolle sitzen, ohne daß irgend jemand der Herren oder Damen ihn im geringsten beachtet, ja selbst ohne die Aussicht, der Diener mit den Kaviarbrödchen und dem Portwein würde endlich auch einmal zu ihm kommen. Diese letztere Vernachlässigung beleidigte mich, ehrlich gestanden, für den Augenblick am schmerzlichsten. Mein Appetit war, wie das bei einem neunzehnjährigen Burschen von meiner Körperbeschaffenheit nicht anders sein konnte, immer ausgezeichnet und jetzt durch den scharfen Lauf von der Schule zum Hafen und durch den frischen Seewind ungewöhnlich gereizt.
Ich stand in einer Anwandlung von Ungeduld auf, aber setzte mich alsbald wieder. Nein, Arthur mußte kommen und mich zur Gesellschaft führen; es war, nachdem ich ihm den Gefallen gethan hatte, mit ihm wegzulaufen, das Geringste, was er mir schuldig war. Als ob er mir noch jemals bezahlt hätte, was er mir schuldig war! Wie viel Angelruthen, Kanarienvögel, Muscheln, Thonpfeifen, Messer hatte er mir abgekauft, das heißt abgeschmeichelt und abgetrotzt, ohne jemals den ausbedungenen Preis zu entrichten! Ja, wie oft hatte er mir mein baares Geld abgeborgt, sobald es nur irgend der Mühe werth schien, wozu manchmal nicht mehr als zwei und ein halber Silbergroschen gehörten!
Sonderbar, daß ich gerade jetzt in dieser hellen Morgenstunde diese dunkle Rechnung aufsummiren mußte! Es war gewiß das erste Mal seit dem Beginn unserer Freundschaft, die doch mindestens schon von unserm sechsten Jahre an datirte. Denn ich hatte den schönen schlanken Knaben immer geliebt, der so langes goldglänzendes Haar und so weiche braune Augen hatte und weil der Sammt von seiner Sonntagsjacke sich immer so glatt anfühlte. Ich hatte ihn geliebt, wie ein großem vierschrötiger Kettenhund ein zartes Windspiel lieben mag, das er mit einem Druck seiner Kinnbacken zermalmen kann: und so liebte ich ihn noch gewiß in diesem Augenblick, während er mit den Mädchen schäkerte und als ein petit maître, der er war, sich plaudernd, lachend durch die Gesellschaft bewegte.
Ich wurde ganz traurig, als ich das von meinem Platz, der eigentlich ein Versteck war, beobachtete, – ganz traurig und ganz muthlos; – ich mußte wohl sehr hungrig sein.
Wir hatten jetzt die weit in das Meer sich streckende Landzunge, in welche der westliche Strand auslief, und die wir umfahren mußten, erreicht. Auf der äußersten flachen Spitze, von der Reihe der Dünenhäuser durch einen weiten Zwischenraum getrennt, und vom Meere rings umfluthet, stand, von einer alten halbverdorrten Eiche überragt, noch eine Hütte, an die sich für mich viel köstliche Erinnerungen knüpften. Der alte Schmied Pinnow wohnte da, meines Freundes Klaus Pinnow Vater. Schmied Pinnow war für meine Knabenjahre unzweifelhaft die merkwürdigste Persönlichkeit gewesen. Er besaß vier alte doppelläufige, verrostete Percussionsgewehre und eine lange einläufige Vogelflinte mit Pfannenschloß, die er an jagdlustige Badegäste verlieh und gelegentlich an uns Jungen, wenn wir gut bei Kasse waren, denn Schmied Pinnow that nicht leicht etwas um Gottes willen; außerdem hatte er ein großes Segelboot, ebenfalls nur zur Benutzung der Badegäste, wenigstens in den letzten Jahren, wo er halb blind geworden war und größere Fahrten nicht wohl unternehmen konnte. Ehemals sollte er freilich ganz andere Fahrten von weniger harmloser Natur gemacht haben; und die Steuerofficianten, meines Vaters Collegen – mein Vater war seit einiger Zeit zum Rendanten avancirt – schüttelten die Köpfe, wenn sie auf Schmied Pinnows Vergangenheit zu sprechen kamen. Indessen, was ging uns Jungen das an! Was ging es mich vor allen an, der ich den vier verrosteten Jagdgewehren und der Vogelflinte und des alten Pinnows altem Boot die schönsten Stunden meines Lebens verdankte und an Klaus Pinnow den besten Kameraden von der Welt gehabt hatte. Gehabt! Denn seit den letzten vier Jahren, wo Klaus bei Schlosser Wangerow in der Lehre und später in Arbeit gewesen, hatte ich ihn selten nur noch gesehen und seit einem halben Jahre gar nicht wieder.
Aber eben jetzt dachte ich an ihn, als wir an seines Vaters Hütte vorüberfuhren und auf dem Sande neben dem auf den Strand gezogenen Boot eine Gestalt stand, – zwerghaft klein in Folge der großen Entfernung, – in der meine scharfen Augen aber dennoch Christel Möwe erkannten, Klaus' Pflegeschwester, welche die nun auch längst verstorbene Frau des alten Pinnow vor sechzehn Jahren nach einer Sturmnacht zwischen Kisten und Planken eines gescheiterten Schiffes am Strande fand und der Alte in einer Anwandlung von Großmuth, wie die Einen – um sich ein Ansehen vor den Leuten zu geben, wie die Andern sagten, in sein Haus aufgenommen hatte. Das Schiff war ein holländisches gewesen; so viel hatte man aus den Trümmern gesehen, sonst war nie etwas über Namen und Eigenthümer bekannt geworden – infolge vielleicht der Lässigkeit, mit der man von seiten der Behörden die Nachforschungen angestellt – den kleinen Findling aber hatte man Christine oder Christel Möwe genannt, weil das wilde Geschrei der in der Luft kreisenden Möwen Frau Pinnow an die Stelle, wo es lag, gelockt hatte.
Ein Geräusch in meiner unmittelbaren Nähe ließ mich schnell den Kopf nach der Seite wenden. Zwei Schritte von mir wurde eine Luke in dem Verdeck des Schiffes geöffnet, und aus der Luke hob sich, mit den Füßen auf der Leiter stehen bleibend, ein Mensch, so weit, daß er eben über die niedrige Schiffswandung blicken konnte. Das kurze starre Haar, das breite Gesicht, der nackte muskulöse Hals, die bis zum Gürtel fast offene Brust, das einst rothbunt gewesene Hemd, die einst grau gewesenen Beinkleider – Alles war mit einer dichten Schicht schwarzen Kohlenstaubes bedeckt, und da der Mann die ohnehin sehr schmalen Augen beinahe zugekniffen hatte, um schärfer in die Weite blicken zu können, so wäre an ihm Alles schwarz gewesen, hätte er nicht in diesem Moment den ungeheuren Mund zu einem fröhlichen Grinsen verzogen und zwei Reihen Zähne gezeigt, die an glänzender Weiße nicht übertroffen werden konnten. Und jetzt hob er sich noch ein paar Zoll höher, winkte mit der großen leeren schwarzen Hand zum Gruß hinüber nach dem Strande, und jetzt erkannte ich den schwarzen Gesellen.
»Klaus!« sagte ich.
»Halloh!« rief er, sichtbar zusammenschreckend, und richtete schnell die schmalen Augen auf mich.
»Das war ja ein gewaltig zärtlicher Gruß, Klaus!«
Klaus erröthete unter seiner Rußdecke und zeigte alle seine Zähne: »Herr du meines Lebens!« rief er, »Georg, wo kommst Du – wo kommen Sie hierher?«
»Ja, und Du, Klaus!«
»Ich bin ja schon seit Ostern hier,« erwiederte er; – »ich wollte immer schon einmal herankommen und sehen, wie es Ihnen geht.«
»Aber, närrischer Kerl, weshalb nennst Du mich denn auf einmal Sie?« fragte ich.
»Na, Sie gehören doch nun auch zu der vornehmen Gesellschaft,« sagte Klaus, mit dem Daumen über die Schulter nach dem Hinterdeck zeigend.
»Ich wollte, ich wäre unten bei Dir und Du könntest mir ein tüchtiges Butterbrod geben,« sagte ich. »Hole der Teufel die vornehme Gesellschaft!«
Klaus sah mich erstaunt an.
»Ja, aber,« sagte er; »warum –«
»Warum ich hier bin?« unterbrach ich ihn; – »weil ich ein Narr, ein Esel bin, Klaus.«
»Ach nein!« sagte Klaus.
»Glaub es mir, Klaus, ein vollkommener Esel. Ich wollte, ich hätte lauter so gute Freunde, wie Du, Klaus.« – Und mein Blick irrte zu dem treulosen Arthur hinüber, der mit dem Sonnenschirm der treulosen Emilie zwischen den Gästen herumstolzirte, während sie sich seinen kleinen Strohhut kokett auf die Locken gesetzt hatte.
»Ich muß wieder hinunter,« sagte Klaus, freundlich grinsend, »adjüs!« und er stieg die Leiter hinab.
»War das ein Schornsteinfeger?« fragte eine helle Stimme hinter mir.
Ich wandte mich schnell um, indem ich mich zugleich von meinem Sitz erhob. Da stand ein zierliches Dämchen von zehn Jahren in weißem Kleidchen mit kornblumblauen Bändern an den Achseln und kornblumblaue Bänder flatterten von ihrem Strohhütchen und die großen kornblumblauen Augen starrten neugierig auf die Luke, durch die mein schwarzer Freund verschwunden war, und blickte dann fragend zu mir empor.
In demselben Moment wurde die Luke wieder gehoben; Klaus schaute heraus: »Soll ich Ihnen wirklich ein Butterbrod –«
»O Gott!« schrie die Kleine. Hinter mir klappte die Luke über dem blitzschnell untertauchenden Freunde.
»O Gott,« rief die Kleine nochmals. – »Wie ich erschrocken bin!«
»Worüber, ma chère?« fragte eine andere Stimme. Die Stimme war sehr dünn, und die Dame, der sie gehörte, und die eben um das Kajütenhaus herumtrat, war ebenfalls sehr dünn, ungefähr so, wie das fadenscheinige Seidenkleid, couleur changeante, das ihre Gestalt umflatterte, oder die röthlichen Locken, die von beiden Seiten ihres blassen Gesichts herabfielen.
Diese Dame war Fräulein Amalie Duff und die mit den kornblumblauen Augen und Bändern war ihre Zöglingin, Hermine Weber, des Commerzienraths einziges Kind. Ich kannte natürlich beide, wie ich denn so ziemlich wohl sämmtliche Bewohner unserer kleinen Stadt, sobald sie nur erst aus den Windeln heraus waren, kannte und hätte auch wohl von ihnen gekannt sein können, denn ich war ein paar Mal mit Arthur in dem großen Garten des Commerzienraths vor dem Thore gewesen und hatte vor vierzehn Tagen sogar die Ehre gehabt, die kleine Hermine eine halbe Stunde lang schaukeln zu dürfen in der großen hölzernen Schaukel, von der man, wenn man sie recht hoch schleuderte, einen Blick zwischen die Bäume weg auf's Meer hatte. Ueberdies stammte Fräulein Duff aus demselben kleinen sächsischen Städtchen, welches auch der Geburtsort meiner Eltern war, und sie hatte, als sie vor einigen Monaten in unserer Stadt erschien, Empfehlungen und Grüße aus der Heimat gebracht, welche leider für meine gute Mutter, die schon seit fünfzehn Jahren in der Erde ruhte, zu spät kamen. Auch hatte Fräulein Duff mich schon wiederholt – auch an jenem Schaukelnachmittage – ihrer belehrenden Unterhaltung gewürdigt, aber sie war sehr kurzsichtig, und so konnte ich es ihr denn nicht weiter verübeln, daß sie jetzt die goldene Lorgnette vor die blassen Augen nahm und mit jener Verbeugung, die man in der Tanzstunde, glaube ich, grand compliment nennt, fragte: »Ich habe die Ehre?«
Ich nannte meinen Namen.
»O ciel!« rief Fräulein Duff, »mon jeune compatriote! Ich bitte tausendmal um Verzeihung! meine Kurzsichtigkeit! – Wie befindet sich Ihr würdiger Herr Vater? Wie befindet sich Ihre liebe Frau Mutter? – Himmel, wie verwirrt ich bin! sie weilt ja nicht mehr unter den Lebenden! verzeihen Sie! aber Ihr plötzliches Erscheinen in diesem stillen Winkel der Welt hat mich ganz fassungslos gemacht. Was ich sagen wollte – man verlangt dort drüben sehr nach Ihnen. Wie haben Sie sich so versteckt halten können; man sucht Sie überall –«
»Und doch wäre ich leicht genug zu finden gewesen,« sagte ich, vermuthlich mit einiger Bitterkeit, welche dem leisen Ohr Fräulein Duffs nicht entging.
»Ach ja,« sagt sie mit einem verständnißvollen Blick der blassen Augen, und indem sie einen Schritt näher trat: »Wer sich der Einsamkeit ergiebt ... das ist eine ewige Wahrheit. Am Golde hängt, nach Golde drängt ... Nicht so wild, ma chère! Das gräuliche Thier wird dir die Kleider zerreißen!«
Diese letzten Worte galten der kleinen Hermine, welche mit einem allerliebsten Wachtelhündchen, das bellend herangesprungen kam, auf den glatten Dielen des Verdecks Haschen zu spielen begann.
»Sie sind ein sinniges Gemüth,« fuhr die Gouvernante fort, indem sie sich wieder zu mir wandte; »ich sehe es an dem schmerzlichen Zug, der um Ihren Mund grollt. Die lauten Freuden widern Sie an; das Toben und Schreien ist Ihnen ein verhaßter Klang; aber wir Armen müssen uns in das Unvermeidliche schicken, ich wenigstens muß es. Würde ich sonst hier sein? auf diesem schwankenden Kahn, wo ich Todesangst ausstehe? Und zu welchem Zweck? einem kannibalischen Mahle beizuwohnen! unschuldige Austern, die man dem mütterlichen Schooße der heiligen Salzfluth entreißt, um sie lebend zu verschlingen! Ist das ein Schauspiel, das man einem Kinde bieten darf?« und Fräulein Duff schüttelte sorgenvoll ihre dünnen Locken.
»Es fragt sich noch sehr, ob wir welche finden,« sagte ich höhnisch.
»Meinen Sie? auch die anderen Herren bestreiten es. Der Salzgehalt der Ostsee ist zu gering. Zwar sollen die Römer in Süßwasserseen bei Neapel – aber wie darf ich einem jungen Gelehrten wie Ihnen mein bescheidenes Wissen aufdrängen wollen! Der gute Commerzienrath! Ja, ja: verachte nur Vernunft und Wissenschaft! Aber da kommt er selbst! Kein Wort von dem, was wir gesprochen, mein junger Freund! ich bitte!«
Mir blieb keine Zeit, die blasse Dame meiner Verschwiegenheit zu versichern, denn beinahe die ganze Gesellschaft, an der Spitze der Commerzienrath, der die dicke Frau Justizrath Heckepfennig am Arm führte, kam jetzt auf das Vorderdeck geschwärmt, einen Dreimaster besser zu sehen, der mit vollen Segeln auf uns zurauschte. Im nächsten Augenblick war ich mitten in dem Schwarm, und das Eis, in welchem ich so zu sagen festgesessen hatte, war gebrochen. Arthur, dessen feines Gesicht von dem reichlich genossenen Wein bereits lebhaft geröthet war, schlug mich auf die Schulter und fragte, wo zum Kukuk ich denn gesteckt hätte? Die treulose Emilie reichte mir die Hand und lispelte: »Haben Sie mich denn ganz vergessen?« und sank, als jetzt, zum Salut des vorüber rauschenden Oceanriesen an Bord unseres Dampfers die Böller gelöst wurden, mit einem kleinen Schrei in meine Arme. Der Dreimaster, der eben von Westindien zurückkam, gehörte zu des Commerzienraths Flotte. Man hatte gewußt daß er heute einlaufen würde, und dem Commerzienrath war es keineswegs unlieb, seine Gäste auf der Fahrt nach seinen Austerbänken an dem stolzesten seiner Schiffe vorüberführen zu können. Er stand auf dem Radkasten, das Sprachrohr am Munde, aus Leibeskräften etwas schreiend, was in dem allgemeinen Hurrah hinüber und herüber und dem Krachen der Böllerschüsse unmöglich von dem bronzefarbenen Kapitain drüben verstanden werden konnte, der denn auch zum Zeichen, daß er nichts verstanden habe, die breiten Achseln zuckte. Aber was kam darauf an! Es war doch ein glorioses Schauspiel, und der Commerzienrath mit dem Sprachrohr auf dem Radkasten die Hauptperson in demselben. Das war ihm genug, und als er jetzt, nachdem der »Albatros« auf breiten Schwingen vorübergerauscht war und die plumpen Beine des »Pinguin« wieder zu schaufeln begannen, von seinem Piedestal herunterstieg, die Glückwünsche der Gesellschaft in Empfang zu nehmen, glitzerten seine Aeuglein so hell, zuckten die Flügel seiner langen Nase so vergnüglich, strich er sich so behaglich das spitze Bäuchelchen und sein lautes Lachen klang wie das Krähen eines Hahns, der sich in dem angenehmen Bewußtsein bläht, der Erste auf dem Düngerhof zu sein.
Das übrige Geflügel erkannte diesen Vorzug auf das bereitwilligste an: man schnatterte, piepte, gluckste Beifall; man duckte sich, man kratzfüßelte. Niemand mehr als Arthurs Vater, der Steuerrath, der sich beständig an der Seite des Gefeierten hielt und ihm mit seiner glatten Stimme Schmeicheleien sagte, die Jener, als etwas, das sich von selbst verstand, und woran er, besonders von dieser Seite, gewöhnt war, mit einer Gleichgültigkeit aufnahm, die für die meisten Anderen etwas Beleidigendes gehabt haben würde. Auch mochte wohl der Steuerrath nicht gerade angenehm durch das Benehmen seines reichen Schwagers berührt sein, obgleich er ein viel zu gewandter Mann war, um, was auch immer in solchen Augenblicken sein Herz bedrücken mochte, merken zu lassen. Nicht ganz so gut gelang diese Selbstkasteiung seiner Gemahlin, die, als geborene Baroneß Kippenreiter und als leibliche Schwester der verstorbenen Frau Commerzienrath, ohne Zweifel Anspruch auf respectvolle Behandlung hatte und ein Recht, unzufrieden zu sein, wenn ihr diese versagt wurde. Sie suchte sich für die Zurücksetzung durch ein möglichst herablassendes Benehmen gegen die übrigen Damen, die Frau Bürgermeister Koch, die Frau Justizrath Heckepfennig, die Frau Bauinspector Strombach und wer denn noch sonst von der weiblichen Elite unseres Städtchens anwesend war, zu entschädigen, indessen konnte diese Genugthuung nicht die Wolke von ihrer aristokratischen Stirn verscheuchen, mit wie krampfhafter Freundlichkeit auch die dünnen Lippen über den langen, gelben Zähnen auf- und niederzuckten.
Ich hatte kaum angefangen, mich in der Gesellschaft heimisch zu fühlen – und wie bald geschah das! – als mein gewöhnlicher, kecker und zum Theil wilder Uebermuth sein Recht verlangte und sich in hundert Streichen Luft machte, die vielleicht nicht immer vom besten Geschmack waren, aber gewiß niemals aus einem schlechten Herzen kamen, und in denen ich mich um so unbefangener gehen ließ, als ich die Lacher stets auf meiner Seite hatte. Lieber Himmel! ich könnte jetzt noch vor Scham erröthen, wenn ich denke, welche schalen Reden ich meinem bescheidenen Auditorium für Witze verkaufte, wie arm an Erfindung und plump in der Darstellung die Scenen waren, die ich vorzuführen liebte und für die ich in der ganzen Stadt eines großen Rufes genoß (ein Verliebter, der seiner Schönen ein Ständchen bringen will und dabei fortwährend von bellenden Hunden, miauenden Katzen, keifenden Nachbarinnen, schadenfrohen Passanten gestört und zuletzt vom Wächter arretirt wird, war meine Glanzrolle); wie tactlos und unsinnig die Reden, die ich über Tisch hielt und mit wie vielen Gläsern Wein ich mich für diese tactlosen und unsinnigen Reden zu belohnen für gut fand!
Ach! dieses Mittagsmahl auf dem mit Zelttuch überspannten Deck des in dem spiegelglatten Meer vor Anker ruhenden Dampfers! es war für mich die letzte wirkliche Lustbarkeit auf lange, lange Jahre hinaus; ich weiß es nicht, ob sie darum so hell in meiner Erinnerung geblieben ist, oder ob es die Jugend war, die mir in den Adern brauste, oder der Wein, der in den Krystallgläsern funkelte, oder der Sonnenschein, der so glanzvoll auf dem weiten Meere lag, oder die balsamische Luft, welche über die ungeheure Fläche so leise herangeschwingt kam, daß sie die glühenden Wangen der Mädchen nicht zu kühlen vermochte. – Es war wohl eben Alles zusammen: Jugend, Sonnenschein, Meeresathem, goldener Wein, rothe Mädchenwangen, ach! und die Austern, die bösen Austern, die zwei Jahre Zeit gehabt hatten, sich zu vermehren wie der Sand des Meeres und die der Meeressand und die Meeresströmung bis auf wenige leere Schalen vergraben und fortgespült hatte! Welch' ein unerschöpfliches Thema waren diese leeren Schalen, die mitten auf der Tafel in einer prachtvollen Schüssel als humoristisches Schaugericht prangten! wie versuchte Jeder seinen Witz daran! und wie gönnte man es heimlich dem Millionär, daß sein trotziger Eigensinn doch endlich einmal eine Lection bekommen, daß er mit allen seinen Millionen der Natur nicht abringen konnte, was sie nicht zu gewähren entschlossen war!
Aber man mußte es dem alten Kauz lassen: er machte zu dem bösen Spiel die beste Miene von der Welt, und als jetzt, nachdem er in launiger Rede sein Unglück beklagt, plötzlich lautes Geschrei auf dem Vorderdeck entstand und die Matrosen große Austerfässer herbeischleppten, die sie eben gefangen zu haben behaupteten, da war des Jubels kein Ende und der Lebehochs auf den splendiden Wirth, der zum andern Mal bewiesen, daß seine Schlauheit und Umsicht denn doch noch größer waren, als sein Trotz und sein Eigensinn.
Ich weiß nicht, wie lange das glänzende Mahl für die Herren noch währte, während die Damen auf dem Verdeck promenirten; jedenfalls noch sehr lange, viel zu lange für uns junge Burschen. Man erzählte sich die bedenklichsten Geschichten – in denen besonders der Commerzienrath stark war – man lachte überlaut, man schrie; ich mußte Lieder singen, die mit Jubel aufgenommen wurden, und ich war nicht wenig stolz, als mein kräftiger Baß selbst die Damen wieder an die Tafel lockte; ich that mein Bestes, in einem unisonen, von dem gesammten Herren- und Damenpersonal ausgeführten Vortrage von: »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« eine zweite Stimme (in Terzen) durchzuführen und verwandte während dessen kein Auge von Fräulein Emilie – eine Aufmerksamkeit, welche die Freundinnen der jungen Dame natürlich zu kichern und sich gegenseitig anzustoßen zwang und Arthur so in Eifersucht versetzte, daß er mich später, als wir, die Cigarren im Munde, auf dem Vorderdeck promenirten, nothwendig zur Rede stellen mußte.
Es war unterdessen Abend geworden; ich erinnere mich, daß, als ich den Wortwechsel mit Arthur hatte, auf der Küste der Insel, der wir uns auf unserer Heimfahrt einmal ziemlich genähert hatten, eine vom Schein der untergehenden Sonne getroffene Ruine erglänzte, die malerisch von dem hohen, steilabfallenden Vorgebirge aufragte. Der Anblick dieser Ruine gab unserem Streit, der schon ziemlich lebhaft geworden war, eine peinliche Wendung. Jener Thurm war nämlich das einzige Ueberbleibsel der uralten Zehrenburg, der Stammburg von Arthurs Familie, die in früheren Zeiten auf der Insel reich begütert gewesen war. Arthur deutete mit pathetischer Geberde auf die rothen Steine und verlangte von mir, daß ich, Angesichts der Burg seiner Ahnen, auf immer und ewig Emilie Heckepfennig abschwören solle. Ein Bürgerlicher, wie ich, habe immer vor einem Adeligen zurückzustehen. Ich behauptete, daß in der Liebe von Bürgerlich und Adelig nicht die Rede sei, und daß ich mich nun und nimmer zu einem Schwur verstehen könne, der mich und das Mädchen ungleich machen würde. – »Sclave,« sagte Arthur, »so belohnst Du mich für die Herablassung, mit der ich mir Deinen Umgang so lange schon habe gefallen lassen?« – Ich lachte überlaut; mein Lachen entflammte den trunkenen Zorn Arthurs auf's Höchste. – »Mein Vater ist der Steuerrath von Zehren,« rief er, »Dein Vater ist ein elender Subalternbeamter.« – »Laß unsere Väter aus dem Spiel, Arthur,« sagte ich; »Du weißt, ich verstehe in Beziehung auf meinen Vater keinen Spaß.« – »Dein Vater ...« – »Noch einmal, Arthur, laß meinen Vater aus dem Spiel! Mein Vater ist mindestens so viel werth, als der Deine. Und wenn Du jetzt noch ein Wort gegen meinen Vater sagst, so fliegst Du über Bord!« und ich schüttelte meine Fäuste vor Arthurs Gesicht.
»Was giebt es hier?« fragte der Steuerrath, der plötzlich herantrat. – »Wie, junger Mensch, ist dies die Achtung, die Sie meinem Sohn, die Sie mir schuldig sind? Es scheint, daß Sie dem unpassenden Betragen, dessen Sie sich während des ganzen Tages befleißigt haben, jetzt die Krone aufsetzen wollen. Mein Sohn hat Sie zum letzten Male mitgenommen.«
»Mitgenommen?« rief ich, »mitgenommen! Weggelaufen sind wir, Einer wie der Andere. Mitgenommen! Mitgefangen, mitgehangen!« – und ich brach in ein schallendes Gelächter aus, das den mir soeben gemachten Vorwurf des unpassenden Betragens leider vollauf bestätigte.
»Wie?« sagte der Steuerrath, »Arthur, was heißt das?«
Aber Arthur war nicht im Stande, eine verständliche Antwort zu geben. Er lallte, ich weiß nicht was und taumelte mit erhobener Hand auf mich zu. Der Vater ergriff ihn am Arm und führte ihn fort, indem er leise und heftig auf ihn einsprach und mir im Abgehen noch einen wüthenden Blick zuwarf.
Diese Scene hatte das Blut, das so schon feurig genug durch meine Adern brauste, vollends in Flammen gesetzt. Das Nächste, dessen ich mich noch erinnere, war, daß ich den Commerzienrath – ich weiß nicht mehr, wie ich zu der Ehre gekommen – am Arm führte und ihm in leidenschaftlichen Worten das himmelschreiende Unrecht klagte, das ich so eben von meinem besten Freunde erlitten habe, für den ich Gut und Blut zu opfern jederzeit bereit sei. Der Commerzienrath wollte sich todt lachen. – »Gut und Blut!« rief er, »ja, das können sie brauchen! denn das Gut!« – der Commerzienrath zog die Schultern in die Höhe und blies die Backen auf: – »und das Blut!« hier stieß er mich mit dem Elnbogen in die Seite; – »das Blut! Vollblut, capitales Blut, das versteht sich! habe ja selbst eine gehabt; – eine Kippenreiter! Baroneß Kippenreiter! mein Hermann mindestens Halbblut. Da springt sie hin – ist es nicht ein Engel? Schade, daß es kein Junge geworden ist; nenne sie deshalb immer Hermann. Hermann, Hermann!«
Die Kleine kam gesprungen; sie hatte ein rothes Tuch umgebunden, das ihr der Vater, nachdem er sie geküßt, noch fester um die zarten Schultern zog.
»Ist es nicht ein Engel? ein Stolz?« – fuhr er fort, indem er wieder meinen Arm nahm. – »Sie soll auch einen Grafen zum Mann haben, nicht so einen ausgehungerten Adeligen, wie mein Schwager, der Steuerrath, oder so einen, wie sein Bruder auf Zehrendorf, der Saufaus, oder wie der andere, der Duckmäuser, der Zuchthausdirector in Dingsda! Nein, einen wirklichen Grafen, einen Kerl, der seine sechs Fuß hoch ist, so wie Sie! ja, so wie Du, mein Junge!«
Der kleine Commerzienrath suchte mir seine beiden kurzen plumpen Hände auf die Schultern zu legen und blickte mit weinseligen Augen gerührt zu mir auf. – »Du bist ein kapitaler Kerl, ein Prachtkerl. Schade, daß Du so ein armer Teufel bist, Du solltest mein Schwiegersohn werden; aber ich muß dich Du nennen; kannst mich auch Du nennen, Bruderherz!« – und der würdige Mann schluchzte an meiner Brust und rief nach Champagner, vermuthlich, um den eben geschlossenen Bruderbund nach alter Weise mit einem solennen Trunk zu besiegeln.
Ich bezweifle, daß dies geschehen ist, wenigstens erinnere ich mich dieser Ceremonie nicht mehr, die sich doch wohl meinem Gedächtniß eingeprägt haben würde. Dagegen weiß ich, daß ich kurz nach dieser Scene mit einer vollen Flasche in dem Maschinenraum gewesen bin, um mit meinem Freunde Klaus anzustoßen und ihn zu versichern, daß er der beste, treueste Kerl von der Welt sei und daß ich ihn zum Oberheizer in der Hölle machen wolle, sobald ich einmal dorthin gelangt, was gar nicht mehr lange dauern werde; denn mit meinem Vater müsse es heute Abend noch eine Entscheidung geben, obgleich ich mich für ihn jeden Augenblick in Stücke zerreißen lassen würde, und das möge lieber jetzt gleich geschehen, und wenn der große schwarze Kerl nicht aufhöre, mit dem langen eisernen Arm auf und nieder zu fahren, würde ich meinen Kopf darunter stecken, und dann werde es wohl mit Georg Hartwig aus sein.
Wie der gute Klaus mir dieses selbstmörderische Vorhaben ausgeredet und wie er mich die steile Leiter wieder hinaufgeschafft hat, weiß ich nicht; doch muß es irgendwie geschehen sein; denn als wir in den Hafen einliefen, war ich wieder auf Deck und sah die Maste der vor Anker liegenden Schiffe an uns vorübergleiten und zwischen die Raaen und Spieren hindurch die Sterne tanzen, und der Halbmond stand auf dem spitzen Thurm der St. Nikolaikirche und fiel dann mit einem Male herunter, und ich wäre auch beinahe gefallen, denn der »Pinguin« streifte eben ziemlich hart die vorspringenden Balken der Schiffbrücke, auf welcher wieder eine schwarze Menschenmenge stand, die aber nicht Hurrah schrie, wie heute Morgen, sondern – wie mir vorkam – auffallend still war, und als ich durch sie hindurch drängte, mich – so schien es – mit wunderlich ernsten Gesichtern anstarrte, so daß mir zu Muthe wurde, als sei irgend ein Unglück geschehen, oder es werde demnächst eines geschehen, und ich selbst hätte irgendwie das Unglück zu Wege gebracht.
Ich stand vor dem kleinen Hause meines Vaters in dem schmalen Hafengäßchen. In der Stube zur Hausthür linker Hand schimmerte Licht durch die geschlossenen Läden; mein Vater war also schon zu Hause – er pflegte um diese Zeit einen einsamen Spaziergang um den Stadtwall zu machen. – War es denn schon so spät? – Ich zog die Uhr hervor – und suchte bei dem schwachen Schimmer des Mondes – Laternen brannten an Mondscheinnächten in Uselin nicht – zu sehen, welche Zeit es sei. Es war nicht möglich. Pah! sagte ich, es kommt auf eins heraus! – und ich ergriff entschlossen den Messingdrücker der Hausthür. Er fühlte sich an wie Eis so kalt in meiner fieberheißen Hand.
Drittes Capitel.
Als ich die Hausthür hinter mir schloß, trat Riekchen, die seit dem Tode der Mutter dem Vater die Wirthschaft führte, schnell aus dem Zimmerchen rechter Hand. Bei dem Schein des Oellämpchens auf dem weißgescheuerten Flurtisch sah ich, daß die gute Alte die Hände zusammenschlug und mich mit weit aufgerissenen, entsetzten Augen anstarrte. – Ist dem Vater etwas passirt? sagte ich, indem ich mich an dem Küchentisch fest hielt. Die im Vergleich mit draußen etwas dumpfe Luft des Flures und der Schrecken über Riekchens Angstmiene versetzte mir den Athem und dann strömte mir das Blut so heftig nach dem Kopfe: die Gegenstände im Flur schienen sich mir im Kreise zu drehen. – »Ach, Du Unglückskind, was hast Du angerichtet,« wimmerte Riekchen. »Um Gottes willen, was ist's?« rief ich laut, die Alte bei der Hand fassend.
Hier öffnete mein Vater die Thür seines Zimmers und erschien auf der Schwelle, beinahe den ganzen Rahmen ausfüllend, denn die Thür war schmal und niedrig und mein Vater ein starker, großer Mann.
»Gott sei Dank!« murmelte ich.
Ich empfand in diesem Augenblicke nichts, als das freudige Gefühl der Befreiung von der Angst, die mir noch eben die Kehle zugeschnürt hatte; im nächsten freilich schon hatte diese natürliche Regung einer ganz anderen Platz gemacht und wir starrten uns an wie zwei Gegner, die plötzlich aufeinandertreffen, nachdem der Eine schon lange des Andern geharrt hat, und der Andere, so gut es gehen will, sich zu der Entscheidung aufrafft, von der er weiß, daß sie unvermeidlich ist.
»Komm herein,« sagte mein Vater, indem er aus der Thür zurücktrat.
Ich folgte seinem Ruf. Es sauste mir in den Ohren, aber mein Schritt war fest, und wenn mein Herz wild an die Rippen schlug, so war es nicht vor Angst.
Als ich eingetreten war, erhob sich eine lange, schwarze Gestalt, die auf dem mit Haartuch überzogenen Arbeitsstuhl meines Vaters gesessen hatte – mein Vater duldete kein Sopha in seinem Hause – es war der Professor Lederer. Ich stand in der Nähe der Thür; mein Vater weiter rechts am Ofen, der Professor vor dem Arbeitstisch und vor der Lampe, so daß sein Schatten dunkel über die geweißte Zimmerdecke und über mich fiel. Keiner regte sich und Keiner sprach: der Professor wollte dem Vater das erste Wort lassen, mein Vater war zu aufgeregt, um sprechen zu können; so verging wohl eine halbe Minute, die mir eine Ewigkeit dünkte und während welcher ich jedenfalls Zeit hatte, mir den Gedanken zum klarsten Bewußtsein zu bringen, daß, wenn der Professor nicht sofort das Zimmer und das Haus verließ, jede Möglichkeit einer Verständigung zwischen meinem Vater und mir abgeschnitten war.
»Verirrter junger Mann,« sagte der Professor.
»Lassen Sie mich mit meinem Vater allein, Herr Professor,« sagte ich.
Der Professor sah mich an, wie Jemand, der seinen Ohren nicht traut. – Ein Schuldiger, ein Verbrecher – das war ich in den Augen des Schulmannes – der dem Richter in die Rede zu fallen, in diesem Tone, mit einer solchen Zumuthung in die Rede zu fallen wagt, – es war unmöglich.
»Junger Mann,« fing er noch einmal an, aber sein Ton war nicht mehr so sicher wie das erste Mal.
»Ich sage Ihnen, lassen Sie uns allein,« rief ich mit starker Stimme, indem ich eine Bewegung nach dem Professor machte.
»Er ist von Sinnen,« sagte der Professor, indem er, rückwärts schreitend, an den Tisch stieß.
»Bursche,« rief mein Vater, der rasch vorgetreten war, als wollte er den Professor vor einem Angriff schützen.
»Wenn ich von Sinnen bin,« sagte ich, meine glühenden Augen bald auf den Professor, bald auf meinen Vater richtend, »so thäten Sie doppelt wohl daran, uns allein zu lassen.«
Der Professor sah sich nach seinem Hut um, der hinter ihm auf dem Tisch stand.
»Nein, bleiben Sie, bleiben Sie!« rief mein Vater mit vor Leidenschaft bebender Stimme. – »Soll dieser freche Bube wieder einmal seinen bösen Willen durchsetzen? Ich habe nur zu lange eine strafbare Nachsicht geübt; es ist Zeit, endlich andere Saiten aufzuziehen.«
Mein Vater fing an, im Zimmer hin- und herzugehen, wie er immer that, wenn er sehr aufgeregt war. – »Ja, andere Saiten aufzuziehen,« fuhr er fort; – »dies geht nicht länger; ich habe gethan, was ich konnte; ich brauche mir nichts vorzuwerfen; aber ich will nicht eines ungerathenen Buben wegen zum Gespött der Leute werden. Wenn er nicht thun will, was seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit ist, so habe ich auch keine Pflicht und keine Schuldigkeit gegen ihn mehr zu erfüllen; so mag er sehen, wie er ohne mich durch die Welt kommt.«
Er hatte mich nicht ein einziges Mal angesehen, während er diese Worte, die der Zorn oft unterbrach, hervorstieß. Ich sah später einmal ein Gemälde, das jenen alten Römer darstellte, wie er sich die Hand auf den glühenden Kohlen abschwälen läßt und mit einem unendlich schmerzhaften Blick seitwärts auf die Erde starrt. Ich mußte dabei an meinen Vater in dieser verhängnißvollen Stunde denken.
»Ihr Herr Vater hat recht,« hob hier zum dritten Male der Professor an, der es für seine Pflicht hielt, an dem Eisen, das auf dem Amboß lag, mit schmieden zu helfen; – »wann hat es einen Vater gegeben, der mehr für seine Kinder gethan hätte, als dieser treffliche Mann, dessen Ehrenhaftigkeit, Fleiß und Biederkeit sprüchwörtlich sind, den jede Bürgertugend schmückt und der nun durch Ihre Schuld des schönsten, kostbarsten Schmuckes eines Bürgers entbehren soll, das ist: eines wohlgerathenen Sohnes, der ihm eine Stütze sei in seinem wankenden Alter. Ist es nicht genug, daß diesen trefflichen Mann das unabwendbare Schicksal so hart getroffen, daß er so früh die theure Gattin, einen Sohn in der Blüthe der Jahre verlieren mußte? Soll ihm nun auch noch der letzte geraubt werden, der Benjamin seines Alters? soll seine treue Sorge, sein Gebet bei Tag und Nacht –«
Mein Vater war ein strenger Mann, aber nichts weniger als fromm im Sinn der Kirche; die Unwahrheit war ihm ein Gräuel, und daß er Tag und Nacht gebetet haben solle, das war eine Unwahrheit; überdies war er von tiefster, fast krankhafter Bescheidenheit und das Lob des Professors dünkte ihm überschwänglich und unpassend.
»Lassen Sie es gut sein, Herr Professor,« unterbrach er den beredten Gelehrten mit rauher Stimme; – »ich sage noch einmal: ich habe meine Pflicht gethan, damit basta! und er soll seine thun, und damit basta! Ich will weiter nichts von ihm, nichts, gar nichts, nicht so viel« – und mein Vater strich dabei die Handflächen übereinander – »das aber will ich, und will er's nicht, nun –«
Mein Vater hatte sich von Neuem in einen Zorn hineingesprochen, der um so heller aufflammte, je ruhiger meine Haltung war. Seltsam! hätte ich mich auf Bitten und Flehen gelegt, ich bin überzeugt, mein Vater würde mich verachtet haben; aber weil ich that, was er, wäre er in meiner Lage gewesen, ganz gewiß auch gethan haben würde; weil ich trotzig und stumm war, haßte er mich in diesem Augenblicke, wie man das haßt, was sich uns in den Weg stellt, über das wir fort müssen und das wir dennoch nicht mit dem Fuß verächtlich bei Seite stoßen können.
»Sie haben sich ein schweres Vergehen zu Schulden kommen lassen, Georg Hartwig,« declamirte der Professor weiter; – »Sie haben sich ohne die Erlaubniß Ihrer Lehrer aus dem Gymnasium entfernt. Ich will nicht sprechen von der grenzenlosen Mißachtung, mit welcher Sie wiederum, wie schon so oft in anderer Weise, die Ihnen gebotene kostbare Gelegenheit, sich zu unterrichten, von sich gewiesen haben; ich will nur sprechen von der schlimmen moralischen Schuld des Ungehorsams, der frechen Auflehnung gegen das Gebot, dem bösen Beispiel, das Sie durch dies schändliche Betragen Ihren Mitschülern geben. Wenn Arthur von Zehrens leichter Sinn sich endlich in entschiedenen Leichtsinn umgewandelt hat, so ist das die böse Frucht dieses Beispiels, denn nimmermehr würde jener bethörte Jüngling gewagt haben, was er heute gewagt hat. –«
Hier brach ich, der ich den bethörten Jüngling besser kannte, in ein kurzes, höhnisches Gelächter aus, welches den Professor vollständig aus der Fassung brachte. Er griff nach seinem Hut und wollte sich, unverständliche Worte murmelnd, die vermuthlich seine Ueberzeugung, daß ich rettungslos verloren sei, ausdrücken sollten, entfernen. Mein Vater vertrat ihm den Weg.
»Noch einen Augenblick, Herr Professor,« sagte er; und dann sich zu mir wendend: »Du wirst jetzt sofort Deinen Lehrer wegen dieser neuen Frechheit um Verzeihung bitten; sofort!«
»Nein,« sagte ich.
»Sofort!« donnerte mein Vater.
»Nein,« sagte ich noch einmal.
»Willst Du, oder nicht?«
Er stand vor mir, vor Zorn am ganzen Leibe bebend. Sein immer etwas gelbliches Gesicht war aschfarben, auf seiner Stirn lag eine Ader wie ein Ast, seine Augen blitzten. Er hatte die letzten Worte in einem heiseren, zischenden Ton gesprochen.
»Nein,« sagte ich.
Mein Vater hob den Arm zu einem Schlage, aber er schlug mich nicht; der Arm senkte sich langsam, und die ausgestreckte Hand deutete nach der Thür: »Hinaus«, sagte er langsam und fest: »aus meinem Hause, für immer!«
Ich sah ihm starr in die Augen; ich wollte etwas erwiedern; vielleicht: Vergieb mir, vergieb Du mir, Dich will ich um Verzeihung bitten! – aber das Herz lag mir wie ein Stein in der Brust, meine Zähne waren wie von einem Schraubstock zusammengepreßt; ich konnte sie nicht auseinanderbringen; ich konnte kein Wort hervorbringen; ich ging stumm nach der Thür.
Der Professor eilte mir nach und ergriff mich beim Arm, gewiß in der besten Absicht; aber ich sah in ihm nur den, der schuld war, daß es so gekommen; ich stieß ihn unsanft auf die Seite, schlug die Thür hinter mir zu, rannte an der alten Dienerin vorüber – sie mochte gehorcht haben, die gute Seele, und stand jetzt, die Hände ringend, ein Bild trostlosen Jammers da – zum Hause hinaus auf die Gasse.