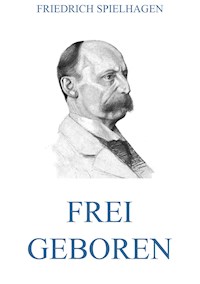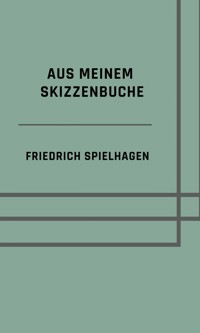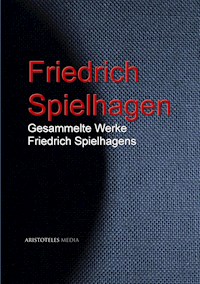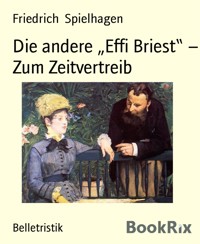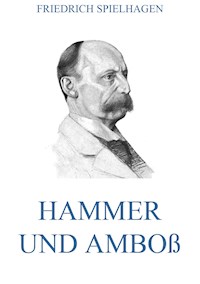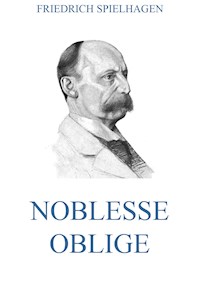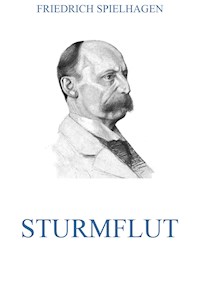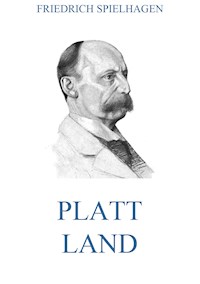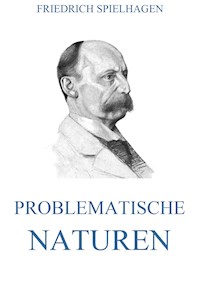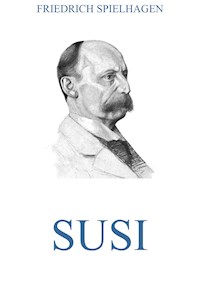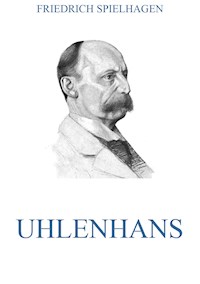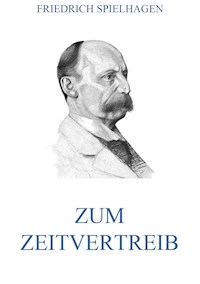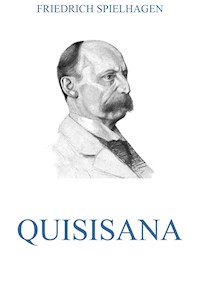
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Novelle aus der Feder des Autors, der auch für Klassiker wie "Sturmflut" verantwortlich zeichnet. Friedrich Spielhagens Werke sind stark geprägt von seiner Liebe zum Meer, die er in seiner Zeit in Stralsund entwickelte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quisisana
Friedrich Spielhagen
Inhalt:
Friedrich Spielhagen – Biografie und Bibliografie
Quisisana
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
Quisisana, F. Spielhagen
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849636425
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Spielhagen – Biografie und Bibliografie
Romanschriftsteller, geb. 24. Febr. 1829 in Magdeburg als Sohn eines preußischen Regierungsrates, verbrachte sein Jugend in Stralsund (ein großer Teil seiner spätern Romane spielt an diesem Teile der Ostseeküste und auf der Insel Rügen), absolvierte hier das Gymnasium, studierte von 1847 an anfangs die Rechte, dann Philologie und Philosophie in Berlin, Bonn und Greifswald, war einige Zeit als Lehrer tätig, widmete sich aber bald ausschließlich der Literatur. Neben Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen, von denen wir die »Amerikanischen Gedichte« (Leipz. 1856, 3. Aufl. 1871) nennen, veröffentlichte er schon in Leipzig die Novelle »Klara Vere« (Hannov. 1857) und das Idyll »Auf der Düne« (das. 1858), die jedoch nur geringe Beachtung fanden. Eine um so glänzendere Aufnahme fand der erste größere Roman Spielhagens: »Problematische Naturen« (Berl. 1860, 4 Bde.; 22. Aufl., Leipz. 1900), mit seiner abschließenden Fortsetzung: »Durch Nacht zum Licht« (Berl. 1861, 4 Bde.). Dieser Roman gehörte durch Lebendigkeit des Kolorits und eine in den meisten Partien künstlerisch ansprechende Darstellung zu den besten deutschen Romanen seiner Zeit. S. war inzwischen 1859 von Leipzig nach Hannover und Ende 1862 nach Berlin übergesiedelt, wo er kurze Zeit die »Deutsche Wochenschrift« und das Dunckersche »Sonntagsblatt« redigierte. Auch von der Herausgabe von Westermanns »Illustrierten deutschen Monatsheften«, die er 1878 übernommen, trat er 1884 wieder zurück. Sein zweiter großer Roman: »Die von Hohenstein« (Berl. 1863, 4 Bde.), der die revolutionäre Bewegung von 1848 zum Hintergrund hatte, eröffnete eine Reihe von Romanen, welche die Bewegungen der Zeit zu spiegeln unternahmen. War hierdurch ein gewisses Übergewicht des tendenziösen Elements gegenüber dem poetischen unvermeidlich, und standen die Romane: »In Reih' und Glied« (Berl. 1866, 5 Bde.) und »Allzeit voran!« (das. 1872, 3 Bde.) wie die Novelle »Ultimo« (Leipz. 1873) allzu stark unter der Herrschaft momentan in der preußischen Hauptstadt herrschender Interessen, so erwiesen andre freiere Schöpfungen den Gehalt, die Lebensfülle und die künstlerische Gewandtheit des Verfassers. Neben der Novelle »In der zwölften Stunde« (Berl. 1862), den unbedeutendern: »Röschen vom Hofe« (Leipz. 1864), »Unter Tannen« (Berl. 1867), »Die Dorfkokette« (Schwerin 1868), »Deutsche Pioniere« (Berl. 1870), »Das Skelett im Hause« (Leipz. 1878) und den Reiseskizzen: »Von Neapel bis Syrakus« (das. 1878) schuf S., unabhängiger von den momentanen Tagesereignissen oder sie nur in ihren großen, allgemein empfundenen Wirkungen auf das deutsche Leben darstellend, die Romane: »Hammer und Amboß« (Schwer. 1868, 5 Bde.), »Was die Schwalbe sang« (Leipz. 1872, 2 Bde.) und »Sturmflut« (das. 1876, 3 Bde.), ein Werk, worin der Dichter, besonders im ersten und letzten Teile, auf der vollen Höhe seiner Darstellungskunst steht, und worin er in glücklicher Symbolik das Elementarereignis der Ostseesturmflut mit der wirtschaftlichen Sturmflut 1873 im Zusammenhange erzählt; den Roman »Platt Land« (das. 1878, 3 Bde.), die seine, nur etwas allzusehr zugespitzte Novelle »Quisisana« (das. 1879) sowie die Romane: »Angela« (das. 1881, 2 Bde.), »Uhlenhans« (das. 1884, 2 Bde.), »An der Heilquelle« (das. 1885), »Was will das werden« (das. 1886, 3 Bde.), »Noblesse oblige« (das. 1888), »Ein neuer Pharao« (das. 1889), »Sonntagskind« (das. 1893, 3 Bde.), »Susi« (Stuttg. 1895), »Zum Zeitvertreib« (Leipz. 1897), »Faustulus« (das. 1898), »Opfer« (das. 1900), »Frei geboren« (das. 1900), »Stumme des Himmels« (1903). Eine Abnahme der dichterischen Kraft Spielhagens ist seit der »Sturmflut« nicht zu verkennen; seine Darstellungsweise geriet immer mehr in den Stil des in sich selbst eingesponnenen Reflektierens, statt des einfach konkreten Gestaltens. Auch kam S. über den Standpunkt des liberalen Achtundvierzigers und des Liberalen aus der Konfliktszeit nicht mehr recht hinaus, und der große Meister der Zeitschilderung verstand nicht mehr den »neuen Pharao«. Nur in den kleinern Werken: »Deutsche Pioniere« und »Noblesse oblige«, streifte S. vorübergehend das Gebiet des historischen Romans. Mit dem nach einer eignen Novelle (Berl. 1868) bearbeiteten und an mehreren Theatern erfolgreich aufgeführten Schauspiel »Hans und Grete« (das. 1876) wendete er sich auch der Bühne zu. Größern Erfolg hatte das Schauspiel »Liebe für Liebe« (Leipz. 1875), in dem die Kritik neben novellistischen Episoden einen wahrhaft dramatischen Kern anerkannte. Außerdem brachte er die Schauspiele: »Gerettet« (Leipz. 1884), »Die Philosophin« (das. 1887) und »In eiserner Zeit«, Trauerspiel (das. 1891). Von S. erschienen ferner: »Vermischte Schriften« (Berl. 1863–68, 2 Bde.), »Aus meinem Skizzenbuch« (Leipz. 1874), »Skizzen, Geschichten und Gedichte« (das. 1881), »Beiträge zur Theorie und Technik des Romans« (das. 1883), »Aus meiner Studienmappe« (Berl. 1891), »Neue Beiträge zur Theorie und Technik der Epik und Dramatik« (Leipz. 1898), »Am Wege«, vermischte Schriften (das. 1903) und eine Sammlung seiner formschönen »Gedichte« (das. 1892) und »Neuen Gedichte« (das. 1899). Die letzte Ausgabe seiner »Sämtlichen Romane«, die alle zahlreiche Auflagen erlebten, erschien in 29 Bänden (Leipz. 1896 ff.). S. schrieb auch seine Selbstbiographie: »Finder und Erfinder, Erinnerungen aus meinem Leben« (Leipz. 1890, 2 Bde.), die aber wesentlich nur die innere und äußere Entstehungsgeschichte seiner »Problematischen Naturen« erzählt. Vgl. Karpeles, Friedrich S. (Leipz. 1889), und die Festschrift zu Spielhagens 70. Geburtstag: »Friedrich S.« (das. 1899).
Quisisana
I.
Warum wecken Sie mich, Konski?
Sie lagen wieder einmal auf der linken Seite, erwiderte der Diener, indem er seinen Herrn, den er um Brust und Schulter gefaßt hielt, vollends von dem Sofa in die Höhe richtete; und Champagner haben Sie bei Tisch auch getrunken – über eine Flasche, sagt der Johann; das ist nun der reine –
Konski brach kurz ab und wandte sich zu den Koffern, deren einer bereits aufgeschlossen war; er begann den Inhalt in die Kommode zu packen und sagte dabei, scheinbar mehr mit sich selbst, als zu seinem Herrn sprechend:
Ich tue nur, was mir der Herr Sanitätsrat befohlen, noch gestern abend in Berlin, als ich ihm hinunterleuchtete. Konski, hat er gesagt, wenn Ihr Herr auf der linken Seite liegt und so zu stöhnen beginnt, wecken Sie ihn bei Tag oder Nacht – auf meine Verantwortung. Und, Konski, Champagner ist nicht – für mindestens sechs Wochen, und am liebsten gar nicht mehr; und wenn ihr erst in Italien seid, den Wein immer nur mit Wasser, Konski, und –
Und nun tun Sie mir den Gefallen und schweigen Sie.
Bertram war von dem Sofa, auf dem er, die Stirn in die Hand gedrückt, sitzengeblieben war, rasch aufgestanden und trat jetzt, nachdem er ein paarmal, unmutige Blicke auf Konski werfend, in dem Gemach hin und wider geschritten, an eines der Fenster. Die Sonne mußte im Untergehen sein; nur noch die bewaldeten Berge drüben waren hell beleuchtet, während der Terrassengarten, der in das Tal hinabstieg, und das Tal selbst mit dem Dorfe bereits in tiefem Schatten lagen. Das landschaftliche Bild, dessen Anmut er doch sonst so zu schätzen wußte, übte nicht den mindesten Zauber auf seinen dumpfen Sinn. Konski hatte recht: der Champagner, den er gegen das ausdrückliche Verbot des Arztes heute zum erstenmal nach der Krankheit getrunken, war ihm nicht gut bekommen; aber er hatte getrunken, um sich die Kehle, die ihm von dem vielen Sprechen trocken geworden, anzufeuchten; und hatte so viel gesprochen, weil die häufigen Pausen, die in der Unterhaltung eintraten, ihn nervös machten. Es war positiv langweilig gewesen; die schöne Freundin und der gute Freund hatten sich in den letzten drei Jahren sehr zu ihrem Nachteil verändert. Oder war er's, der sich verändert hatte? fing er wirklich an, alt zu werden? Man darf mit fünfzig Jahren nicht schwer erkranken, wenn es nicht auf einmal bergab gehen soll.
Das war nun das zweite energische Memento mori – nach einer Zwischenzeit von zwanzig Jahren! Und das erste – das hatte er ihr verdankt – ihr, die ihm Treue geschworen unter tausend Küssen – da – drüben am Bergeshang, wo die Rieseneiche ihre Krone hoch heraushob aus dem bronzenen Blätterdach der Buchen. Warum, zum Kuckuck, gab man ihm denn immer diese Zimmer? Er wollte sich noch heute abend andere von Hildegard ausbitten, gleich – ehe der Dummkopf, der Konski noch alles auspackt.
Lassen Sie das! rief er, sich umwendend; ich will nicht in diesen Zimmern bleiben – ich will überhaupt nicht bleiben; wir reisen vielleicht morgen schon wieder ab.
Konski, der bereits in der Tiefe des zweiten Koffers kramte, glaubte nicht recht gehört zu haben. Er hob den Kopf und blickte den Herrn verwundert an.
Morgen, Herr Doktor? ich denke, acht Tage mindestens.
Tun Sie, was ich Ihnen sage!
Konski legte das Paket Hemden, das er in der Hand hielt, wieder in den Koffer zurück und erhob sich langsam von den Knien. Der Herr war offenbar in einer greulichen Laune; aber das hält bei ihm niemals lange an, dachte Konski, und dann der Champagner –
Es wird mit der Einquartierung nicht so schlimm, sagte er; Sie können sich darauf verlassen, Herr Doktor; ich weiß alles ganz genau von Mamsell Christinen. Dann ein Oberst, ein Major, zwei Hauptleute und ein Dutzend! Leutnants höchstens, und vielleicht noch ein Oberstabsarzt und so was; von unseren Prinzen und von denen hier nun schon gar keiner. Na, und die paar Menschen verkrümeln sich ja in dem großen Hause wie eine Handvoll Korinthen in einer Stolle, und besonders, wenn Sie in diesen Zimmern bleiben, wo wir noch immer gewohnt haben! und kein Mensch nicht hinkommt; und im Garten werden sie ja wohl nicht manövrieren –
Ich weiß gar nichts was Sie mit Ihrem Manöver wollen! rief Bertram.
Er hatte sich wieder an das offene Fenster gestellt, durch welches ein lebhafter Zug kam; Konski ging und schloß die Tür nach dem Zimmer nebenan, trat dann in respektvoller Entfernung hinter seinen Herrn und sagte in bescheidenem, halblautem Ton:
Nehmen Sie es nicht übel, Herr Doktor; aber was ist denn am Ende daran gelegen, wenn das gnädige Fräulein nun wirklich kommt –
Was soll das nun wieder? sagte Bertram, ohne sich umzudrehen; was hat das mit meinem Bleiben oder Gehen zu tun? weshalb soll die Kleine nicht kommen?
Konski kraute sich, verstohlen lächelnd, in dem starren schwarzen Haar, senkte die Stimme noch mehr und sagte:
Nicht das junge gnädige Fräulein Erna; das andere Fräulein – das nie kommen darf, wenn Sie hier sind –
Lydie? Fräulein von Aschhof? sind Sie toll?
Bertram hatte, sich blitzschnell wendend, es mit rauher Stimme gerufen, und die sonst so freundlichen Augen leuchteten zornig. Konski erschrak, doch war die Neugier größer als der Schrecken. Er hätte so gern endlich das Richtige über das Fräulein gehört, das nicht kommen durfte, wenn der Herr in Rinstedt zu Besuch war, und das er infolgedessen noch nie gesehen, trotzdem er im Laufe der Jahre nun schon ein halbes dutzend Male mit ihm hier gewesen. Aber er wurde auch diesmal in seiner Erwartung getäuscht; der Herr war plötzlich ganz ruhig geworden, oder gab sich doch wenigstens den Anschein, und hatte auch seine gewöhnliche Stimme wieder, als er jetzt fragte:
Von wem haben Sie denn das? von Mamsell Christinen natürlich.
Natürlich von Mamsell Christinen, erwiderte Konski.
Und die hat es von der Frau Amtsrätin?
Direkte von der Frau Amtsrätin, bestätigte Konski.
Und wann wird die Dame erwartet?
Heute abend zusammen mit Fräulein Erna; und außerdem der Herr Baron von Lutter oder Lotter – ich hab's nicht recht verstanden; sie sprechen ja hier in Thüringen alles kauderwelsch.
So, so?
Bertram hatte des Barons von Lotter-Vippach über Tisch mehr als einmal von Hildegard erwähnen hören. Auch von Lydie hatte sie, trotzdem er grundsätzlich nie auf das Thema einging, immer wieder angefangen zu sprechen, wie es jetzt klar war, in der Absicht, ihn auf den Überfall vorzubereiten. Aber sie hatte sich verrechnet, die schöne Frau; es war dies eine Rücksichtslosigkeit, ja schlimmer: es war eine Perfidie. Er brauchte sich das nicht gefallen zu lassen, und er wollte es sich nicht gefallen lassen.
Wo sind die Herrschaften? fragte er.
Der Herr Amtsrat ist in den Wald nach den Braunkohlengruben geritten; die Frau Amtsrätin ist ins Dorf gegangen; sie haben hinterlassen, daß sie zurück sein würden, bevor Sie aufwachten, und wenn Sie sich nicht auf die linke Seite gelegt hätten –
Es ist gut – ins Dorf, sagten Sie? geben Sie mir meinen Hut!
Nehmen Sie auch den Überzieher, sagte Konski, es kommt ganz kalt vom Tal herauf, und vor Erkältungen, meinte der Herr Sanitätsrat –
Bertram, der bereits den Hut auf dem Kopfe hatte, wies das dargereichte Kleidungsstück mit einer Handbewegung zurück. In der Tür wandte er sich:
Machen Sie sich keine unnötige Mühe mit den Koffern; wir reisen in einer Stunde wieder ab. Und noch eins: wenn Sie Mamsell Christinen oder irgend jemand hier im Haus jetzt oder in Zukunft ein Wort – Sie verstehen mich – und ich erfahre es – so sind wir geschiedene Leute – trotz alledem.
Damit war er zur Tür hinaus, und schon in der nächsten Minute sah ihn Konski, der nun, sich das Haar krauend, am Fenster stand, mit langen Schritten durch den Garten bergabwärts eilen.
Sollte man denken, daß der vor noch nicht sechs Wochen auf den Tod gelegen hat? murmelte er. – Und heute abend fort? in einer Stunde! Fällt mir gar nicht ein; erst wird das mit Christinen in Ordnung gebracht, und das geht nicht so fix. – Er hat sich damals von dem Fräulein einen Korb geholt, sagt Christine – na, das verstehe ich nicht: vor zwanzig Jahren muß er doch ein blitzschöner Kerl gewesen sein – ist's ja beinah noch – und arm war er auch nicht, obgleich wir ja seitdem viel dazugeerbt haben. Ich bin höllisch neugierig auf das alte Fräulein; daß sie heute abend kommt, steht bombenfest.
Konski warf einen zweifelhaften Blick auf die unausgepackten Koffer. Es war vielleicht wirklich unnötige Mühe. Aber es wird ja nichts so heiß gegessen, wie es gekocht ist; und daß der Herr vor einem Frauenzimmer weglaufen sollte, wenn sie auch ihre vierzig Jahre oder so was –
Konski schüttelte ungläubig den Kopf und machte sich getrost daran, die Koffer vollends auszupacken.
II.
Unterdessen hatte Bertram schon die Brücke, welche am Fuße der Gartenterrasse über den Bach führte, passiert und eilte auf dem Wiesenrain dem Dorfe zu. Hildegard hatte über Tisch gesagt, daß sie heute, wie immer am Donnerstag nachmittag, ihre neugegründete Spielschule besuchen werde; er glaubte also, die Dame leicht finden zu können. Kannte er doch von seinen häufigen Besuchen in Rinstedt jedes Gäßchen, und die Spielschule sollte an der Hauptgasse, nicht weit von der Pfarre, liegen. Was wollte er Hildegard sagen, wenn er sie traf? Zuerst natürlich die Tatsache feststellen. Aber dessen bedurfte es nicht; Konski war ein geriebener Bursche, der sich nicht leicht verhörte, und er stand mit der allwissenden Christine auf einem so guten Fuße! Also sie fragen, was sie bewogen habe, den nun schon durch beinahe zwanzig Jahre festgehaltenen Pakt diesmal zu brechen. Unnötige Frage! wann wären denn jemals Weiber konsequent gewesen! wann hätten sie sich denn nicht in solchen Dingen einander beigestanden und in die Hände gearbeitet, selbst wenn sie sich im übrigen keineswegs liebten! Und auch die Liebe schien ja jetzt zwischen den beiden groß zu sein! Hatte die schöne Frau doch, ganz gegen ihre Gewohnheit, Lydies Lob in allen Tönen gesungen! und der Umstand allein, daß sie die Tochter zu ihr in Pension gegeben, drei Jahre in dieser Pension gelassen, sagte ja mehr als genug. Die arme Erna! drei Jahre unter der Obhut des überspannten Frauenzimmers! das schöne, anmutige Geschöpf mit den großen blauen, tiefen Augen! es hätte nicht sein dürfen; es war eine Beleidigung für ihn! hatte er nicht abgeraten, was er konnte? eine vortreffliche Pension in Berlin ausgemittelt? sich erboten, die Oberaufsicht selbst zu übernehmen; dringend gebeten, ihm das Kind anzuvertrauen, dem Kinde Gelegenheit zu geben, einen Blick in größere Verhältnisse zu werfen? Und man hatte zu allem ja gesagt; war so dankbar gewesen für seine Bemühungen, seine Güte, um im letzten Augenblicke in den geliebten Sumpf der Misere der kleinen Residenzstadt zurückzuplumpen. Freilich, man war ja selbst in dem Sumpfe groß geworden, schwärmte noch immer sanft von der versunkenen klassischen Herrlichkeit, beklagte im stillen das traurige Los, welches dem Freifräulein von Unkerode nicht wie Lydien hatte gewähren wollen, sich zeitlebens in den unmittelbaren Strahlen fürstlicher Gnade zu sonnen; daß sie einen Mann hatte heiraten müssen, der, wie reich auch immer, doch ein Bürgerlicher war mit dem höchst bürgerlichen Namen Bermer und bürgerliche Freunde halte, an die man die allerfreundschaftlichsten, liebenswürdigsten Briefe unweigerlich seit zwanzig Jahren mit Sr. Wohlgeboren adressierte. Da war denn freilich ein Baron von Lotter-Vippach vorzuziehen! Und ihm den Menschen aufzudringen, trotzdem er doch ausdrücklich befürwortet, daß er, als halber Rekonvaleszent, der größten Ruhe bedürfe; und, wenn sie Gesellschaft hätten, lieber auf das Vergnügen, die Freunde zu sehen, jetzt verzichten wolle und vorsprechen werde, wenn er im Frühjahr aus Italien heimkehre!
So! das war's ungefähr, was er der schönen Frau sagen wollte – in aller Ruhe und Freundschaft natürlich – nur mit einem feinen ironischen Anfluge – und das neue Gebäude da mußte die Spielschule sein.
Es war die Spielschule; aber das junge Mädchen, das die in dem Vorgärtchen sich herumtummelnden Kinder beaufsichtigte, sagte durch das Gitter, die gnädige Frau sei bereits vor einer halben Stunde fort; sie glaube, in die Pfarre. Ein paar halbwüchsige Jungen, die herbeigelaufen waren, berichteten, die Frau Amtsrätin sei mit dem Herrn Pfarrer zu dem Herrn Schulzen.
Des Schulzen Hof lag an dem anderen Ende des Dorfes. Bertram wollte dorthin; aber als er bereits den halben Weg gemacht, fiel ihm ein, daß der Pfarrer Hildegard sehr wahrscheinlich zurückbegleiten würde, und er dann doch keine Gelegenheit hätte, sich mit jener auszusprechen. Er kehrte also wieder um, sie an der Pfarre, an der sie auf dem Heimweg vorüber mußte, zu erwarten. Indessen, wie konnte er warten, da er gar nicht wußte, ob ihm dann noch Zeit blieb, seine Flucht zu bewerkstelligen, er vielmehr jeden Augenblick fürchten mußte, daß der Wagen, der sie aus der Stadt brachte, die Dorfstraße herauf an ihm vorüberkam. Und hier so zu stehen und sie grüßen zu sollen – nimmermehr! Links ab führte ein schmales Gäßchen unmittelbar in den Wald, der sich auf der Höhe bis hart an das Schloß heranzog. Der Weg war ein wenig länger als der, welchen er gekommen, auch etwas steiler, aber jedenfalls viel kürzer als die Fahrstraße, die, nachdem sie sich am Eingange des Seitentales von der Chaussee im Haupttale abgezweigt, erst das ganze Dorf durchschnitt und sich dann in einer langen Serpentine den Schloßberg hinaufwand. So hatte er noch immer den Vorsprung von mindestens einer halben Stunde. Hoffentlich war Otto mittlerweile von dem Braunkohlenwerke, das nach der anderen Seite im Walde lag, zurück. Er wollte dann dem Freunde reinen Wein einschenken und ihn zum Überbringer seiner Empfehlungen an Hildegard machen. Es würde ein schlimmer Auftrag für den armen Pantoffelhelden sein; aber schlimm oder nicht: jeder ist sich selbst der Nächste, und man stand ja einmal in dem Ruf eines eingefleischten Egoisten! Dann brachte ihn ein schnell angespannter Wagen – Konski mochte, wenn es sein mußte, mit den Koffern zurückbleiben – in zwei oder drei Stunden erst durch den Wald, nachher wieder auf der Chaussee nach Fichtenau. Er liebte Fichtenau. Er würde in dem immergrünen Tal ein paar Tage bleiben, sich von den Strapazen der Reise und dem Ärger des heutigen Tages zu erholen. Auf jeden Fall war er Lydie entgangen, der Schlinge entwichen, welche die Weiber für ihn gestellt – das war eine Genugtuung, die er sich schuldig war, und die ihm den rauhen Waldpfad, den er jetzt betreten, ebnen mochte.
Freilich, der Pfad war rauh, viel rauher, als er ihn in der Erinnerung hatte. Viel rauher und auch viel steiler, in der Tat abscheulich steil – gleichviel, er mußte – immer an dem Bächelchen hin, das in der Schlucht neben ihm murmelte und unten in den Dorfbach fiel – bald an den Steg gelangen, der auf die andere Seite führte; dann ging es glatt oder doch so ziemlich glatt auf der halben Höhe bis zum Schloß.
Was hatte sie nur mit dem Pfarrer bei dem Schulzen zu suchen? Einquartierungsangelegenheiten vermutlich – die Vielgeschäftige bekümmerte sich ja um alles! – oder auch wieder irgend ein wohltätiger Zweck: Armenpflege, Krankenpflege – sie gönnte sich keine Ruhe und Rast in der Verfolgung so edler Ziele, seitdem die Landesmutter mit leuchtendem Beispiele vorangegangen – nur, sich bis zum anderen Ende des Dorfes zu begeben, wenn man bereits einen Gast im Hause hatte und andere Gäste jede Minute eintreffen konnten, war doch etwas sehr rücksichtslos von der Rücksichtsvollen. Vielleicht wollte man gerade dem einen aus dem Wege gehen, und der Weg der anderen führte an dem Schulzenhause vorüber. Man setzte sich dann zu ihnen in den Wagen und hatte auf der Fahrt durch das Dorf noch Zeit zu ein paar vertraulichen Mitteilungen und nützlichen Winken betreffs der Behandlung des mit solcher Schlauheit eingefangenen dummen Vogels. Noch nicht gefangen, meine Gnädigste, noch nicht!
Aber wo blieb der Steg? er hätte längst da sein müssen. Und die tiefe Schlucht hinunter- und auf der anderen Seite wieder hinaufzuklettern, nachdem man sich unten im Bach nasse Füße geholt – hatte sich denn heute alles gegen ihn verschworen!
Endlich: ein nagelneuer Steg, den man an Stelle des morschen alten ein verteufeltes Ende bachaufwärts regelrecht gezimmert mit obligaten schmuckhaften Geländern aus geschwungenen und verschlungenen Baumästen.
Der Pfad drüben war neu wie der Steg – ein richtiger Promenadenpfad, jedenfalls in das System der Pfade gehörig, womit Hildegard bereits seit Jahren die Wälder ringsum zu durchflechten sich bemühte. Die Verschönerungsleidenschaft Charlottens aus den Wahlverwandtschaften – das gehörte ja notwendig zu den Requisiten einer Chatelaine hierzulande – selbstverständlich ohne zarte Hinneigung für die wohlgeborenen Freunde ihres Gatten. Nun, er hatte die unnahbare Tugend der schönen Frau nie bezweifelt; und wenn sie sich jetzt ein ganz klein wenig aufs Kuppeln legte, so war das gewiß nur ein Ausfluß der überschwenglichen Güte ihres keuschen, kühlen, menschenfreundlichen Herzens. – Möchte nur wissen, ob die Menschenfreundlichkeit vor dem Klopfen und Bohren hier auch nur fünf Minuten standhielte! Jetzt fehlte bloß, daß ich mir durch das unsinnige Laufen und Klettern einen Rückfall geholt; dann könnte die Geschichte schließen, wo sie angefangen, und Lydie käme gerade zur rechten Zeit, um sich zu überzeugen, daß, was die Leute vom Herzbrechen erzählen, doch nicht so ganz ein Märchen ist. Pah! wenn meines bricht, so ist's, weil es einen bösen Klappenfehler hat und ich zur Unzeit Champagner getrunken.
Er hatte sich auf eine Bank fallen lassen, die an der Wegseite stand, und saß da, zusammengekrümmt, das Taschentuch vor den Mund pressend, damit sein Stöhnen nicht zu laut in den stillen Wald hallte.
Der Anfall ging vorüber; in der Brust wurde es wieder still; mit den wilden Schmerzen war die grimme Leidenschaft entwichen, in die er sich hineingearbeitet. Dafür fühlte er eine peinliche Schwere und Mattigkeit in den Gliedern, und im Kopf war es so dumpf und wüst.
Wenn es nun gebrochen wäre! so hier im Walde, wer weiß wie lange, ein toter Mann, zu sitzen und den Armen, der zuerst vorüberkam, grausam zu erschrecken – der Gedanke war nicht behaglich; aber das war denn auch das Schlimmste. Vor dem Tode fürchtete er sich nicht: der Tod war nur das Ende des Lebens. Und das Leben? wenn er sich sagen durfte, daß er niemand zuleide lebte, außer etwa dem braven Konski, den er mit seinen Grillen quälte – so lebte er auch niemand zur Freude – am wenigsten sich selbst. Die paar armen Schlucker von Studenten und jungen Künstlern würden ihre Pensionen auch nach seinem Tode die bestimmte Zeit ausgezahlt erhalten, und ein paar gemeinnützige Institute mochten sich in den Rest teilen. Das würde ganz glatt und geschäftsmäßig abgehen und keinen Menschen auch nur eine Träne kosten; es hätte denn Konski sein müssen, nur daß es unmöglich war, sich den leichtlebigen Gesellen in Tränen zu denken.
Auf dem Wipfel der Buche, an deren Fuße er saß, schrie eine Krähe.
Du wirst dich schon noch ein wenig gedulden müssen, sagte Bertram aufblickend.
Aber der Krähenschrei hatte wohl nicht ihm gegolten, sondern der Dame, die er jetzt den Seitenpfad herabkommen sah, der aus dem Walde gerade auf die Bank zuführte. Sein Herz wollte sich wieder zusammenkrampfen; aber er hatte sich mit dem zweiten Blick überzeugt, daß es nicht Lydie war. Lydie war größer und hatte aschblondes Haar, und die Dame hatte dunkles, sehr dunkles; sie ging auch anders: in einem leichten, gleichmäßigen Schritt, so daß es war, als ob sie den ziemlich steilen Pfad herabschwebte, trotzdem er die Füße deutlich unter dem hellen Kleide sich bewegen sah. Und jetzt war sie bis dicht vor ihn gelangt. Sie schrak ein wenig zusammen, denn sie hatte, nach der schreienden Krähe emporschauend, ihn nicht bemerkt, und er war so plötzlich von der Bank aufgefahren; doch faßte sie sich bald wieder, und ebenso schnell entwich die Röte, die sich über ihre Wangen ergossen.
Ist es möglich? – Erna!
Onkel Bertram!
Es war ein melodischer Klang in der Stimme, aber nicht die leiseste Spur von der freudigen Erregung, die er beim Erblicken seines Lieblings empfunden. Sein Herz zog sich zusammen, er wollte sagen: du hast mich sonst anders empfangen, aber er schämte sich, dem schönen Mädchen als ein Bettler gegenüberzutreten, und sagte nur, indem er ihre Hände losließ:
Du hast mich hier nicht vermutet?
Wie konnte ich? erwiderte sie.
Sehr richtig! dachte Bertram; wie konnte sie! es war eine dumme Frage.
Er wußte nicht, was er weiter vorbringen sollte, und schwieg verlegen. Die Krähe, die während der letzten halben Minute still gewesen, brach in ein abscheuliches Krächzen aus und flog über ihre Häupter weg in den Wald. Sie hatten beide unwillkürlich in die Höhe gesehen und gingen dann schweigend nebeneinander hin den Pfad entlang.
III.
Das mattere Licht des hereinbrechenden Abends drang nur spärlich durch das dichte Unterholz, das den Pfad auf beiden Seiten begrenzte, während die ineinandergreifenden Kronen der Buchen ihn oft genug gänzlich überdachten; an einer abschüssigen Stelle waren ein Paar rauhe Stufen eingefügt.
Willst du meinen Arm nehmen, Onkel Bertram? fragte Erna.
Es war das erste Wort, seitdem sie vor ein paar Minuten, die bleiern auf Bertram gelastet, die Bank verlassen hatten.
Ich wollte dieselbe Frage eben an dich richten, erwiderte er.
Ich danke, sagte Erna; – ich kenne hier jeden Schritt, aber du – und du bist krank gewesen.
Das mochte ja freundlich gemeint sein, nur daß es wieder so kühl herauskam – so almosenhaft, dachte Bertram.
Gewesen, entgegnete er, und längst hergestellt – völlig.
Ich denke, du gehst für den Winter nach Italien zu deiner Erholung?
Ich gehe nach Italien, weil ich hoffe, daß ich mich in Rom ein wenig weniger langweilen werde als in Berlin – das ist alles.
Und wenn du dich nun auch in Rom langweilst?
Du meinst, langweilige Leute langweilen sich überall?
Das meine ich nicht; es wäre auch recht häßlich gewesen, wenn ich es gemeint hätte; – ich wollte nur wissen, wohin man von Rom geht, wenn man noch weiter will – nach Neapel – nicht wahr?
Ja wohl: nach Neapel – Capri. Auf Capri steht mitten in Orangengärten mit herrlichstem Ausblick in die blaue Unendlichkeit des Meeres ein weißes, rosenübersponnenes Gasthaus: Quisisana. Ich war vor langen Jahren dort, und seitdem hat's mich immer dahin sehnlich gezogen, Qui si sana! Das klingt so tröstlich! so verheißend: Hier gesundet man! Auch wenn man sich leidlich gesund fühlt – zu gesunden hat man immer, zum Beispiel vom Leben, das im Grunde doch eine lange Krankheit ist, von der uns gründlich nur der Tod kuriert.
Wieder trat eine Pause ein. Er hatte die Unterhaltung nicht wieder ins Stocken kommen lassen wollen, und doch war, was er da eben noch unter dem Eindruck der krankhaften Verstimmung gesagt, wohl recht wenig geeignet, das schöne, wortkarge junge Mädchen an seiner Seite zum Sprechen zu bringen. Er hätte es gern getan; es fiel ihm nicht bei, ihre Schweigsamkeit auf Gedankenlosigkeit oder auch nur Befangenheit zurückzuführen. Im Gegenteil: sie interessierte ihn mit jedem Augenblicke mehr, und er hatte durchaus den Eindruck, daß er es mit einem höchst eigenartigen, in seiner Kraft sicher ruhenden Wesen zu tun habe, in dem er von dem Kinde, das er gekannt und geliebt, und dessen Bild er treu in der Erinnerung bewahrt, kaum einen Zug wieder zu entdecken vermochte.
Du weißt, Onkel Bertram, daß du Fräulein von Aschhof – Tante Lydie – heute abend sehen wirst? begann sie plötzlich.
Bertram zuckte zusammen; der Name hatte aus diesem schönen, keuschen Munde einen doppelt häßlichen Klang.
Ich weiß es – nicht von deinen Eltern – aber ich weiß es, erwiderte er.
Sie werden sich gescheut haben, es dir mitzuteilen, fuhr Erna fort; Mama hat sehr ungern ihre Erlaubnis gegeben, daß Tante kommen durfte; aber Tante hat so sehr gebeten, sie möchte dich nur noch einmal wiedersehen, und sie dachte, jetzt, wo du schwer krank gewesen bist und auf so lange Zeit verreist, wärest du vielleicht in einer milderen Stimmung. Und doch fürchtet sie sich, dir zu begegnen; sie war unterwegs so nervös, es fehlte, glaube ich, nicht viel, so wäre sie ausgestiegen und hätte uns allein weiterfahren lassen. Ich konnte ihre Unruhe kaum noch mit ansehen und fühlte mich ordentlich erleichtert, als ich selbst ausgestiegen war, um über den Berg zu gehen – von Fischbach aus, weißt du – und während ich herüberkam, fragte ich mich, ob ich dich, wenn ich vor ihnen nach Hause käme, nicht bitten dürfte, ein bißchen freundlich gegen die Tante zu sein; du bist – aber ich weiß nicht, ob ich weitersprechen darf –
Ich bitte dich darum.
Ich wollte nur noch sagen: du bist es ihr schuldig.
Bin ich das?
Ich sollte meinen, denn sie hat doch nichts getan, als daß sie dich geliebt hat und noch liebt, während du –
Ich bitte dich, liebes Kind, sprich ohne Scheu weiter; es liegt mir viel, sehr viel daran.
Während du sie verlassen hast, nachdem ihr ein ganzes Jahr lang verlobt gewesen seid.
Und dann habe ich ihr einen Absagebrief geschrieben, nicht wahr? und die Verlassene hat sich in ihrer Verzweiflung vierundzwanzig Stunden später mit dem Grafen Finkenburg verlobt, der sich schon lange um ihre Hand beworben? und dem alten Herrn ist die Freude darüber so zu Kopfe gestiegen, daß er nach kaum einer Woche vom Schlage getroffen wird und stirbt, ohne nur die Zeit zu haben, die schöne Braut in seinem Testamente zu bedenken? Ist es nicht so?
Laß uns abbrechen, Onkel Bertram, erwiderte Erna, ich höre aus deinen Worten und aus deinem Tone, daß du erregt bist, und ich fühle jetzt doppelt die schwere Unschicklichkeit, die ich beging, als ich um der Tante willen die Rede auf eine Angelegenheit gebracht habe, von der ich freilich nicht einmal wissen, geschweige denn sprechen sollte.
Ich kann dich leider so nicht loslassen, liebes Kind, sagte Bertram; ich muß dich noch fragen, von wem du es weißt? von Fräulein von Aschhof natürlich.
Ich finde es wenigstens nicht unnatürlich, erwiderte Erna, wenn Tante Lydie in der Aufregung, in der sie seit dem Tage ist, wo dein Besuch angekündigt war, und sie den Entschluß gefaßt hatte, dich wiederzusehen – wenn sie da ihr übervolles Herz gegen mich ausgeschüttet und mir alles gesagt, was ich ja zum größten Teil schon wußte oder doch ahnte. Und sie hat mich auf das dringendste gebeten, dir kein Wort wiederzusagen, und ist auch gewiß überzeugt, daß ich es nicht tun würde; aber ich habe es ihr versprochen, denn ich – ich habe dich immer lieb gehabt, Onkel Bertram, sehr lieb; und es tat mir weh, daß du – daß ich dich nun nicht mehr lieb haben könnte. Ich habe immer in meinem Herzen für dich Partei genommen, wenn sie sagten, daß du kalt seiest und selbstsüchtig und niemand liebtest als dich selbst. Ich habe immer gedacht: er hat nur keine gefunden, die seiner wert gewesen wäre. Und jetzt, da ich alles weiß, möchte ich sagen: vielleicht ist es auch Tante Lydie nicht gewesen; sie hat viele Eigenschaften, die mir gar nicht gefallen – aber sie wäre gewiß anders geworden, wenn du Geduld mit ihr gehabt, wenn du sie nicht verrat – verlassen hättest. Wie kann ein Mädchen gut bleiben, das der Mann, den sie liebt, verläßt! wie kann sie, hat sie ein leicht bewegliches Herz, anders als gefallsüchtig und kokett werden und Manieren annehmen, über welche die Leute spotten und lachen, oder – wenn sie stolz ist und sich ihres Unglücks schämt – kalt und herzlos und voller Verachtung gegen alle Männer, ja gegen alle Menschen.
Die kühle, leise Stimme war bis zum letzten Worte dieselbe geblieben, aber mit dieser Ruhe und Selbstbeherrschung kontrastierte auf das eindringlichste der leidenschaftliche Glanz der großen, dunkeln Augen, die jetzt zu Bertram aufblickten mit einer wundersamen Festigkeit, wie sich die Alten den Blick der Götter gedacht haben mochten, die nicht wie die Sterblichen mit den Wimpern zucken.
Das schoß durch Bertrams Seele, während sie sich so für ein paar Momente auf der Lichtung, wozu sich der enge Waldpfad erweitert hatte, gegenüberstanden; und daß keine Rücksicht ihn verdammen könne, vor diesen Augen als ein Schacher dazustehen, und daß er das graue Gespinst, welches die Lüge zwischen ihr und ihm gewoben, zerreißen müsse, es koste, was es wolle.
Er nahm ihren Arm, wie um sich zu versichern, daß sie ihm nicht entfliehe, und sagte, indem er sie hastigen Schrittes fast mit sich fortzog:
Und nun höre auch mich und verachte mich, wenn du es noch kannst, nachdem du mich gehört. Verlassen, sagst du, verlassen und verraten! ja wohl! aber wer den Verrat geübt, das war sie – den schmählichsten, greulichsten Verrat, dem auch keine Spur einer Entschuldigung innewohnt, wenn anders irgend etwas den Verrat entschuldigt. Ich habe sie geliebt – ich sage nicht, wie nur ein Mensch lieben kann – ich weiß nicht, wie andere Menschen lieben – ich weiß nur, daß ich sie geliebt mit meines Herzens bester, reinster Kraft. Ich war kein Jüngling mehr, als ich die Jugendfreundin deiner Mutter auf deiner Eltern Hochzeit kennen lernte; ich war ein Mann von fast dreißig Jahren – ich lebte in Leipzig, wie du weißt, als Privatgelehrter, wie sie's nannten, denn ich hatte den Plan meiner Studien allzu groß angelegt, und da ich's mit der Wissenschaft und der Kunst ernsthaft nahm, wie mit allen übrigen Dingen, arbeitete ich jahrelang an Aufgaben, die Leute, die weniger Zeit oder mehr Genie haben, in ebenso vielen Monaten lösen. Auch hatte ich, was ich zum Leben gebrauchte, vielleicht etwas mehr – ich war nicht gewohnt, darauf zu achten. Das wurde nun mit einem Schlage anders, als ich sie liebte und mich wiedergeliebt glaubte – wir hatten uns hier bei deinen Eltern noch wiederholt gesehen und hatten uns verlobt, wenn auch nur in aller Heimlichkeit, um die ich selbst gebeten. Ich begriff, daß der Bräutigam, der Gatte eines so glänzenden, gefeierten Mädchens, wie Lydie von Aschhof, etwas Besseres sein mußte als ein obskurer Privatgelehrter; es kostete mich keine Mühe mehr, mich zusammenzuraffen, entschlossen auf meine Ziele loszugehen. Aber freilich, einige Zeit dauerte es denn doch, bis mein großes Werk vollendet. Ihr dauerte es zu lange; oder zweifelte sie an dem Erfolge, oder galt ihr ein derartiger Erfolg im Grunde nichts trotz der Schwärmerei, die sie für meine Bestrebungen affichierte, und trotzdem sie die Güte hatte, mir tausendmal zu sagen, daß mein Geist, mein Talent sie gefesselt habe und gefesselt halten werde, und wenn man ihr eine Krone zu Füßen legte? Es brauchte, wie sich dann erwies, noch keine Fürstenkrone zu sein, nur eine freiherrliche – auf einem eisgrauen, dekrepiten Haupte dazu – und da schrieb sie mir den großmütigsten Absagebrief: daß sie mein stolzes Streben nur hemme, daß der Künstler, der Gelehrte frei sein müsse, daß ihr mein Ruhm teurer sei als ihre Liebe, und so noch ein paar Seiten tönender Phrasen in der zierlichsten Handschrift mit dem selbstverständlichen Schluß der Verlobungsanzeige, durch die sie, als durch ein fait accompli, ihrem schwankenden Herzen zu Hilfe kommen müsse. Der Brief war hier von Rinstedt aus geschrieben; ich stürzte zur Eisenbahn, nahm auf der letzten Station einen Wagen – die armen abgetriebenen Gäule konnten nicht weiter, als wir in Fischbach waren; ich erklomm auf dem kürzesten, steilsten Pfade den Hirschstein, über den du eben heraufgekommen bist; ich stürzte hier oben zusammen, raffte mich wieder auf, wankte weiter, weiter – bis zum Hause. Sie mochte denn doch gefürchtet haben, daß ich es nicht so geduldig nehmen würde; sie war bereits seit einer Stunde fort – nach Fichtenau, den Weg, den ich – nicht kommen konnte. Ich bin ihr nachträglich recht dankbar gewesen für ihre Umsicht und Vorsicht: ich war einfach rasend, und es war für uns beide ein Glück, daß meine Kraft gebrochen war, daß ich der Entflohenen nicht weiter nachsetzen konnte und deinen Eltern hier zur Last liegen mußte, ein todkranker, aufgegebener Mann, der sich nach sechs oder acht Wochen doch wieder erholte, um weiter zu leben, wie man denn so mit einem wunden Herzen – und diesmal nicht bloß im moralischen Sinne – weiter lebt. Was war es mir, daß, während ich hier oben mit dem Tode rang und mich dann an zwei Stöcken durch die Gartenterrassen schleppte, mein Werk herauskam und mich mit einem Schlage zu dem machte, was man hyperbolisch einen berühmten Mann nennt? daß einem alten, kinderlosen Geizhals von Onkel in derselben Zeit das Sterben ankam und mir, in Ermangelung anderer Erben, das ganze große Vermögen zufiel? Ich hatte genug erfahren von dem Lug und Trug irdischer Herrlichkeit. Ruhm, Liebe – pah! ich wurde, wofür ich meinen Bekannten gelte, und wie sie mich auch dir gegenüber genannt haben: ein kalter Selbstling, der, wenn er trotzdem die Hände nicht in den Schoß legte und weiterarbeitete und ein freies Wort, wozu andere, weniger Unabhängige, nicht den Mut fanden, hineinrief in den Streit des Tages und zu gemeinnützigen Unternehmungen anregte oder nach Kräften beitrug und hier und da einem armen Schlucker über eine Dornenhecke seines Lebensweges half – das alles nicht tat um Gottes willen, sondern um vor sich selbst das bißchen Respekt nicht zu verlieren, das zu den notwendigen Requisiten eines anständigen Egoisten gehört. Und da ich gerade von Respekt spreche, fühle ich schmerzlich, daß ich das besagte Bißchen stark vermindere, indem ich dir dies alles sage. Denn ein Gentleman muß in einer Herzenssache der Dame das erste Wort abnehmen und das letzte lassen; und wenn sie behauptet, daß er der Don Juan und sie die Elvira sei, noch obendrein sich für die zugeteilte glänzende Rolle bedanken. So, liebes Kind, und nun sei deinem alten schwatzhaften Onkel wieder gut, wie du ihm vordem gewesen – willst du?
Die erwartete Antwort blieb aus; das Gefühl der Beschämung, das über Bertram schon während seiner Erzählung gekommen war und das er durch die humoristische Wendung zuletzt vergeblich hatte abschwächen wollen, wurde durch Ernas Schweigen auf das peinlichste gesteigert. Wie hatte er sich nur so weit vergessen, sich so viel vergeben können: das tiefste Geheimnis seiner Brust, an dem er selbst abgewandten Antlitzes vorüberzugehen sich gewöhnt, einem jungen Mädchen zu enthüllen, das noch ein halbes Kind war, ohne Verständnis für so traurige, schmerzliche, häßliche Erfahrungen! und das überdies mit ihr, die er so leidenschaftlich angeklagt, in dem intimen und zarten Verhältnis der Schülerin zur Erzieherin stand! – Es war abscheulich, unwürdig! wie ein unreifer Knabe hatte er gehandelt! er wünschte sich tausend Meilen weit fort; er verwünschte seinen Mangel an Entschlossenheit, daß er nicht vor einer Stunde Knall und Fall aufgebrochen und so all diesem Wirrsal entronnen war. Jetzt wollte er, mußte er noch heute abend auf der Stelle abreisen, ohne womöglich jemand zu sehen, zu sprechen; ohne sich jedenfalls auf eine Erklärung einzulassen. Was bei den Erklärungen herauskam, er hatte es eben gekostet! er würde den bitteren Nachgeschmack sobald nicht von der Zunge verlieren!
Sie waren aus dem Walde heraus und schritten über einen Wiesenplan dem Pförtchen zu, das hier durch die dicke alte Mauer auf den Schloßhof führte.
Und du hast das alles bisher niemand gesagt? fragte Erna plötzlich.
Nein, antwortete er; – es kostete ihn Mühe, das kurze Wort herauszubringen.
Sie traten in das Pförtchen; auf dem schon von dichter Dämmerung erfüllten Hofe, in der Nähe der Rampe vor der Haustür, stand ein großer offener Reisewagen, aus welchem Diener die Sachen der abgestiegenen Herrschaften räumten; ein mit Koffern beladener kleiner Leiterwagen kam eben durch das Haupttor auf der anderen Seite, dem Pförtchen gegenüber.
Onkel Bertram! sagte Erna.
Sie hatte, gerade als sie die Schwelle des Pförtchens überschreiten wollten, mit leichtem Druck seine Hand gefaßt; er blieb unwillkürlich stehen. Sie blickte wieder zu ihm empor, aber nicht mit dem strengen Ausdruck wie vorhin im Walde. War es das Licht der Mondsichel, die drüben im Abenddämmer über den Häusern schwebte, waren es Tränen, was in den großen Augen schimmerte?
Du willst fort, Onkel Bertram?
Wer hat dir das gesagt?
Gleichviel! du willst fort?
Ja!
Bleib! ich bitte dich! um meinetwillen!
Sie ließ die Hand los, die sie bis dahin festgehalten, und eilte über den Hof nach dem Schlosse, während er das Treppchen zu dem Seitenflügel, wo seine Zimmer lagen, emporstieg, die Seele erfüllt von dem Bilde des wundersamen Mädchens, dessen Worte, dessen Blicke so zauberkräftig waren, daß er gegen ihren Willen einen eigenen Willen nicht mehr zu haben schien.
IV.
Das lange Ausbleiben des Herrn hatte nachgerade angefangen, den treuen Konski ernstlich zu beunruhigen. Zwar wußte er aus zehnjähriger Erfahrung, daß er auf Befehle, die der Herr in solcher Erregung gab, nicht viel Gewicht zu legen brauchte; und je später es wurde, desto unwahrscheinlicher wurde ja auch die angekündigte Abreise; aber wenn ihm nun unterwegs etwas zugestoßen war? Der Doktor hatte ihm auf die Seele gebunden, ernstlich darauf zu achten, daß der Herr sich wenigstens in den nächsten Wochen vor allen Strapazen sorgsam hüte, und er war die Terrassentreppen hinabgesprungen wie toll! Dies vertrackte Fräulein, das nicht kommen durfte, wenn sie hier waren! weshalb hatte er nicht reinen Mund gehalten? weshalb dem Herrn die große Neuigkeit brühwarm zutragen müssen?
Er wäre ihm am liebsten in das Dorf nachgeeilt; aber er wagte nicht, seinen Posten zu verlassen. Und nun kam auch der Amtsrat und fragte nach dem Herrn und schien sehr betreten, als er, um seine eigene Sorge zu beschwichtigen, andeutete, der Herr habe die Nachricht, daß noch andere Gäste erwartet würden, nicht eben gut aufgenommen, und nur so als seine Vermutung hinzufügte, er sei wohl ausgegangen, um nicht beim Empfange zugegen zu sein. Dann ließ ihn die Frau Amtsrätin, die eben heimgekehrt war, rufen, und er mußte der Gnädigen, vor der er einen heillosen Respekt hatte, wiederholen, was er dem Herrn Amtsrat gesagt; und die Gnädige hatte ihn mit ihren großen braunen Augen so durchbohrend angesehen, daß er heilfroh war, als er wieder auf seinem Beobachtungsposten am Flurfenster stand, von dem er den ganzen Hof überblicken konnte, und da fuhr auch schon die offene Equipage in den Hof; es saßen nur zwei darin: ein Herr und eine Dame – Gott sei Dank! Konski hatte in der Dämmerung Züge und Gestalt der Dame nicht mehr zu erkennen vermocht; aber wer sollte es denn sein, als Fräulein Erna? Und vor der lief der Herr sicher nicht weg! nun war alles gut, wenn er selbst nur erst wieder zurück wäre!
Unten ging die Tür; Konski hörte den Schritt des Herrn auf der Treppe. Er lief ihm entgegen und berichtete freudig seine Beobachtungen; vielleicht wüßte der Herr schon, daß nur Fräulein Erna angekommen sei?
Der Herr hatte sich in dem Wohnzimmer, wo Konski die Lichter bereits angezündet, in einen Lehnstuhl geworfen und starrte so vor sich hin, strich sich wiederholt über Stirn und Augen, richtete sich dann plötzlich auf und fragte: Was sagten Sie?
Konski hatte während der letzten Minute gar nichts gesagt, fragte nun aber, ob der Herr sich nicht für die Abendtafel umkleiden wolle? Er glaube, es sei die höchste Zeit.
Bertram erhob sich und ging in das Schlafzimmer, wo Konski einen Anzug, den er für die Gelegenheit passend erachtet, zurechtgelegt hatte. Er leistete die nötige Hilfe, nicht wenig verwundert, daß der Herr nicht das kleinste Wörtchen sprach, während er gerade beim Anziehen am meisten mit ihm zu plaudern pflegte. Merkwürdig war auch, daß er sich, was er sonst nie tat, wiederholt sehr aufmerksam im Spiegel betrachtete und sogar, was Konski sich nie gesehen zu haben erinnerte, an dem Schnurrbart zupfte und drehte. Indessen, da er dabei wohl eine sehr ernste, aber keineswegs verdrießliche oder zornige Miene machte, war es Konski zufrieden. Mit der Abreise heute abend hatte es unter allen Umständen gute Wege.
Man pochte an die Tür; es war der Amtsrat, der so eilfertig eintrat, als es seine Korpulenz immer gestattete.
Gott sei Dank, daß du hier bist! rief er, dem Freunde wie einem sehnlich Erwarteten, eben Angekommenen, beide Hände wieder und wieder schüttelnd. Hast du uns Angst und Sorge gemacht! Hildegard war so bös, daß ich dich allein gelassen! ich sagte: er ist ja doch kein Kind mehr, dem man überall aufpassen muß. Das heißt: ich habe es nicht gesagt, sondern nur gedacht; Hildegard ist heute so nervös; ich hatte ihr gleich –
Der Übereifrige bemerkte jetzt erst die Gegenwart des Dieners und brach verlegen ab; Bertram war mit seiner Toilette fertig; die beiden Herren verließen das Zimmer. Während sie über den langen Korridor nach dem Haupthause schritten, legte der Amtsrat seinem schlanken Freunde den Arm um die Hüfte und sagte mit vorsichtig leiser Stimme:
Ich hatte es Hildegard gleich gesagt, daß du es übelnehmen würdest, oder es ihr doch wenigstens angedeutet, denn du weißt, sie verträgt Widerspruch nicht gut; und es war ja auch zwischen den Weibern beschlossene Sache, wie ich bald merkte. Nun sagt mir Erna – ist es nicht ein liebes Kind, wie? ein bißchen sehr eigen, sehr apart, aber immer gut gegen mich – wie hübsch, daß ihr euch getroffen habt! – ja, sie sagt mir, du wärst nicht weiter bös, daß Lydie mitgekommen ist. Das heißt: Erna weiß nichts von den alten Geschichten oder hat die Glocken nur läuten hören, daß ihr euch nicht leiden könnt, oder du Lydie nicht – na, das ist ja nun ganz gleich. Sag mir nur, daß du nicht weiter bös bist.
Ich war es im ersten Augenblick, aber bin es nicht mehr.
Das ist alles, was ich verlange. Und im Grunde, alter Kerl, na – Mißverständnisse und so weiter, und so weiter! Aber die Schuld liegt doch gewiß auf deiner Seite, oder doch zum größten Teil; liegt ja immer auf unserer Seite – das weiß ich als alter Eheknüppel – wie?
Der Amtsrat lachte; Bertram, um der Antwort auszuweichen, fragte, wo die Gesellschaft sei.
Die Damen sind auf der Veranda – der Baron war noch auf seinem Zimmer.
Wer ist denn eigentlich dieser Baron? fragte Bertram; ihr habt über Tisch öfter von ihm gesprochen, aber ich gestehe, ich habe nicht recht hingehört.
Lotter! sagte der Amtsrat. – Du, höre, das ist ein famoser Kerl, der dir sehr gefallen wird; höllisch gescheit, hat alles gelesen, spielt Klavier, malt – prachtvoll, sage ich dir: Porträt, Landschaft – was du willst. Ist eigentlich wegen der Malerei hierher gekommen – Schüler unserer Akademie, weißt du. Und geht natürlich bei Hofe aus und ein –
Aus eurer Gegend?
Gott bewahre; aus Württemberg, uralte Familie: Lotter-Vippach; Vater war General, glaube ich, Onkel Minister – kurz, in den höchsten Würden. Selbst Offizier gewesen, Kampagne von 1870 mitgemacht; aber ein bißchen unruhiges Blut – fabelhaft in der Welt herumgewesen: Algier, Südamerika – was weiß ich. Habe ihn dringend gebeten, während des Manövers hier zu bleiben, ein bißchen die Honneurs zu machen – war selbst nie Soldat, weißt du. Freut sich riesig darauf, dich kennen zu lernen, hat alles von dir gelesen – wo sind denn unsere Damen? werde mal nachsehen, bleib hier – du hast keinen Hut auf.
Das letzte war bereits in dem Gartensaal gesprochen, in welchem die großen Fenstertüren nach der Veranda offen standen. Der Amtsrat war davongeeilt, die Damen zu suchen; Bertram schritt auf und nieder in dem weiten, halb dunkeln Raum. Hatte er sich Ernas Befehl nicht doch zu willig gefügt? Wenn ihm das Gehorchen leicht, wenn es ihm nur möglich sein sollte, durfte sie ihn wenigstens nicht verlassen. Und jetzt war selbst ihr Bild vor seinem inneren Auge entschwunden, und das der einst so heiß Geliebten stand da, als wären nicht zwanzig Jahre hingegangen, seit er sie zum letztenmal gesehen; als ob sie nur eben mit der schönen Freundin in den Garten gegangen, um alsbald unter irgend einem Verwand zurückzukommen, in seine Arme zu fliegen, ihn mit Küssen zu überschauern – hier, hier – wie oft, wie oft – in diesem Saale, in dem noch der Duft des Veilchenparfüms zu schweben schien, das sie so liebte und das ihm, fern von ihr, stets ein Talisman holdester Erinnerung gewesen war!