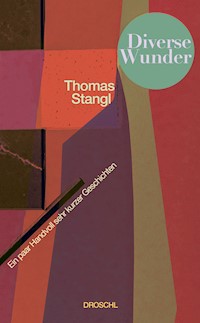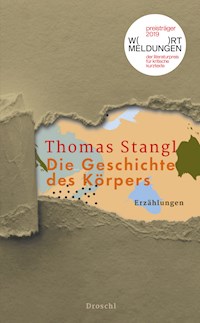14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droschl, M
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Essays
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Thomas Stangl hat nicht erst mit seinem Band Reisen und Gespenster bewiesen, dass seine außergewöhnliche, tiefgründige Prosa nicht nur im Bereich der erzählenden Literatur großartige Werke hervorbringt, sondern dass dieselbe Gestaltungskunst auch seine Essays durchdringt. Es tut der Literatur immer gut – und zu manchen Zeiten ist es sogar unabdingbar –, wenn man sie nicht nur schreibend und lesend betreibt, sondern wenn man über sie nachdenkt, in grundsätzlichen und auch in ungewohnten Zusammenhängen, und darin ist Thomas Stangl ein Meister. Es sind Texte über den Raum der Literatur, über das Geheimnis des Für-Nichts-Stehens, die Einsamkeit, die sich dem Sozialen entzieht (»und damit der Gewalt, auch der Gewalt des Erzählten«), über das Unbestimmte, in dem und von dem die Literatur lebt, und über »die Spannung zwischen Wörtern wie ›seltsam‹ und ›wirklich‹«, über revolutionäre Hoffnungen und die Verwechslung von Literatur und Politik, über den Moment, in dem plötzlich alles möglich scheint, über die Pflicht, »absolut modern« zu sein und »diese Grenze aufzusuchen, hinter der nichts ist (nicht einmal ein Abgrund)«. Kronzeugen für die Argumentationen und Überlegungen Stangls sind Peter Weiss (»der vielleicht letzte revolutionäre Schriftsteller der deutschen Literatur«), Inger Christensen, Maurice Blanchot, Peter Waterhouse, Chris Marker oder Jean-Luc Godard.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 110
Ähnliche
Essay67
Thomas Stangl
Freiheit und LangeweileEssays
Literaturverlag Droschl
Thomas Stangl zieht eine Wand ein, die keine Wand ist
Es gibt dieses Zimmer hier, ein kleines Zimmer in einer großen Wohnung mit Blick auf einen Hinterhof und auf das kleine Zimmer eines Gitarristen in der großen Wohnung gegenüber, so wie es früher, solange ich alleine wohnte, ein großes Zimmer in einer kleinen Wohnung mit Blick auf ein Versicherungsgebäude gab. Auf dem Schreibtisch vor dem Fenster steht der Computer, auf dem ich schreibe. In einem Schrank sind einige dutzend Notizbücher verstaut. Ein Notizbuch liegt auf dem Schreibtisch neben dem Laptop oder steckt in meiner Umhängetasche.
Und dann ist da noch der andere Innenraum, in dem die Texte eigentlich entstehen, der Raum auf (oder hinter) dem Bildschirm; ein Raum, der kein Raum ist. Hier lebt jedes zarte kaum geborene Textchen in flüchtiger Nachbarschaft mit sozusagen der ganzen Welt (einer Welt, die keine Welt ist): ständig kann Post kommen, ich könnte irgendetwas spielen, schlimmstenfalls Schach oder Solitär, Fotos und Videos von fast allen Punkten auf der Erde und fast allen lebenden und toten Menschen, beim Golfspiel oder beim Geschlechtsverkehr, sind verfügbar, ein Gedränge von Möglichkeiten, die gleichgültig und zeitlos nebeneinanderher existieren: das eigene Leben und Nichtleben (auf Festplatte gespeichert) grenzt sich gerade eben halbherzig von den Milliarden der hier in irgendeiner Form auftauchenden und verschwindenden anderen Leben und Nichtleben ab.
Es gibt überhaupt keinen Grund, an einem bestimmten Ort zu sein, einen bestimmten Satz zu schreiben.
Ein Sog zieht Blick und Bewusstsein in diese endlos wachsende Welt, die keine Welt ist, ins Nirgendwo hinein. Um Halt zu finden und die Illusion zu haben, der Apparat vor mir wäre wirklich meins, ziehe ich eine Wand ein, wenn auch nur eine Wand, die keine Wand ist; die Technik bietet mir das an.Als Desktophintergrund auswählen.Wenn man immer auf das gleiche Bild schaut, kann es scheinen, als wäre dahinter eine wirkliche Welt.
Im Lauf der letzten Jahre habe ich verschiedene Fotos als Desktopbilder verwendet, Fotos, die auf Reisen entstanden sind,bestimmte Orte: eine weite schwarze Wattlandschaft mit auf der feuchten Erde glitzerndem Sonnenlicht; eine weiße Ziege, die in Saint-Louis, Senegal, auf einer Mauer balanciert, im Hintergrund der Fluss mit bunten Fischerbooten, eine Hausecke in der gleichen Stadt, hinter der im ockerfarbenen Licht eine Frau verschwindet; das Cinema Tineretului in Iasi, Rumänien, ein Gebäude wie aus einem alten Film über alte Filme (man stellt sich das Rattern des Projektors vor und das Wunder, als auf einer Leinwand schwarzweiße Schatten erscheinen, zu Gegenständen und Gesichtern werden, vor einem Publikum von längst verstorbenen Bewohnern des zwanzigsten Jahrhunderts); eine leere Landstraße an einem anderen Ende der Welt, die sich weit über Hügel zum Horizont, zu zackigen Gebirgen hinzieht. Darüber ein wolkiger Himmel wie eine weitere Landschaft.
Ich schaue in den Text, ich schaue auf das Bild, dann wähle ichDatei Drucken, nehme das Notizbuch vom Schreibtisch und stecke es mit den Ausdrucken in meine Umhängetasche, setze mich aufs Fahrrad. Wenn ich im Text stocke oder glaube, dass der Text gleich wirklich, so wie er sein soll, da sein wird (es fehlt nur noch ein bisschen an Wirklichkeit, das kleine bisschen, das ich in meinem kleinen Zimmer, an meinem Computer nicht finden werde), muss ich raus, zu Fuß gehen, radfahren, mich auf eine Bank im Augarten oder am Donaukanal setzen, dort weiterlesen, nachlesen, was ich geschrieben habe, es anders lesen, auf bedrucktem Papier.
Dann plötzlich knüpfen sich Fäden zwischen Text und Welt, zwischen diesem Moment, dieser Bank, diesem Gewässer vor mir und dem, was auf dem Papier (und bald wieder auf dem Computer) festgehalten ist.
Eine Leere, ein Surren: Über den Raum der Literatur
In einer berühmten Szene aus Luis Buñuels FilmBelle du Jourzeigt ein Bordellkunde, ein selbstzufriedener dicker Japaner, ein kleines Kästchen vor. Er öffnet es, außerhalb des Blickwinkels der Kamera, ein Surren ertönt, die Prostituierte erbleicht. Als Buñuel gefragt wurde, was sich in dem Kästchen befinde, meinte er schlicht: Keine Ahnung.
Das ist eine hübsche Pointe und zugleich die einzig mögliche Antwort. Alles andere wäre lächerlich und würde der Szene ihre Kraft nehmen, nicht nur das Geheimnis, sondern auch das Geheimnis des Geheimnisses auflösen: dass es sich auf nichts Bestimmtes beziehen kann, wenn es geheimnisvoll bleiben will, wenn die – für Buñuel typische – Balance zwischen dem Lächerlichen und dem Beunruhigenden gewahrt bleiben soll. Das Geheimnis des Geheimnisses ist: es bezieht sich auf ein Inneres, das nicht benennbar ist, sich auflösen würde, sobald man es benennt; das vermutlich nichts ist, eine Leere. Das Geheimnis umgibt eine Leere.
Aber ein Surren ist zu hören.
Kann es sein, dass sich die Kraft der Darstellung aus einem Nichts speist? Jemand öffnet ein Kästchen, es surrt, Phantasien kommen in Gang, erotische, exotische und exotistische, die Phantasien von etwas Besonderem, einer fremden, vielleicht der höchsten Lust, einer fremden, vielleicht der tiefsten Angst; in einem Nichts fallen diese Lust und diese Angst zusammen.
Die Frage ist nicht, was in diesem Kästchen ist. Das Geheimnis entsteht, sobald das Kästchen sichtbar ist, vorgezeigt wird und eine Reaktion auslöst; eine Reaktion im Film, die wiederum eine Reaktion des Zuschauers auslöst (ein Schaudern, ein Lachen, ein leicht schauderndes Lachen). Ein Spiel von Reaktionen entsteht, Abstände, Entfernungen, Unzugängliches, Erwartungen; ein anderesInnenwird angesprochen und in ein Verhältnis zur Filmszene gesetzt: das im Zuschauerkörper, diesem Kästchen aus Fleisch und Knochen, zu vermutende Innere (das vielleicht leere Erwartung ist). Man kann es als das Entstehen eines Musters oder eines Raums sehen: die Beziehungen von Gegenständen und Menschen, die Abstände zwischen Gegenständen und Menschen, Anziehung und Abstoßung, vor dem Hintergrund einer Schaulust, die aus der Enttäuschung genauso viel Gewinn zieht wie aus der Befriedigung. Die höchste Lust, die tiefste Angst sind in diesem Raum nie zu finden, aber sie sind im Spiel.
Von solch einem Muster her lässt sich das Verhältnis der Literatur zu ihrem Gegenstand lesen, das Verhältnis zu ihrem Sinn, zu ihren Figuren, den Menschen, die im Innern der Bücher ihre Art von Leben oder Beinahe-Leben führen. Was das bedeutet, lässt sich nicht im Allgemeinen sagen, sondern nur im Einzelnen; es lässt sich zeigen und nicht sagen. In jedem Satz drängen sich, wenn ich darüber zu sprechen versuche, die großen, allgemeinen Wörter heran, Liebe oder Tod, Angst oder Begehren, Lust oder Tiefe, Geheimnis, Nichts und Leere, mit ihrem schalen, abgenutzten Klang, sie surren mir um den Kopf, und ich muss versuchen, sie abzuwehren, zurückzudrängen. Ich zögere vor jedem Satz, weil er mir schon zu weit geht, zu viel an Bedeutung verspricht (ein Griff nach dem Kästchen, ein zu faszinierter, ein gleich angewiderter Blick –).
Literatur ist Sprache, die weiß, dass sie Sprache ist; sie ist Sprache, die zugleich (statt nur zu argumentieren und zu referieren) etwas wie körperliche Wirklichkeit beansprucht; sie ist Sprache, hinter der keine gesicherte (anwesende) Sprecherperson steht: wer hier Ich sagt und erzählt oder beschreibt oder sich Fragen stellt, kann alles und jeder andere als das Ich des Autors sein. Die Widersprüche und Unmöglichkeiten in diesem Feld von Bezügen und Selbstbezügen rund um Sprache, Wirklichkeit und Ich, die Möglichkeiten und Freiräume, die diese Widersprüche öffnen, und die Grenzen und Leerstellen, auf die sie literarisches Schreiben und Lesen stoßen, scheinen aus den Sätzen, Figuren, Texten und Textwelten, um die es gehen soll, hervor, der Gewalt des Begriffs verweigern sie sich (was nichts mit Irrationalismus zu tun hat).
Der Leere hinter der Sprache, der Schwelle, an der in der frühen Kindheit die Erinnerung einsetzt, dem Gestammel von Träumen, das sich aus dem Schlaf löst, kann man sich vielleicht nur geistesabwesend nähern, indem man redet und andauernd vergisst. In seinem BuchEcholalien. Über das Vergessen von Spracheerzählt Daniel Heller-Roazen, Roman Jakobson folgend, wie Kinder ihre sogenannte Muttersprache erlernen, indem sie die unbegrenzten Lautbildungsmöglichkeiten der Lallperiode verlernen: »Es ist, als könnten Kinder eine bestimmte Sprache nur durch einen Akt des Vergessens erlernen.« In der Erwachsenensprache bliebe von diesen unbegrenzten – aber auch undifferenzierten – Möglichkeiten höchstens ein Echo: »das Echo eines anderen Sprechens oder von etwas anderem als Sprechen«, das »durch sein Verschwinden erst Sprache ermöglichte«. Später spitzt Heller-Roazen Diskussionen jüdischer Mystiker über den BuchstabenAleph(dem kein Laut, kein Klang mehr zugeordnet ist) und die Offenbarung am Berg Sinai zu: die an dem Berg versammelte Menge der Israeliten hörte, so die letzte Konsequenz dieser Tora-Interpretationen, vom Text der göttlichen Rede nichts als einen einzigen Schall, das »Ich«, mit dem diese Rede einsetzt, oder vielmehr nur den Anfangsbuchstaben dieses Ich:Aleph, demBuch Bahirzufolge die »Wurzel der zehn Gebote«. Heller-Roazen folgert: »Die gesamte Offenbarung reduziert sich auf einen einzigen Buchstaben, an dessen Klang sich niemand zu erinnern vermag… Als das einzig Greifbare an der göttlichen Rede markiert der stumme Buchstabe das Vergessen, aus dem jede Sprache hervorgeht. DasAlephist der Platzhalter des Vergessens am Anfang jedes Alphabets.«
Aber ist, wenn es um Literatur, also um Wirklichkeit geht, dieses Vergessen »des Anfangs« nicht schon zu allgemein – also zu viel und zu wenig? Wenn es nicht um den Anfang geht, es gar keinen Anfang gibt und die Setzung, mit der ein Autor unhörbar »ich« sagt, unbedeutend ist, gibt es nur im Nachhinein ein Echo, ein Vergessen, das Surren einer Leere; dies wäre die Grenze, an die die Literatur stößt, an die Sprache und Wahrnehmung durch die Literatur stoßen?
Das ist kein festes Fundament, ganz im Gegenteil; dennoch hat die Kraft von Texten, Geschichten, diesseits der Schwelle, mit diesem Wenigen, diesem Fast-Nichts zu tun und hängt vielleicht davon ab, so wie sie von der Energie des Schmerzes (der Angst), des Begehrens (der Lust) und dem verweigerten Vertrauen auf diese großtuenden Wörter abhängt. Was an Vertrauen bleibt, ist auf wenig gegründet; jeder Blick, jeder Satz versucht, sich der Wirklichkeit zu versichern. Ich schaue ins Zimmer und sehe ein paar Gegenstände, im Raum verteilt: Lampe, bist du noch da, fragt Robert Walser (und wiederholt in Andrea WinklersKönig, Hofnarr und Volkeine Romanheldin, die statt der Lampe schon, an der Wand hängend, das Gedicht von der Lampe vor sich hat).
Hier, im Raum verteilt, finde ich die Wörter; sobald die Wörter da sind, finden sich auch die Dinge ein.
Dann kommt etwas dazu, die Erinnerung an ein Gesicht, zum Beispiel, an einen ganz bestimmten Moment (gleichgültig, ob man ihn erlebt hat oder nicht oder vielleicht gerade jetzt, in diesem Moment erlebt), an eine Geste oder ein Lächeln, vielleicht ist es nicht eine Erinnerung, sondern zum Beispiel eine Fotografie, aus der heraus (wann ist das Bild aufgenommen worden?) mir ein Blick begegnet, und das Spiel beginnt, ein Spiel von Abständen: ein Muster, ein Raum. Roland Barthes beschreibt in seinem Fotografie-BuchDie helle Kammerein Schwarzweißfoto, auf dem ein schöner junger Mann zu sehen ist, ein gewisser Lewis Payne, im Sitzen, ziemlich lässig an eine narbige Stahlblechwand gelehnt, die Gelenke in Handschellen. Das Foto ist kurz vor der Hinrichtung des jungen Mannes aufgenommen, Lewis Payne hat 1865 versucht, den amerikanischen Außenminister zu ermorden. Barthes schreibt: »Daspunctumaber ist dies: er wird sterben. Ich lese gleichzeitig:das wird seinunddas ist gewesen …Was mich besticht, ist die Entdeckung dieser Gleichzeitigkeit: … ich erschauere (…)vor einer Katastrophe, die bereits stattgefunden hat. Gleichviel, ob das Subjekt, das sie erfährt, schon tot ist oder nicht, ist jegliche Photographie diese Katastrophe. … Immer wird hier die Zeit zermalmt: dies ist tot und dies wird sterben.«